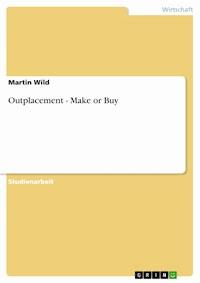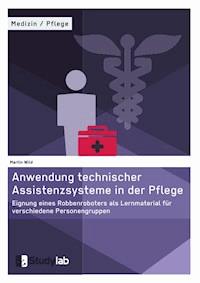
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Um den Herausforderungen des demografischen Wandels begegnen zu können, kommen in der Pflege zunehmend technische Assistenzsysteme zum Einsatz. Doch vor Einführung dieser bislang wenig bekannten AAL-Systeme (Ambient Assisted Living ) muss das Pflegepersonal in deren Anwendung geschult werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll daher untersucht werden, ob der Robbenroboter PARO als praktisches Anschauungsmaterial für ein AAL-System in der Weiterbildung für Pflegekräfte dienen kann. Ist sein Einsatz sinnvoll, um einen Zugang zu AAL-Technik im Allgemeinen als auch für wenig technikaffine Menschen herzustellen? AAL (Ambient Assisted Living ) steht für intelligente Umgebungen, die sich selbstständig, proaktiv und situationsspezifisch den Bedürfnissen und Zielen des Anwenders anpassen, um ihn im täglichen Leben zu unterstützen. Ein maßgeblicher Faktor zur Einführung der AAL-Systeme in Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen sowie im häuslichen Umfeld besteht in der Vermittlung von Kenntnissen über ihre Anwendung. Der Roboter PARO ist ein bereits heute existierendes und vereinzelt in der Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen eingesetztes, altersgerechtes AAL-System. Er wurde von Takanori Shibata am National Institute of Advanced Industrial Science and Technology in Japan entwickelt. Es fehlen bislang jedoch Erkenntnisse, ob PARO in der Weiterbildung von Pflegekräften als gutes Beispiel für ein AAL dient und sich somit positiv auf den Erfolg von Schulungen zum Thema AAL in der Pflege auswirken kann. Zur Untersuchung der Fragestellung wurde eine schriftliche Befragung von Pflegekräften einer Wohneinrichtung für beeinträchtigte Menschen mittels eines eigens dafür entwickelten Fragebogens angewandt. Auf Grundlage der Ergebnisse von 118 Befragungsteilnehmern wurden fünf für die Beantwortung der Fragestellung bedeutsame Hypothesen überprüft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 94
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung und Ziel der Arbeit
2 Herausforderung – demografischer Wandel
2.1 Einsatzbereiche von AAL
2.1.1 Gesundheit und (ambulante) Pflege
2.1.2 Haushalt und Versorgung
2.1.3 Sicherheit und Privatsphäre
2.1.4 Kommunikation und soziales Umfeld
2.2 Aus- und Weiterbildung
3 PARO der Robbenroboter
3.1 Technische Daten und Eigenschaften von PARO
3.2 Therapie mit PARO
4 Untersuchung zur Eignung von PARO als Lernmaterial und „Türöffner“
4.1 Beschreibung der Methodik
4.2 Das Fokusgruppengespräch
4.2.1 Vorbereitung der Fokusgruppe
4.2.2 Durchführung der Fokusgruppe
4.2.3 Ergebnisse der Fokusgruppe
4.3 Der Fragebogen
4.3.1 Vorbereitung der Fragebogenbefragung
4.3.2 Erstellung des Fragebogens
4.3.3 Durchführung der Fragebogenbefragung
5 Auswertung und Ergebnisse
5.1 Hypothesen
5.2 Beschreibung der Stichprobe
5.3 Technikaffinität
5.4 Überprüfung der Hypothesen
5.5 Ethische Aspekte und Zukunftsvorstellungen
5.6 Betrachtung der Freitextangaben
6 Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
Anhang
Fokusgruppenleitfaden
Persönliches Fokusgruppenprotokoll
Fokusgruppenzitate
Fragebogen
Mann-Whitney-U-Test Ergebnisse
Freitextangaben
Einwilligungserklärung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Belegungsstatistik ambulant Betreutes Wohnen (Soziale Förderstätten für Behinderte e.V. 2015)
Abbildung 2: Belegungsstatistik stationär Betreutes Wohnen (Soziale Förderstätten für Behinderte e.V. 2015)
Abbildung 3: PARO MCR900
Abbildung 4: Fokusgruppe
Abbildung 5: fünfstufige Likert-Skala mit Beispielfrage
Abbildung 6: Altersstruktur der Befragungsteilnehmer
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Teilnehmer der Fokusgruppe
Tabelle 2: PARO kann unterstützen
Tabelle 3: Vergleich der Subskalen des TA-EG Fragebogens
Tabelle 5: PARO macht Neugierig
Tabelle 6: PARO einsetzen
Tabelle 7: PARO ausprobieren
Tabelle 8: Bedienung von PARO
Tabelle 9: zukünftiger Einsatz von Technik in der Pflege
Tabelle 10: Kreuztabelle über Begeisterungsgruppen
Tabelle 11: PARO als Beispiel für Technikeinsatz
Tabelle 12: Entlastung des Pflegepersonals
Tabelle 13: Verlust der Nähe
Tabelle 14: weniger Dokumentationsaufwand
Tabelle 15: Verletzungen des Datenschutzes
Tabelle 16: Personaleinsparungen
1 Einleitung und Ziel der Arbeit
In Deutschland steigt die Zahl älterer Menschen kontinuierlich an und mit ihr die Anzahl derer, die im häuslichen Umfeld oder in Pflegeeinrichtungen betreut, versorgt und gepflegt werden müssen.
Um den Herausforderungen des demografischen Wandels z.B. im Bereich der Pflege von alten und/oder kranken Menschen begegnen zu können, werden derzeit technische Assistenzsysteme entwickelt, die in der Betreuung und Pflege von beeinträchtigten Menschen Anwendung finden sollen.
Nach einer Studie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (2011a) wird Assistenzsystemen eine breite Einsatzmöglichkeit in der Pflege attestiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass Pflegekräfte in Zukunft vermehrt mit AAL-Systemen konfrontiert sein werden.
AAL steht für intelligente Umgebungen, die sich selbstständig, proaktiv und situationsspezifisch den Bedürfnissen und Zielen des Anwenders anpassen, um ihn im täglichen Leben zu unterstützen. Solche intelligenten Umgebungen sollen insbesondere auch älteren, beeinträchtigten und pflegebedürftigen Menschen ermöglichen, selbstbestimmt in einer privaten Umgebung zu leben (Fraunhofer-Allianz AAL 2015).
Es müssen geeignete Konzepte zur Fort- und Weiterbildung entwickelt werden, in denen es möglich sein muss, auch wenig technikaffinen Menschen den Zugang zu AAL-Systemen zu eröffnen. Praxisbezug und ein anschauliches Schulungsmaterial bilden die Grundlagen erfolgreicher Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen (Huber & Hader-Popp 2005).
Ein maßgeblicher Faktor zur Einführung und Etablierung der bislang wenig bekannten unterstützenden AAL-Systemen in Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen sowie im häuslichen Umfeld, besteht in der Vermittlung von Kenntnissen über solche Systeme und in der Schulung von deren Anwendung in der Praxis. In Weiterbildungen und Schulungen für Pflegekräfte sollen diese Kenntnisse vermittelt werden.
Ein bereits heute existierendes und vereinzelt in der Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen eingesetztes, altersgerechtes AAL-System ist der Robbenroboter PARO, welcher von Takanori Shibata am National Institute of Advanced Industrial Science and Technology in Japan entwickelt wurde (Parorobots 2014).
Es fehlen Erkenntnisse, ob PARO in der Weiterbildung von Pflegekräften ein gutes Beispiel für ein AAL ist und somit positiv auf den Erfolg von Schulungen zum Thema AAL in der Pflege auswirken kann.
Im Rahmen dieser Arbeit soll die folgende Frage untersucht werden:
Kann der Robbenroboter PARO als praktisches Anschauungsmaterial für ein AAL-System in der Weiterbildung für Pflegekräfte dienen und somit den Zugang zu AAL-Technik im Allgemeinen, auch für wenig technikaffine Menschen, herstellen?
Als zweckmäßige Methode zur Untersuchung der Fragestellung wurden standardisierte Fragen in einer schriftlichen Befragung von Pflegekräften einer Wohneinrichtung für beeinträchtigte Menschen mittels eines eigens dafür entwickelten Fragebogens angewendet.
Auf Grundlage der Ergebnisse von 118 Befragungsteilnehmern, wurden die folgenden, für die Beantwortung der Fragestellung bedeutsamen Hypothesen überprüft.
Hypothese 1: PARO wird von Personen in Pflegeberufen als geeignetes Anschauungsmaterial bei Weiterbildungen für technische Assistenzsysteme in der Pflege gesehen.
Hypothese 2: Die Menschen, denen der Film von PARO im Einsatz in einer Pflegeeinrichtung vorgeführt wurde, würden PARO gerne bei ihrer Arbeit mit den Bewohnern einsetzen.
Hypothese 3: Die Bedienung von PARO als technisches Assistenzsystem wird von Menschen in Pflegeberufen als einfach eingeschätzt.
Hypothese 4: Menschen in Pflegeberufen, denen PARO vorgestellt wurde, gehen davon aus, dass zukünftig vermehrt technische Assistenzsysteme im Pflegebereich eingesetzt werden.
Hypothese 5: PARO eignet sich als Beispiel für den Einsatz technischer Assistenzsysteme im Pflegebereich.
Nach der Einleitung wird im zweiten Kapitel der demografische Wandel in Deutschland mit seinen Auswirkungen und den sich daraus ergebenden Herausforderungen für die Gesellschaft, insbesondere für die in der Pflege beschäftigten Menschen, beschrieben. Im Folgenden wird die Bedeutung von AAL-Systemen als Mittel gegen den Pflegenotstand sowie deren gegenwärtige und zukünftige Einsatzbereiche dargestellt. Anschließend wird die Aus- und Weiterbildung in Bezug auf AAL-Systeme thematisiert.
Inhaltlich wird im dritten Kapitel der Robbenroboter PARO vorgestellt, seine Eigenschaften beschrieben und sein derzeitiger Einsatz im Rahmen der Therapie bei demenziell erkrankten Menschen aufgezeigt.
In dem für die Beantwortung der Fragestellung zentralen vierten Kapitel wird ein Fragebogen für Pflegekräfte in Wohneinrichtungen für beeinträchtigte Menschen entwickelt und die Befragung durchgeführt. Konkret findet zunächst die qualitative Erhebungsmethode der Fokusgruppe in einer kleineren Personengruppe Anwendung. Aus den Ergebnissen wird ein quantitativer Fragebogen entwickelt, der in einer größeren Gruppe von Pflegenden eingesetzt wird. Die Konzeptionierung und Durchführung der empirischen Erhebung wird in diesem Kapitel aufgezeigt.
Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse der Fragebogenbefragung dazu verwendet, die zuvor aufgestellten Hypothesen zu überprüfen. Durch die Datenanalyse werden die Informationen der Einzeldaten zunächst verdichtet und so dargestellt, dass das Wesentliche zur Überprüfung der jeweiligen Hypothese verdeutlicht wird. Die Daten werden tabellarisch dargestellt und es werden sowohl deskriptive als auch analytische Untersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Analysen lassen Rückschlüsse auf den erfolgreichen Einsatz von PARO im Rahmen von Schulungen zum Thema AAL zu.
2 Herausforderung – demografischer Wandel
Die in den letzten Jahrzehnten in der fortwährenden Erhöhung der Lebenserwartung begründete allgemein ansteigende Anzahl älterer Menschen stellt die gesamte Gesellschaft vor die Frage, wie in Zukunft die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen sowohl quantitativ als auch qualitativ sichergestellt werden kann.
Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (2012) zeigen, dass die Zahl der über 80-Jährigen zwischen 2011 und 2050 von 4,3 Millionen auf 10,2 Millionen Menschen steigen wird. Im Jahr 2060 wird jeder siebte Mensch in Deutschland 80 Jahre oder älter sein. Ebenso wird für das Jahr 2060 von 4,5 Millionen Pflegebedürftigen ausgegangen (Zweites Deutsches Fernsehen 13.01.2015). Gleichzeitig sinkt die Gesamtanzahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter (Statistisches Bundesamt 2012, Statistisches Bundesamt 2009).
Bereits heute besteht ein Mangel an Pflegefachkräften, der sich voraussichtlich weiter verschärfen wird. Das bedeutet, dass zukünftig eine steigende Anzahl pflegebedürftiger Menschen von einer nicht proportional mitsteigenden, wenn nicht gar sinkenden Anzahl von Pflegefachkräften versorgt werden muss. Andersherum betrachtet, müssen die einzelnen Pflegefachkräfte mehr Menschen mit Pflegebedarf versorgen als bislang.
Aufgrund dieser Entwicklung ist davon auszugehen, dass Technische Unterstützungssysteme wie AAL vermehrt zum Einsatz kommen werden, um einerseits die Versorgung pflegebedürftiger Menschen sicherzustellen, die Lebensqualität älterer und beeinträchtigter Menschen zu erhalten und um andererseits professionelle Pflegekräfte und Angehörige zu entlasten.
Längst sind professionelle Pflegekräfte und Angehörige am Limit des Leistbaren angelangt. Die Arbeit in der Pflege wird oft als sehr stressig und auch als körperlich sehr erschöpfend eingeschätzt (Bispinck et al. 2012, S. 27).
Hohe Krankenstände und ein erhöhtes Risiko eine Depression oder ein Burn-out zu entwickeln, sprechen für sich (DAK Forschung 2012, S. 132,Zweites Deutsches Fernsehen 2015). Hinzu kommt, dass die Gruppe der pflegenden Angehörigen laut einer Studie der Siemens-Betriebskrankenkasse hohen Belastungen bei der Pflege von Angehörigen ausgesetzt ist (Billinger 2013).
Gleichfalls betroffen von veränderten und zusätzlichen Aufgaben und Belastungen, primär bedingt durch die kontinuierlich steigende Anzahl älterer Bewohner und die dadurch stetig anwachsende Pflegetätigkeit, sind Mitarbeiter/innen in Einrichtungen der Behindertenhilfe.
Diese sind in der Regel Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit pädagogischem Schwerpunkt. Dementsprechend verfügt das Personal überwiegend über Berufsausbildungen dieses Bereichs und nicht über pflegerische Fachkenntnisse. Erst in den letzten Jahren wird auch Pflegefachpersonal eingestellt, um der einsetzenden Entwicklung Rechnung zu tragen (Schulze Höing 2013).
Dass ältere Bewohner in diesen Einrichtungen bislang fast gänzlich fehlten, und damit altersbedingter Pflegebedarf die Ausnahme darstellte, liegt in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland begründet, in der Menschen mit Behinderungen als „lebensunwert“ abgestempelt und systematisch vernichtet wurden. Mehrere Generationen wurden ermordet oder hatten durch extrem schlechte Lebensbedingungen und fehlende medizinische und psychosoziale Betreuung eine erheblich verringerte Lebenserwartung (Wetzel & Oettl 2010).
Da der demografische Wandel alle Bevölkerungsteile gleichermaßen betrifft, steigt adäquat zu der Entwicklung in der Allgemeinbevölkerung auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe die Anzahl älter werdender Bewohner. Die mit dem Älterwerden verbundenen Beeinträchtigungen nehmen entsprechend zu.
Schätzungen zufolge ist inzwischen jeder zweite Bewohner stationärer Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe älter als 55 Jahre, 15% sind über 65 Jahre alt (Lindmeier & Lubitz 2011).
Zusätzlich sind Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oft zugleich von körperlichen Beeinträchtigungen betroffen. Im Gegensatz zur Allgemeinbevölkerung ist diese Personengruppe in allen Lebensphasen – Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter und Alter – auf Unterstützung, Assistenz und Begleitung angewiesen. Im Alter zeigen sie häufig Anzeichen für eine physiologische Voralterung. Der Unterstützungsbedarf steigt somit altersbedingt teilweise stark an (Lindmeier & Lubitz 2011).
Für Betreuungskräfte sowohl in ambulant betreuten Wohnformen als auch in stationären Wohneinrichtungen stellt diese erstmalig erheblich steigende Anzahl älter werdender Betreuter bzw. Bewohner eine neue Herausforderung dar (Schulze Höing 2013).
Neben den durch die Behinderung ohnehin eingeschränkten Alltagskompetenzen kommen, entsprechend der Allgemeinbevölkerung, altersbedingte Erkrankungen wie z.B. Osteoporose, Seh- und Hörbeeinträchtigungen, Schilddrüsenunterfunktion und demenzielle Erkrankungen hinzu (Statistisches Bundesamt 2009).
Zurzeit leben in Deutschland circa 1,5 Millionen demenziel erkrankte Menschen, im Jahr 2050 wird ihre Zahl auf 3 Millionen Menschen angestiegen sein (Bundesministerium für Gesundheit 2015).
Menschen mit Down-Syndrom weisen ein höheres Risiko für eine demenzielle Erkrankung auf (Kranich 2001). Bereits ab dem 40. Lebensjahr finden sich bei dieser Personengruppe hirnorganische Veränderungen, die denen von an Alzheimer-Demenz erkrankten Menschen der Allgemeinbevölkerung entsprechen (Ding-Greiner 2014).
In der Allgemeinbevölkerung leiden ca. 11% der über 65jährigen an einer demenziellen Erkrankung, bei Menschen mit Down-Syndrom liegt die Demenzrate dieser Altersgruppe bei 75% (Lindmeier & Lubitz 2011). Demzufolge steigt die Erkrankungsrate mit zunehmendem Lebensalter zusätzlich überproportional stark an.
Einrichtungsträger der Behindertenhilfe, und mit ihnen das Betreuungspersonal, sind aufgrund dieser Entwicklung im stationären und ambulanten Bereich gefordert, auf die steigende Anzahl alter und an Demenz erkrankter Bewohner zu reagieren und neue Handlungsstrategien und -konzepte zu entwickeln.