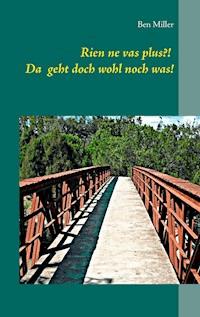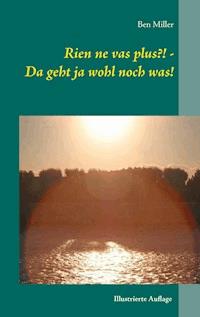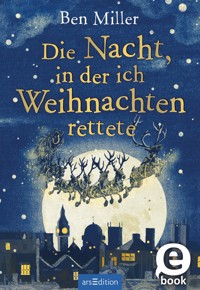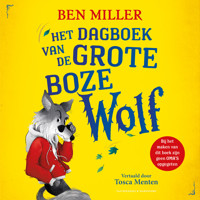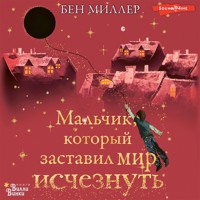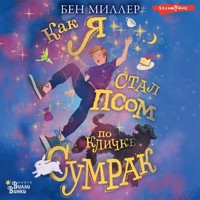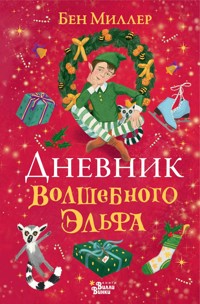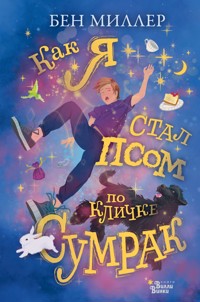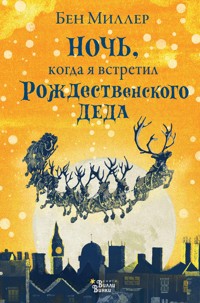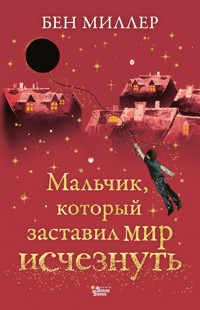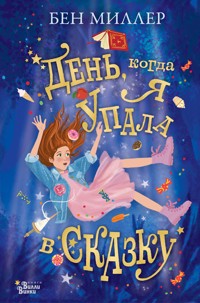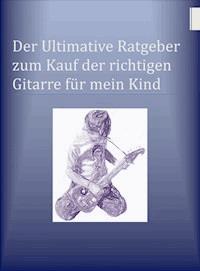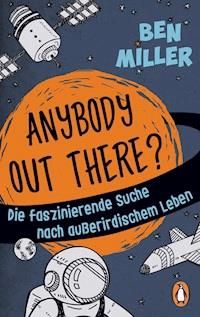
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Eines ist gewiss: Die Aliens werden kommen! Die Frage ist nur, wann? Und wie werden sie aussehen? Ben Miller, britischer Komiker und promovierter Physiker, nimmt uns in "ANYBODY OUT THERE?" mit auf die hoch spannende Suche nach außerirdischem Leben. Auf unterhaltsame und zugleich wissenschaftlich-fundierte Weise zeigt er uns, welche Anstrengungen die Menschen unternehmen, um auf die Ankunft der Aliens vorbereitet zu sein und mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Ein Wissenschaftsbuch, das großen Spaß macht - und ohne das wir in naher Zukunft nicht mehr auskommen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ben Miller ist, wie du und ich, ein mutierter Affe, der auf einer Kugel aus geschmolzenem Eisen die Eiszeit überlebt hat und um ein supermassives Schwarzes Loch kreist. Er ist aber auch Schauspieler, Komiker (Johnny English, Doctor Who) und Bestsellerautor. Und er schlägt sich immer noch mit der Erkenntnis rum, dass es für ihn nie zum Astronauten reichen wird. ANYBODY OUT THERE? ist sein erstes Buch im Penguin Verlag.
Anybody out there? in der Presse:
»Ein ausgezeichnetes, lehrreiches Buch für alle mutierten Affen, Teenager wie Erwachsene.«
The Guardian
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Aus dem Englischen von Sonja Hagemann
Für Sonny, Harrison und Lana
Inhalt
Kapitel 1 Extremophile
Kapitel 2 SETI
Kapitel 3 Planeten
Kapitel 4 Universen
Kapitel 5 Leben
Kapitel 6 Menschen
Kapitel 7 Aliens
Kapitel 8 Botschaften
Dank
Zur weiteren Lektüre
Kapitel 1 Extremophile
Der Autor bringt seine Raumschiffe an den Start und entdeckt, dass das Sonnensystem keine Wüste, sondern eine Oase ist.
Wir kommen in Frieden
Am 25. August 2012 erreichte das erste unserer Schiffe den interstellaren Raum. Es war unbemannt. Vor dreieinhalb Jahrzehnten auf seinen Weg geschickt, war es an Jupiter und Saturn vorbeigekommen und verließ nun das Sonnensystem mit dem Ziel eines wenig bekannten Sternbilds namens Kamelopard in der Nähe des Großen Wagens. Obgleich es vom Sonnenwind unberührt blieb, war es nicht komplett außer Reichweite der Anziehungskraft der Sonne und würde es auch für weitere 30 000 Jahre nicht sein.
Aber dann würde es endlich die sogenannte Oort’sche Wolke durchquert haben, eine dicke Schicht aus Eisgeröll, die unseren Heimatstern und seine acht Planeten umgibt wie das Fruchtfleisch einen Pfirsichkern. Zu diesem Zeitpunkt würde es schon fast ein Lichtjahr entfernt sein. Vergesst die Galaxie, allein das Sonnensystem ist unvorstellbar groß.
Der Name des Raumschiffs war Voyager 1, und an Bord befand sich eine Nachricht von uns Menschen, festgehalten auf einer als Golden Record bekannten Datenplatte. Diese vergoldete Scheibe, deren Inhalt von dem herausragenden amerikanischen Kosmologen Carl Sagan zusammengestellt worden war, sprach im Namen der ganzen Menschheit. Los ging es mit einer Rede des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Kurt Waldheim. Zögerlich lesend trug er mit starkem österreichischem Akzent folgenden Text vor:
Viele Grüße im Namen der Menschen unseres Planeten. Wir treten aus unserem Sonnensystem hinaus ins Universum und suchen dabei nur Frieden und Freundschaft, um andere zu lehren, wenn man uns dazu auffordert, und um Dinge zu lernen, wenn wir denn dieses Glück haben. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass unser Planet mit all seinen Bewohnern nur ein kleiner Teil des riesigen Universums ist, welches uns umgibt, und gehen diesen Schritt deshalb voller Hoffnung und Demut.
Nach dieser Einleitung erklang ein Chor von Stimmen mit Grüßen in 55 Sprachen,1 angefangen beim Akkadischen, der Sprache des alten Sumer, bis hin zu Wu, einem zeitgenössischen chinesischen Dialekt aus der Gegend von Schanghai. Manche der Sprecher, wie zum Beispiel die Japaner, klangen eher schüchtern: »Hallo, wie geht’s?« Andere waren forscher, beispielsweise die Amoy-Sprecher aus Südostchina: »Freunde aus dem All, wie geht es euch? Habt ihr schon was gegessen? Kommt uns doch mal besuchen, wenn ihr Zeit habt.« Auf Altgriechisch wurde hingegen eine kaum verhüllte Drohung ausgestoßen: »Grüße an euch alle, wer auch immer ihr sein mögt. Wir kommen in Freundschaft … zu denen, die auch unsere Freunde sind.«
Diese Grüße wurden von gut 20 Geräuschen unseres Planeten begleitet, darunter widerhallende Schritte, heftiger Regen und das Bearbeiten von Holz mit einer Handsäge.
Darüber hinaus gab es über 100 Bilder von der Erde, darunter die Röntgenaufnahme einer Hand, die Silhouette von einem Mann und einer schwangeren Frau und die chemische Struktur der DNA. Außerdem hatte man über 20 Aufnahmen der besten Musikstücke auf Erden hinzugefügt, unter anderem den ersten Satz aus Beethovens fünfter Symphonie, Bachs Wohltemperiertes Klavier und Chuck Berrys Johnny B. Goode.
Eine Nachricht von der Erde
Das Ganze mag nach Science-Fiction klingen – zumindest hoffe ich das, ich hab nämlich mein Bestes gegeben –, aber es ist alles wahr. Soweit wir wissen, ist die Golden Record bis jetzt noch nicht von durchs All reisenden Außerirdischen abgefangen worden. Und falls doch, kann niemand wissen, was sie damit wohl anfangen werden. Zunächst einmal müssen wir hoffen, dass diese Wesen nicht allzu groß sind. Ein Alien von den Ausmaßen eines Blauwals dürfte wohl so seine Schwierigkeiten damit haben, die Nadel korrekt auf die Schallplatte zu setzen, mal abgesehen davon, dass er erst eine Hi-Fi-Anlage bauen müsste, die sie mit den erforderlichen 16 2/3 Umdrehungen pro Minute abspielen kann.
Ein zu kleiner Außerirdischer – vielleicht nur so groß wie eine Mikrobe – würde die Voyager 1 mit ihrer Golden Record vielleicht nicht einmal bemerken.
Als Nächstes müssen wir dann hoffen, dass diese Wesen dieselbe Wahrnehmung von Zeit haben wie wir. Wie wir in einem späteren Kapitel sehen werden, ist das nicht mal bei allen Tieren auf der Erde der Fall, bei Außerirdischen kann man also erst recht nicht davon ausgehen. Für eine Krähe zum Beispiel, deren Gehirn mit einer schnelleren Uhr ausgerüstet ist, klingt die menschliche Sprache langsam und bedächtig. Wenn die Zeit für die Außerirdischen viel schneller verstreicht als für uns, dann begreifen diese Wesen vielleicht gar nicht, dass die menschliche Sprache Informationen enthält. Für sie klingen unsere Äußerungen womöglich nur wie ein langes, unverständliches Grunzen. Ein in menschlichem Tempo tickendes Gehirn ist wirklich hilfreich, um menschliche Sprache zu verstehen.
Und wo wir schon mal beim Thema Sprache sind, sollten wir nicht nur hoffen, dass die Finder der Golden Record überhaupt Ohren haben, sondern dass der Frequenzbereich ihrer Ohren auch dem der unseren entspricht. Ohnehin bringt das alles nur dann etwas, wenn sich diese Wesen überhaupt durch Lautäußerungen miteinander verständigen.
Wenn wir in diese Richtung weiterdenken, stellt sich die Frage, ob die in unseren Nachrichten ausgedrückten Konzepte wie Frieden, Raum und Zeit in ihrer Sprache oder ihren Sprachen wohl eine Entsprechung haben.
In noch grundlegenderer Hinsicht müssen wir auch hoffen, dass diese Lebewesen in ihrer Kultur das Konzept Nachricht überhaupt kennen und die Sonde nicht einfach wieder zurückschicken.
Und das ist noch immer nicht alles. Die Außerirdischen müssen auch sehen können, um die Beschreibung der Codierung des Inhalts auf der Hülle der Schallplatte zu lesen, und das elektromagnetische Spektrum ihrer Sehkraft muss in etwa dem unseren entsprechen. Schließlich gibt es auch auf der Erde Lebensformen, die uns zeigen, dass man so etwas nicht einfach voraussetzen kann. Für eine Rasse hochintelligenter Fledermäuse wäre die Schallplatte zum Beispiel nicht viel mehr als ein Frisbee aus Metall. Eine Lebensgemeinschaft aus superintelligenten Bakterien würde sie vielleicht als Snack ansehen.
Das Wichtigste von allem: Wir müssen wirklich darauf hoffen, dass die Außerirdischen ein umfassendes Verständnis von der menschlichen Kultur haben. Wenn nicht, wird es ihnen vermutlich schwerfallen, unsere Absichten zu verstehen. Warum wurden so viele Grüße mitgeschickt, wenn die Speicherkapazität doch begrenzt war? Warum werden auf einigen der Bilder von Menschen Genitalien gezeigt, auf anderen nicht? Wofür ist die Musik da? Wer sind diese Typen, und was zum Teufel wollen sie uns sagen?
Kurz gesagt: Wir sollten hoffen, dass die Außerirdischen genauso sind wie wir.
Die Aliens lieben
Gibt es eine faszinierendere Frage als die, ob wir im Universum allein sind oder nicht? Das schwache, geisterhafte Licht der Milchstraße ist das Leuchten von Milliarden von Sternen. Ist es also wirklich möglich, dass die Erde darunter der einzige bewohnte Planet ist und wir die einzige intelligente Spezies? Und falls es da draußen intelligentes Leben geben sollte, wären wir in der Lage, uns damit in Verbindung zu setzen?
Die alten Griechen gingen jedenfalls davon aus.
Epikur, einer der Gründerväter der modernen Wissenschaft, schrieb zum Beispiel im Jahre 300 vor Christus, dass es »andere Welten mit Pflanzen und anderen Lebewesen geben muss, einige sicher der unseren ähnlich, andere nicht«.
Auch Newton war dieser Meinung, wie aus dem Anhang der Principia, seiner berühmten Schrift über Mechanik und Schwerkraft, deutlich hervorgeht:
Diese bewunderungswürdige Einrichtung der Sonne, der Planeten und Kometen hat nur aus dem Ratschluss und der Herrschaft eines alles einsehenden und allmächtigen Wesens hervorgehen können. Wenn jeder Fixstern das Zentrum eines dem unsrigen ähnlichen Systems ist, so muss das Ganze, da es das Gepräge eines und desselben Zweckes trägt, bestimmt einem und demselben Herrscher unterworfen sein.
Außerirdische sind überall. Sie können Engel sein, die uns vor dem Wahnsinn eines Atomkriegs warnen, oder Dämonen, die uns entführen, um an uns bizarre sexuelle Experimente vorzunehmen. Ihr Aussehen veränderte sich von den wütenden kleinen grünen Männchen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zu ihren friedlicheren grauen Verwandten von heute. Sie besuchen uns in fliegenden Untertassen, setzen sich telepathisch mit uns in Verbindung oder erscheinen als seltsame Lichter am Himmel. Soweit wir wissen, ist das alles bislang aber nur ein Produkt unserer Fantasie.
Sosehr wir es uns auch wünschen, bis jetzt gibt es keine überzeugenden Beweise dafür, dass intelligente, technologisch hoch entwickelte Außerirdische die Erde je besucht haben.
Bevor du dieses Buch jetzt aber mit einem Anflug von antiwissenschaftlichem Ekel in die Ecke pfefferst und dich auf den Weg zum Esoterikregal machst, warte noch einen Moment. Wie so oft sind nämlich die Tatsachen viel spannender als jede nichtwissenschaftliche Behandlung des Themas.
Während Autopsien von Außerirdischen Schlagzeilen machen, rücken Tausende von Wissenschaftlern – echte, hart arbeitende, wirklich qualifizierte Forscher, deren Ergebnisse unter Kollegen anerkannt sind – Zentimeter um Zentimeter näher an die Wahrheit heran.
Und glaub mir: Wenn es uns einst tatsächlich gelingt, mit einer außerirdischen Intelligenz Kontakt aufzunehmen, dann werden Geschichten über fliegende Untertassen und perverse grüne Männchen ziemlich altbacken aussehen.
Unsere Perspektive in Bezug auf mögliches Leben im Kosmos hat sich in den letzten Jahren verändert. Durch die vor Kurzem durchgeführte Kepler-Mission der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA haben wir herausgefunden, dass es in der Galaxie etliche Planeten wie den unseren gibt. Wir wissen ebenfalls, dass sich das Leben auf Erden sehr früh in der Geschichte des Planeten entwickelt hat und dass es sogar unter extremsten Umständen gedeiht.
Jetzt, wo wir Sonden und bemannte Raumschiffe hinaus in unser Sonnensystem schicken und eine immer bessere Vorstellung von anderen erdähnlichen Planeten bekommen, nähern wir uns schnell der ersten Begegnung mit außerirdischem Leben.
Die meisten Wissenschaftler rechnen damit, dass man es mittels eines Teleskops entdecken wird und dass es sich bei der betreffenden Lebensform um einen so kleinen einzelligen Organismus handeln wird, dass man ihn mit bloßem Auge nicht erkennen kann.
Es besteht noch eine zweite, weniger wahrscheinliche Möglichkeit: dass mikroskopisch kleine Organismen auf einem Eismond innerhalb unseres eigenen Sonnensystems zu finden sind oder dass sie vielleicht sogar Seite an Seite mit uns hier auf der Erde leben. Und wenn einzelliges Leben so weit verbreitet ist, wie wir gegenwärtig glauben, dann wird darauf irgendwann auch komplexes intelligentes Leben folgen.2 Um die Frage, wie lange es wohl brauchen wird, dreht sich dieses Buch. Es hat sich etwas Spannendes herausgestellt, nämlich dass das Leben auf unserer Erde uns so einiges über das Leben auf anderen Planeten lehren kann. Wie wir noch sehen werden, sind komplexe Lebensformen seltener als Einzeller. Wie viel seltener, ist die Fragestellung einer sehr intensiven Debatte, die auf der Basis von immer mehr Erkenntnissen geführt wird. Wie wir später noch entdecken werden, sind Menschen nicht die einzigen Lebewesen, die über Intelligenz verfügen. Tatsächlich teilen wir uns diese Eigenschaft mit mindesten einem Dutzend anderer Arten, vielleicht sogar mehr. Manche dieser anderen intelligenten Arten verfügen über verbale Kommunikation, und das Entschlüsseln ihrer Sprache könnte der erste wichtige Schritt für eine spätere Verständigung mit Außerirdischen sein.
Vergesst Science-Fiction, ihr erlebt gerade eine der unglaublichsten Revolutionen in der Geschichte der Wissenschaft: Immer mehr Physiker, Biologen und Chemiker glauben mittlerweile, dass wir nicht allein sind. Wie es zu diesem Umbruch kommen konnte, will ich hier ergründen. Unsere Reise wird uns durch hinreißend schöne Momente der Wissenschaft führen und dabei die Antworten auf wahrhaft tiefschürfende existenzielle Fragen streifen. Was nun folgt, ist für jeden verständlich, der unbefangen an die Sache herangeht. Ehrlich gesagt haben kreative Köpfe hier ebenso Vorteile wie analytisch denkende Menschen, weil sich dieses Thema auch um die Frage dreht, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein.
Lasst mich noch kurz unsere Marschroute skizzieren, bevor wir loslegen. Die drei einleitenden Kapitel bieten einen Überblick über die Jagd nach Außerirdischen bis heute, UFO-Sichtungen inklusive, und sie gehen der Frage nach, warum die Suche nach außerirdischem Leben, auch als SETI bekannt, sich in weniger als einem Jahrzehnt vom Schmuddelkind zum Superstar gemausert hat.
Im Hauptteil schauen wir uns dann an, was neue Studien über Phänomene auf der Erde uns über die Möglichkeiten von ähnlichem oder völlig unterschiedlichem Leben verraten. Oder anders ausgedrückt: über die Möglichkeit, intelligente außerirdische Organismen auf der Basis von Kohlenstoff zu finden oder solche, die aus etwas ganz anderem bestehen.
Zum Schluss befassen wir uns noch mit der Frage, wie wir in der Zukunft eine Botschaft von Außerirdischen entschlüsseln könnten – wenn wir denn je ihr glücklicher Empfänger sein sollten – und ob wir überhaupt darauf antworten sollen.
Falls die Wissenschaft recht behält, wird man innerhalb des nächsten Jahrzehnts Beweise für Leben da draußen im Universum finden. Und obgleich die Chancen dafür eher gering sind, haben wir vielleicht sogar das Glück, dass sich ein paar dieser Lebewesen in genau dem richtigen Entwicklungsstadium befinden, um Signale loszuschicken, die uns verständlich sind. Vielleicht sind sogar in dem Moment, in dem du dieses Buch liest, gerade einige von diesen Nachrichten auf dem Weg zu uns. Wenn du dich auch nur ein kleines bisschen dafür interessierst, wie wir sie empfangen können und was darin steht, dann lies einfach weiter …
An alle Passagiere des interplanetaren Flugs
Als Kind des Weltraumzeitalters hat mich die Vorstellung von Leben jenseits der Erde immer fasziniert. Ich bin 1966 geboren, war also erst drei Jahre alt, als Apollo 11 auf dem Mond gelandet ist. Deshalb war ich auch noch zu klein, um aufzubleiben und mir die Liveübertragung anzusehen, aber ich erinnere mich noch gut an die Nachrichten am Tag danach. Selbst heute spüre ich noch dieselbe köstliche Mischung aus Begeisterung und Enttäuschung, wenn ich mir Aufnahmen davon anschaue, wie Neil Armstrong aus der Mondlandfähre steigt. Begeisterung natürlich deshalb, weil so etwas Unglaubliches möglich ist. Und Enttäuschung, weil kein riesiger quietschbunter Fangarm hinter einem Felsen hervorkam, um Armstrong mit einem High Five zu begrüßen.
Die Landung auf dem Mond war Novum genug für mich und meine Zeitgenossen, um über die Abwesenheit von Außerirdischen hinwegzusehen. Die fehlende Atmosphäre und geringe Schwerkraft hielten uns bei der Stange. Rückblickend ist es fast witzig, wie unwissenschaftlich die ersten Apollo-Missionen waren. Wenn ihr je daran gezweifelt habt, dass die Menschen vom Affen abstammen, schaut nur mal ein paar schwerelosen Astronauten dabei zu, wie sie auf ihrer dreitägigen Reise mit Saltos und Kaffeekränzchen die Zeit totzuschlagen versuchen.
Für mich sah es so aus, als wollten sie mit all dieser Hyperaktivität die Milliarden Zuschauer da draußen von einer beunruhigenden, aber zentralen Wahrheit ablenken: dass der Mond nämlich völlig tot ist. Da half es auch nicht, dass Kinder in meinem Alter glaubten, noch zu unseren Lebzeiten Außerirdische treffen zu können. Wir hatten ja eine Fülle von Geschichten über die Invasion von Aliens aus der Blütezeit der Science-Fiction geerbt, wie Die Mars-Chroniken von Ray Bradbury oder Wenn der Krake erwacht von John Wyndham. In diesen Storys lauerten die Außerirdischen da draußen in der Dunkelheit und beobachteten uns.
Damals hatte die Menschheit gerade den Technologiethron bestiegen, daher wurde es höchste Zeit für einen Putschversuch.
Der herkömmlichen Auffassung nach waren diese schaurigen Geschichten eine Erscheinung des Kalten Kriegs und der Bedrohung durch die Sowjets, aber wenn ihr mich fragt, gab es da noch eine andere, genauso wichtige Inspirationsquelle, nämlich die Geburt des Rundfunks.
Als Erstes kam der Funksender, dessen Pionier Marconi angeblich 1901 die erste transatlantische Funkverbindung gelang, und später, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, waren Radiosendungen dann ein wichtiger Teil der deutschen Propagandamaschine. Das Fernsehen folgte kurz darauf und hatte in den späten 1940ern bereits die Vorherrschaft übernommen. Für beide Medien waren riesige Sendeanlagen nötig, die ihr Signal nicht nur auf Erden verbreiteten, sondern es auch ins Weltall hinausschickten.
Als Ray Bradbury 1950 Die Mars-Chroniken veröffentlichte, hatte sich daher längst die Idee ins kollektive Bewusstsein geschlichen, dass mögliche technisch hoch entwickelte Außerirdische auf Nachbarplaneten ganz genau wussten, wo wir steckten und was wir so trieben.
Natürlich werden sowohl Radio- als auch Fernsehsignale von elektromagnetischen Wellen getragen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen.3 Deshalb entfernen sich seit etwa 70 Jahren alle Signale und Sendungen immer weiter von der Erde. Inzwischen sind also Hunderte von Sternensystemen in Reichweite unserer TV- und Radiosignale, nicht mehr nur das gute Dutzend aus den 1950er Jahren. Ich finde das irgendwie schon beunruhigend. Vielleicht sind längst wütende Außerirdische auf dem Weg zu uns, die sich über das unbefriedigende Ende von Twin Peaks4 beschweren wollen.
Für mich hat Carl Sagan diese Geschichte am besten erzählt. Am Anfang des Films Contact aus dem Jahre 1997, der auf seinem gleichnamigen Buch basiert, reitet die Kamera auf einer sich immer weiter ausbreitenden Welle mit Fetzen aus Talkshows, Nachrichtensendungen und Popmusik, die sich nach und nach von der Erde entfernt und sich auf den Weg hinaus in die Galaxie macht. Während wir Fahrt aufnehmen, treffen wir auf immer älteres, früheres Material. Am Anfang sind Thrash Metal und die Spice Girls zu hören, dann kommen wir an Madonna und am Titelsong des ersten Star Wars-Films vorbei, und irgendwann überholen wir Neil Armstrongs »riesigen Sprung für die Menschheit«. Während wir die Milchstraße hinter uns lassen, hören wir den Sprecher der Nachrichtensendung The Maxwell House Good News aus dem Jahr 1939, dann Morsezeichen und schließlich Stille.
Liebesgrüße aus Moskau
Aber ich greife mir selbst vor. Was ich hier sagen will, ist Folgendes: Selbst in den 1960ern, also vor relativ kurzer Zeit, glaubten noch viele herausragende Wissenschaftler, dass es innerhalb unseres eigenen Sonnensystems technisch hoch entwickelte außerirdische Zivilisationen geben könnte, und erst recht in unserer Galaxie. Dafür haben wir erstaunlich wenige Funksignale mit der bewussten Absicht einer Kontaktaufnahme losgeschickt. Das erste davon, die sogenannte Mir-Nachricht, wurde am 19. November 1962 von einer Radarantenne in der Ukraine abgesendet und hatte die Venus zum Ziel. Sie bestand aus drei Wörtern im Morsecode: MIR, LENIN, SSR. Mir ist das russische Wort für Frieden und SSR die russische Abkürzung für die Sowjetunion. Eine Eins mit Sternchen für alle Venusbewohner, die das entschlüsseln konnten.
Als wir im Lauf der 1970er neue Erkenntnisse über unser Sonnensystem gewannen, schwand damit der Optimismus. Sowohl Apollo als auch die nachfolgenden Orion-Missionen, die Menschen zum Mars bringen sollten, wurden abgebrochen. Stattdessen konzentrierte man sich auf die unbemannte Raumfahrt und schickte eine Reihe von Robotersonden los. 1972 gelang es den Russen, mit Venera 7 auf der Venus zu landen. Daher wissen wir jetzt mit Sicherheit, dass auf der Oberfläche dieses Planeten nicht nur unfassbare 500 Grad Celsius herrschen, sondern dass der Luftdruck dort mehr als neunzigmal so hoch ist wie auf der Erde. Drei Jahre später schickte Venera 9 die ersten Schwarzweißfotos von der Oberfläche der Venus. Sie erinnerten an einen verlassenen Schiefersteinbruch. Aber es wurde noch schlimmer.
Die Vorbeiflugsonde Mariner 10 der NASA näherte sich 1973 Merkur, dem sich der Sonne am nächsten befindenden Planeten. Während die Venus praktisch als Zwillingsschwester der Erde durchgeht, ist Merkur nur ein bisschen größer als der Mond. Wie erwartet stellte sich heraus, dass er keine Atmosphäre hat und mit Kratern übersät ist. Die Krater kann man als Hinweis darauf deuten, dass sein Kern wie beim Mond kalt ist.5 Nicht erwartet hatte man, dass er anders als der Mond über ein schwaches Magnetfeld verfügt, welches ihn zum Teil vor Sonnenwind schützt. Da die Temperaturen an der Oberfläche aber regelmäßig auf bis zu 400 Grad Celsius ansteigen, würde man Merkur wohl trotzdem ungern sein Zuhause nennen.6
Als ich zehn Jahre alt war, landete schließlich die Viking auf dem Mars. Das war für mich wirklich ein herber Schlag. Merkur, Venus und der Mond sahen ja selbst von der Erde aus ziemlich dröge aus, aber beim Mars war das ganz anders. Der war schließlich rot, leuchtete in der Farbe von Eisen, Erde und Leben. Würde wohl ein Heer von Krabben mit wuscheligem Fell aus dem Sichtfeld huschen, um sich vor den Fernsehkameras in Sicherheit zu bringen? Leider nein. Der Rote Planet hat zwar eine dünne Atmosphäre, es gab also eine Art rosafarbenes Tageslicht, das war es aber auch schon, was das Thema Bewohnbarkeit anging. Der Mars war eine Wüste.
Voyager
Das Fass zum Überlaufen brachten für mich dann die Voyager-Missionen. Im Lauf der 1980er Jahre schickten ihre beiden Zwillingssonden uns immer neue, erstaunlich deprimierende Fotos von Jupiter und Saturn, bevor Voyager 2 dann weiter an Uranus und Neptun vorbeiflog. So wunderschön die vier riesigen Gasbälle auch waren, wie sollte dort ohne festen Boden und flüssiges Wasser jemals Leben entstehen?
Auch die großen Hoffnungen, die wir in ihre felsigen Monde gesetzt hatten, wurden zerschlagen. Von der Größe her liegen Jupiters galileische Monde ‒ Io, Europa, Ganymed und Kallisto – zwischen unserem Mond und Merkur, und sie sind leider auch genauso kahl und karg. Ein paar Überraschungen hielten sie allerdings doch bereit: Auf Io gibt es aktive Vulkane, die fröhlich Schwefelgase ausspucken, und Europa ist so glatt wie eine Billardkugel, aber das war es dann auch schon. Ohne Atmosphäre sind sie da draußen im eisigen Hinterland des Sonnensystems biologische Nichtstarter.7
Als die Jupitermonde aus dem Rennen waren, wandte man seine Aufmerksamkeit Saturn zu. Eine der Hauptaufgaben der Voyager-Mission bestand im Erkunden von Titan, den man damals für den größten Mond im Sonnensystem hielt.8 Voyager 1 flog in nur sechs Kilometer Entfernung an seiner Oberfläche vorbei, konnte aber nichts weiter als undurchdringlichen Nebel erkennen. Dieser Nebel bedeutet, dass Titan als einziger unter den Monden eine Atmosphäre hat. Leider versperrt uns diese Dunstschicht aber auch den Blick auf alles, was sich darunter befindet.
Es schien sinnlos, Voyager 2 noch hinterherzuschicken, deshalb wurden Uranus und Neptun als neue Ziele für diese Sonde gewählt. Unterwegs gelangen ihr noch ein paar Bilder von einem anderen Saturnmond, nämlich Enceladus, der wie ein großer Klumpen gefrorenes Wasser aussieht.9
Die Monde von Jupiter und Saturn mögen kalt sein, doch die von Uranus und Neptun sind eisig. Im Januar 1986 erreichte Voyager 2 Miranda, der mit nur etwa einem Siebtel der Größe unseres Mondes absolut winzig ist und auf dem eine Durchschnittstemperatur von –210 Grad Celsius herrscht. Mirandas bizarre Oberfläche ist eine Art Patchwork aus mit Kratern übersäten und glatten Bereichen, deshalb ist manchmal auch von Frankensteins Mond die Rede. Entweder wurde Miranda zerschlagen und hat sich danach hastig wieder zusammengefunden, oder Uranus’ Anziehungskraft erwärmt sein Inneres und führt im Eis damit zu einer ähnlichen Dynamik wie die Plattentektonik.10
Im Sommer 1989 erreichte Voyager 2 dann endlich Triton, den bei weitem größten von Neptuns 14 Monden. Seine Größe entspricht etwa drei Vierteln unseres eigenen Trabanten. So wie Miranda war auch Triton wirklich fremd und merkwürdig, und zwar nicht im positiven Sinne. Wie ihr vielleicht wisst, kreisen und drehen sich Planeten und ihre Monde für gewöhnlich in dieselbe Richtung: entgegen dem Uhrzeigersinn, wenn man von oben auf das Sonnensystem schaut. Bei Triton ist das anders, er umkreist Neptun im Uhrzeigersinn und verrät uns damit, dass er ursprünglich wohl nicht zu diesem Planeten gehörte, sondern vermutlich aus der als Kuipergürtel bekannten Region voll von eisigem Schutt außerhalb der Umlaufbahn von Neptun entführt worden ist.
Obwohl Triton im Vergleich zur Erde eher klein ist, hat er ein paar Krater, die auf geologische Aktivität hinweisen. Seine Oberfläche ist aus festem Stickstoff. Nicht besonders überraschend hat sich Triton mit –240 Grad Celsius auch als einer der kältesten Orte im Sonnensystem erwiesen. Aber das war es dann auch schon.
In den 1950ern hatten wir von wütend kämpfenden Marsmännchen geträumt und davon, in einem tropischen Paradies von blonden Venusbewohnerinnen verführt zu werden. Ende der 1980er war uns schmerzlich bewusst, dass wir nach der Party allein nach Hause gehen würden. Am 14. Februar 1990 schickte Voyager 1 ein Foto zur Erde zurück, das die Sonde von einem Punkt aus mitten im Kuipergürtel geschossen hatte. Dieser Blick auf unser Sonnensystem wirkte wie ein Symbol für diese Erkenntnis.
Die Aufnahme zeigt eine riesige, leblose schwarze Fläche, in der die winzige Erde nur ein zu verschwinden drohender Pixel ist. Carl Sagan hat sie in diesem Zusammenhang mal als »blassblauen Punkt« bezeichnet. Seine Worte waren so zutreffend, dass ich sie hier gern noch einmal wiederhole:
Soweit wir bis jetzt wissen, ist die Erde die einzige Welt, auf der es Leben gibt. Zumindest in der nahen Zukunft gibt es keinen anderen Ort, an den wir Menschen auswandern könnten. Wir können fremde Planeten durchaus besuchen, uns dort aber nicht ansiedeln. Ob es uns gefällt oder nicht, im Moment ist die Erde der Ort, an dem wir ausharren müssen. Astronomie wird oft als Tätigkeit bezeichnet, die einen demütig werden lässt und den Charakter stärkt. Vermutlich ist diese Aufnahme unserer winzigen Welt aus weiter Ferne der beste Beweis dafür, wie verrückt unsere menschliche Anmaßung eigentlich ist. Für mich unterstreicht sie noch einmal, wie wichtig es ist, dass wir freundlich zueinander sind und diesen blassblauen Punkt respektieren und schützen. Immerhin ist er das einzige Zuhause, das wir bisher kennen.
Den Beagle trainieren
Das Weltraumzeitalter, welches doch mit solch einem Optimismus begonnen hatte, endete also mit einem kosmischen Dämpfer. Wir waren allein. Nicht Entdeckergeist, sondern die Wirtschaft wurde schließlich zur treibenden Kraft hinter der Raumforschung, und die Satellitenindustrie boomte. Derweil ließ das öffentliche Interesse an der Raumfahrt nach, wie ich auf ein oder zwei Dinnerpartys in Nordlondon erfahren musste, zu denen ich zu meinem Leidwesen während der frühen Nullerjahre eingeladen war. Dort meldeten intelligente und gebildete Menschen Zweifel an, ob wir überhaupt je auf dem Mond gelandet seien. Im Internet kursiert nämlich das Gerücht, die größte Leistung der Menschheit sei in Wirklichkeit nur ein Betrug seitens der US-Regierung gewesen. Angeblich hat Stanley Kubrick sie in einem Filmstudio mit Fernsehkameras gedreht, weil die USA auf diese Weise beim Wettlauf im All während des Kalten Krieges triumphieren und die UdSSR demoralisieren wollten. Die Astronauten hätten also gar nicht ihr Leben aufs Spiel gesetzt, sondern wären alle Betrüger.
Der absolute Tiefpunkt war für mich allerdings der Start des Roboter-Landers Beagle, der als Teil der Mars-Express-Mission der Europäischen Weltraumbehörde 2003 ins All geschickt wurde, um nach außerirdischem Leben zu suchen.
So wie einst Darwins Reise auf der HMS Beagle die Evolutionslehre zur Folge hatte, so hoffte man, dieser beherzte kleine Spürhund würde auf dem Mars Hinweise auf Leben finden und die Gesetze der Biologie neu schreiben.
Das Sendezeichen der Landeeinheit war von Blur komponiert worden, und man benutzte ein Tupfenbild von Damien Hirst als Testkarte für die Videokamera an Bord, daher war der Beagle im Prinzip Britpop auf Steroiden und auch etwa genauso langlebig.
Dabei muss man fairerweise dazusagen, dass das Design der Landefähre ziemlich genial war. Sein Mutterschiff Mars Express war nicht als Landegerät, sondern eher als Raumgleiter entworfen worden. Der charismatische Brite Colin Pillinger wusste jedoch mit den Medien umzugehen und trickste die hohen Tiere der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA aus, sodass man schließlich Platz für einen blinden Passagier von der Größe eines Mülleimerdeckels machte. Nach seinem Abwurf würden zwei sich nacheinander öffnende Fallschirme den Sinkflug des Beagles bremsen und drei Airbags die Landung abfedern. Sobald der Lander den Boden berührt hätte, würden sich die Airbags von allein lösen, das Gehäuse würde sich öffnen, und es würden vier Solarpaneele in der Form von Blütenblättern zum Vorschein kommen. Wie die riesige Narbe einer Blume würde in der Mitte dann ein mechanischer Arm mit etlichen Gerätschaften ausgefahren werden.
Die Vielfalt der vorhandenen Werkzeuge war beeindruckend. Da gab es nicht nur die bereits erwähnte Videokamera, sondern auch ein Mikroskop, eine Maschine zum Entnehmen und Zerkleinern von Gesteinsproben, einen Windsensor, einen Weitwinkelspiegel und einen Teleskopbohrer namens Mole (Maulwurf), der bis zu eineinhalb Meter tief bohren konnte. Nach dem Entnehmen einer Probe würde der mechanische Arm des Beagles sie durch eine Öffnung im Gehäuse ins Innere des Gefährts transportieren, wo ein gut ausgerüstetes Labor die im Gestein vorhandenen Moleküle identifizieren würde. Wenn es auf dem Mars Leben gab – oder je gegeben hatte –, dann waren die Chancen groß, dass der Beagle es aufspüren würde.
Seine Ankunft auf dem Mars war für den Weihnachtstag 2003 geplant, und zur vorgesehenen Stunde warteten patriotische Briten geduldig vor Radio und Fernseher auf die ersten Töne von Blurs Sendezeichen. Stattdessen herrschte Stille. Der Beagle war spurlos verschwunden.
Die von sich ach so überzeugte Medienschickeria aus Nordlondon schien also doch recht zu behalten: Die Mondlandung war ein Fake und die Unfähigkeit des Beagle Wasser auf den Mühlen ihrer unerträglichen Selbstgefälligkeit.
Doch Hilfe war nicht fern. Während beim Thema interplanetare Odyssee eher Flaute herrschte, kam aus einer Ecke, mit der niemand gerechnet hatte, plötzlich eine frische Brise der Begeisterung. Sie brachte wieder Leben in die Sache. Die Weltraumforscher hatten sich auf nahe Planeten konzentriert und eine Niete nach der anderen gezogen – nun trumpften ihre Kollegen aus der weitaus weniger glamourösen Welt der Mikrobiologie auf. Es stellte sich nämlich heraus, dass sie so etwas Ähnliches wie Außerirdische gefunden hatten, und zwar dort, wo niemand es erwartet hatte – mitten unter uns.
Leben, aber nicht so, wie wir es kannten
Tom Brock verbrachte gern Zeit draußen in der Natur. Zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehörten Kanufahren und Wandern, und so besuchte er im Juli 1964 den Nationalpark Yellowstone in Wyoming. Dort ist natürlich der berühmte Geysir Old Faithful beheimatet, der alle eineinhalb Stunden kochend heißes Wasser 45 Meter hoch in die Luft schleudert. Aber nicht er sprang Tom Brock an jenem Tag ins Auge, sondern der mehrfarbige Schlick in den heißen Quellen ganz in der Nähe. Zu unserem großen Glück war Tom Brock nämlich nicht nur ein Naturbursche, sondern auch Mikrobiologe. Und deshalb erkannte er darin natürlich auf den ersten Blick einen Mikrobenteppich. Doch mehr noch: Er wusste auch, dass ein solcher in der Nähe von fast kochend heißem Wasser eigentlich nicht entstehen konnte.
Mikrobe ist der Fachbegriff für einen einzelligen Organismus, so wie eine Bakterie. Wie der Name bereits andeutet, sind einzelne Mikroben so klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht erkennen kann. In geeigneter Umgebung finden sie sich jedoch gerne zu Gruppen zusammen, die als Teppiche bezeichnet werden. Die Mikrobenteppiche im Yellowstone-Park enthalten oft Pigmente wie Chlorophyll, das man durch seine grüne Farbe erkennt, und Carotinoide, welche in Schattierungen von Gelb bis Rot vorkommen.
Chlorophylle und Carotinoide sind Schlüsselfiguren bei der Photosynthese. Bei diesem Prozess benutzen Mikroben, Pflanzen und Algen die Energie des Lichtes, um Kohlendioxid in langkettige Kohlenstoffmoleküle umzuwandeln. Experten sprechen dabei auch von Kohlenstofffixierung.11
In Yellowstone führte das zu wirklich spektakulären Effekten, vor allem bei einer Quelle namens Grand Prismatic Spring. Das tiefe Blau des zentralen Beckens ist hier von Mikrobenteppichen in der Form konzentrischer Kreise in Grün, Gelb, Orange und Rot umgeben, während das Wasser nach außen hin immer seichter wird.
Mikroben sind natürlich Lebewesen, und damals besagte die gängige Meinung, dass sie nur innerhalb eines engen Temperaturrahmens existieren können. Schließlich bestehen Lebewesen aus Eiweiß und enthalten Wasser. Wenn man sie gefrieren lässt, werden sie fest, wenn man sie erhitzt, lösen sich ihre Proteine auf oder denaturieren, was wir im Alltag als kochen bezeichnen. Wer Fleisch oder Mikroben auf mehr als 60 Grad Celsius erhitzt, kann erwarten, dass selbst die hartnäckigsten Proteine irgendwann zu Gelatine werden. Zumindest sind wir davon in den 1960er Jahren ausgegangen. Trotzdem schienen zu Tom Brocks großer Verblüffung die Mikroben in den brodelnden Tümpeln fröhlich zu gedeihen. Von nun an konzentrierte Brock seine Forschung auf diese Lebewesen, die bald als Extremophile bekannt wurden – als Organismen, die extreme Lebensumstände lieben. Ihre Verwegenheit schien keine Grenzen zu kennen, in den späten 60ern entdeckten Brock und sein Forschungsteam sogar Spuren von Bakterien in jenen Yellowstone-Quellen, in denen Temperaturen bis zu 90 Grad Celsius herrschten.
Am erstaunlichsten finde ich daran, wie lange es gedauert hat, bis sich diese Erkenntnis durchsetzte. Wenn es um die Wirklichkeit geht, sind wir Menschen nicht unbedingt die verlässlichsten Kreaturen. Wir sehen nicht nur Dinge, die es gar nicht gibt, sondern wir ignorieren auch solche, die tatsächlich vorhanden sind, gerne mal.
Im Jahr 1964 war der Yellowstone-Park von etwa zwei Millionen Menschen besucht worden, welche vermutlich alle die mehrfarbigen heißen Quellen bestaunt haben. Unter ihnen waren doch sicher auch Wissenschaftler, vielleicht sogar der eine oder andere aus dem Bereich Mikrobiologie. Dennoch war Tom Brock der Einzige, dem auffiel, was uns inzwischen allzu offensichtlich erscheint: dass es im kochend heißen Wasser nur so wimmelte von Lebewesen, die doch eigentlich gar nicht da sein sollten.
Brock veröffentlichte schon nach kurzer Zeit erste Ergebnisse, aber erst in den späten 70ern erreichte die Neuigkeit von seiner Entdeckung die gängigen wissenschaftlichen Fachzeitschriften.
Und an diesem Punkt nimmt unsere Geschichte nun eine Wendung. Es ist nämlich eine Sache, wenn ein fleißiger Mikrobiologe ungewöhnliche Bakterien entdeckt, die in den heißen Quellen des Yellowstone-Parks Photosynthese betreiben, aber es ist eine ganz andere, wenn ein Geologe im Pazifischen Ozean in zwei Kilometern Tiefe auf einen ganzen Zoo von ungewöhnlichen Tieren stößt.
Drei Mann in einem Tiefseeboot
Alvin, einem U-Boot der US Navy mit Platz für drei Passagiere, sollten wir aus zwei Gründen dankbar sein. Erstens, weil es 1966 eine nicht explodierte Wasserstoffbombe vom Grund des Mittelmeers geborgen hat, nachdem ein B-52 Bomber in der Luft mit einem Tankflugzeug kollidiert war. Es kann durchaus sein, dass es damit eine nukleare Katastrophe und das Ende der menschlichen Rasse verhindert hat. Zweitens hat Alvin in den Augen von manch einem die Heimat vom Vorläufer allen Lebens – selbst von uns Menschen – entdeckt, den Ort, an dem alles begann.
Die Theorie der Plattentektonik wurde 1922 vom deutschen Geologen Alfred Wegener entwickelt. Wie ihr vielleicht wisst, besagt sie, dass die Erdkruste nicht statisch ist, sondern aus einer Ansammlung von sich bewegenden Platten besteht.
In den Fugen zwischen den Platten entstehen geologisch interessante Phänomene wie Vulkane, Inseln, Berge und Gräben. Welche Form diese Phänomene annehmen, hängt davon ab, was sich auf den Platten befindet – zum Beispiel ein Ozean oder ein Kontinent – und davon, ob sie zusammengepresst oder auseinandergezogen werden oder ob sie nebeneinander hergleiten.
So läuft das zumindest normalerweise. Manchmal gibt es allerdings auch Vulkane in der Mitte einer Platte, weit weg von ihrem Rand. In diesem Fall scheint sich etwas tief unter der Kruste zu befinden, die Platte gleitet quasi über eine heiße Stelle. Während sie sich voranbewegt, entstehen durch diesen Hotspot eine Reihe von Vulkanen. Die hawaiianischen Inseln sind dafür das klassische Beispiel: Sie sitzen mitten auf der Pazifischen Platte, die sich zurzeit in nordwestlicher Richtung auf Eurasien zubewegt. Während immer wieder ein neues Stückchen der Platte über den Hotspot gleitet, schießt das heiße Magma ein ums andere Mal nach oben und lässt so einen Vulkan nach dem anderen auf dem Meeresgrund entstehen. Die Spitzen dieser Vulkane bilden die hawaiianischen Inseln.12
Lustigerweise ist ausgerechnet der Yellowstone-Park ein weiteres Beispiel für eine solche Stelle, auch wenn wir uns dort gerade zwischen zwei Ausbrüchen befinden. Der letzte hat so etwa vor 640 000 Jahren stattgefunden.
Wenn ein Vulkan ausbricht, stürzt oft die Umgebung ein, und es bleibt eine Vertiefung zurück, die wir mit dem spanischen Wort für Kessel als Caldera bezeichnen. In der Caldera vom letzten Ausbruch an dieser Stelle finden wir im Yellowstone-Park nun Old Faithful und die Prismatic Springs. Ein drittes Beispiel sind die Galapagos-Inseln, und da kommt nun unser furchtloses kleines U-Boot namens Alvin ins Spiel.
Garten Eden
Am 8. Februar 1977 brach Alvin an Bord eines extra dafür gebauten Katamarans namens Lulu auf, um den vulkanischen Tiefsee-Grabenbruch Galapagos Rift nördlich der Galapagosinseln zu erkunden. Dort wollten sich Forscher auf die Suche nach heißen Quellen machen. Der große Salzgehalt der Weltmeere schien darauf hinzudeuten, dass sie von irgendwoher mit Salzwasser gespeist wurden. Deshalb erwartete man, am Grund des Ozeans ein Pendant zu Yellowstones Geysiren und Quellen zu finden, das Salz und Mineralien ins Meer pumpte. Zum Zeitpunkt von Alvins Tauchausflug hatte jedoch noch niemand eine echte hydrothermale Spalte entdeckt, welche eine definitive Antwort liefern konnte.
Im Sommer zuvor war bei einer Untersuchung des Galapagos Rifts eine unbemannte Tiefseekamera für die Suche nach heißen Quellen benutzt worden, jedoch ohne Erfolg. Irgendwann waren zwischen den x Aufnahmen vom kargen Meeresgrund allerdings ein paar Fotos mit einem Haufen toter weißer Muscheln und einer Bierdose aufgetaucht. Das Team hatte diese Gegenstände für Müll gehalten, der nach einer Party auf einem Schiff über Bord geworfen worden war, und die Stelle nach einem Gericht mit Meeresfrüchten benannt – Clambake. Denn Leben war da unten ja nicht möglich, weil kein Licht bis dorthin vordrang. Ohne Licht, so war man überzeugt, konnte es keine Pflanzen, Algen oder Bakterien geben, und ohne diese könnten sich andere Wesen nicht ernähren.
Wie falsch man damit lag! Am 17. Februar 1977 ging Alvin mit Jack Donnelly am Steuer auf Tauchgang, außerdem waren noch zwei Geologen namens Jack Corliss und Tjeerd van Andel mit an Bord. Als sie sich dem Meeresgrund näherten, begann ihre Umgebung zu schimmern.
Tatsächlich entsprang dem dunklen Vulkangestein dort unten heißes Wasser und bildete beim Abkühlen schwefelhaltige schwarze Wolken, weshalb man diesen Quellen auch den Spitznamen Schwarze Raucher gegeben hat. Aber das war noch längst nicht alles.
Als Alvins Suchscheinwerfer über die Felsen in der Umgebung wanderten, brachten sie eine geisterhafte Menagerie unglaublicher Kreaturen zum Vorschein. Da gab es riesige weiße Muscheln, weiße Krebse und sogar einen lilafarbenen Oktopus, und sie alle waren quietschfidel.
Verwirrt griff Corliss zum Telefon und rief seine Doktorandin Debra Stakes oben an Bord der Lulu an. »Sollte der Meeresgrund hier nicht eigentlich die reinste Wüste sein?«, fragte Corliss. Als Stakes bejahte, erwiderte der verblüffte Corliss: »Na ja, wir haben alle möglichen Tiere entdeckt.«
Und es wurde noch verrückter. Bei den nächsten Tauchgängen fand man weitere heiße Quellen und noch mehr seltsame Wesen. An einer Quelle stießen sie auf ein orangefarbenes Tier, das wie Löwenzahn aussah. Bei einer anderen, die sie atemlos Garten Eden tauften, fanden sie einen Wald aus riesigen Würmern mit leuchtend roter Spitze, die sich im Wasser wiegten wie Blumen im Wind. Zwar sammelten die Wissenschaftler Proben, als geologische Expedition hatten sie aber kein Formaldehyd für die Aufbewahrung dabei. Deshalb musste das Nächstbeste herhalten: ein paar Flaschen russischer Wodka, die sie in Panama gekauft hatten.
Tjeerd van Andel verlor das Interesse an seiner ursprünglichen Suche nach den heißen Quellen und lag nachts wach, weil sich hinter seiner Stirn tausend Fragen drängten: Woher stammten diese Tiere nur? Und wovon ernährten sie sich wohl?
Zwei Jahre später, also 1979, kehrte ein Biologenteam zurück, um es herauszufinden. Man hatte Alvin mit einem neuen Auffangbehälter und einem zweiten mechanischen Arm ausgestattet sowie eine Filmkamera eingebaut. Nach jedem Tauchgang kehrte die Mannschaft mit einem Zoo von Wesen zurück, die man so noch nie gesehen hatte: Da gab es neue Arten von Muscheln, Seeanemonen, Wellhornschnecken, Napfschnecken, Röhrenwürmern, Nacktschnecken, Hummern, Schlangensternen und blinden weißen Krabben.
Das zarte orangefarbene Löwenzahnwesen, das die Geologen bei ihrem Tauchgang 1977 gesehen hatten, stellte sich als Verwandter der Portugiesischen Galeere heraus, zerfiel nach seiner Ankunft an der Oberfläche aber leider schnell. Das Rätsel darum, was all diese Tiere denn nun fraßen, wurde bald von einem Biologen namens Holger Jannasch gelöst.
Das unterste Glied dieser seltsamen Nahrungskette war eine Mikrobe. Statt ihre Energie aus Licht zu ziehen, ernährte sich diese Bakterie von den Chemikalien aus dem Wasser der Quelle, vor allem von Schwefelwasserstoff.
Mit einem Mal war alles möglich. Wenn für Leben also weder Licht noch moderate Temperaturen nötig waren, wo auf Erden konnte man es dann noch finden? Plötzlich schienen wir Extremophile zu entdecken, wo auch immer wir hinschauten. In Kernreaktoren labten sich Bakterien an zehnmal stärkerer Strahlung als der, die auch der zähesten Küchenschabe den Garaus machen würde. Es wurden sowohl Mikroben als auch Fische entdeckt, die im Challengertief des Marianengrabens in 11 000 Meter unter Wasser unglaublich hohem Druck widerstanden.13 Man fand Mikroben und Pilze in so starken Säuren, dass sie einen pH-Wert von null hatten, und es wurden sogar Bakterien entdeckt, die in Steinen leben.
Das alles wirft eine interessante Frage auf: Wer lebt denn hier nun unter extremen Umständen, wir oder die anderen? Für eine Bakterie in der brodelnden Hitze einer Yellowstone-Quelle müssen wir doch wohl die Extremophilen sein, schließlich existieren wir in einer unglaublich trockenen Umgebung bei Temperaturen, die das wenige vorhandene Wasser regelmäßig gefrieren lassen! In welcher natürlichen Umgebung entstand das Leben? Wurden die ersten Zellen vielleicht in der flirrenden Hitze eines Schwarzen Rauchers ausgebrütet und sind erst später in kühlere Gefilde unter der Sonne ausgewandert?
Wenn Mikroben in Steinen überleben können, sind sie dann vielleicht in Meteoriten von einem Planeten zum anderen gereist? Hat das Leben etwa irgendwo anders begonnen – vielleicht auf dem Mars – und uns dann in einem Felsklumpen aus dem All erreicht?
Kurz gesagt, ist das Leben nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Es ist nicht empfindlich, kostbar oder irgendwie vorhersehbar. Ganz im Gegenteil: Es ist zäh und banal und kann sich auf unendlich viele Arten anpassen. Hier auf der Erde scheint es nur Wasser, Kohlenstoff und eine Energiequelle zu brauchen. Vielleicht sind Mars, Venus und Merkur ja doch nicht die unwirtlichen Wüsten, für die wir sie einst gehalten haben. Wenn es dort auch nur ein kleines bisschen Feuchtigkeit gibt, dann könnten diese Planeten irgendeine Art von Bakterien beherbergen. Könnte einer der Eismonde, die am Rand unseres Sonnensystems um riesige Gasplaneten kreisen, vielleicht doch bewohnbar sein?
Die Entstehung der Arten
Dass Alvin ausgerechnet in der Nähe der Galapagosinseln auf eine Flut völlig unbekannter Lebewesen gestoßen ist, hat natürlich etwas wunderbar Poetisches an sich. Schließlich hat damals auf diesen Vulkaninseln der große Charles Darwin die Exemplare gesammelt, die später seine Evolutionstheorie inspiriert haben. Es lohnt sich, die Geschichte hier noch einmal zu erzählen. Nicht nur, weil Darwin der Astronaut seiner Zeit war und sich dorthin auf den Weg gemacht hat, wo noch kein Naturforscher vor ihm gewesen war, sondern auch weil die Evolution so ein wichtiger Bestandteil unserer Suche nach intelligentem außerirdischem Leben ist. Was nun folgt, mag wie ein Umweg wirken, er erleichtert uns aber später das Erreichen des Gipfels, also los …
Galápago ist ein spanisches Wort für Schildkröte, und Darwins Tagebuch zufolge brachte die Schiffsmannschaft der Beagle am 18. September 1835 15 Riesenschildkröten von Chatham Island (heute San Cristobal) an Bord, um daraus ein Festmahl zuzubereiten. Die Tiere auf den Galapagos waren relativ vertrauensselig, weil sie nur wenig natürliche Feinde kannten. Jagen und Sammeln war hier deshalb gewissermaßen dasselbe. Darwin selbst schildert, wie er mit der Spitze seines Gewehrs einen Falken von einem Ast holte, und erinnert sich auch daran, dass sein Fähnrich King einen Vogel mit einem Hut erledigte.
Verständlicherweise machten die Riesenschildkröten auf unseren jungen Helden großen Eindruck, und ihn faszinierte die Behauptung von Nicholas Lawson, dem Vizegouverneur der Galapagosinseln, dass er »mit Sicherheit sagen konnte, von welcher der Inseln eine solche Schildkröte stammte«.14 Mit anderen Worten: Jede Insel hatte ihre eigene Schildkrötenart. Leider war Darwin nicht sehr erfolgreich bei seinem Versuch, Exemplare zu finden, die das beweisen würden. Er trug drei Panzer von Schildkröten von unterschiedlichen Inseln zusammen, doch da diese von Jungtieren stammten, zeigten sie kaum Unterscheidungsmerkmale.
Zurück in der britischen Hauptstadt präsentierte Darwin vor der Geological Society of London die Tiere, die er von seiner Reise mitgebracht hatte. Die Vögel übergab er John Gould von der Royal Zoological Society, damit er sie untersuchte. Darunter waren auch die Tiere von den Galapagosinseln, die Darwin als Amseln, Zaunkönige und Finken identifiziert hatte. Das überraschende Ergebnis von Goulds Untersuchung war jedoch, dass es sich bei all diesen Vögeln um Finken handelte, »so speziell, dass sie eine völlig neue Gruppe mit zwölf Arten bildeten«. Als Darwin dies hörte, begann er eine kühne Theorie zu entwickeln. Die Galapagosinseln waren ja relativ junge Vulkaninseln. Was, wenn es dort ursprünglich gar keine Finken gegeben hatte? Konnte es sein, dass vielleicht ein Finkenpaar von der südamerikanischen Küste herübergeflogen war und dass sich dessen Nachkommen auf den verschiedenen Inseln zu unterschiedlichen Arten weiterentwickelt hatten?
Um das zu beweisen, musste Darwin wie bei den Riesenschildkröten des Vizegouverneurs zeigen können, dass jede Insel eine andere Finkenart beherbergte. Ungewöhnlicherweise hatte der sonst so sorgfältige Darwin seine eigenen Vögel allerdings nicht vernünftig beschriftet. Zum Glück war sein Gehilfe Syms Covington nicht so schludrig gewesen.
Indem er Covingtons Vögel mit denen von Beagle-Kapitän Robert Fitzroy kombinierte, konnte Darwin die Orte rekonstruieren, an denen er selbst seine Finken gefunden hatte. Und es stimmte: Jede Insel hatte ihre eigene Art.
Von Gould hatte er am 10. Januar 1837 die Untersuchungsergebnisse bekommen, und im März schrieb Darwin dann die Worte in ein Notizbuch, die den Verlauf der Biologie für immer verändern würden: »Eine Art verändert sich zu einer anderen.«
Arten konnten sich verändern, aber wie? Für Darwin stellte sich das in etwa so dar: Das erste Paar hatte sich vermehrt, und ihre Nachkommen hatten die verschiedenen Inseln bevölkert. Da bei der Fortpflanzung niemals eine exakte Kopie eines Elternteils entsteht, gab es innerhalb der Population jeder Insel eine Vielfalt an Merkmalen. Einige Finken hatten zum Beispiel einen dickeren Schnabel, einige einen dünneren. Wenn die Samen auf einer der Inseln nur schwer zu knacken waren, dann hatten die Finken mit dickem Schnabel dort einen Überlebensvorteil und deshalb mehr Nachkommen. Nach genügend Generationen würde deshalb die komplette Finken-Population auf dieser bestimmten Insel einen dicken Schnabel haben. Anders ausgedrückt begünstigte die Natur nicht alle Lebewesen auf dieselbe Art und Weise. Sie wählte manche aus und manche nicht. Wie Darwin es formulierte: Die Arten entwickelten sich durch einen natürlichen Ausleseprozess weiter.
Im Juli desselben Jahres, kaum acht Monate nach seiner Rückkehr mit der Beagle, holte Darwin sein Notizbuch hervor und schrieb die Worte: »Ich denke«. Darunter skizzierte er dann den ersten Stammbaum des Lebens. Alles ging mit einem einzigen Stamm los – dem ersten lebendigen Wesen –, und dann fügte er sich verzweigende Äste hinzu. Jeder sprießende Zweig stellte eine neue Art da. Es war eine einfache Zeichnung, aber von großer Tragweite. Ausgehend von einem einzigen Organismus hatte sich das Leben auf der Erde zu einer ständig wachsenden Anzahl von Arten weiterentwickelt. Dieser Graphik zufolge konnte man zwei x-beliebige Lebewesen auf der Erde auswählen und ihre Abstammungslinie bis zu einem gemeinsamen Vorfahren zurückverfolgen. Also war alles Leben auf der Erde eins.
Das Entscheidende sind die Gene
Dieser Gedanke ist so faszinierend, dass man sich ruhig mal einen Moment Zeit nehmen kann, um ihn zu verdauen. Wenn jedes lebendige Wesen auf der Erde mit allen anderen in Verbindung gebracht werden kann, dann gehört also nicht nur Großtante Ada zu deiner Familie, sondern du bist auch ein Angehöriger der Scholle und ein entfernter Cousin der Amöbe. So merkwürdig wir die Tiere da unten beim Schwarzen Raucher auch finden mögen, sie hocken auf den Zweigen desselben Stammbaums wie wir, genau wie die seltsamsten je entdeckten Fossilien, die der Ediacara-Fauna.15
Im Zentrum von Darwins Evolutionstheorie durch natürliche Auslese steht natürlich das Konzept der Vererbung, die Idee, dass Eigenschaften von den Eltern an ihre Nachkommen weitergegeben werden. Zu Darwins Zeit war noch nicht genau bekannt, wie Fortpflanzung funktioniert. Heute wissen wir, dass jeder Organismus auf der Erde in jeder Zelle seines Körpers seinen eigenen Bauplan mit sich herumträgt, verschlüsselt durch die langkettigen Kohlenstoffmoleküle der Desoxyribonukleinsäure, auch DNA genannt. Kurz gesagt: Ihr ähnelt euren Eltern, weil ihr deren DNA geerbt habt.
Oder ein wenig exakter: Ihr habt das meiste davon geerbt. Das System, mit dem die DNA reproduziert wird, ist nicht vollkommen, und das ist ganz entscheidend. Denn die weniger perfekten Kopien führen zu dem, was Darwin »Variabilität« nennt: zum Auftreten neuer Merkmale, die die Nachkommen nicht von ihren Eltern geerbt haben. Meistens haben diese neuen Merkmale keine weitere Bedeutung. Manchmal sind sie nachteilig und mindern die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Nachkommen vermehren. Dadurch stirbt das neue Merkmal dann aus. In einigen seltenen Fällen bringt diese neue Eigenschaft jedoch Überlebensvorteile mit sich und erhöht die Wahrscheinlichkeit der Fortpflanzung.
Die Information über solche Merkmale ist in kleinen Abschnitten der DNA kodiert, die als »Gene« bekannt sind.16
Man kann sich jede Eigenschaft herausgreifen – zum Beispiel wie dick der Schnabel eines Vogels ist – und die Gene identifizieren, von denen diese Eigenschaft abhängt. Der britische Biologe W. D. Hamilton konnte zeigen, dass der Kampf ums Überleben weniger auf der Ebene von Organismen oder Arten stattfindet, sondern vor allem auf der Ebene der Gene. Einfach ausgedrückt tun die Gene alles nur für sich selbst.17 Für euer Erbgut ist bloß eins wichtig, nämlich so viele Kopien von sich selbst anzufertigen wie möglich. Wir Wirtsorganismen sind nur ein Mittel zum Zweck.
Ich bin ein MAC, Zarg ist ein PC
So sieht es also aus. Die Evolution ist der Schlüssel, mit dem wir das Rätsel des Lebens, so wie wir es kennen, lösen. Außerdem kann sie zwei ganz außergewöhnliche und scheinbar in keinem Zusammenhang stehende Fakten erklären.
Erstens sind nämlich die Lebensformen immer simpler, je älter die gefundenen Fossilien sind. Noch hat niemand in derselben Gesteinsschicht ein Mastodon und einen Trilobiten gefunden, und wir erwarten auch nicht, dass das einst geschehen wird. Artenbildung – der Prozess, durch den die natürliche Auslese zwei Arten entstehen lässt, wo es vorher nur eine gab – ist unumkehrbar, und die Gesamtzahl von sowohl lebenden als auch ausgestorbenen Arten18 kann im Lauf der Zeit nur immer weiter zunehmen.
Zweitens erklärt all das auch die unfassbaren Ähnlichkeiten zwischen ganz unterschiedlichen Zweigen des Lebens, so wie wir es kennen. Um mal einen Vergleich aus der Welt der Computer zu benutzen: Da sind lauter Macs zu finden, aber keine PCs. Jedes Lebewesen auf der Erde besteht aus einer oder mehr Zellen, braucht Wasser als Lösungsmittel, speichert seinen Bauplan in der DNA und verbrennt Kohlenhydrate, um Energie freizusetzen. Bei lebendigem Protein besteht jedes einzelne Molekül aus denselben 20 Aminosäuren,19 und jedes Molekül lebendiger DNA wurde mit denselben vier Nukleinbasen verschlüsselt.20 Auf noch grundlegenderer Ebene könnte man auch sagen, dass alle uns bekannten Lebensformen komplett auf Kohlenstoff basieren, weil fast jedes nur erdenkliche Molekül mit einer biologischen oder biochemischen Funktion aus Kohlenstoffverbindungen besteht.
Aber was heißt das nun für unsere Suche nach intelligentem Leben? Na ja, Galapagos hat’s gegeben, Galapagos hat’s genommen. Auf der einen Seite haben die Schwarzen Raucher bewiesen, dass es beim Leben unter extremen Bedingungen keine Grenzen gibt. Auf der anderen Seite haben uns die Finken gezeigt, dass es auf der Erde nur eine einzige Art von Leben gibt. Sind wir nun also allein oder nicht? Was wäre denn, wenn das Leben, wie wir es kennen, nur ein Glückstreffer war, ein absolut zufälliger und einmaliger Vorfall, der sich so nie mehr wiederholen wird? Eins ist wohl sicher: Wenn wir Beweise für einen zweiten Stammbaum des Lebens auf Erden hätten, dann würden wir uns bestimmt viel zuversichtlicher auf die Suche nach Leben in der Galaxie machen. Aber da ist nichts. Oder?
Jetzt ist wohl ein guter Zeitpunkt, um über Wüstenlack zu sprechen.
Ein Leben im Schatten
Der Gründervater der Wüstenlackforschung war der wegweisende deutsche Naturforscher und Entdecker Alexander von Humboldt. Während seiner bahnbrechenden Südamerika-Expedition entdeckte er 1799 auf Granitfelsen in den Stromschnellen nahe der Mündung des Orinoco-Flusses im Nordosten Venezuelas eine merkwürdige Metallschicht, welche die Steine »glatt, dunkelfarbig, wie mit Graphit überzogen« aussehen ließ.21
Humboldt war fasziniert und ließ diese Schicht von einem der bedeutendsten Chemiker seiner Zeit untersuchen, von Jöns Jacob Berzelius.22 Dieser erklärte ihm, dass es sich um Mangan und Eisenoxid handelte, was erstaunlich war, weil Granit normalerweise nur kleine Mengen von Mangan und Eisen enthält.23 Woher stammten diese Metalle? Vermutlich aus dem Wasser des Orinoco, aber warum blieben sie an den Felsen kleben?
In Die Fahrt der Beagle beschreibt auch Charles Darwin die Entdeckung einer seltsamen Schicht auf Felsen. Seine fand er an der brasilianischen Küste an einem Strand unterhalb der Wasserlinie, und sie war farblich von einem »satten Braun«. Darwin war ein Bewunderer Humboldts, und zu seinem wertvollsten Besitz an Bord der Beagle gehörte eine siebenbändige Übersetzung der Reise in die Äquinoktial-Gegenden des Neuen Kontinents seines Helden.24 Daher wusste er, dass Humboldts Fund viel dunkler gewesen war, und fragte sich, ob die rötlichere Färbung bei ihm damit zu tun haben konnte, dass die Schicht am Strand von Brasilien weniger Mangan und mehr Eisen enthielt.
Ihn verblüffte, wie sie »in der Sonne glitzer[te]«, und er hatte keine Ahnung, wie sie wohl entstanden sein könnte. »Den Ursprung […] dieser Metalloxide, die wie auf die Steine gekittet zu sein scheinen, kennen wir nicht«, schrieb er.
Sowohl Humboldt als auch Darwin fanden diese Metallschicht im tropischen Klima Südamerikas, doch – wenig überraschend bei dem Namen –, wie sich später herausstellte, ist der inzwischen als Wüstenlack bekannte Überzug genauso oft in trockener Umgebung zu finden.
Ein klassisches Beispiel ist die Wüste des Colorado-Plateaus im Südwesten der Vereinigten Staaten, wo die glänzende schwarze Schicht auf den Felsen den Indianern eine praktische Oberfläche bot, um ihre Malereien hineinzukratzen. In den Schluchten sind die mit Wüstenlack bedeckten Bereiche besonders beeindruckend; manchmal sind ganze Wände davon überzogen, oder es bilden sich senkrechte Streifen, bei denen sich Schwarz, Rot und Hellbraun abwechseln.
Seit Humboldts Zeiten haben wir einige neue Erkenntnisse über Wüstenlack gewonnen, aber viele sind es nicht. Wie Darwin bereits vermutete, hängen die Farbschattierungen von Rot bis Schwarz tatsächlich von den enthaltenen Mengen an Eisen und Manganoxid ab. Lack mit etwa der gleichen Menge von beidem ist hellbraun.
Wir wissen, dass dieser Lack auch Kieselerde in Form von Ton enthält und dass er besser auf Felsen und Wänden wächst, die in unregelmäßigen Abständen nass werden und der Sonne ausgesetzt sind, so als würde das schnelle Trocknen von Wasser seine Entstehung irgendwie begünstigen. Uns ist auch bekannt, dass sich dieser Lack nur ganz langsam bildet und alle tausend Jahre um weniger als die Dicke eines menschlichen Haares zunimmt. Außerdem wissen wir – und hier wird die Sache brisant – dass der Lack Mikroben enthält.
Honorary Research Fellow Barry DiGregorio vom Buckingham Centre for Astrobiology glaubt, dass es sich bei diesen Mikroben um Bakterien handelt, die bei der Photosynthese Mangan fixieren. Er hält den Lack in Wirklichkeit für eine Art Mikrobenteppich25 so wie der, den Brock in den heißen Quellen des Yellowstone Parks gefunden hat.
Randall Perry, ein Forscher der Abteilung für Geowissenschaften am Imperial College London, denkt hingegen, dass die wichtigsten Aufgaben im Lack der Lehm erfüllt, welcher seiner Meinung nach bei Feuchtigkeit zu einem Gel wird und alles Mögliche in sich einschließt, zum Beispiel auch freie Mikroben. Damit dient er laut Perry als Katalysator für ziemlich abgefahrene chemische Prozesse, bei denen die Metalloxide konzentriert werden. Wenn dieses Gel in der Sonne trocknet, entsteht dadurch der Lack, so Perry.26
Wer hat nun recht? Tja, vielleicht keiner von beiden, meint Carol Cleland, eine Philosophin der University of Colorado Boulder in den USA und Mitglied des Instituts für Astrobiologie der NASA. Es fasziniert sie, dass wir nicht so genau wissen, ob der Wüstenlack in den Bereich der Chemie oder der Biologie gehört. Für sie ist die Vorstellung, Felsen könnten einfach durch chemische Prozesse eine Schicht aus Metall entwickeln, doch recht weit hergeholt. Aber wenn man Ausgrabungen vornimmt – falls man beim Wegkratzen einer nur ein Hundertstel Millimeter dicken Schicht überhaupt von Ausgrabungen sprechen kann –, findet man dabei nicht viele Zellen, nur ein paar Fragmente. Was, fragt nun Cleland, wenn es sich beim Wüstenlack einfach um eine völlig andere Lebensform handelt?
Auf den ersten Blick mag das ein wenig verrückt klingen, aber es sprechen durchaus Dinge dafür. Immerhin gibt es auf der Erde schon seit Milliarden von Jahren Extremophile, auch wenn wir Brock brauchten, um darauf aufmerksam zu werden. Nachdem er sie entdeckt hatte, fanden auch andere überall solche Lebewesen. 2005 schlug Cleland vor, dass es womöglich eine »Schattenbiosphäre« geben könnte – ein mikrobielles Ökosystem, das parallel zu dem unseren existiert, von uns aber noch als solches erkannt werden muss. Worauf sie völlig zurecht hinweist: All unsere Tests gehen davon aus, dass es nur eine Art von Leben gibt, nämlich unsere. Doch was ist denn, wenn etwas da draußen nicht denselben DNA-Code hat oder andere Aminosäuren benutzt, um daraus Proteine zu bilden? Oder wenn es über gar keine DNA oder Proteine verfügt? Vielleicht nicht einmal über Zellen? Womöglich basiert es auf etwas anderem als Kohlenstoff? Wie sollen wir es dann erkennen?
Cleland findet, dass wir aktiv nach Leben suchen sollten, welches ganz anders ist als die uns bis jetzt bekannten Formen, und dass der Wüstenlack da ein guter Ausgangspunkt sein könnte. Ein anderer wären Manganknollen, seltsame Metallklumpen, die auf dem Grund vieler unserer Ozeane zu finden sind und die mich immer an die Eier in dem Film Alien erinnern. Auch bei denen wird davon ausgegangen, dass sie eher durch chemische als durch biologische Prozesse entstanden sind, aber wie können wir da sicher sein? Sobald wir uns von der vorgefassten Meinung darüber befreit haben, wie Leben auszusehen hat, entdecken wir es vielleicht bald überall, sogar in den heißen Quellen des Yellowstone-Parks.
Natürlich drängt sich dann noch eine weitere Frage auf: Wenn wir irgendwann feststellen, dass sich auf der Erde eine zweite Art von Leben entwickelt hat, wie nennen wir dieses dann? Da es von unserem Planeten stammt, fällt »außerirdisch« wohl weg. Der Kosmologe Paul Davies plädiert dafür, dass wir uns völlig von dem Wort »außerirdisch« verabschieden. Er empfiehlt, den Begriff »seltsames Leben« für all das zu verwenden, was mit dem Leben, so wie wir es kennen, keinen gemeinsamen Ursprung hat. Er hat sogar eine »Erdmission« vorgeschlagen, um danach zu suchen.
Und wie sollen wir eigentlich Lebensformen bezeichnen, die aus dem immer weiter wachsenden Feld der synthetischen Biologie entstehen? Gehören die auch in die Kategorie »seltsam«?
Vor unserer eigenen Haustür
Wie man es auch dreht und wendet, eins ist klar: Die Entdeckung von Extremophilen hat uns die Augen für die Idee geöffnet, dass es in unserem eigenen Sonnensystem womöglich doch von Leben nur so wimmeln könnte. Gut, vielleicht galoppieren keine Gnuherden majestätisch über die Steppen von Jupiters Mond Europa. Aber es könnte gut sein, dass in dem riesigen Ozean unter seiner eisigen Oberfläche Mikroorganismen wachsen und gedeihen.
Auch Ganymed, der größte von Jupiters galileischen Monden, verbirgt zwischen Schichten von Eis salziges Meerwasser, wie wir heute wissen. Und mit den neuen Erkenntnissen über Leben in den seltsamsten Umgebungen im Hinterkopf kann man sich schon fragen, was in dessen Tiefen wohl verborgen sein mag.
Erinnert ihr euch noch an Enceladus, den winzigen Saturnmond, der für Voyager aussah wie ein fester Klumpen Eis? Nun, im Juli 2005 hat das NASA-Raumschiff Cassini zu Ende gebracht, was Voyager begonnen hatte. Zur allgemeinen Überraschung ist Enceladus nämlich doch keine kalte, tote Welt, sondern es gibt dort jede Menge Aktivität. An seinem Südpol befindet sich ein riesiger vulkanischer Hotspot, aus dem Eisfragmente und Wasserdampf Hunderte von Kilometern ins All geschleudert werden. Tatsächlich speist sich Saturns breiter Außenring aus genau diesem Hydranten. 2014 bestätigten dann weitere Messungen durch Cassini, was viele bereits vermutet hatten: Unter der Eisschicht an Enceladus’ Südpol befindet sich ein enormer überhitzter Ozean.27
Und obgleich der Mars dem Viking-Lander in den späten 70ern so leblos vorgekommen war, weist immer mehr darauf hin, dass es dort in der Vergangenheit durchaus mikrobielles Leben gegeben hat und vielleicht auch heute noch geben könnte. Dank jüngster Missionen wie der Raumsonde MRO