
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Emotional, berührend, wahr - typisch Dessen! Dass Sydneys Leben auf den Kopf gestellt wird, nur weil sie eine Pizzeria betritt, hätte sie nicht für möglich gehalten. Doch so, wie es im Moment läuft, kann ihr Leben einige Änderungen gut gebrauchen. Ihr Grundgefühl: unsichtbar. Denn zu Hause dreht sich alles nur um ihren Bruder, weil er betrunken einen Jungen angefahren hat und nun im Gefängnis sitzt. Dass ihre Mutter seine Schuld an dem Unfall ignoriert, macht die Sache nicht leichter für Sydney. Bis sie in der Seaside Pizzeria Mac und Layla kennenlernt, deren Familie so ganz anders ist als ihre: chaotisch und warm, laut und liebenswert. Unvoreingenommen wird Sydney willkommen geheißen. Und wenn Mac sie ansieht, fühlt sie sich alles andere als unsichtbar …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Sarah Dessen
Anything for love
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Michaela Kolodziejcok
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für all die Mädchen, die für niemanden sichtbar sind.
Und für meine Leser, die mich sehen.
1
»Würde der Angeklagte sich bitte erheben?«
Das war keine richtige Bitte, auch wenn es sich so anhörte. Das war mir schon beim ersten Mal klar gewesen, als wir uns alle hier versammelt hatten. Es war eine Anweisung, ein Befehl, das ›bitte‹ war pure Kosmetik.
Mein Bruder stand auf. Mom neben mir wurde ganz steif vor Anspannung und sog geräuschvoll Luft ein. Wie wenn sie einem vorm Röntgen sagen, man soll tief einatmen, damit sie mehr erkennen können und auch ja alles draufkriegen. Mein Dad hielt den Blick starr geradeaus gerichtet, so wie immer, mit unergründlichem Gesicht.
Der Richter hatte wieder zu reden begonnen, aber ich konnte irgendwie nicht zuhören. Stattdessen schweifte mein Blick zu den deckenhohen Fenstern. Draußen wiegten sich die Bäume im Wind. Wir hatten Anfang August, in drei Wochen fing die Schule wieder an. Es kam mir so vor, als hätte ich den ganzen Sommer genau in diesem Saal gesessen, ja sogar genau auf diesem Platz, obwohl ich wusste, dass das nicht stimmte. Die Zeit schien hier einfach stillzustehen. Aber vielleicht war das gerade der Sinn, für Leute wie Peyton.
Erst als meine Mutter keuchend nach vorn schwankte und an der Banklehne vor uns Halt suchte, ging mir auf, dass das Urteil verkündet worden war. Ich sah zu meinem Bruder rüber. Schon damals, als wir Kinder immer im Wald hinter unserem Haus gespielt hatten, war er für seine Furchtlosigkeit bekannt gewesen. An jenem Tag allerdings, an dem er sich von den älteren Jungs dazu anstacheln ließ, auf einem dünnen Ast über das weite, klaffende Senkloch zu balancieren, waren seine Ohren knallrot gewesen. Er hatte Angst gehabt. So wie heute.
Der Richterhammer knallte auf das Pult und wir waren entlassen. Die Anwälte drehten sich zu meinem Bruder um, der eine neigte sich beim Sprechen dicht an ihn heran, während ihm der andere eine Hand auf den Rücken legte. Die Leute standen auf und verließen nacheinander den Saal. Ich konnte ihre Blicke auf uns spüren und konzentrierte mich unter mühsamem Schlucken auf meine im Schoß gefalteten Hände. Neben mir schluchzte meine Mutter.
»Sydney?«, sagte Ames. »Alles okay?«
Ich konnte nicht antworten, also nickte ich nur.
»Kommt, wir gehen«, sagte mein Vater und erhob sich. Er fasste meine Mutter am Arm, dann forderte er mich mit einer Geste auf vorauszugehen, dorthin, wo Peyton und die Anwälte standen.
»Ich muss mal zur Toilette«, sagte ich.
Mom sah mich einfach nur aus rot verheulten Augen an. Als wäre das die eine Sache, die sie nach allem, was passiert war, einfach nicht mehr ertragen könne.
»Schon okay«, sagte Ames. »Ich begleite sie hin.«
Mein Vater nickte und tätschelte ihm im Vorbeigehen die Schulter. Draußen in der Lobby des Gerichtsgebäudes sah ich die Leute, die durch die Türen hinaus ans Tageslicht drängten. Wenn ich nur zu denen gehört hätte!
Ames legte mir im Gehen einen Arm um die Schulter. »Ich warte hier auf dich«, sagte er, als wir die Damentoilette erreicht hatten. »Okay?«
Das Licht drinnen war grell, geradezu unerbittlich. Ich trat ans Waschbecken und betrachtete mich im Spiegel. Mein Gesicht war fahl, die Augen dunkel und leer.
Hinter mir schwang eine Kabinentür auf und ein Mädchen kam heraus. Sie war ungefähr so groß wie ich, aber zierlicher, schlanker. Sie trat neben mich ans Waschbecken. Ihr blondes Haar hing in einem langen, unordentlich geflochtenen Zopf seitlich über ihrer Schulter und ein paar lose Strähnen umrahmten ihr Gesicht. Sie trug ein Sommerkleid, Cowboystiefel und eine Jeansjacke. Ich hatte das Gefühl, dass sie mir zuschaute, wie ich mir erst ein und dann ein zweites Mal die Hände wusch, ein Papiertuch nahm und mich zum Gehen wandte.
Ich drückte die Tür auf und da stand Ames, genau gegenüber auf der anderen Seite des Flurs. Er lehnte an der Wand, mit vor der Brust verschränkten Armen. Als er mich sah, richtete er sich auf und ging langsam auf mich zu. Ich blieb zögerlich stehen, und das Mädchen, das hinter mir aus der Toilette kam, lief in mich hinein.
»Oh! Tut mir leid!«, sagte sie.
»Nein«, erwiderte ich und drehte mich nach ihr um. »War meine Schuld.«
Sie sah mich an, dann wanderte ihr Blick über meine Schulter hinweg zu Ames. Ihre grünen Augen taxierten ihn einen Moment lang, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf mich richtete. Ich hatte sie noch nie zuvor gesehen. Doch ein Blick in ihr Gesicht genügte, und ich wusste genau, was sie dachte.
Alles okay?
Ich war es gewohnt, unsichtbar zu sein. Die Leute nahmen mich selten wahr, und wenn sie es doch taten, dann immer nur am Rande. Ich war nicht so strahlend und umwerfend wie mein Bruder, nicht so mitreißend und zauberhaft wie meine Mutter oder so clever und energiegeladen wie meine Freundinnen. Das ist halt so eine Sache. Man glaubt immer, wahrgenommen werden zu wollen. Bis es dann passiert.
Das Mädchen sah mich immer noch an, wie in Erwartung einer Antwort auf die Frage, die sie eigentlich nicht mal gestellt hatte. Und womöglich hätte ich ihr sogar eine gegeben. Doch dann spürte ich eine Hand an meinem Ellbogen. Ames.
»Sydney? Können wir?«
Auch darauf antwortete ich nichts. Wir steuerten die Lobby an, wo meine Eltern jetzt mit Peytons Anwälten zusammenstanden. Im Gehen wandte ich mich ein paarmal nach dem Mädchen um, doch die Menschentraube vor dem Gerichtssaal versperrte mir die Sicht. Als das Gedränge sich gelichtet hatte, schaute ich ein letztes Mal zurück. Überrascht stellte ich fest, dass sie noch genau an der Stelle stand, wo ich sie zurückgelassen hatte. Ihr Blick ruhte immer noch auf mir, als hätte sie mich nie aus den Augen verloren.
2
Das Erste, was man sah, wenn man unser Haus betrat, war ein Porträt meines Bruders. Es hing gegenüber der breiten Glastür direkt über der Anrichte aus Massivholz und der von meinem Vater zum Regenschirmständer umfunktionierten chinesischen Vase. Allerdings nahm kaum ein Besucher Notiz von den beiden Einrichtungsgegenständen, was einem aber niemand verübeln konnte. Denn sobald man Peyton erblickte, konnte man die Augen nicht mehr von ihm losreißen.
Obwohl wir beide die gleichen äußeren Merkmale besaßen (dunkle Haare, olivfarbener Teint, braune, fast schwarze Augen), wirkten sie bei ihm völlig anders. Ich war Durchschnitt, allenfalls ganz niedlich. Peyton dagegen – übrigens der zweite bei uns im Haus, neben meinem Vater Peyton, dem ersten – war absolut umwerfend. Man hatte ihn öfters mit Filmstars von früher verglichen oder mit irgendwelchen Heldenfiguren, die sich tapfer durch schottische Moorlandschaften kämpften. Als mein Bruder noch klein war, war er sich der ganzen Aufmerksamkeit, die ihm in Supermärkten oder an der Postschalterschlange zuteilwurde, gar nicht bewusst gewesen. Ich fragte mich immer, wie es sich für ihn angefühlt haben mochte, als er plötzlich mitkriegte, welche Wirkung er auf andere Menschen und insbesondere auf Frauen hatte. Als würde man auf einmal eine Superkraft an sich entdecken, die gleichermaßen aufregend wie beängstigend ist.
Lange vor alledem war er allerdings einfach nur mein Bruder gewesen. Drei Jahre älter als ich, mit blauer King-Combat-Bettwäsche im Gegensatz zu meiner rosafarbenen mit Fee Fu. Ich vergötterte ihn regelrecht. Wie auch nicht? Er war der unangefochtene Meister in ›Wahrheit oder Pflicht‹ (er wählte natürlich immer Letzteres), der schnellste Läufer der ganzen Nachbarschaft und der einzige Mensch, den ich jemals freihändig auf dem Lenker eines rollenden Fahrrads hatte stehen sehen.
Doch für mich bestand sein größtes Talent darin, wie er verschwinden konnte.
Wir spielten als Kinder oft Verstecken und Peyton nahm die Sache furchtbar ernst. Sich hinter den nächstbesten Stuhl im Zimmer zu ducken oder das offensichtliche Versteck im Besenschrank? Das war etwas für Amateure! Mein Bruder zwängte sich wie ein Schlangenmensch in den Waschbeckenunterschrank, machte sich unter dem Laken platt wie eine Flunder, kletterte in der Duschkabine hoch und klammerte sich spinnengleich unterhalb der Decke fest. Jedes Mal, wenn ich ihn nach seinem Geheimnis fragte, lächelte er nur. »Du musst einfach den unsichtbaren Ort finden«, erklärte er mir. Doch außer ihm fand den keiner.
An den Wochenenden übten wir morgens Wrestling-Griffe vorm Fernseher, während irgendwelche Trickfilmsendungen liefen, und stritten darüber, wen der Hund lieber mochte (dreimal dürft ihr raten). Wenn wir nachmittags nach der Schule kein Training hatten (Fußball für ihn und Turnen für mich), streiften wir durch das Waldgebiet, das an unser Viertel grenzte. Und genauso sehe ich meinen Bruder heute noch vor mir: wie er, einen Stock in der Hand, an einem sonnig kalten Tag durch den herbstlich gesprenkelten Wald vorausmarschiert. Selbst wenn ich Angst hatte, wir könnten uns verlaufen, Peyton hatte nie welche. Furchtlos eben. Eine ebene Landschaft reizte ihn nicht. Er brauchte immer etwas zum Erklimmen. Als die Sache mit Peyton anfing, aus dem Ruder zu laufen, wünschte ich mir so manches Mal, wir würden wieder durch diesen Wald stromern. So als hätten wir den eingeschlagenen Weg noch nicht betreten und es gäbe immer noch die Chance, ganz woanders rauszukommen.
Ich war in der Sechsten, als alles schleichend anders wurde. Bis dahin waren wir beide Unterstufenschüler an der Perkins Day gewesen, der Privatschule, die wir seit dem Kindergarten besuchten. In jenem Jahr aber war Peyton in die Mittelstufe gekommen. Nach nur zwei Wochen hing er schon mit ein paar älteren Schülern ab. Sie behandelten ihn wie ihr Maskottchen, animierten ihn zu dämlichen Sachen wie Lollis aus der Cafeteria klauen oder in den Kofferraum eines Autos klettern und sich für die Mittagspause vom Schulgelände schmuggeln lassen. Und so begann Peytons zweifelhafter Ruhm. Ein Ruhm, der uns alle in den Schatten stellen sollte.
Derweil fuhr ich an den turntrainingsfreien Tagen allein mit dem Schulbus nach Hause, saß allein an unserer Kücheninsel und aß allein meinen Nachmittagssnack. Natürlich hatte ich meine eigenen Freunde, aber die meisten von ihnen waren die ganze Woche über mit irgendwelchen Freizeitaktivitäten beschäftigt. Das war absolut typisch für unsere Wohngegend, die Arbors, wo es sich praktisch jede Familie leisten konnte, die Kinder in alle möglichen außerschulischen Zusatzangebote zu stecken, vom Chinesischunterricht bis hin zum Irischen Folkloretanz. Finanziell gesehen gehörte meine Familie hier zum Durchschnitt. Mein Dad, der vor seinem Jurastudium Soldat gewesen war, verdiente sein Geld mit der Bewältigung von Unternehmenskrisen. Er war der Typ, den man anrief, wenn eine Firma ein Problem hatte – drohende Gerichtsprozesse, ernsthafte Mitarbeiterkonflikte, Enthüllungen zu dubiosen Geschäftspraktiken – und man es ausräumen wollte. Kein Wunder also, dass ich in dem Glauben aufwuchs, es gäbe kein Problem, das mein Vater nicht lösen könnte. Ich hatte es nie anders erlebt.
Wenn Dad so was wie der Generaldirektor unserer Familie war, dann hatte Mom die operative Geschäftsleitung inne. Anders als andere Eltern, die Kindererziehung als gemeinschaftliche Aufgabe begriffen, waren in meiner Familie die Rollen klar verteilt. Mein Vater kümmerte sich um die Rechnungen, das Haus und den Garten, während Mom für alles andere zuständig war. Julie Stanford war die Mutter schlechthin. Die, die jeden Erziehungsratgeber gelesen hatte und in deren Minivan es immer einen unerschöpflichen Vorrat an Müsliriegeln und Sportausrüstung gab, der für alle Kinder in der Nachbarschaft gereicht hätte. Wenn meine Mom etwas machte, dann machte sie es richtig, ganz wie mein Dad. Weshalb es umso überraschender war, als die Dinge dann plötzlich aus dem Ruder liefen.
Der Stress mit Peyton begann in dem Winter, als er in der zehnten Klasse war. Es war nachmittags und ich saß mit einer Schüssel Popcorn bewaffnet im Wohnzimmer vorm Fernseher, als es plötzlich an der Haustür klingelte. Ich spähte nach draußen und sah einen Polizeiwagen in der Einfahrt stehen.
»Mom?«, rief ich nach oben. Sie war in ihrem Büro, das so etwas wie die Steuerungszelle unseres Hauses war. Mein Dad nannte es die Kommandozentrale. »Da steht jemand vor unserer Haustür.«
Keine Ahnung, warum ich ihr nicht sagte, dass es die Polizei war. Vielleicht, weil es real würde, sobald ich es aussprach, und ich nicht sicher war, was das dort draußen zu bedeuten hatte.
»Sydney, du wirst doch wohl in der Lage sein, selbst an die Tür zu gehen«, erwiderte sie. Aber genau, wie ich es mir gedacht hatte, hörte ich sie eine Sekunde später die Treppe herunterkommen.
Ich hielt den Blick starr auf den Fernseher gerichtet, in dem sich die Charaktere meiner Lieblings-Realityshow Big New York mal wieder einen Zickenkrieg lieferten. Seit Peyton mit der Highschool begonnen hatte, waren die Big-Sendungen für mich zu einem festen Nachmittagsritual geworden, das lasterhafteste aller heimlichen Laster. Irgendwer hatte die Sendung mal mit ›Zicken, Zoff und Zaster‹ zusammengefasst, womit eigentlich alles gesagt war. Es gab sechs verschiedene Staffeln – unter anderem Dallas, Los Angeles und Chicago –, also ausreichend Material, um die Zeit zwischen Nachhausekommen und Abendessen totzuschlagen. Ich war dermaßen tief in die Serie eingetaucht, dass mir die Figuren fast wie Freunde vorkamen, und oft ertappte ich mich dabei, wie ich mit dem Fernseher redete, als könnten sie mich hören, oder wie ich im Laufe des Tages über ihre Probleme nachgrübelte. Beim Gedanken, dass einige meiner engsten Freundinnen nicht mal wussten, dass es mich gab, fühlte ich mich auf eine absurde Weise einsam. Doch ohne sie kam mir das Haus so leer vor, sogar wenn Mom da war, und das erfüllte mich mit einem Gefühl von Leere, vor dem mir graute, sobald ich aus dem Schulbus stieg. Mein eigenes Leben war so banal und trist, dass es irgendwie tröstlich war, in das von anderen einzutauchen.
Und so verfolgte ich gerade, wie Rosalie, die Ex-Schauspielerin, dem Model Ayre tyrannisches Verhalten vorwarf, als unser gesamtes Familienleben ins Wanken geriet. Eben noch war die Tür zu und alles in schönster Ordnung. Und plötzlich war sie offen und vor ihr standen Peyton und ein Polizist.
»Ma’am«, sagte der Cop, als meine Mutter einen Schritt zurückwich und sich die Hand auf die Brust legte. »Ist das Ihr Sohn?«
Das war es, woran ich später immer wieder dachte. An diese eine Frage, die so kinderleicht zu beantworten war, an der meine Eltern von diesem Moment an jedoch schwer zu knabbern haben sollten. An jenem Tag, als Peyton auf dem Parkplatz der Perkins Day zusammen mit seinen Freunden beim Grasrauchen erwischt wurde, begann mein Bruder sich in jemanden zu verwandeln, den wir oft einfach nicht wiedererkannten. Es sollten noch weitere Besuche von Behördenseite folgen, Fahrten zur Polizeiwache und schließlich Gerichtstermine und Aufenthalte in Entzugskliniken. Doch dieses allererste Mal war es, das sich mir ins Gedächtnis brannte. Die Schüssel Popcorn, angenehm warm auf meinem Schoß. Rosalies schrille Stimme. Und meine Mom, die einen Schritt zurücktrat, um meinen Bruder reinzulassen. Als der Cop ihn den Flur entlang in die Küche begleitete, sah mein Bruder mich im Vorübergehen kurz an. Seine Ohren waren knallrot.
Da die Polizei Peyton keinen Drogenbesitz nachweisen konnte, entschieden die Verantwortlichen an der Perkins Day, das Vergehen intern zu ahnden. Er wurde suspendiert und zu Helferstunden in der Grundschule verdonnert. Die Geschichte – vor allem der Part, in dem Peyton als Einziger weggerannt war und die Cops notgedrungen hinterher – machte sofort die Runde, wobei die zurückgelegte Strecke (bis zur nächsten Ecke, fünf Straßen weiter, eine ganze Meile) mit jedem Erzählen länger wurde. Mom weinte. Dad war außer sich und brummte ihm einen vollen Monat Hausarrest auf. Und doch wurde nichts mehr so wie früher. Peyton kam von der Schule nach Hause und verkrümelte sich in sein Zimmer, wo er bis zum Abendessen hocken blieb. Er riss seine Zeit ab, schwor, dass er seine Lektion gelernt habe, und wurde drei Monate später wegen Einbruchsdiebstahls verhaftet.
Schon merkwürdig, wenn ein Ausrutscher plötzlich zur Gewohnheit wird. Wenn das Problem nicht länger nur ein temporärer Hausgast ist, sondern mit Sack und Pack einzieht.
Nach dieser Geschichte entwickelten wir eine gewisse Routine. Mein Bruder akzeptierte seine Strafe, und meine Eltern trösteten sich, indem sie ihre zahlreichen Theorien darüber, warum so etwas nie wieder vorkommen würde, als Tatsachen verbuchten. Dann wurde Peyton erneut festgenommen – wegen Drogen, Ladendiebstahls oder Gefährdung des Straßenverkehrs – und wir purzelten allesamt erneut durchs Kaninchenloch und fanden uns in einer absurden Welt aus Anklagen, Anwälten, Gerichtssälen und Urteilen wieder.
Nach seinem ersten Ladendiebstahl wurde er mit Gras aufgegriffen und musste in die Entzugsklinik. Zurück kehrte er mit einer Dreißig-Tage-Medaille am Schlüsselbund und einer neu entdeckten Liebe zum Gitarrenspiel, erweckt durch seinen Zimmergenossen im Evergreen Care Center. Meine Eltern zahlten ihm Einzelunterricht und machten sich daran, im Keller ein kleines Tonstudio einzurichten, in dem er seine selbst komponierten Songs aufnehmen sollte. Die Umbauarbeiten waren halb abgeschlossen, als die Schule eine Handvoll Pillen in seinem Schließfach fand.
Er wurde für drei Wochen suspendiert und sollte in dieser Zeit zu Hause bleiben, Nachhilfe nehmen und sich auf seine Gerichtsverhandlung vorbereiten. Zwei Tage vor seiner planmäßigen Rückkehr an die Schule wurde ich vom lauten Rumpeln unseres Garagentors aus dem Schlaf gerissen. Ich schaute aus dem Fenster und sah Dads Auto, das rückwärts auf die Straße setzte. Mein Wecker zeigte 3:15 Uhr.
Ich stand auf und schlüpfte hinaus in die Diele, wo es still und dunkel war. Ich tappte die Treppe hinunter. In der Küche brannte Licht, drinnen brühte meine Mutter in Schlafanzug und Uni-Logo-Sweatshirt gerade eine Kanne Kaffee auf. Als sie mich sah, schüttelte sie einfach nur den Kopf.
»Leg dich wieder hin«, sagte sie zu mir. »Ich erzähl’s dir morgen.«
Am nächsten Morgen war mein Bruder bereits wieder gegen Kaution auf freiem Fuß. Allerdings hatte man ihn erneut wegen Einbruchsdiebstahls angeklagt, diesmal jedoch in Tateinheit mit Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Am Abend davor hatte er sich, nachdem meine Eltern zu Bett gegangen waren, aus seinem Zimmer geschlichen, war die Straße raufmarschiert und dann über den Zaun der sogenannten Villa geklettert, dem stattlichsten Anwesen der Arbors. Er fand ein unverschlossenes Fenster und zwängte sich hindurch. Drinnen stöberte er ein paar Minuten lang herum, bis schließlich die per Fernalarm herbeigerufenen Cops eintrafen. Als sie das Haus betraten, türmte Peyton durch die Hintertür. Sie überwältigten ihn auf der Poolterrasse, wobei er blutige Kratzer im Gesicht davontrug. Erstaunlicherweise regte meine Mutter sich darüber mehr auf als über alles andere.
»Womöglich haben wir da eine juristische Handhabe«, sagte sie etwas später an diesem Morgen zu meinem Vater. Sie war bereits gestiefelt und gespornt: Um Punkt neun hatten sie einen Termin mit Peytons Anwalt. »Ich meine, hast du dir mal diese Verletzungen angesehen? Ich sage nur: Polizeigewalt!«
»Julie, er ist vor ihnen weggerannt«, entgegnete Dad mit matter Stimme.
»Ja, das sehe ich durchaus. Aber ich sehe auch, dass er noch minderjährig ist und die Anwendung von Gewalt vollkommen unnötig war. Herrgott noch mal, da steht ein Zaun! Ist ja nicht so, dass er sich aus dem Staub hätte machen können!«
Aber genau das hat er doch getan, dachte ich, hütete mich jedoch davor, es laut zu sagen. Je mehr Mist Peyton baute, desto verzweifelter erhob Mom Vorwürfe gegen alle und jeden: Die Schule wollte ihn fertigmachen. Die Polizisten waren zu brutal. Aber mein Bruder war kein Unschuldslamm. Man brauchte sich doch nur mal die Fakten anzuschauen. Obwohl ich manchmal das Gefühl hatte, dass ich die Einzige war, die sie sehen konnte.
Am nächsten Tag hatte die Geschichte bereits an der Schule die Runde gemacht und ich wurde auf den Fluren von allen Seiten schief angesehen. Es galt als beschlossene Sache, dass Peyton von der Perkins Day abgehen und die Highschool woanders beenden würde, wobei die Meinungen darüber auseinandergingen, ob diese Entscheidung von meinen Eltern oder der Schule getroffen worden war.
Zum Glück hatte ich meine Freundinnen, die sich schützend vor mich stellten und den Leuten unmissverständlich klarmachten, dass ich nicht mein Bruder war, auch wenn wir uns ähnlich sahen und denselben Nachnamen trugen. Jenn, die ich schon seit dem Kindergarten kannte, nahm mich besonders eifrig in Schutz. Ihr Dad war selbst mal als junger Student mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
»Da hat er nie ein Geheimnis draus gemacht, er hat ein bisschen rumexperimentieren wollen«, sagte sie, als wir mittags in der Cafeteria saßen. »Er hat dafür gebüßt, und schau, heute leitet er ein großes Unternehmen und ist total erfolgreich. Bei Peyton wird’s genauso sein. Das ist doch alles nur eine Phase.«
So hörte Jenn sich immer an, älter, als sie in Wirklichkeit war, hauptsächlich deshalb, weil ihre Eltern sie mit über vierzig gekriegt hatten und wie eine kleine Erwachsene behandelten. Jenn sah sogar aus wie eine Erwachsene, mit einem anständigen Haarschnitt, einer Brille und bequemen Schuhen. Manchmal war das fast schon etwas gruselig, beinahe, als hätte sie die Kindheit einfach übersprungen. Aber jetzt war sie meine Rettung. Ich wollte ihr glauben. Wollte irgendwas glauben.
Peyton wurde zu drei Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe verurteilt. Es war das erste Mal, dass wir alle gemeinsam in einem Gerichtssaal saßen. Sein Anwalt Sawyer Ambrose, dessen Werbeplakate an sämtlichen Bushaltestellen der Stadt hingen (Sie brauchen einen Anwalt? Rufen Sie Sawyer an!), behauptete, es wäre äußerst wichtig, dass uns die Jury geschlossen hinter meinem Bruder sitzen sah, um zu demonstrieren, dass wir eine loyale, einander eng verbundene Familie waren.
Ebenfalls anwesend war der neue beste Freund meines Bruders, ein Typ, den er in der Drogen-Selbsthilfegruppe kennengelernt hatte, die er gemäß einer Gerichtsauflage besuchen musste. Ames war ein Jahr älter als Peyton, groß, mit strubbligen Haaren und einem schlenkernden Gang. Er war vor einem Jahr verhaftet worden, weil er mit Gras gedealt hatte. Er hatte eine sechsmonatige Gefängnisstrafe abgesessen und sich seither nichts mehr zuschulden kommen lassen, womit er das leuchtende Vorbild war, das mein Bruder laut einhelliger Meinung so dringend benötigte. Wenn sie zusammen waren, tranken sie Unmengen von Kaffee in allen nur erdenklichen Varianten, zockten Computerspiele und büffelten – Peyton für die Alternativschule, an der er gelandet war, und Ames für seine Hotelfachkurse, die er an der Lakeview Tech absolvierte. Ihr Plan war, dass Peyton nach bestandenem Schulabschluss die gleiche Laufbahn einschlug und sie dann gemeinsam in irgendwelchen Ferienanlagen arbeiteten. Meine Mom war von der Idee hellauf begeistert und hatte bereits alle erforderlichen Unterlagen zusammengesucht, um sie auch ja in die Realität umzusetzen. In einem fertig beschrifteten Umschlag auf ihrem Schreibtisch warteten sie nur noch auf ihren Einsatz. Doch erst einmal galt es, diese kleine Knastsache aus der Welt zu schaffen.
Am Ende verbüßte mein Bruder sieben Wochen im Bezirksgefängnis. Mir war es nicht gestattet, ihn dort zu besuchen, aber Mom nutzte jede Gelegenheit, um ihn zu sehen. In der Zwischenzeit blieb uns Ames erhalten. Es schien, als würde er ständig mit einem Kaffeebecher an unserem Küchentisch sitzen und nur hin und wieder zum Rauchen in die Garage verschwinden, wo er die Kippen in dem kleinen Sandeimer ausdrückte, den Mom (die das Rauchen verabscheute) extra für ihn dort aufgestellt hatte. Manchmal tauchte er zusammen mit seiner Freundin Marla auf, einer Maniküristin mit blonden Haaren und großen blauen Augen, die dermaßen schüchtern war, dass sie so gut wie nie etwas sagte. Sobald man das Wort an sie richtete, wurde sie schrecklich nervös, wie diese überspannten Minihunde, die permanent vor sich hin zittern.
Ich wusste, dass Ames meiner Mom ein Trost war. Doch mir bereitete er ein mulmiges Gefühl. Etwa, wenn ich ihn dabei ertappte, wie er mich über den Rand seiner Tasse hinweg beobachtete, jede meiner Bewegungen mit seinen dunklen Augen verfolgte. Oder wenn er beim Hallosagen immer eine Möglichkeit fand, mich zu berühren – meine Schulter anfasste oder mir über den Arm strich. Andererseits hatte er mir nie etwas Konkretes getan, und so fragte ich mich, ob das Problem nicht vielmehr bei mir lag. Außerdem hatte er eine Freundin. Ihm ging es nur darum – so beteuerte er in einer Tour –, sich um mich zu kümmern, wie Peyton es getan hätte.
»Das war seine einzige Bitte an mich, als er ins Gefängnis ist«, erzählte er mir, kurz nachdem mein Bruder inhaftiert worden war. Wir saßen zu zweit in der Küche, denn Mom war zum Telefonieren rausgegangen. »Er hat zu mir gesagt: ›Pass mir auf Sydney auf, Alter. Ich verlass mich auf dich.‹«
Ich wusste nicht so recht, was ich dazu sagen sollte. Das klang so gar nicht nach Peyton, der mich in den Monaten vor seinem Einzug ins Gefängnis mehr oder weniger wie Luft behandelt hatte. Außerdem war er schon vorher nie der Beschützertyp gewesen. Aber Ames kannte meinen Bruder gut, was ich ehrlicherweise von mir nicht mehr behaupten konnte. Also musste ich seinen Worten glauben.
»Tja«, sagte ich aus dem Gefühl heraus, irgendwas erwidern zu müssen, »ähm, danke.«
»Kein Problem.« Wieder musterte er mich mit diesem bohrenden Blick. »Das ist doch ganz klar.«
Nach seiner Entlassung war Peyton zwar immer noch recht still, nahm aber mehr Anteil am Leben zu Hause, half mit und war in einer Weise anwesend wie die ganzen Monate zuvor nicht. Manchmal sah er nach der Schule sogar mit mir zusammen fern. Allerdings dauerte es nie lange, bis er die komplette Big New York- oder Miami-Truppe über hatte.
»Das ist Ayre«, versuchte ich zu erklären, als das hagere, von Kopf bis Fuß in Form geschnippelte Ex-Playmate einen erneuten Ausraster hatte. »Sie und Rosalie, die Schauspielerin? Die zoffen sich ständig.«
Peyton sagte nichts, sondern rollte nur mit den Augen. Mit seiner Geduld war es insgesamt nicht weit her, fiel mir auf.
»Such du aus«, sagte ich und schob ihm die Fernbedienung rüber. »Im Ernst, mir ist egal, was wir gucken.«
Doch das klappte nie. Irgendwie schien er sich immer nur vorübergehend neben mir niederlassen zu können, bevor er wieder aufspringen musste, um seine E-Mails zu checken, auf der Gitarre rumzuklimpern oder sich etwas zu essen zu holen. Sein Gehibbel steigerte sich von Mal zu Mal und es machte mich vollkommen kirre. Auch Mom spürte es. Wie eine innere Energie, die vergeblich ein Ventil suchte und sich von Tag zu Tag mehr aufstaute, bis sie ein neues fand.
Im Juni erhielt er sein Abschlusszeugnis, im Rahmen einer kleinen Zeremonie mit nur acht weiteren Mitschülern, die fast ausnahmslos von ihren vorherigen Schulen geflogen waren. Wir nahmen vollzählig daran teil, einschließlich Ames und Marla. Danach gingen wir zum Abendessen ins Luna Blu, eins unserer Lieblingslokale. Dort toasteten wir Peyton mit alkoholfreien Drinks zu und aßen als Vorspeise die berühmten frittierten Gewürzgurken, bevor er von unseren Eltern sein Examensgeschenk bekam: zwei Rundreise-Tickets nach Jacksonville, Florida, wo er und Ames sich eine namhafte Hotelakademie ansehen durften. Meine Mom hatte sogar einen Termin beim Rektor klargemacht sowie eine Privatführung durchs Haus. Natürlich, was auch sonst.
»Das ist gigantisch«, sagte mein Bruder, während er auf die Tickets starrte. »Im Ernst. Danke, Mom und Dad.«
Meine Mutter lächelte, mit Tränen in den Augen, und mein Vater beugte sich zu Peyton vor und klopfte ihm auf die Schulter. Wir saßen draußen auf der Terrasse, über uns eine Lichterkette mit winzig kleinen Leuchten, und hatten gerade hervorragend gegessen. Der Moment schien so weit entfernt von dem Jahr, das hinter uns lag, als wären die Ereignisse vom Herbst und davor alle nur ein schlechter Traum gewesen. Am nächsten Tag setzte sich Mom mit mir zusammen, um über meine College-Pläne zu sprechen. Endlich war ich das Projekt. Ich war an der Reihe.
In diesem Herbst hatte ich die zehnte Klasse an der Perkins Day begonnen. Mein eigener Wechsel in die Mittelstufe im Jahr zuvor war so wenig bemerkenswert gewesen wie der meines Bruders spektakulär. Jenn und ich hatten uns mit einer Neuen angefreundet, Meredith, die extra der Uni-Kunstturnanlage wegen nach Lakeview gezogen war. Sie war klein und athletisch, hatte einen wippenden Pferdeschwanz und die aufrechteste Körperhaltung, die ich je gesehen hatte. Seit sie sechs war, trainierte sie als Leistungsturnerin in der Wettkampfklasse. Noch nie hatte ich jemanden kennengelernt, der so ehrgeizig und diszipliniert war. Praktisch jede Stunde, die Meredith nicht in der Schule war, verbrachte sie in der Turnhalle. Wir drei verstanden uns mühelos, auch weil uns das Gefühl einte, einen Tick älter zu sein als der Rest unserer Mitschüler: Jenn aufgrund ihrer Erziehung, Meredith aufgrund ihres Sports und ich aufgrund der Ereignisse des letzten Jahres. Der Ruf meines Bruders eilte mir wohl oder übel immer voraus. Doch die Freunde, mit denen ich mich umgab – sowie die Tatsache, dass wir sämtlichen Partys und illegalen Vergnügungen fernblieben, obwohl unsere Mitschüler es tüchtig krachen ließen –, machten deutlich, dass er und ich grundverschieden waren.
Jetzt, wo Peyton als Parkdiener in einem der hiesigen Hotels jobbte und mit Ames Touristikkurse an der Lakeview Tech besuchte, mein Dad häufiger auf Geschäftsreise ging und Mom sich wieder vermehrt ihren Ehrenämtern widmete, war ich nach Schulschluss erneut oft ganz allein im Haus. Wieder befiel mich diese Traurigkeit, die jeden Nachmittag herangekrochen kam, sobald die Sonne unterging. Ich versuchte, sie mit Big New York oder Miami zu vertreiben, und sah mir ein und dieselben Folgen immer wieder von vorne an, so lange, bis ich Schleier vor den Augen hatte. Trotzdem war ich jedes Mal erleichtert, wenn das Garagentor aufrumpelte und signalisierte, dass jemand zurückkehrte, der Abend und das Essen bevorstanden und ich nicht mehr allein war.
Und dann, einen Tag nach Valentinstag, verließ mein Bruder seine Arbeitsstelle zur gewohnten Zeit, kurz nach zehn Uhr abends. Doch statt nach Hause zu gehen, besuchte er einen alten Kumpel von der Perkins Day. Dort trank er ein paar Bier, kippte mehrere Schnäpse und ignorierte die wiederholten Anrufe unserer Mutter, bis seine Mailbox voll war. Um zwei Uhr morgens verließ er die Wohnung seines Freundes, setzte sich in sein Auto und machte sich auf den Heimweg. Zur selben Zeit stieg ein fünfzehnjähriger Junge namens David Ibarra auf sein Fahrrad, um die kurze Strecke bis zu seinem Elternhaus zu radeln, nachdem er beim Computerspielen auf der Couch seines Cousins eingeschlafen war. Er bog von der Dombey Street nach rechts in die Pike Avenue ein, als mein Bruder frontal in ihn hineinfuhr.
An diesem Tag wurde ich vom Brüllen meiner Mutter geweckt. Es klang wie ein Urschrei, grausam und wild, etwas, das ich nie zuvor gehört hatte. Zum ersten Mal verstand ich, was es heißt, wenn einem das Blut in den Adern gefriert. Ich stürzte aus meinem Zimmer, rannte die Treppe hinunter und blieb an der Schwelle zur Küche stehen, unsicher, ob ich für das, was mich da drinnen erwartete, wirklich gewappnet war. Doch dann begann Mom lautstark zu heulen und ich gab mir einen Ruck und trat ein.
Sie saß auf den Knien, den Kopf tief gebeugt, Dad kauerte vor ihr, seine Hände umfassten ihre Schultern. Die Laute, die sie von sich gab, waren grässlich, schlimmer als von einem leidenden Tier. Als Erstes kam mir der Gedanke, mein Bruder sei tot.
»Julie«, sagte Dad. »Atme, Liebling. Atme.«
Mom schüttelte den Kopf. Ihr Gesicht war kalkweiß. Meine starke, patente Mutter so zu erleben, war kaum zu ertragen. Ich wollte einfach nur, dass es aufhörte. Und so zwang ich mich, etwas zu sagen.
»Mom?«
Mein Vater drehte den Kopf und sah mich an. »Sydney, geh wieder rauf. Ich bin gleich bei dir.«
Ich ging. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Dann setzte ich mich auf meine Bettkante und wartete. Und diesmal fühlte es sich an, als würde die Zeit tatsächlich stehen bleiben, in diesen fünf oder zehn Minuten oder wie lange es auch immer dauerte.
Endlich erschien mein Vater in der Tür. Das Erste, was mir auffiel, war sein knittriges, zerknautschtes Hemd, das aussah, als hätte sich jemand darin festgekrallt. Später sollte ich mich vor allem an dieses Bild erinnern. An das Karomuster, das verrutscht und schief war.
»Es hat einen Unfall gegeben«, sagte er. Seine Stimme klang rau. »Dein Bruder hat jemanden verletzt.«
Später, als ich mich wieder an diese Worte zurückerinnerte, ging mir auf, wie treffend sie waren. Dein Bruder hat jemanden verletzt. Sie waren geradezu metaphorisch, mit einer wörtlichen Bedeutung und darüber hinaus noch vielen weiteren. David Ibarra war das Opfer. Aber er war nicht der Einzige, der verletzt worden war.
Peyton war noch auf der Polizeiwache, denn der Alkoholtest hatte ergeben, dass der Wert seines Blutalkoholspiegels doppelt so hoch war wie erlaubt. Aber dass sie ihn betrunken am Steuer erwischt hatten, war sein geringstes Problem. Da er noch auf Bewährung war, würde es diesmal keine mildernden Umstände und keine Freilassung gegen Kaution geben, zumindest vorerst nicht. Mein Dad rief Sawyer Ambrose an, wechselte sein Hemd und verließ dann das Haus, um sich mit ihm zu treffen. Mom verschwand in ihrem Zimmer und machte die Tür hinter sich zu. Ich selbst ging zur Schule, weil ich nicht wusste, was ich sonst hätte tun sollen.
»Ist wirklich alles okay mit dir?«, fragte Jenn, als sie mich am Schließfach abpasste. »Du bist heute irgendwie komisch.«
»Alles okay«, sagte ich und stopfte ein Buch in meine Tasche. »Nur müde.«
Keine Ahnung, warum ich es ihr nicht erzählte. Das Ganze schien zu groß zu sein; es sollte keine weitere Luft zum Atmen und Wachsen bekommen. Außerdem würden die Leute es noch früh genug erfahren.
Zur Abendbrotzeit gingen die ersten Textnachrichten ein. Erst von Jenn, dann von Meredith, dann von noch ein paar anderen Freunden. Ich schaltete mein Telefon aus und stellte mir vor, wie die Neuigkeit sich ausbreitete, so wie Lebensmittelfarbe, die tröpfenchenweise das gesamte Wasser im Glas trübt. Meine Mutter saß noch immer in ihrem Zimmer, Dad war fort, und so machte ich mir eine Portion Nudeln mit Käsesoße, die ich stehend am Küchentresen aß. Dann ging ich auf mein Zimmer und starrte die Decke an, bis ich das vertraute Geräusch des sich öffnenden Garagentors hörte. Diesmal allerdings verspürte ich keine Erleichterung.
Ein paar Minuten später klopfte es an meine Tür und Dad kam herein. Er sah müde aus, mit tiefen Augenringen, so als wäre er in den vergangenen Stunden um zehn Jahre gealtert.
»Ich mache mir Sorgen um Mom«, platzte ich raus, bevor er irgendwas sagen konnte. Ich hatte das gar nicht sagen wollen. Es war, als würde jemand anders mit meiner Stimme sprechen.
»Ich weiß. Aber sie wird schon wieder. Hast du was gegessen?«
»Ja.«
Er sah mich eine Minute lang an, dann durchquerte er das Zimmer und setzte sich zu mir auf die Bettkante. Dad war nicht der Typ, der sich in stark gefühlsbetonten Gesten ausdrückte, das war er nie gewesen. Er war ein Schulterklopfer, ein Meister der angedeuteten Umarmung mit flüchtigem Rückentätscheln. Mom war diejenige, die mich an sich zog, mir das Haar streichelte, mich fest drückte. Aber heute, an diesem unsagbar bizarren, furchterregenden Tag, schlang mein Dad seine Arme um mich. Ich erwiderte die Umarmung, klammerte mich an ihn, als würde mein Leben davon abhängen, und so blieben wir eine gefühlte Ewigkeit lang sitzen.
Es lag so viel vor uns, schrecklich Vertrautes und – noch schlimmer – vollkommen Neues. Mein Bruder würde nie wieder derselbe sein. Und für mich würde kein Tag mehr vergehen, an dem ich nicht wenigstens ein Mal an David Ibarra dachte. Meine Mom würde weiterkämpfen, aber ihr war etwas verloren gegangen. Ich würde sie nie wieder ansehen können, ohne zu bemerken, dass es fehlte. Aber in diesem Moment hielt ich einfach nur meinen Dad im Arm, kniff die Augen fest zu und versuchte, die Zeit anzuhalten. Doch es klappte nicht.
3
»Nervös?«
Ich sah zu meiner Mom rüber, die am Küchentisch saß, vor sich einen Bagel, den sie nicht anrühren würde. Aber es war lieb, dass sie sich Mühe gab.
»Eigentlich nicht«, sagte ich und zog den Reißverschluss meines Rucksacks zu. Das stimmte nicht: Ich hatte bereits zweimal nachgesehen, ob ich meinen Parkausweis und den Stundenplan eingesteckt hatte, trotzdem musste ich mich immer wieder vergewissern. Doch ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen machte. Zumindest nicht meinetwegen.
»Das ist eine große Veränderung, eine neue Schule«, sagte sie.
Während der darauf folgenden Schweigepause schwebte dieser Satz zwischen uns wie ein leerer Haken, der nur darauf wartete, dass jemand etwas daranhängte. Seit ich Anfang Juni beschlossen hatte, die Perkins Day zu verlassen und mich an der Jackson High anzumelden, hatte mir Mom wiederholt Gelegenheit gegeben, ihr den Grund zu erklären. Ich dachte, das hätte ich längst getan. Mein ganzes Leben hatte ich an der Perkins Day verbracht. Ich brauchte einen Tapetenwechsel, besonders nach letztem Jahr. Darüber hinaus gab es noch einen weiteren Grund, über den ich aber nicht redete: Geld.
Peytons Verteidigung war kostspielig gewesen und inzwischen stapelten sich bei uns zu Hause die entsprechenden Rechnungen neben denen von Sawyer Ambrose. Auch wenn meine Eltern es nicht offen aussprachen, so wusste ich doch, dass sie knapp bei Kasse waren. Wir hatten unsere Haushälterin entlassen und eines unserer Autos verkauft, genau wie unser selten genutztes Strandhaus in dem kleinen Küstenort Colby. Es hatte zwar niemand ein Wort über meine Schulgebühren verloren, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich in zwei Jahren aufs College gehen würde, wollte ich auch meinen Beitrag leisten. Außerdem sehnte ich mich danach, endlich in einer anonymen Masse unterzutauchen.
Zwei Tage nach Peytons Urteilsverkündung waren meine Mutter und ich zur Jackson High gefahren, um mich anzumelden. Mom glich immer noch einem wandelnden Geist, der täglich Tasse um Tasse Kaffee leerte und so gut wie nichts aß. Dad war wieder häufig geschäftlich auf Reisen und nahm einen Auswärtstermin nach dem nächsten wahr, weshalb nur noch sie und ich im Haus waren, abgesehen von den Tagen zweimal pro Woche sowie jedes zweite Wochenende, an denen sie die dreistündige Hin- und Rückfahrt zur Lincoln-Vollzugsanstalt unternahm.
Für unseren Termin beim Schulberater hatte sie jedoch keine Mühen gescheut, sich geschminkt und meine Unterlagen in einen mit meinem Namen gekennzeichneten Ordner einsortiert.
Wir parkten in einer Besucherlücke, Mom stellte den Motor ab und ließ ihren Blick an der Fassade des Hauptgebäudes hochwandern.
»Ganz schön riesig«, stellte sie fest. Sie sah mich fragend an, als würde ich es mir womöglich doch noch anders überlegen, aber ich öffnete bereits meine Tür, um auszusteigen.
Drinnen roch es nach Putzmittel und Turnmatten, was merkwürdig war, da die Sporthalle am anderen Ende des Schulhofs lag. An der Perkins Day – die kürzlich erst mithilfe von Spendengeldern eines ehemaligen Schülers, dem Gründer des sozialen Netzwerks Ume.com, aufwendig modernisiert worden war – war alles neu oder so gut wie neu. Die Jackson High dagegen erinnerte eher an eine Flickendecke; der Campus war eine Ansammlung aus alten Gebäuden, modernen Anbauten und dem einen oder anderen Container. Abgesehen von ein paar Lehrern und einer Handvoll Mitarbeitern war die Schule wie leer gefegt, wodurch die Flure nur noch breiter, das Gelände nur noch riesiger wirkte. Im Büro des Schulberaters roch es penetrant nach Raumerfrischer mit Zimtaroma. Da es verwaist war, nahmen wir auf einer durchgesessenen Couch Platz und warteten.
Mom schlug die Beine übereinander und blickte nach rechts zu einem Metallregal, auf dem ein mit »Fundsachen« beschrifteter Karton voller Klamotten, ein Stapel mit Broschüren über Essstörungen und eine leere Taschentuchbox standen. Wäre ihr nicht ohnehin schon zum Heulen zumute gewesen, hätte spätestens dieser Anblick dafür gesorgt – das konnte ich ihr am Gesicht ablesen.
»Ist alles okay, Mom«, sagte ich. »Das hier ist genau das, was ich will.«
»Ach, Sydney«, erwiderte sie und fing ganz plötzlich an zu weinen.
Auch das war eine Seite der neuen Julie. Sie hatte schon immer nah am Wasser gebaut, allerdings nur bei Hochzeiten oder schnulzigen Filmen. Das Übliche eben. Doch diese unvermittelten, von Schluchzen begleiteten Tränenausbrüche waren etwas völlig Neues und machten mich immer ganz hilflos. Diesmal konnte ich ihr nicht mal ein Taschentuch reichen.
Jetzt, zurück in unserer Küche, checkte ich zum zigsten Mal meinen Rucksack, während ich überlegte, ob ich mich noch einmal umziehen sollte. An der Perkins Day trugen die Schüler Uniformen, und ich war es nicht gewohnt, Outfits für die Schule auszuwählen. Nach mehrmaligem Klamottenwechsel hatte ich mich für eine Jeans und meine Lieblingsbluse entschieden, ein weißes, durchgeknöpftes Modell mit kleinen violetten Fliegenpilzen drauf, und dazu die silbernen Creolen, die ich zu meinem sechzehnten Geburtstag bekommen hatte. Aber ich hätte mich auch in Tarnkleidung geworfen, wenn mir das irgendwie geholfen hätte, in der Masse zu verschwinden.
»Du siehst gut aus«, sagte Mom, so als könnte sie meine Gedanken lesen. »Aber du solltest jetzt besser los. Du möchtest an deinem ersten Tag doch nicht zu spät kommen.«
Ich nickte, warf mir den Rucksack über die Schulter und ging zu ihr. Von dem Bagel auf ihrem Teller war ein Mal abgebissen worden. Ein winziger Fortschritt.
»Ich hab dich lieb«, sagte ich, beugte mich hinunter und küsste sie auf die Wange.
Sie griff nach meiner Hand und drückte sie, einen Tick zu fest. »Ich hab dich auch lieb. Hab einen schönen Tag.«
Ich nickte, ging hinaus in die Garage und stieg in mein Auto. Als ich rückwärts aus unserer Einfahrt setzte, sah ich sie durchs Küchenfenster noch immer dort sitzen. Ich dachte, sie würde mir vielleicht nachschauen, aber das tat sie nicht. Stattdessen starrte sie an die Wand ihr gegenüber, mit der Tasse in den Händen. Sie trank nicht daraus und stellte sie nicht hin, sondern hielt sie einfach auf Brusthöhe am Körper, und irgendwas daran machte mich so traurig, dass ich es kaum erwarten konnte, hier wegzukommen.
Der Unterricht war um Viertel nach drei zu Ende. Zehn Minuten nach dem Klingeln stand nur noch mein Auto auf dem hinteren Parkplatz. Ausnahmsweise fühlte es sich gut an, allein zu sein.
Die Schule war einfach dermaßen riesig. Als ich an diesem ersten Morgen das Gebäude betrat, quollen die Flure, die mir noch drei Wochen vorher so breit vorgekommen waren, bereits über vor Menschen. Man konnte keinen Schritt tun, ohne jemanden anzurempeln oder zumindest einen Arm oder Ellenbogen zu berühren. Doch damit hatte ich gerechnet. Die eigentliche Überraschung war der Lärm. Da gab es das Schrillen der Glocke – ein langer, ohrenbetäubender Ton. Die Presslufthammer der Bauarbeiter, die kaputte Gehwegplatten austauschten. Und dazu das ständige Schülergeschrei: in den Fluren, auf dem Hof, draußen vor den Klassenräumen, in einer Lautstärke, die einen selbst bei geschlossener Tür noch zusammenzucken ließ. Es trotzte jeder Logik, dass man in einer solchen Enge Angst hatte, von niemandem gehört zu werden. Doch offenbar waren alle hier von dieser Angst geplagt.
Meine einzige richtige Begegnung an diesem Tag war mit einem aufgekratzten Mädchen namens Deb, das sich mir als »selbst ernannte Jackson-Botschafterin« vorstellte. Sie war in meinem Klassenraum aufgekreuzt, bewaffnet mit einer Geschenktüte, die einen Schulkalender, einen Jackson-Footballteam-Bleistift und ein paar selbst gemachte Kekse enthielt sowie ihre persönliche Visitenkarte für den Fall, dass ich noch irgendwelche Fragen hätte. Als sie wieder ging, starrten alle mich an, als ob ich drei Köpfe hätte. Na bravo!
Jetzt, wo ich allein war, wusste ich wieder einmal nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Nach Hause fahren kam nicht infrage, bis zum Abendbrot waren es noch gut zwei Stunden hin, die gleichen hundertzwanzig Minuten, vor denen mir schon gegraut hatte, bevor Peyton ins Gefängnis gekommen war. Mit einem Mal fühlte ich mich hilflos. Wenn ich keine Menschenmengen ertrug, meine eigene Gesellschaft aber ebenso wenig, was blieb mir da noch? Dermaßen niedergeschlagen hatte ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Ich warf den Motor meines Wagens an, als könnte ich vor der Traurigkeit einfach davonfahren.
Nur eine Querstraße von der Schule entfernt entdeckte ich an einer roten Ampel drüben auf der anderen Straßenseite eine kleine Ladenzeile. Es gab einen Nagelsalon, einen Schnapsladen, ein Figurstudio und in der hintersten Ecke eine Pizzeria.
Pizza war ein fester Bestandteil meines Nachmittagsprogramms und beinah noch wichtiger als mein Popcorn-und-Big-Ritual. In der Nähe der Perkins Day gab es ein kleines Einkaufscenter und der Italiener dort, Antonella’s, war quasi das heimliche Klubhaus der Schule. Sie hatten Steinofen-Pizza, eine Kaffeebar, Gelato und die süßeste Cola aus dem Zapfhahn, die ich je getrunken hatte. Meredith ging nach dem Unterricht immer direkt zum Training, aber Jenn und ich fielen mindestens einmal pro Woche bei Antonella’s ein, teilten uns eine Schinken-Ananas-Broccoli-Pizza und gaben vor, Hausaufgaben zu machen. Die meiste Zeit allerdings tratschten wir und spionierten die angesagten Kids aus, die immer an den großen Fenstertischen saßen, rumflirteten und sich gegenseitig die Strohhalmhüllen ins Gesicht bliesen.
Heute war alles neu für mich gewesen. Mit Pizza gäbe es endlich wieder ein Stück Vertrautheit. Bevor ich es mir anders überlegen konnte, setzte ich den Blinker, wechselte die Spur und bog auf den Parkplatz ein.
Ich wusste im selben Moment, als ich durch die Eingangstür trat, dass dieser Laden mit dem Antonella’s nichts gemein hatte. Das Seaside Pizza war klein, eng und von gelbem Neonlicht erhellt, wobei ein paar der Leuchtröhren bereits den Geist aufgegeben hatten. Es gab runde Nischen mit abgewetzten Ledersitzen sowie eine Handvoll Tische. An den dunkel getäfelten Wänden hingen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Stränden und Holzstegen. In der Auslage hinter der Theke war eine Auswahl verschieden großer Pizzen zu sehen, und ein Stück weiter hinten stand ein altersschwacher Ofen, an dessen Klappe in verblassten Buchstaben das Wort HEISS zu lesen war. Oberhalb der Zapfanlage, neben der ein leicht schiefer Stapel aus laminierten Speisekarten stand, hing ein Fernseher von der Decke, in dem eine Sport-Talkshow lief. Im Hintergrund dudelte Musik, und ich hätte schwören können, ein Banjo herauszuhören.
Kaum war ich drinnen, ließ ich die Glastür hinter mir zufallen, behielt aber eine Hand an der Scheibe, weil mir bereits dämmerte, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Offensichtlich war dieser Schuppen kein Renner bei den Schülern der Jackson High, geschweige denn bei irgendwem anderen. Ich war der einzige Gast.
Ich drehte mich zum Gehen um, musste aber feststellen, dass jetzt ein junger Typ auf der anderen Seite der Glastür stand. Er war groß, mit schulterlangem braunem Haar, und trug ein weißes T-Shirt, eine Jeans und einen Rucksack auf dem Rücken. Er wartete, bis ich erst einen, dann einen zweiten Schritt von der Tür zurückgetreten war, bevor er sie langsam aufschob und hereinkam.
Jetzt konnte ich unmöglich türmen, ohne wie eine arme Irre auszusehen, also drehte ich mich wieder zur Theke um und angelte eine Speisekarte vom Stapel. Ich würde einfach zum Schein darin lesen, um mich dann hinauszuschleichen, während er seine Bestellung aufgab. Doch als ich einen Augenblick später den Kopf hob, stand der Typ hinter der Theke und band sich eine Schürze um. Mist! Er arbeitete hier. Und jetzt sah er mich auch noch an.
»Was kann ich für dich tun?«, fragte er. Ich starrte auf den Aufdruck auf seinem T-Shirt:
Anger Management. Wcom Radio.
»Ähm«, machte ich und schaute wieder in die Karte. Sie fühlte sich klebrig an und ich konnte kein Wort entziffern. Voller Panik warf ich einen Blick in die Auslage. »Ein Stück mit Salami, bitte. Und was zu trinken.«
»Kommt sofort«, sagte er und griff hinter sich nach einer Pizzapfanne. Er hantierte mit einer Art Zange zwischen den Pizzastücken herum, dann angelte er eines heraus, warf es in die Pfanne und schob sie in den Ofen. Als er wieder an der Kasse stand, schüttelte er sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und drückte ein paar Tasten. »Macht drei zweiundvierzig.«
Ich nestelte mein Portemonnaie aus der Tasche und reichte ihm einen Fünfer. Als er das Wechselgeld heraussuchte, bemerkte ich das Glas mit Yam-Yam-Lollis neben der Kasse. Zum Mitnehmen! stand in rosa Markerschrift auf einem kleinen Schildchen. Als Kind war ich süchtig nach diesen Lutschern gewesen, seit Jahren schon hatte ich keinen mehr gegessen. Ich kramte zwischen den Lollis herum und schob auf der Suche nach meiner Lieblingssorte die mit Apfel-, Wassermelone- und Kirschgeschmack beiseite.
»Bitte schön, dein Wechselgeld, ein Dollar, achtundfünfzig Cent«, sagte der junge Typ und hielt mir das Geld hin. Als ich es nahm, zusammen mit dem leeren Becher, den er auf die Theke gestellt hatte, sagte er: »Falls du einen mit Zuckerwatte- oder Bubblegum-Geschmack suchst, kannst du dir die Mühe sparen.«
Ich hob die Augenbrauen. »Die wollen wohl alle?«
»Um es vorsichtig auszudrücken!«
In dem Moment flog knallend die Ladentür auf und jemand eilte mit platschenden Schritten an mir vorbei. Gerade noch rechtzeitig wandte ich den Kopf, um ein blondes Mädchen zu sehen, das in einem rückwärtig gelegenen Raum mit der Aufschrift »Privat« verschwand und die Tür hinter sich schloss.
Der Junge blickte mit leicht zusammengekniffenen Augen zur Tür, dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf mich. »Deine Pizza ist in einer Minute fertig. Wir bringen sie dir an den Tisch.«
Ich nickte, ging zum Zapfhahn hinüber, füllte meinen Becher und nahm mir ein paar Servietten. Ich setzte mich an einen der Tische, holte mein Telefon heraus und fummelte daran herum, nur um etwas zu tun zu haben. Nach ein paar Minuten hörte ich, wie sich die Ofenklappe öffnete und wieder schloss. Kurz darauf trat der Typ mit einem Papierteller in der Hand durch eine Schwingtür und stellte ihn vor mich hin.
»Danke.«
»Keine Ursache«, sagte er. Dann ging er zum Privatraum rüber und klopfte an die Tür.
»Hau ab!«, sagte eine Mädchenstimme. Eine Minute später jedoch ging die Tür auf und wieder zu.
Wieder allein, biss ich ein Stück von meiner Pizza ab, obwohl ich eigentlich gar nicht hungrig war. Dann biss ich ein zweites Stück ab. Etwa von dem Moment an musste ich mich total zusammenreißen, um mir nicht das ganze Ding auf einmal in den Mund zu schieben. Ich meine, Salami-Pizza ist Salami-Pizza. Es ist vermutlich die Nullachtfünfzehn-Sorte schlechthin. Aber die hier war der reinste Wahnsinn! Die Kruste war außen knusprig und innen fluffig weich, und die Soße hatte diese würzige Note, die nicht scharf, sondern pikant ist. Und der Käse erst – mit Worten nicht zu beschreiben. Oh mein Gott!
Ich schwebte im siebten Pizzahimmel und bemerkte deshalb auch nicht, dass jemand hinter der Theke hervorgetreten war. Erst als ich eine Stimme hörte.
»Alles in Ordnung?«
Ich hob den Blick und sah einen Mann in Dads Alter, vielleicht ein bisschen jünger. Er hatte dunkles Haar, durchzogen von weißen Strähnen, und eine Schürze um den Bauch.
»Die ist super«, sagte ich mit halbvollem Mund. Ich schluckte herunter und fügte hinzu: »Das dürfte mit Abstand die beste Pizza sein, die ich je gegessen habe.«
Er lächelte sichtlich erfreut, dann reckte er sich über die Kasse hinweg nach dem Glas mit den Lollis. »Hast du dir schon einen Lutscher genommen? Die sind perfekt für hinterher. Aber spar dir die Zeit, nach Zuckerwatte oder Bubblegum zu suchen. Die haben wir nicht.«
»Hab schon gehört, die sind sehr begehrt.«
Er schnitt eine Grimasse und schüttelte den Kopf. Im selben Moment hörte ich die Privatraumtür aufgehen. Kurz darauf marschierte der junge Typ an mir vorbei, gefolgt von dem blonden Mädchen. Sie hielt einen Lutscher in der Hand. Einen rosafarbenen.
»Bleibt die Kasse neuerdings unbesetzt, oder was?«, fragte der Mann, nahm die Zange und ordnete die Pizzastücke in der Auslage neu an. »Hat mir noch keiner gesagt, dass der Laden nach dem Ehrprinzip läuft.«
»Schimpf nicht mit ihm«, sagte das Mädchen. Sie trug ein Sommerkleid und Flip-Flops und an einem ihrer Arme einen ganzen Schwung Silberreifen. »Er hat nur nach mir gesehen.«
Der ältere Mann zog die Ofenklappe auf, guckte hinein, dann knallte er sie wieder zu. »Ist das etwa nötig?«
»Heute ja.« Sie zog einen Stuhl unter dem Tisch gegenüber der Kasse hervor und setzte sich. »Daniel hat gerade mit mir Schluss gemacht.«
Der Mann stockte in der Bewegung und wandte sich zu ihr um. »Wie? Echt jetzt?«
Das Mädchen nickte langsam. Sie schob sich den Lolli wieder in den Mund. Einen Moment später zupfte sie eine Serviette aus dem Spender und tupfte sich die Augen ab.
»Hab den Kerl noch nie leiden können«, brummte der Mann und drehte sich wieder dem Ofen zu.
»Doch, das hast du«, sagte der junge Typ mit tief klingender Stimme.
»Hab ich nicht. Er sieht zu gut aus. Diese Haare! Einem Kerl mit so einer Matte kann man nicht trauen.«
»Schon gut, Dad«, sagte das Mädchen, während sie immer noch in ihrem Gesicht rumwischte. Sie nahm den Lolli aus dem Mund. »Das ist jetzt sein Abschlussjahr und da wollte er sich nicht fest binden, bla, bla, bla.«
»Von wegen. So ein Scheiß!« Dann sah er zu mir rüber. »’tschuldigung!«
Ich fühlte mich ertappt und merkte, dass ich rot anlief. Sofort richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder auf meine Pizza beziehungsweise auf ihren spärlichen Rest.
»Und so richtig ätzend ist«, fuhr das Mädchen fort und zog eine frische Serviette aus dem Spender, »dass Jake mir genau die gleichen Gründe genannt hat, als er am Sommeranfang mit mir Schluss gemacht hat. ›Wir haben Sommer! Ich will mich jetzt nicht fest binden!‹ Also echt, Mann. Mit diesem saisonalen Verlassenwerden komme ich nicht klar. Das ist einfach zu krass.«
»Diese Haare«, murmelte der ältere Mann. »Diese Haare waren mir von Anfang an suspekt.«
Die Ladentür schwang auf und zwei Jungs kamen herein, jeweils mit einem Skateboard unter dem Arm. Während sie ihre Bestellung aufgaben, aß ich meine Pizza auf und versuchte, nicht ständig zu dem blonden Mädchen rüberzuschielen. Sie hatte ein Bein unter den Körper gezogen und starrte mit dem Lolli im Mund zum Fenster hinaus, das Kinn in die Hände gestützt.
Die Skater setzten sich an einen Tisch und kurz darauf erschien der junge Typ und brachte ihnen das Essen. Auf dem Rückweg zur Theke tippte er dem Mädchen auf die Schulter und sagte etwas zu ihr, das ich nicht verstand. Sie sah zu ihm hoch und nickte. Dann ging er weiter.
Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Wenn ich jetzt nach Hause aufbrach, müsste ich noch eine Stunde bis zum Abendessen totschlagen. Schon beim Gedanken daran spürte ich ein zentnerschweres Gewicht auf den Schultern. Das Seaside Pizza war alles andere als optimal, aber wenigstens umgaben mich hier nicht meine heimischen vier Wände, von denen laut die Einsamkeit widerhallte. Ich stand auf und füllte meinen Becher nach.
»Du solltest dir einen Lolli nehmen«, sagte das Mädchen, den Blick unverwandt aufs Fenster gerichtet, als ich auf dem Weg zurück an meinen Tisch an ihr vorbeiging. »Die sind gratis.«
Offenbar war jeder Widerstand zwecklos. Also trottete ich zum Lolliglas zurück und wühlte darin herum. Insgeheim wartete ich darauf, dass das Mädchen mich auf die Knappheit an rosafarbenen Sorten aufmerksam machen würde, aber das tat sie nicht. Nachdem ich eine Weile herumgekramt hatte, meldete sie sich dann allerdings doch zu Wort.
»Welche Sorte soll’s denn sein?«
Ich blickte zu ihr rüber. Hinter der Theke bestrich ihr Vater gerade einen Pizzateigling mit Soße, während der junge Typ Geldscheine in die Kasse einsortierte. »Kräuter«, sagte ich.
Sie starrte mich an. »Du machst Witze!«
Sie war sichtlich schockiert. Was wiederum mich dermaßen irritierte, dass ich keine Antwort zustande brachte. Aber dann sprach sie auch schon weiter.
»Niemand«, erklärte sie, »mag Kräuterlollis. Die bleiben doch immer übrig, wenn alle anderen Sorten längst weg sind, sogar die widerlichen wie Pistazie oder Blaubeere.«
»Was stimmt nicht mit Blaubeere?«, fragte der Mann.
»Sie sind blau«, sagte sie ausdruckslos und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf mich. »Ist das jetzt dein voller Ernst – Kräuter? Das ist deine Lieblingssorte?«
Jetzt schauten alle mich an. Ich schluckte. »Na ja … Ja.«
Wie zur Antwort schob sie sich mitsamt Stuhl vom Tisch zurück und stand auf. Dann kam sie auch schon auf mich zu. Mir schoss durch den Kopf, dass ich mich anscheinend zum allerersten Mal in meinem Leben wegen Bonbonvorlieben würde prügeln müssen, doch sie rauschte an mir vorbei. Ich schaute ihr nach, wie sie wieder im Privatraum verschwand.
Der Mann hinter der Theke zuckte nur die Schultern und streute eine Handvoll Käse auf die Soßenschicht seiner Pizzakreation. Jetzt drangen Geräusche aus dem Privatraum – Schubladen wurden aufgerissen und wieder zugemacht, Schranktüren knallten. Dann wurde es still und das Mädchen kam wieder heraus, mit einer Plastiktüte in der Hand. Sie stellte sich direkt vor mich und hielt mir die Tüte hin.
»Hier«, sagte sie. »Für dich.«
Ich nahm sie. Darin lagen an die fünfzig Kräuterlollis, vielleicht noch mehr. Eine volle Minute lang starrte ich sprachlos auf den Tüteninhalt, bevor ich den Blick wieder hob.
»Auch wenn ich sie verabscheue, es sind immer noch Süßigkeiten«, erklärte sie. »Ich hab’s nicht übers Herz gebracht, sie einfach wegzuwerfen.«
Wieder spähte ich in die überraschend schwere Tüte. »Danke«, sagte ich.
»Gern geschehen.« Sie lächelte und streckte mir die Hand entgegen. »Ich bin Layla.«
»Sydney.«
Wir schüttelten die Hände. Dann herrschte kurz Schweigen. Als ich sie wieder ansah, zog sie die Augenbrauen hoch.
»Oh«, sagte ich hastig, nahm rasch einen Lutscher aus der Tüte und wickelte ihn aus. Ich schob ihn mir in den Mund, und – zack-peng! – war ich wieder zehn Jahre alt und zusammen mit Peyton auf dem Heimweg vom Quik-Zip, wo wir mein Taschengeld für Süßkram auf den Kopf gehauen hatten. Er kaufte immer Schokolade: mit Erdnüssen, mit Mandeln, mit Karamell. Ich hingegen liebte Zucker pur und zog den Genuss gern in die Länge. In jeder Tüte Yam-Yam-Lollis waren mindestens zwei mit Kräutergeschmack: Einen davon aß ich immer sofort, den zweiten hob ich mir auf, bis alle anderen Sorten weg waren. Ich dachte an meinen Bruder in Lincoln. Ob sie dort jemals Schokolade bekamen? Vielleicht sollte ich Mom mal dran erinnern, ihm welche mitzubringen.
In dem Moment klingelte ein Telefon hinter der Theke. Der junge Typ ging ran.
»Seaside Pizza, Sie sprechen mit Mac.« Er schnappte sich einen Notizblock und zog einen Stift hinter seinem Ohr hervor. »Mhm hm. Ja. Das macht einen Dollar extra. Sicher. Wie lautet die Adresse?«
Während er schrieb, lugte ihm der ältere Mann über die Schulter, las die Bestellung mit, nahm sich einen Teigklumpen und begann ihn zwischen den Händen hin und her zu werfen.
»Die Lieferadresse ist bei uns um die Ecke. Er kann dich mitnehmen und zu Hause absetzen«, sagte er zu Layla. »Ruf deine Mom an und frag, ob sie irgendwas braucht.«
»Okay«, sagte sie über die Schulter hinweg. Dann wandte sie sich wieder an mich. »Gehst du auf die Jackson?«
Ich nickte. »War heute mein erster Tag.«
Sie zog eine Grimasse. »Oje! Und wie war’s?«
»Nicht so toll«, erwiderte ich. Dann deutete ich mit einem Nicken auf die Tüte. »Aber die hier helfen.«
»Auf jeden Fall!«, entgegnete sie. Dann winkte sie lässig, drehte sich auf dem Absatz um und entschwand wieder nach hinten. Ich kehrte mit meiner Yam-Yam-Tüte an meinen Tisch zurück, klaubte den Müll auf und nahm meinen Rucksack.
»Sag ihr, wir treffen uns draußen«, sagte der junge Typ zu dem älteren Mann, als ich im Rausgehen war. »Der Anlasser spinnt mal wieder. Ich muss ihm ein bisschen auf die Sprünge helfen.«
»Vergiss nicht das Schild!«
Am Ende verließen wir zusammen den Laden, so wie wir ihn betreten hatten. Als ich quer über den Parkplatz zu meinem Auto latschte, trabte er zu einem in die Jahre gekommenen Truck. Ich beobachtete, wie er mit der Hand über die Kante der Ladepritsche langte, ein magnetisches Schild hervorzog und es von außen an die Fahrertür klatschte. Seaside Pizza, stand darauf, die beste weit und breit. Darunter war eine Telefonnummer angegeben.
Inzwischen war es spät genug, dass ich losfahren konnte, um genau rechtzeitig zum Abendessen zu Hause zu sein. Aber ich blieb noch, bis Layla erschien, mit einer Pizza-Warmhaltebox aus Styropor in den Händen. An der ersten roten Ampel trennten uns zwei Autos voneinander, doch ich blieb über mehrere Abzweigungen hinweg hinter ihnen, bis der Verkehr schließlich zu dicht wurde. Erst dann wickelte ich den nächsten Lutscher aus, den ich mir den ganzen restlichen Heimweg über langsam auf der Zunge zergehen ließ.
4
In den folgenden zwei Tagen lief es an der Schule nicht wirklich besser. Schlechter auch nicht. Ich fand die kürzesten Wege zu meinen Kursräumen ebenso heraus wie, dass man auf dem vorderen Parkplatz leichter eine freie Lücke fand, und unterhielt mich zweimal kurz mit anderen Schülern (davon einmal gezwungenermaßen im Rahmen einer Partnerarbeit, aber immerhin).
Ins Seaside kehrte ich nicht zurück, aus Sorge, sonst wie ein Freak rüberzukommen, eine Stalkerin oder gar beides. Stattdessen traf ich mich am nächsten Tag mit Jenn in der Frazier Bakery, um Neuigkeiten auszutauschen und Hausaufgaben zu machen. Am darauffolgenden Tag ging ich direkt nach der Schule nach Hause und redete mir ein, dass es nur halb so schlimm wäre. Dann sah ich Ames’ Auto in unserer Einfahrt.
»Sydney? Bist du das?«
Ich stellte meine Tasche auf die Treppe und holte tief Luft, bevor ich die Küche betrat. Und richtig, da saß er zusammen mit Mom am Tisch und trank Kaffee, zwischen ihnen stand ein Teller mit Keksen. Als meine Mutter mich sah, schob sie ihn in meine Richtung.
»Hallo, Fremde«, sagte Ames, als ich zum Kühlschrank ging und eine Flasche Mineralwasser herausnahm. »Lange nicht gesehen.«
Obwohl er dabei lächelte, lief mir eine Gänsehaut über den Rücken. Doch Mom hatte bereits einen Stuhl unter dem Tisch hervorgezogen, damit ich mich zu ihnen setzen konnte. Also tat ich es auch.
»Wie war’s in der Schule?«, fragte sie. Und an ihn gewandt fügte sie hinzu: »Sie hat diese Woche an der Jackson High angefangen.«
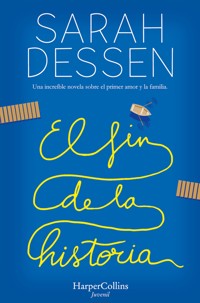

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










