
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Monatelang auf den amerikanischen Bestsellerlisten Luke ist der perfekte Freund: gut aussehend, nett, lustig. Er und Emaline waren schon zu Schulzeiten ein Paar. Aber jetzt, im Sommer vor Collegebeginn, fragt sich Emaline, ob perfekt wirklich gut genug ist. Und als Theo, der junge, ehrgeizige Filmassistent, nach Colby kommt, muss sie sich entscheiden zwischen dem coolen Großstadttypen Theo und ihrem langjährigen Freund Luke, und das in einer Situation, in der ihr leiblicher Vater erstmals wieder so richtig in ihr Leben tritt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sarah Dessen
The Moon and more
Roman
Aus dem Englischen von Michaela Kolodziejcok
Deutscher Taschenbuch Verlag
Für Jay und Sasha, meine ganze Welt
1
Da waren sie also.
»… oder ich verspreche euch, wir drehen auf der Stelle um und fahren zurück nach Paterson!«, schimpfte die Frau hinter dem Lenkrad des weinroten Minivans, als er neben mir zum Stehen kam. Sie hatte sich zur Rückbank umgewandt, von wo drei Kinder zurückstarrten, zwei Jungen und ein Mädchen. Eine Ader am Hals der Frau war stark hervorgetreten und hatte, dick und unübersehbar, eine gewisse Ähnlichkeit mit der Autobahnmarkierung auf der Straßenkarte, welche der Mann auf dem Beifahrersitz in den Händen hielt. »Ich mein’s ernst. Ich habe die Faxen dicke.«
Die Kinder machten keinen Mucks. Nachdem die Frau sie noch einen Moment angefunkelt hatte, drehte sie sich wieder nach vorn und sah mich an. Sie trug eine ausladende Sonnenbrille mit verziertem Gestell und zwischen ihren Beinen klemmte ein großer Trinkbecher, aus dem ein lippenstiftverschmierter Strohhalm ragte. »Willkommen am Strand«, trällerte ich mit meiner liebenswertesten Colby-Ferienvermietungs-Stimme. »Darf ich …«
»Die Anfahrtsskizze auf Ihrer Website ist totaler Müll«, erklärte sie mir. Hinter ihr boxte eines der Kinder ein anderes, woraufhin dem Opfer ein erstickter Schrei entfuhr. »Wir haben uns dreimal verfahren, seit wir von der Autobahn runter sind.«
»Das tut mir schrecklich leid«, erwiderte ich. »Wenn Sie mir einfach Ihren Namen nennen wollen, dann händige ich Ihnen umgehend die Schlüssel aus und Sie können sofort zu Ihrem Mietobjekt.«
»Webster«, sagte sie.
Ich drehte mich um und griff in das kleine Körbchen, in dem die Umschläge für die heutigen Neuankömmlinge lagen. Miller, Tubman, Simone, Wallace … Webster.
»Das Reihernest«, las ich vom Umschlag ab, bevor ich ihn öffnete, um nachzusehen, ob auch beide Schlüssel darin lagen. »Das ist ein tolles Haus.«
Als Antwort streckte sie mir ihre Hand entgegen. Ich reichte ihr den Umschlag, zusammen mit dem kleinen Geschenkbeutel voller Gratisartikel – ein Colby-Ferienvermietungs-Kuli, eine Ansichtskarte, ein Umgebungsplan und ein billiger Getränkekühler – den die Putzcrew unter Garantie nach ihrer Abreise unangetastet wieder einsammeln würde. »Ich wünsche Ihnen eine angenehme Urlaubswoche«, sagte ich. »Genießen Sie den Strand!«
Sie schenkte mir ein schiefes Lächeln, wobei sich schwer sagen ließ, ob sie sich dankbar zeigen wollte oder mich schlichtweg nur bemitleidete. Immerhin stand ich hier auf einem Parkplatz inmitten eines überdimensionierten Sandkastens und in der Schlange hinter ihr warteten bereits drei weitere Autos, voll besetzt mit Urlaubern, die vermutlich alle so drauf waren wie sie. Wenn die Endstation einer Reise das Paradies ist, ist es weiß Gott kein Vergnügen, die vorletzte Haltestelle zu sein.
Aber mir blieb nicht groß Zeit, um darüber nachzudenken. Es war zehn nach drei und das nächste Auto, ein blauer Sedan mit Dachgepäckträger, stand schon vor mir. Ich schüttelte mir so viel Sand wie möglich aus den Schuhen und holte tief Luft.
»Willkommen am Strand«, sagte ich, als der Wagen neben mir anhielt. »Ihren Namen, bitte.«
»Und?«, fragte meine Schwester Margo, als ich zwei Stunden später ins Büro kam, nass geschwitzt und völlig fertig. »Wie ist es gelaufen?«
»Ich habe Sand in den Schuhen«, sagte ich, marschierte geradewegs zum Wasserspender, füllte einen Becher, leerte ihn in einem Zug und kippte den nächsten gleich hinterher.
»Du bist hier ja auch am Strand, Emaline«, stellte sie fest.
»Nein, ich bin hier im Büro.« Ich wischte mir mit dem Handrücken den Mund ab. »Der Strand ist drei Kilometer von hier entfernt. Die Leute bekommen doch noch früh genug Sand unter die Füße, ich kapiere einfach nicht, warum’s schon hier welchen geben muss.«
»Weil«, antwortete sie mit der Coolness derjenigen, die den ganzen Tag in einem klimatisierten Raum verbracht hatte, »wir der erste Eindruck sind, den unsere Gäste von Colby bekommen. Wir wollen ihnen das Gefühl geben, dass sie in dem Moment, wenn sie auf unseren Parkplatz fahren, offiziell in Urlaub sind.«
»Und warum muss ich dafür in einem Sandkasten stehen?«
»Das ist kein Sandkasten«, sagte sie und ich verdrehte die Augen, denn wir beide wussten nur allzu gut, dass es nichts anderes war. »Es ist eine Sandbank und soll eine Hommage an die kraftvolle Schönheit der Küste sein.«
Dazu fiel mir nun echt nichts mehr ein. Seit Margo vor einem Jahr an der East U einen Doppelabschluss in Tourismus und Betriebswirtschaft gemacht hatte, war sie unerträglich. Oder besser gesagt, noch unerträglicher. Meiner Familie gehörte Colby Ferienvermietung & Immobilien nun schon seit über fünfzig Jahren. Unsere Großeltern hatten die Firma gleich nach ihrer Heirat gegründet. Und bislang waren wir auch wunderbar ohne Margo und ihren Sandkasten oder ihre Sandbank oder weiß der Henker was klargekommen, besten Dank auch. Aber sie war die Erste in unserer Familie, die es zu einem Collegeabschluss gebracht hatte, und darum konnte sie tun und lassen, was sie wollte.
Was auch der Grund war, warum sie vor ein paar Wochen diesen Sandkasten samt Tiki-Hütte, oder was immer das sein sollte, auf dem Parkplatz vor unserem Büro hatte aufstellen lassen.
Ungefähr anderthalb Quadratmeter groß und von einem hüfthohen Mäuerchen umgeben, war das Ding eine Art hölzernes Zahlhäuschen, das obendrein noch inmitten einer Wagenladung Spielsand stand. Niemand außer mir stellte die Notwendigkeit des Ganzen infrage. Allerdings musste auch niemand außer mir darin arbeiten.
Ich vernahm ein leises Kichern und schaute auf. Natürlich, meine Großmutter, die hinter ihrem eigenen Schreibtisch saß und telefonierte. Sie zwinkerte mir zu und ich lächelte automatisch zurück.
»Und denk an die VIP-Runde«, rief Margo mir nach, als ich zu meiner Großmutter hinüberstiefelte und im Gehen den Becher im Mülleimer versenkte.
»Du musst pünktlich um halb drei anfangen. Und guck dir noch mal genau die Präsentplatten an, bevor du sie auslieferst. Amber hat sie hergerichtet und du weißt ja, wie sie ist.«
Amber war meine zweite Schwester. Sie steckte mitten in der Ausbildung zur Haarstylistin, arbeitete nur gezwungenermaßen in unserem Familienbetrieb und verlieh ihrem Frust darüber Ausdruck, indem sie alle ihre Aufgaben so schlampig wie möglich erledigte.
»Okey-dokey!«, entgegnete ich und Margo stieß ein frustriertes Schnauben aus. Sie hatte mir schon zigmal erklärt, dass sie den Ausdruck so was von peinlich fände. Was genau der Grund war, warum ich ihn immer wieder benutzte.
Das Büro meiner Großmutter lag auf der Vorderseite des Gebäudes, mit einem großen Fenster, das zur Hauptstraße hinausging, durch die sich jetzt dichter Urlaubsverkehr wälzte. Sie hing noch immer am Telefon, winkte mich aber herein, als sie mich an der Türschwelle stehen sah.
»Ja, Roger, ich fühle mit dir, ehrlich«, sagte sie, nachdem ich einen Stapel Broschüren zur Seite geräumt und mich auf den Stuhl gesetzt hatte, der ihrem Schreibtisch gegenüber stand. Wie üblich herrschte dort heilloses Chaos: Papierberge, Aktenordner und gleich mehrere angebrochene Rollen Toffeebonbons. Ständig verlegte sie die, die sie gerade erst aufgemacht hatte, nur um das Gleiche dann mit der nächsten zu tun und mit der neuen danach auch. »Aber letztlich ist es eben so, dass Türklinken in Ferienhäusern viel benutzt werden. Vor allem die Klinken an den Türen nach hinten zum Strand raus. Wir können sie reparieren, so oft es geht, aber manchmal muss man sie einfach durch neue ersetzen.«
Roger erwiderte irgendwas, seine Stimme dröhnte durch den Hörer. Meine Großmutter steckte sich ein Toffeebonbon in den Mund, dann hielt sie mir die Rolle hin. Ich schüttelte den Kopf.
»Mir wurde berichtet, dass die Klinke abgefallen ist, und zwar innen, nachdem die Tür abgeschlossen wurde. Die Gäste konnten also nicht wieder hinein. Und da haben sie uns angerufen.« Eine Pause. Dann sagte sie: »Na ja, sicherlich hätten sie durchs Fenster klettern können. Aber wenn man fünf Riesen pro Woche hinblättert, kann man einen gewissen Service schon erwarten.«
Während Roger antwortete, kaute sie auf ihrem Toffee. Die klebrigen Bonbons waren keine sehr erfreuliche Angewohnheit, aber sie waren besser als die vielen Zigaretten, die sie bis vor sechs Jahren noch gequalmt hatte. Meine Mutter behauptete immer, dass früher eine permanente Dunstglocke über dem Büro gehangen hatte, als wäre dort eine ganz eigene Klimazone. Kurioserweise konnte man selbst nach zahllosen Putzaktionen, neuen Vorhängen und einem Teppichwechsel noch immer den Qualm riechen. Zwar nur schwach, aber trotzdem.
»Natürlich. Irgendwas ist immer, wenn man Vermieter ist«, sagte sie jetzt, lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und massierte sich den Nacken. »Wir kümmern uns drum und schicken die Rechnung. Einverstanden?« Roger hob an, noch etwas zu sagen. »Bestens! Und vielen Dank für den Anruf!«
Sie legte auf und schüttelte den Kopf. Hinter ihr rollte gerade ein neuer Minivan auf unseren Parkplatz. »Manche Leute«, sagte sie und schnipste noch ein Toffeebonbon aus der Rolle, »sollten sich einfach keine Strandhäuser zulegen.«
Das war einer ihrer Lieblingssprüche, dicht gefolgt von: »Manche Leute sollten einfach keine Strandhäuser mieten.« Ich hatte ihr schon ein paarmal vorgeschlagen, dass wir uns den Spruch einsticken und rahmen lassen sollten, wobei wir ihn hier im Büro nirgends hinhängen konnten.
»Mal wieder eine kaputte Klinke?«, fragte ich.
»Schon die dritte in dieser Woche. Du weißt ja, wie das ist. Die Saison hat begonnen und das bedeutet Verschleiß.« Sie wühlte nach irgendwas auf ihrem Schreibtisch herum und stieß dabei einen Stapel Papiere zu Boden. »Wie ist es beim Einchecken gelaufen?«
»Gut«, sagte ich. »Nur zwei Zufrühkommer, aber beide Häuser waren schon fertig geputzt.«
»Und du machst heute noch die Wipps?«
Mein Gesicht verzog sich zu einem Lächeln. Das VIP-Paket war noch so einer von Margos glorreichen Einfällen. Gegen einen geringen Aufpreis bekamen die Gäste, die einen der sogenannten Strandpaläste mieteten – die exklusivsten Häuser in unserem Angebot, mit Aufzug, Pool und allem Drum und Dran – als Willkommensgruß eine Präsentplatte mit Obst und Käse, zusammen mit einer Flasche Wein. Das hatte uns Margo zunächst beim Freitagmorgen-Meeting unterbreitet, was ebenfalls so eine Margo-Neuerung war, dank der wir notgedrungen einmal pro Woche am Konferenztisch zusammensitzen und all die Dinge durchkauen mussten, die wir normalerweise spontan nebenher klärten. An jenem Tag hatte sie eine gedruckte Tagesordnung mit Unterpunkten verteilt, von denen einer »VIP-Behandlung« lautete. Meine Großmutter starrte ohne Brille mit zusammengekniffenen Augen auf das Blatt und fragte: »Was ist ein Wipp?« Zu Margos großem Verdruss hatte sich das uns nachhaltig eingeprägt und die Wipps blieben hartnäckig bei uns allen hängen.
»Ich will gerade los«, sagte ich zu ihr. »Gibt’s irgendwas Besonderes zu beachten?«
Endlich fand sie das Blatt Papier, das sie gesucht hatte, und überflog es schnell. »Den Dünentraum hat ein Stammkunde gebucht«, sagte sie. »Im Bon Voyage sind neue Gäste, genau wie im Casa Blu. Und wer auch immer die Schatztruhe gemietet hat, wohnt dort für zwei Monate.«
»Monate?«, sagte ich. »Im Ernst jetzt?«
Die Schatztruhe war eines unserer teuersten Objekte, ein großes Haus, das ein Stück außerhalb der Stadt an der Spitze der Landzunge lag. Schon die Miete für eine Woche würde das Budget der meisten Leute sprengen. »Jepp, also sorge dafür, dass sie eine hübsche Präsentplatte bekommen. Alles klar?«
Ich nickte und stand auf. Ich hatte gerade die Tür erreicht, als sie sagte: »Und Emaline?«
»Ja?«
»Richtig goldig hast du vorhin in dem Sandkasten ausgesehen. Hat mich gleich an früher erinnert.«
Ich lächelte, als Margo draußen lostrompetete: »Das ist eine Sandbank, Großmutter!«
Ich holte die Präsentplatten aus der Kammer am Ende des Flurs, wo Amber sie vorhin abgestellt hatte. Natürlich lagen das Obst und der Käse wild durcheinander, so als hätte meine Schwester sie aus drei Metern Entfernung auf den Teller gepfeffert. Nachdem ich gut fünfzehn Minuten damit verbracht hatte, die Platten ansehnlich herzurichten, trug ich sie hinaus zu meinem Wagen, in dem etwa tausend Grad Hitze herrschten, obwohl ich im Schatten geparkt hatte. Ich stellte sie auf den Beifahrersitz, richtete den Luftstrom der Klimaanlage darauf und hoffte das Beste.
Beim ersten Haus, Dünentraum, machte niemand auf, auch nicht, nachdem ich geklingelt und die Mieter über die Pager-Taste der Türsprechanlage angepiepst hatte. Ich betrat die weitläufige Sonnenterrasse und spähte runter in den Garten. Eine Handvoll Leute saßen um den Pool herum und zwei Personen liefen den langen Holzsteg zum Strand hinunter. Ich probierte die Tür – unverschlossen – und trat ein.
»Hallo?«, rief ich mit heller Stimme. »Colby Ferienvermietung? VIP-Lieferung?« Wer einfach so die Häuser von wildfremden Leuten betreten musste – selbst wenn sie erst vor Kurzem und nur für eine Woche eingezogen waren – der lernte, auf sich aufmerksam zu machen. Eine einzige Begegnung mit einem nichts ahnenden Halbnackten genügte, damit man diese Lektion sein Lebtag nicht vergaß. Keine Frage, die Leute sollten in ihrem wohlverdienten Urlaub die Seele und alles andere baumeln lassen. Aber das hieß noch lange nicht, dass ich es sehen wollte. »Colby Ferienvermietung? VIP-Lieferung?«
Stille. Schnell flitzte ich hoch in die Küche im dritten Stock, wo die Aussicht einfach fantastisch war. Ich stellte die Präsentplatte samt eisgekühlter Weinflasche auf der Kücheninsel aus gesprenkeltem Granit ab und legte eine handgeschriebene Grußkarte daneben mit dem Hinweis, uns bitte anzurufen, falls sie noch irgendwas benötigten. Dann machte ich mich wieder aus dem Staub.
Beim Bon Voyage war die Haustür verschlossen. Vermutlich waren die Vermieter unterwegs, um irgendwo auswärts zu Abend zu essen. Ich brachte die Präsentplatte und den Wein in die Küche, wo der Standmixer noch an der Steckdose hing und im Spülbecken eine Glaskaraffe stand, die einen tropischen Geruch verbreitete. Es fühlte sich immer merkwürdig an, die Häuser zu betreten, nachdem die Gäste eingezogen waren, vor allem, wenn ich dort am selben Morgen noch überprüft hatte, ob auch gut sauber gemacht worden war. Es herrschte dann eine ganz andere Energie, vergleichbar mit dem Unterschied, ob etwas angeschaltet war oder aus.
Beim Casa Blu wurde die Tür von einer kleinen, tief gebräunten Frau geöffnet, die einen Bikini trug, der – offen gestanden – nicht gerade altersgemäß war. Was nicht heißen soll, dass ich wusste, wie alt sie war, sondern vielmehr, dass selbst ich mit meinen achtzehn Jahren die Finger von diesem knappen pinkfarbenen Fähnchen gelassen hätte. Auf ihrem Gesicht lag ein weiß schimmernder Sonnenmilchfilm und in ihrer freien Hand hielt sie einen knallgelben Bierkühler.
»Colby Ferienvermietung, VIP-Lieferung«, sagte ich. »Ich habe ein Willkommenspräsent für Sie.«
Sie nahm einen Schluck von ihrem Bier. »Fabelhaft«, sagte sie mit leicht näselnder Stimme. »Komm rein.«
Ich folgte ihr nach oben in die nächste Etage und versuchte dabei, nicht auf ihre Bikinihose zu schauen, die mit jeder Stufe tiefer und tiefer in der Versenkung verschwand.
»Ist das der Stripper?«, fragte jemand, als ich den Treppenabsatz erreichte. Es war noch eine weitere Frau, ebenfalls so Mitte vierzig, die ein Bikinioberteil, einen fließenden Rock und eine dicke geflochtene Goldkette trug. Bei meinen Anblick lachte sie los: »Sieht nicht danach aus!«
»Jemand vom Vermietungsbüro«, sagte Pink Bikini zu ihr und der Dritten im Bunde, einer Frau mit zerzaustem Haarknödel, die in einen kurzen Bademantel gewickelt auf der Terrasse stand und mit einem Weinglas in der Hand in den Garten starrte. »Ein Willkommenspräsent.«
»Oh«, sagte die Bademantelfrau, »und ich dachte, das da wäre unser Präsent.«
Die Frau, die mich hereingelassen hatte, trat ans Geländer und warf ebenfalls einen Blick nach unten; alle drei brachen in lautes Gelächter aus. Ich stellte Präsentplatte und Flasche ab, legte die Grußkarte daneben und wollte mich gerade diskret verdrücken, als ich eine von ihnen sagen hörte: »Würdest du davon nicht gern mal ausgiebig kosten, Elinor?«
»Mmmm«, erwiderte sie. »Ich schlage vor, wir werfen ordentlich Dreck in den Pool, damit er morgen noch mal wiederkommen muss.«
»Und übermorgen auch!«, sagte der Wallewalle-Rock. Darauf prusteten sie aufs Neue los und stießen klirrend miteinander an.
»Genießen Sie Ihren Urlaub!«, rief ich im Hinausgehen, aber natürlich hörten sie mich nicht. Auf dem Weg nach unten zur Haustür blieb ich auf halber Treppe stehen und blickte durch eines der großen Fenster nach draußen, wo ich den Grund für ihre Gafferei entdeckte: ein großer, sonnengebräunter Kerl mit blonden Locken und freiem Oberkörper, der mit einem langen, furchtbar phallisch anmutenden Poolschrubber zugange war. Ich konnte die drei noch immer johlen hören, als ich die Tür sachte hinter mir ins Schloss zog.
Zurück im Auto fasste ich mein Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen, wickelte einen der am Schalthebel hängenden Haargummis darum und blieb einen Moment in der Auffahrt stehen, um das Auf und Ab der Wellen zu beobachten. Ich hatte ein letztes Haus auf meiner Liste und jede Menge Zeit, und so stand ich noch da, als der Pooljunge durchs Gartentor trat und auf seinen Truck zuhielt, der direkt neben meinem Wagen stand.
»Hey«, rief ich ihm zu, als er hinten auf die Ladefläche kletterte und ein paar Schläuche zusammenrollte. »Du könntest diese Woche ordentlich Kohle machen, wenn du’s mit der Moral nicht so eng siehst und auf ältere Frauen stehst.«
Er grinste und entblößte eine Reihe strahlend weißer Zähne. »Meinst du?«
»Die würden dich mit Haut und Haaren verschlingen, wenn sie die Chance dazu hätten.«
Mit einem Lächeln auf den Lippen sprang er von der Ladefläche herunter, schloss die Heckklappe und kam zu mir ans offene Wagenfenster. Die Arme in die Fensteröffnung gelegt beugte er sich vor, bis wir auf gleicher Augenhöhe waren. »Nicht mein Typ«, sagte er. »Außerdem bin ich schon vergeben.«
»Die Glückliche«, sagte ich.
»Das solltest du ihr mal klarmachen. Ich glaube, sie nimmt mich als gegeben hin.«
Ich zog eine Grimasse. »Und ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit.«
Er lehnte sich in den Wagen und gab mir einen Kuss. Ich konnte den Schweiß auf seiner Oberlippe schmecken. Als er den Kopf zurückzog, sagte ich: »Verarschen kann ich mich übrigens selber. Es ist durchaus möglich, beim Arbeiten ein Shirt anzuziehen.«
»Es ist total heiß!«, sagte er, aber ich verdrehte nur die Augen und ließ den Motor an. Seitdem er mit Joggen angefangen und ordentlich Muskeln bekommen hatte, zog dieser Junge wo er ging und stand sein Oberteil aus. Es war nicht das erste Haus, wo das bemerkt worden war. »Und mit heute Abend geht klar?«
»Wieso heute Abend?«
»Emaline.« Er schüttelte den Kopf. »Jetzt tu doch nicht so, als hättest du’s vergessen.«
Ich dachte angestrengt nach. Dann summte er die ersten Takte des Hochzeitsmarsches und ich stieß einen Seufzer aus. »Ach ja, richtig. Der Grillabend.«
»Du meinst die Brautfeier-Schrägstrich-Grillparty«, korrigierte er mich. »Besser bekannt auch als der bereits zwei Monate andauernde Vollzeitwahn meiner Mutter.«
Ups. Zu meiner Verteidigung sei gesagt, dass das bereits die dritte von vier Brautfeiern war, die im Vorfeld der Hochzeit von Lukes Schwester Brooke stattfand. Seit sie sich letzten Herbst verlobt hatte, drehte sich in Lukes Familie alles nur noch ums Heiraten. Ich verbrachte viel Zeit bei ihnen und so langsam war mir, als hätte man mich in einen Intensivkurs zum Erlernen einer Sprache gesteckt, die mich nicht die Bohne interessierte. Und weil Luke und ich seit der neunten Klasse ein Paar waren, witzelten obendrein noch alle herum, dass wir als Nächstes dran wären und seine Eltern zusehen sollten, gleich einen Mengenrabatt rauszuschlagen. Ha, ha.
»Sieben Uhr«, sagte Luke jetzt und küsste mich auf die Stirn. »Wir sehen uns. Ich bin der Typ mit dem Hemd.«
Lächelnd legte ich den Rückwärtsgang ein. Dann fuhr ich die lange Auffahrt entlang bis zur Hauptstraße und dann hoch bis ans Ende der Landzunge zur Schatztruhe.
Es war eins unserer neueren Häuser und vermutlich das schönste. Acht Schlafzimmer, zehneinhalb Bäder, Pool und Jacuzzi, Privatsteg zum Strand, Filmvorführraum im Keller mit echten Kinositzen und Surroundsystem. Das Haus war so neu, dass noch bis vor Kurzem ein Mobilklo davorgestanden hatte und sich der Bauunternehmer mit den letzten Abnahmen halb überschlagen hatte müssen, um vor Saisonbeginn fertig zu werden. Während sie unter Hochdruck die Mängelliste abarbeiteten, um alles schlüsselfertig zu machen, waren Margo und ich damit beschäftigt gewesen, das Geschirr und den ganzen Kram einzuräumen, den der Dekorateur im Park Mart gekauft hatte. Tütenweise stand der Krempel in der Garage. Schon ganz schön abgefahren, ein komplettes Haus auf einen Schlag einzurichten. Nichts von all den Sachen besaß eine Geschichte. Alle Ferienhäuser fühlten sich unpersönlich an, aber bei diesem hier empfand ich es besonders stark. Es war mir fast schon ein bisschen unheimlich. Ich mochte es, wenn Dinge eine Vergangenheit hatten.
Als ich die Auffahrt hinaufrollte, bemerkte ich einen Geländewagen und einen weißen Van mit getönten Scheiben, dessen Kofferraum offen stand. Darin stapelten sich Plastikkisten und Kartons, die offenbar gerade ausgeladen wurden.
Ich stieg aus dem Auto aus und holte die VIP-Präsente heraus. Als ich auf den Eingang zusteuerte, ging die Haustür auf und zwei Jungs in meinem Alter kamen heraus.
»Emaline«, rief mir der eine von ihnen zu. Es war Rick Mason, unser ehemaliger Klassensprecher. Hinter ihm kam Trent Dobash, Mitglied der Footballmannschaft, zum Vorschein. Wir drei waren nicht miteinander befreundet, aber unsere Schule war dermaßen klein und überschaubar, dass jeder jeden kannte, ob einem das nun passte oder nicht. »Was machst du denn hier?«
»Ihr habt das Haus gemietet?« Ich war geschockt.
»Schön wär’s«, schnaubte er. »Wir wollten gerade zum Surfen nach unten an den Strand, da haben sie uns pro Nase einen Hunderter geboten, um das Zeug hier auszuladen.«
»Ach so«, sagte ich, als sie an mir vorbei zur offen stehenden Wagentür gingen. »Was ist denn drin in den Kartons?«
»Keine Ahnung«, erwiderte er, hob eine der Kisten aus dem Auto und reichte sie an Trent weiter. »Vielleicht Drogen oder Waffen. Mir egal, solange ich meine Kohle kriege.«
Genau aufgrund dieser Einstellung war Rick so ein lausiger Klassensprecher gewesen. Andererseits hatte es nur eine einzige Gegenkandidatin gegeben: ein Mädchen, das erst kurz vorher aus Kalifornien zugezogen und bei allen unbeliebt war. Keine große Alternative also.
Durch die geöffnete Eingangstür sah ich noch einen Typen, der in dem riesigen Wohnzimmer herumwuselte. Er war nicht von hier, wie ich mit einem Blick feststellen konnte. Zum einen trug er Oyster-Jeans – in dunkler Waschung mit dem typischen O auf den hinteren Taschen. Ich hatte nicht mal gewusst, dass es die auch für Männer gab. Zum anderen trug er eine Strickmütze, obwohl wir Anfang Juni hatten. Luke und seine Kumpel zogen quasi nur unter Gewaltandrohung etwas anderes an als Shorts, egal, welche Temperaturen herrschten: Strandjungs fassten keine Winterklamotten an, nicht mal im Winter.
Ich klopfte an, aber er hörte mich nicht. Anscheinend zu beschäftigt mit Kistenöffnen. Ich versuchte es noch mal und fügte diesmal hinzu: »Colby Ferienvermietung? VIP-Lieferung?«
Er drehte sich zu mir um und erfasste mit einem Blick den Wein und den Käse. »Sehr schön«, sagte er nüchtern. »Stell’s einfach irgendwohin.«
Ich ging hinüber in die Küche, in der ich keine zwei Wochen zuvor noch Preisschilder von Sieben und Pfannenwendern gepult hatte, und arrangierte die Platte, den Wein und die Karte. Gerade wollte ich wieder gehen, als ich aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrnahm. Und dann ging das Geschrei los.
»Mir egal, wie spät es ist. Ich brauche die Lieferung heute! Das war so abgesprochen und ich erwarte, dass Sie sich auch dran halten, alles andere ist inakzeptabel!« Zuerst sah ich nur einen verschwommenen Fleck; eine Sekunde später bewegte er sich langsam genug, dass ich eine Frau in schwarzen Jeans, einem kurzärmeligen schwarzen Pulli und Ballerinas ausmachen konnte. Ihr Haar war so blond, dass es beinah weiß aussah, und zwischen Schulter und Ohr klemmte ein Telefon. »Ich habe vier Tische bestellt und vier Tische will ich haben. Innerhalb der nächsten Stunden stehen die hier, und zwar gefälligst mit deutlich geminderter Rechnungssumme, bei dieser Verzögerung. Ich bezahle definitiv zu viel Geld, als dass ich mich mit so einem Scheiß zufriedengeben müsste.«
Der Typ in der Oyster-Jeans, der auf der anderen Seite des Raums noch immer mit irgendwelchen Kisten zugange war, schien völlig ungerührt von dem Ganzen. Ich aber starrte sie völlig gebannt an, so wie man Verrückte anstarrt. Man kann einfach nicht wegsehen, obwohl es total unhöflich ist.
»Nein, damit bin nicht einverstanden. Nein. Nein. Heute, oder Sie können die Sache vergessen.« Jetzt, da sie still stand, fiel mir ihr kräftiger Kiefer auf, die hervorstehenden Wangenknochen und das spitze Schlüsselbein. Sie wirkte geradezu stachlig, wie eine von diesen fleischfressenden Wüstenpflanzen. »Schön. Dann erwarte ich bis morgen früh die Erstattung meiner Anzahlung oder Sie bekommen Post von meinen Anwälten. Auf Wiederhören.«
Zum Auflegen stach sie mit dem Finger auf das Telefon ein. Dann schleuderte sie es quer durchs Zimmer, wo es gegen die frisch gestrichene Wand krachte und einen fetten schwarzen Fleck hinterließ. Ach du Scheiße.
»Idioten!«, verkündete sie und ihre Stimme klang selbst in diesem riesigen Raum noch laut. »Prestige Party-Service – ich lach mich tot. Ich wusste in dem Moment, als wir die Mason-Dixon-Linie überquert haben, dass wir praktisch in der Dritten Welt landen.«
Der Typ sah sie an, dann mich, woraufhin natürlich auch sie schließlich von mir Notiz nahm. »Wer ist das jetzt?«, blaffte sie.
»Von den Vermietern«, sagte er. »VIP-irgendwas oder so.«
Sie machte ein verdutztes Gesicht und ich zeigte auf den Wein und die Präsentplatte. »Ein Willkommensgeschenk«, sagte ich. »Von Colby Ferienvermietung & Immobilien.«
»Tische wären mir lieber gewesen«, brummte sie, ging zu der Obst-und-Käse-Platte hin und zupfte die Folie ab. Sie starrte kurz darauf, dann steckte sie sich eine Weintraube in den Mund und schüttelte den Kopf. »Ehrlich, Theo, ich frage mich jetzt schon, ob das Ganze nicht eine Schnapsidee war. Was habe ich mir nur dabei gedacht?«
»Dann leihen wir uns halt anderswo ein paar Tische«, sagte er mit einer Stimme, der anzuhören war, dass er solche Ausbrüche von ihr gewohnt war.
Er hatte bereits ihr Telefon aufgehoben und untersuchte es auf irgendwelche Schäden. Die Wand ignorierte er, genau wie mich.
»Wo denn? Wir hocken hier mitten in der Pampa. Vermutlich ist der nächste Möbelverleih hundert Kilometer weit weg. Gott, ich brauch jetzt dringend einen Drink.« Sie nahm die Flasche Wein, die ich mitgebracht hatte, und musterte sie mit zusammengekniffenen Augen. »Australischer Fusel. Was auch sonst.«
Ich sah zu, wie sie auf der Suche nach einem Korkenzieher eine Schublade nach der anderen aufzog. Ich stand einfach da und rührte keinen Finger, nur so aus Trotz. Schließlich ging ich zu der kleinen Bar neben der Speisekammer, um ihn zu holen.
»Hier.« Ich reichte ihr den Korkenzieher und griff mir den kleinen Notizblock mit Kuli, den wir immer zusammen mit der Willkommenskarte daließen. »Prestige Party ist dafür bekannt, Bestellungen zu vermasseln. Sie sollten mal Everything Island anrufen. Die haben bis 20 Uhr auf.«
Ich schrieb die Nummer auf und schob ihr den Zettel rüber. Sie warf einen Blick auf den Zettel, dann auf mich. Der Zettel blieb liegen.
Ich ging auf die Treppe zu. Kein Wort des Abschieds war zu hören. Aber das kannte ich schon. Was die neuen Bewohner betraf, war das jetzt ihr Haus und ich quasi Teil der Umgebung, so wie das Meer. Aber als ich am kleinen Weidenkorb neben der Tür noch ein Preisschild entdeckte, blieb ich kurz stehen und zupfte es trotzdem ab.
2
Meine Zimmertür stand offen. Schon wieder.
»Und dann habe ich zu ihr gemeint …«, hörte ich meine Schwester Amber von drinnen sagen und spürte schon wieder, wie mein Blutdruck stieg, »… ganz klar, du willst gern aussehen wie ein Model. Und ich will gern im Lotto gewinnen und den Job hier hinschmeißen. Wir sollten einfach beide unsere Erwartungen zurückschrauben, okay?«
»Ich hoffe doch stark, dass du das nicht ernsthaft gesagt hast«, murmelte meine Mutter. Ich war mir sicher, das Umblättern von Seiten zu hören. Wenn sie gerade dabei war, die Ausgabe von Hollyworld zu lesen, in die ich noch nicht mal einen ersten Blick geworfen hatte, würde mir gleich der Kragen platzen.
»Aber mir lag’s auf der Zunge. Stattdessen habe ich ihr den Pony so geschnitten, wie sie’s unbedingt wollte, obwohl sie damit aussah wie eine Fünfunddreißigjährige.«
»Pass auf, was du sagst!«
»Du weißt schon, was ich meine.«
»Ach ja?«
Ich stieß die halb offene Tür weit auf. Schon klar, sie lümmelten auf meinem Bett. Und meine Mutter schmökerte tatsächlich in der Hollyworld, während Amber, deren Haare mal wieder eine neue Farbe hatten – diesmal Karottenrot – gerade an einem XXL-Pappbecher Diätcola nippte. Zwischen ihnen stand eine offene Dose mit Nüssen. »Raus mit euch«, sagte ich bedrohlich leise. »Sofort.«
»Oh, Emaline …«, hob Amber an.
Meine Mom hatte bereits die Zeitschrift zurück in die Schublade gelegt und tastete meine frisch gewaschene Tagesdecke nach dem Nussdosendeckel ab. Als sie ihn nicht finden konnte, gab sie auf und stand mit schuldbewusster Miene auf.
»Du weißt doch, wie’s oben gerade aussieht.«
»Damit hab ich aber nichts zu tun.« Ich marschierte zum Fernseher und schaltete die x-te Wiederholung irgendeiner Model-Realityshow aus. »Das ist mein Zimmer. Mein Zimmer. Ich habe euch nicht erlaubt, hier einfach so einzufallen und alles vollzumüllen.«
»Wir haben nichts vollgemüllt«, sagte meine Mutter. »Wir haben hier nur gesessen und uns unterhalten.«
Ich ging nicht darauf ein, sondern trat an mein Bett, auf dem immer noch, weiß der Teufel warum, meine Schwester herumgammelte. Mit einer Hand fuhr ich unter das Kopfkissen und fand den Deckel der Nussdose. Zum Beweis hielt ich ihn hoch.
Meine Mom seufzte. »Ich hatte Hunger.«
»Dann iss in der Küche.«
»Wir haben keine Küche!«, protestierte Amber. Endlich setzte sie sich in Bewegung, auch wenn sie sich wie immer schön viel Zeit dabei ließ. »Bist du dieser Tage eigentlich mal da oben gewesen, Miss Privatgelände? Das gleicht einem Kriegsgebiet.«
»Das ist kein Privatgelände«, erwiderte ich. »Das ist die Garage.«
»Wie auch immer! Daddy hat alles rausgerissen. Es gibt keine Sitzgelegenheiten, keinen Fernseher …«
Wie um ihr Argument zu unterstreichen, war von oben das Knallen eines Kompressors zu hören, das uns alle zusammenzucken ließ.
Dad machte diesen Zimmermann-Handwerker-Kram schon so lange, dass ihm laute Geräusche nichts mehr anhaben konnten. Wir anderen aber reagierten noch immer so schreckhaft wie Katzen, wenn er mit der Nagelpistole loslegte.
»Und was ist mit deinem Zimmer?«, fragte ich Amber, als meine Mutter neben mir stehen blieb, um das Wäscheschild an meinem Kragen nach innen zu schlagen, das offenbar den ganzen Tag lang herausgeguckt hatte.
»Viel zu chaotisch.« Amber schlappte in Zeitlupe auf die Tür zu und riss auf dem Weg dorthin versehentlich einen Stapel zusammengelegter Wäsche von der Kommode.
»Ach echt? Wie kommt’s?«, erwiderte ich, aber sie ging überhaupt nicht darauf ein.
Seufzend bückte ich mich, um die Wäsche aufzuheben. Eine Sekunde später kam mir meine Mutter zu Hilfe, noch immer ohne ein Wort zu sagen. Amber stieß einen melodramatischen Seufzer aus und schlurfte mitsamt ihrer verkehrskegelroten Frisur aus dem Zimmer. Obwohl älter als ich, war vor langer Zeit mal sie die Jüngste gewesen. Und jetzt, viele Jahre später, benahm sie sich noch immer wie ein Baby, wobei wir es alle darauf schoben, dass sie nun mal das Sandwichkind war.
»Du hast schlechte Laune«, sagte meine Mutter schließlich. Typisch Mom: Während meine Schwestern und ich einen Hang zum Laut- und Heftigsein hatten, blieb sie immer zurückhaltend und ruhig. Als hätte sie all ihre Wucht schon bei der Aufgabe verbraucht, uns großzuziehen.
»Ich bin heute einfach schon ein paarmal zu oft angeschnauzt worden«, sagte ich und stand auf. »Und du weißt, wie sehr ich es hasse, wenn ihr hier einfach so einfallt.«
»Tut mir leid.« Sie hielt mir die Nüsse hin, ein Friedensangebot. Ich schüttelte den Kopf, pickte mir dann aber doch eine Mandel heraus.
»Du Mäkelliese«, sagte sie und nahm sich eine ganze Handvoll. Sich immer nur das Beste herauspicken zu wollen war eine Sache, die sie richtig auf die Palme bringen konnte. »Findet heute Abend nicht diese Verlobungsfeier statt?«
Oben war wieder das Knallen der Nagelpistole zu hören – einmal, zweimal. »Von Brooke und Andy, ja.«
»Maureen ist doch bestimmt total aus dem Häuschen.«
»Kann man wohl sagen. Diese Hochzeitsplanerei ist wie eine Droge und sie braucht ständig den nächsten Schuss.«
»Emaline«, sagte sie, allerdings mit einem Lächeln. Sie und Lukes Mutter waren beide in Colby aufgewachsen, Mom war jedoch sieben Jahre jünger. Trotzdem wusste jeder aus der Gegend, dass Mrs Templeton Cheerleaderin und mit dem Kapitän des Footballteams liiert gewesen war, während meine Mom im Sommer nach der elften Klasse von einem Touristenjungen schwanger wurde. In einer Kleinstadt vergaß man nichts.
»Ehrlich!«, sagte ich. »Du müsstest mal hören, wie sie schon alle von Luke und mir reden. So als würden sie erwarten, dass wir unsere Verlobung auf der Hochzeit bekannt geben oder so.«
Ihre Augen wurden groß und die Hand mit den Nüssen verharrte auf halben Weg zum Mund. »Darüber macht man keine Witze«, sagte sie ungewohnt streng.
»Lunger du nicht in meinem Zimmer herum«, gab ich zurück.
»Das ist nicht mal ansatzweise so schlimm.« Sie starrte mich noch immer grimmig an. »Nimm das zurück.«
»Mom, im Ernst? ›Nimm-das-zurück‹ in deinem Alter? Echt jetzt?«
»Los!«
Sie machte keine Scherze. Aber so ist das mit Leuten, die nie sauer werden: Wenn’s dann doch mal passiert, merkt man’s sofort. Ich räusperte mich. »Tut mir leid. Ich habe bloß einen blöden Witz gemacht. Natürlich werden Luke und ich uns diesen Sommer nicht verloben.«
»Danke.« Sie kaute eine Nuss.
»Damit warten wir definitiv bis nach dem ersten Semester«, fuhr ich fort. »Ich bin der Meinung, ich sollte mich erst im College eingelebt haben, bevor ich mich in die Hochzeitsplanung stürze.«
Sie schaute mich einfach nur an und kaute. Okay, nicht lustig.
»Ach, komm schon, Mom«, sagte ich, aber sie beachtete mich gar nicht und war schon auf dem Flur, als aus dem oberen Stock ein neuerlicher Knall zu hören war. »Tut mir leid. Ich habe einfach …«
Sie hielt weiter auf das Geräusch der Nagelpistole zu.
»… nur rumgeblödelt. Okay?«
Sie drehte sich zu mir um. Aus dieser Entfernung hätte man nie im Leben gedacht, dass sie sechsunddreißig war. Mit ihrem langen braunen Haar, das genauso aussah wie meines, und ihrem sportlichen Körper wirkte sie eher wie Ende zwanzig, wenn überhaupt. Sie wurde oft für Ambers und Margos Schwester gehalten und nicht für ihre Stiefmutter, was früher, als wir noch klein waren, im Supermarkt oder in der Warteschlange bei der Bank immer zu schiefen Blicken geführt hatte, wenn in den Köpfen der Leute das große Rechnen anfing. Nie mit dem richtigen Ergebnis.
»Weißt du«, sagte sie. »Mich macht das nur deshalb so sauer, weil ich mir für dich all das wünsche, was ich nicht hatte.«
»Den Mond und mehr«, sagte ich und sie nickte.
Das war so ein gemeinsames Ding von uns aus der Zeit, bevor mein Dad, Amber und Margo auf der Bildfläche erschienen waren, aus der Zeit, an die ich keine richtige Erinnerung mehr hatte. Aber sie hatte mir oft von einem Buch erzählt, aus dem sie mir jeden Abend vorgelesen hatte, als ich noch ganz klein gewesen war. Es handelte von einer Bärenmutter und ihrem Kind, das nicht schlafen gehen wollte.
»Und wenn ich nun Hunger bekomme?«, fragt es.
»Dann bringe ich dir etwas zu essen«, sagt sie zu ihm.
»Und wenn ich nun Durst habe?«
»Dann hole ich dir Wasser.«
»Und wenn ich nun Angst kriege?«
»Dann verjage ich die Monster.«
Schließlich fragt es: »Und wenn das nicht genug ist? Wenn ich nun etwas anderes brauche?«
Und sie antwortet: »Egal, was du brauchst, ich finde einen Weg. Ich werde den Mond für dich vom Himmel holen, und noch mehr.«
Genau so, sagte sie immer, hatte es sich für sie als alleinerziehende Teeniemutter angefühlt. Sie selbst hatte nichts, aber für mich wollte sie alles. Bis zum heutigen Tag.
Ihr Zeigefinger stocherte in meine Richtung. »Und du benimmst dich bitte auf dieser Party. Hier geht es um Brooke und Andy, nicht um dich oder deine Ansichten.«
»Weißt du«, sagte ich, als sie sich wieder umdrehte, »auch wenn du das meinst, ich glaube gar nicht, dass sich alles immer nur um mich dreht.«
Sie schnaubte nur und war verschwunden. Die Nagelpistole knallte weiter, doch kurz darauf verstummte das Geräusch. In der nachfolgenden Stille hörte ich Mom irgendwas sagen und meinen Dad darüber lachen. Typisch. Wir konnten Mom auf die Schippe nehmen, so viel wir wollten, sobald die beiden zusammen waren, gingen die Witze immer auf unsere Kosten.
»Das habe ich genau gehört«, rief ich, obwohl das nicht stimmte. Mehr Gelächter.
Zurück in meinem Zimmer verschaffte ich mir einen Überblick über den angerichteten Schaden, was nicht schwer war, weil ich an diesem Morgen wie immer alles picobello hinterlassen hatte: das Bett gemacht, die Schubladen geschlossen, Fußboden und Kommode frei. Jetzt aber sah ich Ambers Schlüssel und Sonnenbrille auf meinem Schreibtisch liegen. Die Flipflops meiner Mutter waren unter dem Nachttisch geparkt. Und neben meinem Papierkorb lag noch ein zusammengeknülltes Stück Papier auf dem Boden. Seufzend hob ich es auf. Gerade als ich es wegwerfen wollte, sah ich die Handschrift meiner Mutter und strich es glatt.
Der Zettel stammte von einem der Colby-Ferienvermietung-Gratis-Notizblöcke, die überall im Haus herumlagen. Darauf stand in ihrer gestochenen Handschrift: Dein Vater hat angerufen, 16.15 Uhr. Mehr nicht.
Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Es war 18.30 Uhr, was bedeutete, dass ich nicht mal mehr eine halbe Stunde Zeit hatte, bevor ich losmusste. Aber das hier war wichtiger. Ich schnappte mir den Zettel und ging nach oben.
Als Erstes sah ich meinen Dad inmitten des Trümmerfeldes, das derzeit unsere Küche war, wie er gerade einen Nagel in ein Stück Scheuerleiste neben der Speisekammer jagte. Die Küche selbst war leer, seit er mit der Aufarbeitung der Fußböden begonnen hatte. Mom thronte auf unserem neuen Geschirrspüler, der noch nicht installiert war und bis dahin als Möbelstück, Rettungsinsel und Sammelplatz für alles Mögliche herhalten musste, und schaute ihm zu.
Bamm!, machte die Nagelpistole und ließ mich zusammenzucken. Meine Mutter sah zu mir herüber, offenbar in der Annahme, ich wäre gekommen, um unsere Unterhaltung von eben fortzuführen. Als ich den Zettel hochhielt, veränderte sich ihr Gesichtsausdruck.
»Das wollte ich dir …« Bamm! »… noch sagen«, rief sie.
»Hast du aber nicht.«
Bamm! »Ich weiß. War keine Absicht. Ich hab dann nicht mehr dran gedacht, als du dich so aufgeregt hast wegen …«
Bamm! Bamm!
Ich hob die Hand, um ihren Redefluss zu stoppen. »Dad!«, schrie ich. Noch ein Knall. »DAD!!«
Endlich hörte er auf, drehte sich um und sah mich. »Oh, hallo, Emaline«, sagte er lächelnd. »Wie war dein Tag?«
»Kannst du mal eine Sekunde damit aufhören?«
»Mit Arbeiten?«, fragte er.
»Wenn’s dir nichts ausmacht?«
Er warf Mom einen Blick zu, die angespannt eine weitere Handvoll Nüsse einwarf.
»In Ordnung«, sagte er so gelassen wie immer und tauschte die Nagelpistole gegen eine Flasche Limo, die auf dem Geschirrspüler stand. Meine Mutter und ich sahen ihm schweigend zu, wie er den Verschluss aufdrehte und einen großen Schluck nahm. Er blickte zu mir, dann zu ihr, dann zurück zu mir. »Äh … Was krieg ich hier gerade nicht mit?«
»Nichts«, erwiderte Mom.
»Sie hat mir nicht gesagt, dass mein Vater angerufen hat«, platzte es gleichzeitig aus mir heraus.
Dad machte ein leicht entnervtes Gesicht. »Geht das wieder los?«, sagte er. »Im Ernst?«
»Ich hab’s vergessen«, erklärte sie. »Es war ein Versehen.«
Ich blickte zu ihm. Bestimmt spiegelte mein Gesicht unverhohlene Skepsis. Er stellte die Flasche hin. »Aber jetzt hast du die Nachricht ja gekriegt, oder?«
»Nur weil sie den Zettel zusammengeknüllt auf den Fußboden geschmissen hat.«
Er zuckte die Schultern, als wäre das ein und dasselbe. »Hauptsache ist doch, du weißt jetzt Bescheid.«
Ich atmete tief aus und schüttelte den Kopf. Wie Pech und Schwefel waren die beiden. Noch nie war ich seiner Ansicht nach bei irgendetwas so weit im Recht gewesen, dass er sich auf meine Seite geschlagen hätte. »Ich begreife nur nicht, warum du dich deswegen so komisch benimmst«, sagte ich zu Mom.
»Doch, das tust du«, schaltete sich Dad ein.
Wir schwiegen alle einen Moment. Das Einzige, was ich hörte, war der Fernseher in Ambers Zimmer, der, nebenbei bemerkt, eins a funktionierte. »Ich habe den Zettel geschrieben«, sagte Mom schließlich, »und ihn nach unten in dein Zimmer gebracht, um ihn dort für dich hinzulegen. Aber dann habe ich dich auch schon kommen hören und ihn einfach weggeworfen, weil ich dachte, dass ich’s dir selbst sagen kann. Doch das … habe ich nicht getan. Tut mir leid.«
Die Sache war die, dass das der Wahrheit entsprach, das wusste ich. Ihr tat das Ganze leid. Im wahren Leben war sie eine patente, verantwortungsvolle Mutter, Ehefrau und Tochter. Doch sobald mein Vater ins Spiel kam, schien es, als wäre sie mit einem Schlag wieder achtzehn Jahre alt, und genauso führte sie sich dann auch auf.
Ich schaute auf den Zettel. »Hat er gesagt, was er will?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nur dass du ihn bei nächster Gelegenheit anrufen sollst.«
»Okay.« Ich sah auf die Uhr: 18:40 Uhr. Scheiße. »Ich muss los. Ich bin schon spät dran.«
»Viel Spaß!«, rief sie mir hinterher, als ich die Küche verließ. Es war ein Friedensangebot, das einen Tick zu spät kam, aber ich nickte trotzdem und winkte kurz, um ihr zu zeigen, dass zwischen uns alles in Ordnung war. Meine Eltern blieben schweigend zurück, als ich die Treppe hinunterging. In meinem Zimmer konnte ich über mir ihre gedämpften Stimmen hören, wie Mom ihm die Erklärung gab, die sie mir stets schuldig blieb. Allerdings fiel sie denkbar knapp aus. Als ich aus der Dusche kam, knallte schon wieder die Nagelpistole.
Es gibt einen Unterschied zwischen den Wörtern Vater und Dad. Und er umfasst mehr als zwei Buchstaben.
Bis zum Alter von zehn Jahren wusste ich das nicht. Ich wusste auch nicht viel über die Umstände meiner Geburt, abgesehen davon, dass meine Mutter mich im Abschlussjahr der Highschool bekommen hatte, weshalb sie auch so viel jünger war als die Mütter meiner Freundinnen.
In der fünften Klasse stellte sich unser Lehrer Mr Champion eines Tages vor uns ans Whiteboard und schrieb Mein Familienstammbaum. Und von da an wurden die Dinge kompliziert.
Ich hatte immer alles, was mit Schule zusammenhing, mit Begeisterung getan, angefangen damit, die maximale Anzahl der erlaubten Bücher aus der Bibliothek auszuleihen, bis dahin, meine Hefter in ordentlich beschriftete Abschnitte einzuteilen. Und ich nahm meine Hausausgaben sehr ernst, weshalb ich mich auch nicht damit zufriedengeben wollte, meinen Stiefvater neben meine Mutter oben in den Wipfel des Stammbaums zu setzen, auch wenn er mich adoptiert hatte, als ich drei Jahre alt war.
»Der Stammbaum soll meine echte, genetische Familie enthalten«, erklärte ich meiner Mutter, als sie mir eben genau diesen Vorschlag unterbreitete. »Ich brauche mehr Informationen.«
Ich merkte ihr an, dass sie nicht besonders glücklich darüber war. Aber fairerweise muss man sagen, dass sie trotzdem damit herausrückte. Ein paar Sachen wusste ich schon vorher, andere waren mir völlig neu. Und mir wurde schon nach den ersten paar Sätzen ihrer Geschichte klar, dass mein Stammbaum anders aussehen würde als der von allen anderen.
Meine Mutter hatte meinen Vater mit siebzehn kennengelernt, direkt nach der elften Klasse der Highschool. Sie arbeitete im Vermietungsbüro, er – ein Jahr älter als sie und ab Herbst Collegestudent – war aus Connecticut hergekommen, um den Sommer bei einer Tante zu verbringen, die im nahe gelegenen North Reddemane wohnte. Unter anderen Umständen hätten sie sich wohl niemals kennengelernt. Aber wir sprechen hier von einem Strandsommer und dafür gelten – damals wie heute – nicht die üblichen Regeln. Sie hätten unterschiedlicher kaum sein können. Seine Eltern waren vermögend – der Vater Arzt, die Mutter Immobilienmaklerin – und er besuchte eine Privatschule, wo er Latein büffelte und Lacrosse spielte. Sie war die zweite von drei Töchtern einer Arbeiterfamilie, die ein kleines Unternehmen führte, das saisonabhängig und immer kurz vorm Absaufen war. Mom war hübsch, eine stadtbekannte Schönheit, die immer nur die heißen Sportler und den Mädchenschwarm der Saison datete. Er war ein Intelligenzbolzen an der Grenze zum Klugscheißer. Sie hatten keinerlei Gemeinsamkeiten, doch eines Abends war da diese Party, die sie und ihre beste Freundin besuchten. Der Freund der Freundin hatte einen großspurigen Kerl aus dem Norden im Schlepptau, mit dem er gemeinsam im Shrimpboat, der hiesigen Fischbratbude, als Tellerwäscher arbeitete: meinen Vater. Mom war nicht auf der Suche nach einem Freund. Und am Ende bekam sie … na ja … mich.
Es war nicht nur ein Urlaubsflirt: Ich habe die Fotos gesehen. Sie waren richtig verliebt, unzertrennlich den ganzen Sommer lang. Er reiste Mitte August ab, um zu Hause die letzten Vorbereitungen fürs College zu treffen, doch zuvor schmiedeten sie Reisepläne, um sich so bald wie möglich wiederzusehen. Der Abschied war tränenreich, gefolgt von ein paar Wochen voll gesalzener Rechnungen für Ferngespräche – der typische Sommerromanzenkram eben. Bis die Periode meiner Mom ausblieb.
Und mit einem Schlag war das Ganze keine Romanze mehr oder gar eine Beziehung, sondern eine Katastrophe. Ihre Eltern waren am Boden zerstört, seine außer sich vor Entsetzen, und was mal als eine ungewöhnliche Beziehung zwischen zwei Menschen begonnen hatte, wurde schnell zu einer hoch komplizierten Angelegenheit. Es wurde hin und her telefoniert, Vereinbarungen wurden getroffen. Meine Mutter ist nie groß ins Detail gegangen, aber ich weiß, dass es auf beiden Seiten Stimmen gab, die nicht wollten, dass sie mich behielt. Am Ende jedoch tat sie genau das.
Am Anfang der Schwangerschaft standen mein Vater und sie noch in regelmäßigem Kontakt. Doch als Monat um Monat verging und ihr Bauch immer dicker wurde, drifteten sie langsam auseinander. Vielleicht wäre das so oder so passiert, auch ohne Baby. Vielleicht hätte das Baby genau das verhindern sollen. Mom, das muss man ihr lassen, hat meinen Vater nie als den alleinigen Schuldigen hingestellt. Er sei noch so jung gewesen, sagte sie immer, weit weg im College, mit Eltern, die der Situation ablehnend gegenüberstanden. Da waren diese vielen Kilometer, die zwischen ihnen lagen, und nur der eine gemeinsame Sommer. Es wäre auch so schon schwierig genug für ihn gewesen, sich in ihre Welt einzufinden – eine, in der sich jetzt alles um den Stramplerkauf drehte und um Schwangerschaftsbücher und Geburtsratgeber – auch ohne seine Freunde, die ihm ständig in den Ohren lagen, doch mit ihnen um die Häuser zu ziehen.
Zum Zeitpunkt meiner Geburt hatte sich der sporadische Kontakt zwischen ihnen dann in Nichts aufgelöst. Sein Name stand auf der Geburtsurkunde, aber er sah mich erst, als ich sechs Wochen alt war und er mit seinen Eltern zu einem Besuch nach Colby kam, der allen als Desaster in Erinnerung blieb.
Mom erzählte, dass der Vater meines Vaters ihr nicht einmal in die Augen blicken konnte, wie sie mich so in den Armen hielt, und stattdessen immer links an ihr vorbeischaute, so als wollte er uns ausweichen. Er betrachtete uns als eine Art falsche Abzweigung, die, wenn sie ihr folgten, seine ganze Familie in die Irre führen würde. Und was meinen Vater betraf, der war nervös und distanziert, ganz anders als der Junge, den sie vor einem Jahr kennengelernt hatte. Und so merkwürdig es auch klingen mag: Erst als er da leibhaftig vor ihr stand, wurde ihr so richtig klar, dass er für immer fort war. Nach diesem Besuch sah sie ihn zehn Jahre lang nicht wieder.
Meiner Mutter zufolge war das einzige Gute, was das Treffen damals mit sich brachte, die Einigung über den Kindesunterhalt. Sowohl Mom als auch ihren Eltern war der Gedanke an Almosen zuwider, aber sie ging noch zur Highschool und Windeln und Babysitter waren teuer, und so wurden eine Summe und ein Zahlungsmodus vereinbart. Anders als auf meinen Vater war auf das Geld – in Form eines Schecks, ausgestellt von der Sekretärin des Vaters meines Vaters – immer Verlass. Nach dem Schulabschluss begann meine Mutter, Vollzeit im Vermietungsbüro zu arbeiten. Morgen für Morgen ließ sie mich in der Obhut meiner Großtante Sylvie zurück, die mich fütterte und in den Armen wiegte, während sie ihre TV-Soaps schaute. Später sagte Mom, das wären die härtesten Jahre ihres Lebens gewesen.
So viel zu meinem Vater. Und was meinen Dad betraf – der trat in unser Leben, als ich zwei Jahre alt war. Gemeinsame Freunde hatten zwischen dem Witwer mit zwei kleinen Töchtern und meiner Mutter ein Blind Date arrangiert. Beide waren jung und alleinerziehend mit kleinen Kindern: Es schien ideal zu passen. Stattdessen hasste sie seinen Humor und die Art, wie er aß, während er sie arrogant und viel zu ernst fand. Sechs Monate später allerdings hatte meine Mutter auf der einzigen zweispurigen Straße von Colby eine Autopanne. Mein Dad war der Erste, der anhielt.
Und seitdem waren sie zusammen. Er behauptete immer, sobald sie ihn mit Werkzeug in der Hand gesehen hätte, wäre es um sie geschehen gewesen. Womit er vermutlich nicht ganz unrecht hatte.
Und schwuppdiwupps waren wir eine Familie. Ich war zwei Jahre alt, Amber vier und Margo sechs. Ich hatte keine Erinnerung mehr an ein Leben ohne sie, genauso wenig wie sie noch wussten, wie es gewesen war, bevor Mom den Platz ihrer Mutter einnahm. Nach der Hochzeit bezogen wir dann das Haus, das Dad seitdem in einer Tour einriss und ausbaute. Doch auch ohne die ständigen Bauarbeiten ging es bei uns laut, chaotisch und alles andere als friedlich zu. Aber ich kannte es nicht anders.
Während mein Dad also den größten Teil meiner Kindheit über anwesend war, verhielt es sich mit meinem Vater ähnlich wie mit Bigfoot oder dem Ungeheuer von Loch Ness. Es gab immer wieder Sichtungen, Leute, die behaupteten, es würde ihn geben, aber die Beweise stammten alle aus zweiter Hand: alte Fotos, weit zurückliegende Gespräche, die Schecks, die meine Mutter zurückschickte, als Dad mich adoptierte. Aber dann schrieb Mr Champion jene zwei Wörter an die Tafel, und ich war fest entschlossen, die Leerstellen für mich zu füllen.
»Ich möchte ihm schreiben«, sagte ich zu Mom an dem Tag, als ich mit der Aufgabenstellung nach Hause kam. »Und ein paar Fragen stellen.«
»Ach, Schatz«, hatte sie geseufzt und ihr Gesicht hatte diesen zermürbten Ausdruck angenommen, wie immer, wenn dieses Thema alle Jubeljahre einmal zur Sprache kam. »Das halte ich für keine gute Idee.«
»Er ist mein Vater«, sagte ich. »Es ist meine Geschichte. Ich sollte sie kennen.«
Ich weiß noch, dass sie Hilfe suchend zu meinem Dad schaute. Er war für einen Moment still – er sagte nie etwas, ohne erst mal nachzudenken – und dann meinte er: »Emaline, es könnte sein, dass er dir nicht zurückschreibt. Darauf solltest du dich einstellen.«
»Das mache ich«, sagte ich. Meine Mom sah mich zweifelnd an. »Das mache ich wirklich. Du musst es mich wenigstens versuchen lassen.«
Am Ende tat sie das auch, saß mir schweigend gegenüber, während ich zunächst einen Briefentwurf verfasste – in Schuldingen war ich nun mal eine unverbesserliche Perfektionistin – und dann die endgültige Fassung. Ich schob den Brief in einen Umschlag und sah ihr zu, wie sie in ihrem Adressbuch blätterte, bis sie die Anschrift fand, die immer oben rechts auf den Schecks gestanden hatte. Sie las sie laut vor, ich schrieb sie nieder und wir gingen gemeinsam zum Briefkasten.
Damit hätte die Angelegenheit erledigt sein können. Niemanden hätte das groß überrascht, auch mich nicht. Aber zwei Wochen später flatterte ein an mich adressierter Umschlag ins Haus. Drinnen steckte ein maschinengeschriebener Brief auf dickem Papier. Joel Pendelton stand oben im Briefkopf. Kein Nessie mehr. Er war real.
Liebe Emaline,
vielen Dank für Deinen Brief. Ich habe so oft an Dich gedacht und mich gefragt, wie es Dir geht und was für ein Mädchen aus Dir geworden ist. Aber ich dachte, es stünde mir nicht zu, es herauszufinden. Ich beantworte Dir gern die Fragen für Dein Projekt und erzähle Dir auch, wenn es Dich interessiert, ein bisschen von mir. Ich weiß, dass ich niemals erwarten kann, Dein Vater zu sein. Aber ich hege die Hoffnung, dass wir vielleicht eines Tages Freunde sein können.
Der Brief ging noch weiter. Er beantwortete lang und breit und der Reihe nach alle meine Fragen, bevor er von sich selbst erzählte. Er arbeitete als freier Journalist und war seit fünf Jahren mit einer, wie er sich ausdrückte, wundervollen Frau namens Leah verheiratet. Sie hatten einen zweijährigen Sohn: Benji. Vielleicht könnte ich ihn ja eines Tages mal kennenlernen. Auf der letzten Seite stand eine E-Mail-Adresse. Er hatte nicht geschrieben, dass ich mich bei ihm melden solle. Sie stand einfach nur da, wie ein Angebot.
Das war das erste Mal, dass ich diesen ganz bestimmten Ausdruck – eine Mischung aus Sorge und Traurigkeit – auf dem Gesicht meiner Mutter sah. Mittlerweile erkannte ich ihn schon von Weitem. Er hatte sie so unglaublich verletzt damals. Ihre größte Angst war, dass sie nun zulassen würde, dass er mir das Gleiche antat.
Ich beendete mein Projekt, reichte es ein und bekam eine glatte Eins. Dann heftete ich es ab (schon damals war ich ein Kind mit Aktenordnern gewesen. Einmal Ordnungsfreak, immer Ordnungsfreak). Den Brief bewahrte ich in meiner Nachttischschublade auf, aus der ich ihn ab und zu hervorholte und betrachtete. Das Briefpapier war unheimlich schwer, mit geprägtem Monogramm. Als wäre in seiner Welt selbst das Papier anders. Und schließlich, ein paar Wochen später, öffnete ich meinen E-Mail-Account, tippte seine Adresse ein und schrieb ihm, dankte ihm für seine Hilfe und erzählte, dass ich eine gute Note bekommen hätte. Innerhalb weniger Stunden erhielt ich eine Antwort.
Das sind ja tolle Nachrichten, schrieb er. Was nehmt ihr sonst noch durch im Unterricht?
Und mit diesen acht Worten nahm unsere Beziehung, oder was immer es auch war oder sein würde, ihren Anfang. Die Schule war unser gemeinsames Interesse, etwas, worüber er wahnsinnig viel wusste, mehr als Mom und Dad, ja sogar mehr als die meisten meiner Lehrer. Mathe, Geschichte, Literatur, Naturwissenschaften – er kannte sich auf allen Gebieten aus, legte mir begeistert seine persönliche Auffassung dar, schickte Links zu Artikeln und Büchertipps. Das Lernen wurde unsere gemeinsame Sprache und plötzlich schrieben wir uns regelmäßig.
Ein paar Monate und viele E-Mails später schrieb er mir, dass er mit seiner Frau und seinem Sohn eine Reise nach North Reddemane machen würde. Sie hofften, mich zu treffen, wenn meine Eltern damit einverstanden wären. Als ich meiner Mutter davon erzählte, biss sie sich auf die Lippe und bekam wieder diesen Gesichtsausdruck.
Alle waren dagegen. Ihre Familie sagte, dass er für uns nichts getan hätte und es nun auch verdiente, nichts zurückzubekommen, dass es mich nur durcheinanderbringen und traurig machen würde. Aber Mom hatte alle E-Mails gelesen. Trotz ihrer Bedenken verstand sie, dass er in gewisser Weise eine Lücke ausfüllte, die ansonsten vielleicht nicht mal bemerkt worden wäre. Und so wurde ein paar Monate nach dem ersten Brief ein Treffen vereinbart. Mein Vater, seine Frau und Benji kamen zu uns in den Süden, um seiner mittlerweile in die Jahre gekommenen Tante einen Besuch abzustatten, und wir verabredeten, dass wir alle gemeinsam im Shrimpboat zu Abend essen würden. In den Tagen vor dem Treffen war meine Mutter so nervös, dass sie sich immer wieder übergeben musste, was ich bis dahin noch nie bei ihr erlebt hatte – und seither ebenso wenig, um genau zu sein. Die Vergangenheit wirkt sich anscheinend auf alles aus, sogar auf den Magen.
Als der Tag gekommen war, erschienen wir in dem Restaurant und wurden an einen Tisch am Fenster geführt, an dem ein großer Mann mit Brille und eine Frau mit einem pummeligen Kleinkind auf dem Schoß auf uns warteten. Alles, woran ich mich von diesem Treffen noch erinnern kann, ist, dass mein Vater ganz anders war als in seinen E-Mails. Er wirkte nervös und befangen und riss seine Augen nicht von mir los. Er starrte mich ununterbrochen an, von der Begrüßung (förmliches Händeschütteln, peinlich berührtes Gemurmel) bis zu dem erlösenden Moment anderthalb Stunden später, als wir uns verabschieden konnten. Fast so, als versuchte er wiedergutzumachen, dass sein eigener Vater mich vor vielen Jahren nicht hatte ansehen wollen.
Seine Frau Leah, eine freundliche Brünette mit großen Zähnen, managte die ganze Unterhaltung und quasselte wie ein Wasserfall, um jegliche Momente peinlicher Stille zu vermeiden. Der Junge, Benji, mein Halbbruder, war süß und fand alles, was ich machte, urkomisch. Ich aß frittierte Garnelen. Mein Dad sprach eindeutig zu viel übers Baugeschäft. Meine Mom trank Gingerale und verschwand immer wieder auf dem Klo. Und dann war’s vorbei. Bei der Verabschiedung überreichte mir mein Vater ein Päckchen, das ich mit ziemlicher Scheu öffnete, während alle mir dabei zusahen. Es war eine Ausgabe von Huckleberry Finn, sein Lieblingsbuch, als er in meinem Alter gewesen war.
»Vielleicht gefällt’s dir nicht«, sagte er. »Wär kein Problem. Schau’s dir einfach an.«
Auf dem Nachhauseweg saß ich mit dem Buch im Schoß auf dem Rücksitz und beobachtete meine Mutter, die tief ausatmete und ihren Kopf gegen das geschlossene Fenster lehnte. Mein Dad drückte ihr die Schulter. »So, das wär geschafft«, sagte er und sie nickte.
Na ja, nicht ganz. Ich brauchte eine Woche, um Huckleberry Finn zu lesen, und dann noch eine, um mir zu überlegen, was ich meinem Vater dazu sagen sollte. Am Ende entschied ich mich für die Wahrheit und schrieb, dass es ein ziemlich langweiliges Buch sei mit einer eigenartigen Sprache und dass für meinen Geschmack zu viel Mississippi darin vorkam. Ich fragte mich, ob er deswegen beleidigt wäre, oder ob die Tatsache, dass er sich bei unserem Treffen so merkwürdig benommen hatte, bedeutete, dass ich gar keine Antwort bekommen würde. Aber bereits am nächsten Tag traf Folgendes in meinem Postfach ein:
Und was denkst du sonst noch darüber?
Wie sich herausstellte, markierte dieses Abendessen nicht das Ende unserer Beziehung. Aber es war auch nicht der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Es war mehr wie eine Tür, die einen Spalt geöffnet worden war, um einen Streifen Licht hereinzulassen. Nicht genug, um alles deutlich sehen zu können, aber von da an tappten wir beide nicht mehr völlig im Dunkeln.
Wir mailten uns regelmäßig, sprachen darüber, welches Buch ich gerade las und welche Themen im Unterricht behandelt wurden. Jeden Sommer fuhren sie nach North Reddemane und wir trafen uns. Wir spielten Mingolf, aßen Unmengen frittierte Garnelen und besuchten das Aquarium und das Meeresmuseum zusammen mit Benji, als er ein bisschen größer war. Zu meinem Geburtstag bekam ich Karten und zu Weihnachten sorgfältig (von Leah) verpackte Geschenke. Und in der Zwischenzeit stritt ich weiter mit meinen Schwestern, hing mit Freunden ab und tat all die Dinge, die mein wahres Leben ausmachten, dasjenige, das ich ohne ihn hatte und mit dem ich ziemlich glücklich war. Doch im Sommer, als ich sechzehn wurde, änderte sich etwas.
Es begann mit einer lapidaren Bemerkung, als wir im Igor saßen, dem einzigen italienischen Restaurant der Stadt. (Mein Dad war sich sicher, dass ihr Slogan lautete: »Wenn Ihnen die Meeresfrüchte schon zu den Ohren rauskommen!«, obwohl das natürlich nicht stimmte.) Mein Vater trank einen Schluck Wein, dann sah er mich an. »Und«, sagte er, »hast du schon übers College nachgedacht?«
Ich blinzelte ihn an. »Ähm«, antwortete ich. »Noch nicht.«
»Aber du möchtest schon nach der Schule studieren. Oder?«
Er war mir in vielerlei Hinsicht ein Fremder, aber eine Sache wusste ich: In seinen Kreisen war höhere Bildung ein absolutes Muss. Ganz anders in meiner Familie, in der die Zahl der Collegeabsolventen exakt null betrug. Dieser Unterschied stach einem schon ins Auge, wenn Benji, der im Restaurant eigentlich malen wollte, stattdessen ein Suchrätsel aufgedrückt bekam – Leah hatte immer und überall entsprechendes Material dabei.
»Das schaffst du schon, versuch’s mal«, spornte sie ihn an, als sie das Heft mit den Wortschatzspielen aufschlug und es ihm über den Tisch hinweg zuschob.
Ich beobachtete das Gesicht meines Halbbruders, als er sich die Buchstabenkästchen besah. Als ich wieder zu meinem Vater schaute, starrte er mich noch immer an, genau wie bei unserem allerersten Treffen, aber diesmal fühlte es sich anders an. Das war unser Ding, unser gemeinsames Interesse. Vielleicht war es seltsam, dass wir nur diese eine Gemeinsamkeit hatten. Egal – her damit.
»Ja«, sagte ich. »Auf jeden Fall. Das ist zumindest der Plan.«
»Gut.« Er nickte zufrieden. »Freut mich zu hören.«
Eine Woche später lag ein Buch im Briefkasten: Übung macht den Meister: Vorbereitung auf die College-Aufnahmeprüfung, so lautete der Titel, wenn ich mich recht erinnere, obwohl er in den folgenden Monaten so viel Lektüre schickte, dass ich kaum noch hinterherkam. Ratgeber, wie man erfolgreich Prüfungen absolvierte, ein aussagekräftiges Essay schrieb oder seine Bewerbung aus der Masse hervorhob. Wie man sich ein College aussuchte, seine Chancen realistisch einschätzte und, falls es nicht klappte, die richtige Ersatzuni auswählte. Nach und nach verdrängten diese Bücher alle Romane und Zeitschriften und nahmen mein ganzes Regal in Beschlag, bis es irgendwann in der Mitte durchsackte. Ich war nicht blöd. Mir war klar, dass er mir mit all den Wörtern, eingebunden zwischen zwei Buchdeckeln, einen Weg ebnen wollte, der mich aus Colby herausführte – Buch für Buch.
Das Problem an der Sache war nur, dass die Unis, die mein Vater für mich ins Auge gefasst hatte – Dartmouth, Cornell, Columbia – in meinen Gesprächen mit dem Schulberater noch nicht mal erwähnt worden waren. Außerdem war es eine Frage des Geldes, denn das war bei uns immer knapp.
»Mach dir keine Sorgen«, versicherte mir mein Vater jedes Mal, wenn ich den Mumm aufbrachte, dieses heikle Thema anzuschneiden. »Überlass die Finanzierung mal mir. Du konzentrier dich einfach darauf, die Aufnahme zu schaffen.«
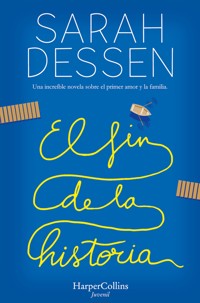

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










