
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Vier Hochzeiten und ein Liebesfall Louna ist die Tochter der gefragtesten Hochzeitsplanerin von Lakeview. Deren Mitarbeiter sind gestählt im Umgang mit panischen Bräuten und kaltfüßigen Bräutigamen. Und bei allem, was sie erlebt haben, glaubt keiner von ihnen mehr an die wahre Liebe. Auch Louna glaubt nicht mehr an das ewige Liebesglück, denn ihre erste Liebe wurde ihr genommen. Seit damals hält sie jeden, der sich ihr nähert, auf Abstand. Auch Ambrose, den charmant-chaotischen Bruder einer zahlungskräftigen Braut to be. Als Lounas Mutter ausgerechnet Ambrose als Praktikant einstellt, beginnt Lounas sorgsam errichteter Schutzwall zu bröckeln …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sarah Dessen
Once and for all
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Michaela Kolodziejcok
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Regina Hayes
Weil du mich zum Nachdenken und zum Lachen bringst
und mich immer wieder aufrichtest.
1
Okay, das hier war eine Premiere für mich.
»Deborah?«, sagte ich und klopfte leise, aber mit Nachdruck an die Tür, um deutlich zu machen, dass es dringlich war. »Ich bin’s, Louna. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
Laut meiner Mutter war das Regel Nummer eins in solchen Situationen: Rede niemals ein Problem herbei. Soll heißen, erkundige dich nur, ob etwas nicht stimmt, wenn du dir sicher bist, dass etwas nicht stimmt. Und so, wie die Dinge im Augenblick standen, war ich das nicht. Wobei die Tatsache, dass eine Braut sich fünf Minuten nachdem die Trauung eigentlich hätte beginnen sollen, im Kirchenbüro verschanzte, nichts wirklich Gutes erahnen ließ.
Auf der anderen Seite der Tür war eine Bewegung zu hören. Dann ein Schniefen. Wenn jetzt doch nur William hier wäre, Moms Geschäftspartner und altgedienter Brautflüsterer der Firma!
Aber der kümmerte sich bereits um eine andere Krise, in Zusammenhang mit der Bräutigammutter, die sich weigerte, der Brautmutter beim feierlichen Einzug voranzugehen, obwohl doch jedes Kind wusste, dass das nun mal so Brauch war. Wenn man aber erst mal so lange wie wir im Hochzeitsbusiness tätig war, wusste man, dass alles zum Problem werden konnte, angefangen beim glücklichen Brautpaar bis hin zu den Serviettenringen. Man musste mit allem rechnen.
Ich räusperte mich. »Deborah? Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen?«
Wasser war zwar nicht die Lösung des Problems, aber schaden konnte es auch nicht – noch so eine Devise meiner Mutter. Statt einer Antwort klickte das Schloss und die Tür öffnete sich knarrend einen Spaltbreit. Ich warf einen Blick über die Schulter zur Treppe, in der verzweifelten Hoffnung, William im Anmarsch zu sehen, aber nein, ich war immer noch allein auf weiter Flur. Also holte ich tief Luft, hob die mitgebrachte Flasche vom Boden auf und trat ein. Mit H2O zum Erfolg!
Unsere Kundin Deborah Bell (im Idealfall bald Deborah Washington), eine bildhübsche, junge schwarze Frau mit hochgesteckten Haaren, saß auf dem Fußboden des kleinen Büroraums, inmitten einer bauschigen weißen Stoffwolke. Ihr Kleid hatte schlappe fünftausend Dollar gekostet, was ich deshalb so genau wusste, weil sie es während der letzten zehn Monate, in denen wir den heutigen Tag geplant hatten, mehrfach erwähnt hatte. Ich versuchte, nicht daran zu denken, als ich flink, aber nicht zu flink, zu ihr hinüberhuschte. (»Und niemals auf einer Hochzeit rennen, es sei denn, es besteht buchstäblich Lebensgefahr!«, hatte ich die Stimme meiner Mutter im Ohr.) Gerade hatte ich den Drehverschluss von der Flasche geschraubt, als ich merkte, dass sie weinte.
»Oh, tun Sie das nicht.« Ich sank – wie ich hoffte – möglichst elegant in die Hocke hinab und zog ein Päckchen Taschentücher aus meiner Hosentasche. »Ihr Make-up! Sie sehen absolut hinreißend aus. Und wir wollen doch, dass das so bleibt, nicht wahr?«
Deborah, deren falsche Wimpern – ein bisschen Schummeln war unerlässlich – am einen Augenlid bereits auf Halbmast hingen, blinzelte mich einfach nur an und schickte ein weiteres Tränenrinnsal über ihre bereits völlig mascaraverschmierten Wangen. »Darf ich dich etwas fragen?«
Nein, dachte ich. Mittlerweile waren wir schon neun Minuten im Verzug. Laut sagte ich aber: »Sicher doch.«
Sie nahm einen tiefen zittrigen Atemzug, so einen, der nur kommt, nachdem man lange und heftig geweint hat. »Glaubst du …« Eine Pause, in der ein erneuter Schwall Tränen aufstieg und losbrach und dabei die losen Wimpern gleich mit sich riss. »Glaubst du, dass wahre Liebe wirklich ewig währt?«
Jetzt kam jemand die Stufen hoch. Den Geräuschen nach zu urteilen – poltrige, große Schritte, vermischt mit weithin hörbarem Schnaufen und Prusten –, war es nicht William. »Wahre Liebe?«
»Ja.« Sie nahm eine Hand hoch und – Himmel, bloß nicht!, schoss es mir durch den Kopf, aber zu spät – rieb sich mit den Fingern über die Augen, sodass ihr Eyeliner bis zu den Schläfen verwischte. Die Schritte hinter uns wurden lauter; wer auch immer da kam, musste gleich hier sein. Indessen sah Deborah mich weiter eindringlich an, mit großen, bittenden Augen, als hinge ihre Zukunft ganz und gar von meiner Antwort ab. »Und, tust du’s?«
Ich wusste, dass sie von mir ein Ja hören wollte, eine klare, unumwundene Antwort, die sie auf jede andere Frage auch bekommen hätte. Stattdessen aber saß ich einfach nur da und schwieg, versuchte vergeblich, das Bild in meinem Kopf in Worte zu fassen: ein Junge im weißen Hemd am dunklen Strand, der lachend eine Hand nach mir ausstreckt.
»Deborah Rachelle Bell!«, donnerte eine Stimme hinter uns. Eine Sekunde später erschien ihr Vater, Reverend Elijah Bell, und füllte mit seiner massigen Gestalt den ganzen Türrahmen aus. Sein Anzug saß ziemlich stramm, der Hemdkragen stand offen und in einer Hand hielt er ein zerknülltes Taschentuch, das er sich gegen seine schweißbedeckte Stirn drückte. »Was in aller Welt soll das hier werden? Die Leute warten auf dich!«
»Tut mir so leid, Daddy«, heulte Deborah los. In dem Moment sah ich William die Treppe hochkommen. Gott sei Dank! Doch bereits im nächsten Augenblick wurde er wieder von der gewaltigen Leibesfülle des Reverends verdeckt. »Ich hab bloß kalte Füße gekriegt.«
»Hm, dann reiß dich jetzt wieder zusammen«, sagte er und schob sich in den Raum. Völlig außer Puste machte er eine kurze Pause, atmete zweimal tief durch und fuhr dann fort. »In dieser Hochzeit stecken dreißigtausend Dollar meines sauer verdienten Geldes. Nicht rückerstattbar, wohlgemerkt! Wenn du also nicht auf der Stelle vor diesen Altar trittst und Lucas heiratest, werde ich es tun.«
Wieder brach Deborah in Tränen aus. Noch während ich ihr etwas linkisch die Schulter tätschelte, zwängte sich William am Reverend vorbei und trat zu uns. Er beachtete mich nicht, seine ganze Aufmerksamkeit galt der Braut. Seelenruhig wie immer beugte er sich zu Deborah hinunter und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie wisperte eine Antwort, während er ihr mit sanft kreisenden Bewegungen den Rücken massierte, wie man es bei einem quengelnden Baby tut.
Was gesagt wurde, konnte ich nicht hören, nur das Geschnaufe des Reverends. Hinter uns auf der Treppe wurde jetzt erneut Getrappel laut, vermutlich die Brautjungfern, Trauzeugen und andere Neugierige. Und alle wollten Teil der Geschichte sein. Früher hatte ich das mal verstanden, inzwischen aber nicht mehr.
Was immer William zu Deborah gesagt hatte, es hatte ihr ein Lächeln entlockt, wenn auch ein sehr zittriges. Aber es reichte und sie ließ sich von ihm hochhelfen. Während sie ihr derangiertes Kleid wieder in Form zu schütteln versuchte, lehnte er sich in den Flur hinaus und winkte jemanden herbei. Eine Sekunde später erschien die Visagistin, ihren Schminkkoffer in der Hand.
»Okay, Leute. Wir lassen Deborah jetzt einen Moment Zeit, um sich frisch zu machen«, verkündete William laut und vernehmlich, als erst eine und dann noch eine Brautjungfer den Kopf durch die Tür steckte. »Reverend, wären Sie so gut, alle Leute wieder auf ihre Plätze zu bitten? Wir sind in zwei Minuten unten.«
»Das will ich schwer hoffen«, knurrte der Reverend und walzte zur Tür, an der die Brautjungfern in einem Gewirbel aus Lavendelblau eilig auseinanderhuschten. »Diese Treppe steige ich nämlich keinzweites Mal hoch!«
William drehte sich zu Deborah um. »Wir warten auf dem Gang und rühren uns nicht vom Fleck«, sagte er sanft und forderte mich mit einer Geste auf, ihm zu folgen. Draußen zog ich die Tür hinter uns zu.
»Tut mir leid«, sprudelte ich los, kaum dass wir auf dem Flur standen. »Damit war ich einfach überfordert.«
»Du hast dich wacker geschlagen«, sagte er, zückte sein Telefon und fing an zu tippen. Ohne hinzusehen wusste ich, dass er eine Nachricht an meine Mutter schrieb, in dieser codeartigen Sprache, die sie benutzen, um sich schnell und diskret auszutauschen. Eine Sekunde später vernahm ich ein Brummen und ihre Antwort war da. William warf einen Blick aufs Display und sagte: »Die Leute wundern sich ein bisschen, aber noch wurden keine Spekulationen laut. Alles kein Problem. Wir haben die Wimper als Entschuldigung.«
Ich sah auf meine Uhr. »Kann eine Wimper denn eine Viertelstunde dauern?«
»Sie kann sogar eine volle Stunde dauern, was die Gäste da unten anbelangt.« Er strich eine unsichtbare Falte in seiner Hose glatt, dann rückte er seine Fliege zurecht. »Ich hätte Deb nicht als jemanden eingeschätzt, der kalte Füße kriegt. Man lernt nie aus.«
»Was hat sie zu dir gesagt?«, fragte ich ihn.
Er lauschte nach Geräuschen auf der anderen Seite der Tür, spitzte die Ohren, ob noch Geschniefe oder Weinen zu hören war. Dann sagte er: »Ach, sie wollte etwas über wahre Liebe wissen. Ob ich glaube, dass sie ewig währt. Typisches Vor-der-Hochzeit-Gedöns.«
»Und was hast du gesagt?«
Jetzt sah er mich mit dieser kühlen Selbstgewissheit an, mit der er es – im Tandem mit Mom – zum erfolgreichsten Hochzeitsplaner von ganz Lakeview gebracht hatte. »Ja natürlich, habe ich gesagt. Und dass ich diesen Job andernfalls gar nicht machen könnte. Liebe ist größer als alles andere.«
Wow, dachte ich. »Und denkst du das wirklich?«
Er erschauderte. »Um Gottes willen!«
Genau in dem Augenblick öffnete sich die Tür und Deborah kam heraus, mit renoviertem Make-up, frisch montierten Wimpern und scheinbar makellosem Kleid. Sie schenkte uns ein nervöses Lächeln und ich lächelte automatisch zurück, während William übers ganze Gesicht strahlte.
»Wunderschön siehst du aus«, sagte er. »Komm, bringen wir’s hinter uns.« Er streckte ihr eine Hand hin, sie ergriff sie und dann verschwanden sie gemeinsam die Treppe hinunter. Die Visagistin folgte ihnen mit einem leisen Seufzen, das nur ich hören konnte. Und dann war ich allein.
Unten im Kirchenfoyer würde meine Mutter jetzt alle Angehörigen der Braut-Entourage an ihre vorgesehenen Plätze dirigieren und letzte Hand an Hosenträger und Revers, Jungfernsträußchen und Ansteckblumen legen. Ich blickte zurück in das kleine Büro, wo nur noch ein Haufen zerknüllter Taschentücher auf dem Boden lag. Während ich sie eilig aufsammelte, überlegte ich, wie viele Bräute hier wohl im Laufe der Zeit schon gesessen hatten, am Rand der Kluft zwischen Gegenwart und Zukunft, voller Angst, den Sprung zu wagen. Ich konnte mit ihnen mitfühlen, allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Schließlich entschieden sie sich freiwillig dazu. Hoffte ich zumindest. Jetzt schwoll die Orgelmusik an; es ging los. Ich machte die Tür zu und huschte die Treppe hinunter.
Meine Mutter ergriff ihr Weinglas. »Ich sage sieben Jahre. Lange genug für zwei Kinder und eine Affäre.«
»Interessant«, erwiderte William, der sein eigenes Glas in die Luft hielt und es nachdenklich betrachtete. Dann sagte er: »Ich gebe ihnen drei. Keine Kinder. Aber eine einvernehmliche Trennung.«
»Meinst du?«
»Nur so ein Gefühl. Das war schon ein extremer Fall von kalten Füßen, und dann noch diese Frage mit der wahren Liebe …«
Meine Mutter dachte kurz darüber nach.
»Ja, vermutlich hast du recht. Diesmal geht der Sieg wohl an dich. Prösterchen!«
Sie stießen miteinander an, sanken in ihre Stühle zurück und nippten versonnen an ihren Gläsern. Das war ihr festes Ritual am Ende jeder Hochzeit, wenn Braut und Bräutigam losgeflittert und alle Hochzeitsgäste nach Hause oder Richtung Hotel aufgebrochen waren. Sie tranken gemeinsam einen Absacker, ließen die Feier Revue passieren und schlossen Wetten auf die Ehen ab, denen sie auf die Beine geholfen hatten. Dabei war ihre Trefferquote, was Dauer und Ausgang derselben anging, äußerst verblüffend. Und, um ehrlich zu sein, auch etwas beängstigend.
Für mich war der entscheidende Augenblick die Abreise. Der Moment, wenn alle sich versammelten, um das Brautpaar zu verabschieden, sprach Bände. Er war anders als die Trauung, bei der sämtliche Leute nervös und angespannt waren, oder der anschließende Empfang, bei dem meist ein solches Chaos herrschte, dass die Einzelheiten untergingen. Beim Abschied lagen viele Monate der Planung hinter Braut und Bräutigam und viele Jahre eines gemeinsamen Lebens vor ihnen. Aus diesem Grund prüfte ich beharrlich ihre Gesichter auf Müdigkeit, Tränen oder Anzeichen von Unsicherheit. Ich schloss keine Wetten auf das Paar ab, sondern drückte ihm die Daumen. Ich wollte immer für alle ein Happy End.
Die Kunden erfuhren natürlich nie davon. Es war der unsichtbare Schlusspunkt hinter einem gesellschaftlichen Ereignis, das die Leute in Lakeview nur eine »Natalie-Barrett-Hochzeit« nannten und das bei Frischverlobten so hoch im Kurs stand, dass sie bereitwillig Warteliste und Anmeldegebühr in Kauf nahmen, um dafür überhaupt in Betracht gezogen zu werden. Mom und William zu beauftragen war eine kostspielige Angelegenheit, keine Frage, aber sie waren jeden einzelnen Cent wert, wie die vier dicken ledergebundenen Alben in ihrem Büro eindrücklich bewiesen. Sie waren gespickt mit Bildern von glücksstrahlenden Brautpaaren, die auf jede erdenkliche Weise geheiratet hatten: barfuß am Strand, mit Schlips und Kragen am See. Auf einem Weingut. Auf einer Bergspitze. Im eigenen (dem Anlass entsprechend zauberhaft dekorierten) Garten. Es gab rauschende Feste und kleine, intime Feiern. Jede Menge Zuckerwatteroben mit Schleppen, aber auch andersfarbige Kleider mit reduzierten Schnitten (meist ein Hinweis darauf, dass es sich um die zweite oder dritte Hochzeit handelte). Der Unterschied zwischen einer normalen Hochzeit und einer Natalie-Barrett-Hochzeit war so groß wie der Unterschied zwischen einer Wunderkerze und einem Feuerwerk. Eine Hochzeit, das waren zwei Menschen, die heirateten. Eine Natalie-Barrett-Hochzeit, das war ein Erlebnis.
Die Deborah-Bell-Hochzeit – es gehörte zu unserer Firmenpolitik, dass alle Events unter dem Namen der Braut geführt wurden, da es ihr großer Tag war – war im Grunde eine Routinenummer für uns. Die Trauung fand in der Kirche statt, der Empfang im Bankettsaal eines nahe gelegenen Hotels. Es gab fünf Brautjungfern und fünf Bräutigamsbegleiter, einen Ringträger und ein Blumenmädchen. Dass sie sich für eine Live-band entschieden hatten, war heutzutage eher unüblich (meine Mutter bevorzugte einen DJ: je weniger Leute, desto geringer das Pannenpotenzial), genau wie die Tatsache, dass das Essen von Servicekräften aufgetragen wurde (seit Jahren waren eher Tranchierstationen und Buffets angesagt). Der Abend war mit einem Feuerwerk zu Ende gegangen, ein Spektakel, das immer häufiger nachgefragt wurde und den Geldbeutel des Kunden buchstäblich explodieren ließ.
Das anfängliche Kalte-Füße-Drama vergessen, war Deborah Hand in Hand mit ihrem frischgebackenen Ehemann zu der wartenden Limousine gerannt, glücklich, mit glühenden Wangen und einem breiten Lächeln auf dem Gesicht. Als die Autotür zufiel, hatten Braut und Bräutigam sich küssend in den Armen gelegen, sehr zum Missfallen des Brautvaters, der sich die tränenfeuchten Augen mit einem Taschentuch betupfte, während ihm seine Frau tröstend den Arm tätschelte. Schließlich fuhr die Limousine los. Viel Glück, dachte ich, als die Rückleuchten um die nächste Kurve verschwanden. Ich wünsche euch, dass ihr auch in schwierigen Zeiten immer zueinanderhaltet.
Und dann war die Hochzeit vorbei, jedenfalls für sie. Nicht aber für uns. Nun gab’s erst mal den Absacker und das Wettspiel und danach unsere obligatorische letzte Runde durch den Saal, bei der wir Ausschau hielten nach verlorenen Gegenständen, verirrten Hochzeitsgeschenken sowie unter dem Tisch liegenden oder, ähm, anderweitig beschäftigten Gästen (bitte keine Fragen!). Anschließend luden wir dann unsere Clipboards, Ordner, Necessaires, doppelseitigen Klebebandrollen, Papiertücherboxen, Power-Klebestrips, Ladekabel und Beruhigungspillen (oh ja!) in die Autos und fuhren nach Hause. Im Normalfall hatten wir genau einen Tag Verschnaufpause, bevor wir wieder im Büro meiner Mutter vor dem riesigen Whiteboard saßen, an dem bereits die nächste Hochzeit vermerkt war, und die ganze Chose wieder von vorne losging.
Obwohl ihre ständigen Spötteleien und Witze etwas anderes vermuten ließen – Mom und William liebten ihren Job. Sie waren mit Herzblut bei der Sache und sie waren richtig gut. Das hatte ich bereits als Kind begriffen, als ich noch mit Malbuch und Stiften bewaffnet am wuchtigen Schreibtisch meiner Mutter gesessen hatte, während sie mit aufgeregten Bräuten Gästelisten und Sitzpläne diskutierte. Inzwischen saß ich an ihrer Seite, im Schoß meine eigene, in Leder gebundene Natalie-Barrett-Hochzeiten-Kladde, und machte mir Notizen. Diese Entwicklung war im Prinzip unausweichlich gewesen. Hochzeiten waren nun mal das Familiengeschäft und ich war Moms ganze Familie. Es sei denn, man zählte William dazu, und genau das taten wir.
Sie hatten sich vor sechzehn Jahren kennengelernt, als ich knapp zwei war und mein Dad uns gerade sitzen gelassen hatte. Damals hatten meine Eltern in einer Hütte im Wald gelebt, etwa zehn Meilen außerhalb von Lakeview. Sie hielten Hühner, hatten einen Biogemüsegarten und stellten selbst gemachte Bienenwachskerzen her, die sie am Wochenende auf dem örtlichen Bauernmarkt verkauften. Mein Vater, der gerade mal zweiundzwanzig war, trug Vollbart, dafür aber selten Schuhe, und arbeitete bereits seit mehreren Jahren an einem Band mit Öko-Gedichten. Meine Mom, ein Jahr jünger als er und überzeugte Veganerin, kellnerte an den Abenden in einem genossenschaftlich geführten Biocafé und knüpfte nebenbei von Erdenergie durchdrungene Armbänder. Sie hatten sich auf dem College kennengelernt, bei einer Studentendemo gegen das öffentliche Bildungssystem, das offenbar »unterdrückerisch, frauenfeindlich, böse und grausam zu Tieren« war. Das hatte ich wortwörtlich einem Flugblatt entnommen, welches neben anderen alten Sachen von damals in einem Karton lag, der von meiner Mutter in die hinterste Ecke ihres Kleiderschranks verbannt worden war. Neben dem Flugblatt enthielt er eine hässliche Bienenwachskerze, ein Knüpfbändchen, das als Ringersatz bei ihrer Trauung gedient hatte (die auf einem morastigen Festivalfeld durch einen Freund vollzogen worden war, der die ebenfalls beiliegende Heiratsurkunde mit »Käpt’n Juhu!« unterschrieben hatte), und außerdem das einzige erhaltene Foto von meinen Eltern, auf dem sie barfuß und sonnengebräunt, mit Harken in den Händen in einem Garten standen. Ich saß – splitterfasernackt – neben den Füßen meiner Mutter am Boden und beäugte ein Kohlblatt. Mein Name ist übrigens ein selbst kreierter Mix aus ihrer beider Vornamen, Natalie und Louis. Ich bin Louna.
Der Karton, in dem all diese Dinge steckten, war sehr klein für jemanden, der mal so große Überzeugungen vertreten hatte, und das machte mich oft ein wenig traurig.
Meine Mutter allerdings rief sich diesen Abschnitt ihres Lebens immer nur dann ins Gedächtnis zurück, wenn Kunden in ihrem Beisein laute Überlegungen anstellten, ob es sich wirklich lohnte, für die Hochzeit ihrer Träume solch eine fast schon unanständige Summe Geld hinzublättern.
»Na ja, ich selbst wurde ja in einem Schlammloch getraut, von einem zugekifften Zeremonienleiter«, pflegte sie dann zu erwähnen, »und wenn Sie mich fragen, war meine Ehe dadurch von Anfang zum Scheitern verurteilt. Aber na ja, das war vielleicht auch ein spezieller Fall.« Dann legte sie eine kurze Pause ein, nur ein, zwei Sekunden lang, um dem Kunden vor ihr genug Zeit zu geben, sich Natalie Barrett – mit ihren maßgeschneiderten Kleidern, der akkurat sitzenden Frisur, dem dezenten Make-up und dem für sie typischen Diamantschmuck – als einen schlammbeschmierten Hippie mit zerrütteter Ehe vorzustellen. Ein Ding der Unmöglichkeit – dennoch unterzeichneten sie danach den Vertrag auf der gestrichelten Linie, in der verzweifelten Hoffnung, damit vor einem vergleichbaren Schicksal gefeit zu sein. Sicher ist sicher.
In Wahrheit war weder das Schlammloch noch der selbst ernannte Priester schuld daran, dass die Ehe meiner Eltern zu Bruch ging, sondern mein Vater. Nach drei Jahren im Wald mit Kerzenziehen und Gedichteschreiben (wobei meine Mutter behauptete, sie habe ihn nie auch nur ein einziges Wort zu Papier bringen sehen) hatte er genug gehabt vom Leben an der Armutsgrenze. Was keineswegs verwunderlich war. Als Sohn eines Vaters, dem ein Dutzend Luxusautohäuser in San Francisco gehörten, taugte er wohl einfach nicht zum dauerhaften Selbstversorgerdasein. Meine Eltern waren kaum verheiratet gewesen, da hatte sein Vater ihm ein Angebot gemacht: Mein Vater würde sein eigenes Porschehaus bekommen, wenn er seiner Ehe – und damit auch dem Baby – den Rücken zukehrte. Meine Mutter gab der Konsumgesellschaft ohnehin schon die Schuld an allem Übel dieser Welt. Aber als die Liebe ihres Lebens beschloss, sich zu verkaufen, wurde die Sache persönlich. Drei Jahre später, als mein Vater uns schon längst fremd geworden war, kam er bei einem Autounfall ums Leben. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter geweint oder irgendeine Reaktion gezeigt hätte. Und ich sowieso nicht. Man vermisst nicht, was man nie gekannt hat.
Und ich kannte nichts anderes als meine Mutter. Ich sah nicht bloß so aus wie sie – die gleichen Züge, dunkles Haar und dunkler Teint –, manchmal kam es mir fast so vor, als wären wir ein und dieselbe Person. Das rührte wohl vor allem daher, dass es außer uns beiden sonst niemanden mehr gab, da ihre schon leicht betagten, vermögenden Eltern sie kurz nach der Schlammloch-Hochzeit verstoßen hatten.
Nachdem mein Vater sich aus dem Staub gemacht hatte, verscherbelte Mom die Hütte im Wald und zog mit mir nach Lakeview, wo sie nach diversen Kellnerinnenjobs eine Stelle in der Hochzeitsabteilung von Linens Etc antrat, einem großen Haushaltswarengeschäft. Von außen betrachtet, war dieser Schritt ziemlich befremdlich, denn schließlich sind Hochzeiten die reinste Kommerzschlacht. Aber meine Mutter hatte ein Kind zu ernähren und war in ihrem früheren Leben Debütantin gewesen, samt Benimmunterricht im Country Club. Diese Welt mochte ihr zuwider sein, aber sie kannte sich gut darin aus. Und so war es auch nur eine Frage der Zeit, bis die Bräute, die in den Laden kamen, um ihr neues Porzellangeschirr oder Silbersteck auszuwählen, gezielt nach meiner Mutter fragten.
Als ein Jahr später William bei Linens Etc anfing, hatte Mom bereits eine riesige Fangemeinde. Sie nahm ihn unter ihre Fittiche, brachte ihm alles bei, was sie wusste, und mit der Zeit wurden sie beste Freunde. Zusammen verbrachten sie etliche Stunden mit den angehenden Bräuten und hörten ihnen aufmerksam zu, wenn sie von den Hochzeitsvorbereitungen erzählten oder auch ihr Leid darüber klagten. Dabei erfuhren sie, welche Lieferanten auf Zack waren und welche nicht, und begannen, Telefonnummern von empfehlenswerten Floristen, Caterern und DJs zu sammeln. Was dazu führte, dass sie immer häufiger als Berater fungierten und im nächsten Schritt ganze Hochzeiten planten. Irgendwann fing es dann an, dass sie in den Mittagspausen oder beim Feierabendgläschen laut darüber nachdachten, sich zusammen selbstständig zu machen. Und wenig später waren sie mit einer neu gegründeten GmbH und einem Kredit von Williams Mutter tatsächlich im Geschäft. Der Unternehmensanteil meiner Mutter betrug 51 Prozent, der von William 49, außerdem erhielt die Firma den Namen meiner Mutter. Aber damit hatten sich auch schon die juristischen Formalitäten. Denn egal, ob ein Projekt schwierig oder einfach war, sie standen alles gemeinsam durch. Sie machten Träume wahr, tönten sie gern, und damit lagen sie sicher nicht ganz falsch. Bei ihrem eigenen Liebesleben jedoch hatten sie kein so glückliches Händchen. Mom hatte sich seit der Trennung von meinem Vater auf nur sehr wenige nähere Bekanntschaften eingelassen, und wenn, suchte sie sich Männer aus, bei denen von vornherein klar war, dass sie nicht von Dauer waren – um, wie sie immer zu sagen pflegte, »erst gar keine Spekulationen aufkommen zu lassen«. Und für William, der bereits im Alter von acht Jahren sein Coming-out gehabt hatte, musste der Mann, der seinen hohen Ansprüchen annähernd genügte, erst noch gebacken werden. Bis dahin griff auch er zu suboptimalen Übergangslösungen ohne jegliches Beziehungspotenzial. Wahre Liebe gab es nicht, darin waren sich die beiden einig, obwohl ihre ganze Existenz auf ebendieser Illusion gründete. Wozu also seine Zeit mit der Suche danach verschwenden? Und überhaupt, sie hatten ja einander.
Bereits als Kind ahnte ich, dass das nicht gerade gesund war. Doch leider hatten ihre zynischen Ansichten in Sachen Romantik, Für-immer-und-ewig und Liebe von klein an auf mich abgefärbt. Das Ganze war, gelinde gesagt, verwirrend. Denn andererseits erlebte ich den großen Hochzeitstraum beinahe täglich hautnah mit. Ständig wurde ich zu Trauungen und Empfängen mitgeschleift oder saß in Besprechungen, bei der jedes Detail – von den Save-the-Date-Karten bis zu den Hochzeitstortenfiguren – bis ins Kleinste ausgewalzt wurde. Doch abseits der Kunden und der Arbeitsroutine hagelte es Kommentare, was für ein Blödsinn das doch sei und dass gute Männer nicht existierten und wir alleine tausendmal besser dran wären. Kein Wunder also, dass ich mich nicht anstecken ließ, als meine beste Freundin Jilly eines Tages total verrückt nach Jungs wurde. Ich war ein vierzehnjähriges Mädchen, das mit der Abgeklärtheit einer verbitterten Geschiedenen mittleren Alters all die Dinge wiederholte, die es zu Hause in einer Tour zu hören bekam. »Er wird dich eh enttäuschen, darauf mach dich schon mal gefasst«, erklärte ich kopfschüttelnd, als sie einem breitnackigen Footballspieler eine Whatsapp-Nachricht schickte. Oder ich warnte: »Tu nichts, was du am Ende bereust«, wenn sie – unter bühnenreifem Getue – überlegte, ob sie einem Jungen gestehen solle, dass sie ihn »gernhatte«. Meine Altersgenossen flirteten auf Teufel komm raus, doch ich blieb auf Abstand – buchstäblich und im übertragenen Sinn. Ich war die Spaßbremse, die es schaffte, jeder Romantikkomödie und jedem Liebeslied den ultimativen Dämpfer zu verpassen. Was das anging, war ich bei den absoluten Profis in die Lehre gegangen.
Doch dann wurde in einer lauen Sommernacht im vergangenen August alles anders und plötzlich glaubte ich an die Liebe, wenigstens für kurze Zeit. Das Ende vom Lied war ein mehrfach gebrochenes Herz, wofür ich niemandem außer mir selbst die Schuld geben konnte, was die Sache umso schlimmer machte. Hätte ich mich doch bloß weggedreht und zweimal Nein gesagt statt nur einmal, hätte ich doch bloß den Heimweg angetreten und dem funkelnden Sternenhimmel den Rücken zugekehrt. Hätte, hätte, Fahrradkette.
Jetzt kippte meine Mutter den letzten Rest ihres Drinks runter und stellte ihr Glas ab. »Kurz nach Mitternacht«, bemerkte sie mit einem Blick auf die Uhr. »Zeit für den Abflug. Seid ihr so weit?«
»Noch eine letzte Kontrollrunde, dann sind wir hier fertig«, erwiderte William, stand auf und klopfte sich den Anzug ab. Wir hatten es uns zur Regel gemacht, bei den Events wie Gäste gekleidet zu sein, allerdings wie welche von der zurückhaltenden Sorte. Das Ziel war, mit der übrigen Hochzeitsgesellschaft zu verschmelzen, allerdings nicht vollständig. Ein kniffliger Balanceakt, wie beinah alles in unserem Geschäft. »Louna, du siehst in der Lobby und draußen nach, ich schaue mich hier und in den Toilettenräumen um.«
Ich nickte und durchquerte den Festsaal, der inzwischen leer war bis auf ein paar Servicekräfte, die Geschirr abräumten und Stühle hochstellten. Im hellen Licht der Deckenbeleuchtung sah ich hier und da Blütenblätter und zerknüllte Servietten auf dem Boden liegen, dazwischen ein paar vergessene Gläser und Bierdosen. Die Lobby war menschenleer, abgesehen von einem Typen, der mit einer Zigarre im Mund an einem Türrahmen lehnte, genau unter einem »Bitte-nicht-rauchen«-Schild.
Ich ging durch den Eingang nach draußen, die Nacht fühlte sich kühl an. Auch auf dem Parkplatz war alles ruhig – niemand da. Zumindest dachte ich das, bis ich mich umdrehte und neben einem der Pflanzenkübel eine Gestalt bemerkte. Es war eine von Deborahs Brautjungfern, ein großes, dunkelhäutiges Mädchen mit Rastazöpfen und Nasenpiercing – Malika? Malina? Sie hatte ein Taschentuch in der Hand und betupfte sich die Augen, und nicht zum ersten Mal stellte ich mir die Frage, warum Hochzeiten immer so viele Emotionen aufrüttelten. Fast, als wären Tränen ansteckend.
Auf einmal blickte sie hoch und bemerkte mich. Ich hob eine Augenbraue, aber sie schüttelte nur traurig lächelnd den Kopf: Sie brauchte meine Hilfe nicht. Es gibt Situationen, da mischt man sich ein, und Situationen, da hält man sich raus, und inzwischen hatte ich gelernt, beides auseinanderzuhalten. Einige Menschen lassen ihrer Traurigkeit gern freien Lauf, doch der überwiegende Teil weint lieber still in sich hinein. Und solange nicht irgendwas dagegensprach, ließ ich sie dabei in Ruhe.
2
»Dein Job«, sagte Jilly aus dem Inneren meines Schranks, »ist echt Gift für mein Liebesleben.«
»Das sagst du immer«, erwiderte ich.
»Und ich mein’s immer ernst.« Es gab ein Poltern, gefolgt von einem dumpfen Aufprall. »Wow. Ist das Pinke etwa trägerlos? Passt gar nicht zu dir. Ich schlüpf da mal eben kurz rein. Crawford, Gesicht zur Wand!«
Ich sah zu ihrem zehnjährigen Bruder rüber, der an meinem Schreibtisch stand und in meinem Mathebuch las. Er schob seine Brille den Nasenrücken hoch, seufzte und drehte sich um. Ich wechselte Bean, Jillys winzige Schwester, auf meine andere Hüfte und versuchte, meine Haare aus ihrem Klammergriff zu lösen. Währenddessen kaute sie an meiner Schulter herum und sabberte einen langen Spuckefaden auf den Ärmel meiner Bluse. Weil Jillys Eltern von morgens bis abends damit zu tun hatten, ihr Imbisswagen-Imperium am Laufen zu halten, ähnelte ein Besuch meiner besten Freundin immer einem Familienausflug.
»Tada!«, verkündete sie einen Moment später und kam in einem melonenfarbenen Sommerkleid zum Vorschein, das ihr unübersehbar zwei Nummern zu klein war. Und das offenbar neuerdings keine Träger hatte. Jilly trug gern hautenge, knappe Klamotten, die ihre üppigen Kurven betonten. Und obwohl dieser Look nicht mal ansatzweise meinem persönlichen Stil entsprach, bewunderte ich sie für ihr unerschütterliches Selbstbewusstsein. Die meisten Mädchen an meiner Schule quatschten ständig über Diäten und Thigh Gaps, aber meine beste Freundin war schon immer jemand gewesen, der gegen den Strom schwamm. Was eine Sache von vielen war, die ich so an ihr mochte. »Und, was sagst du?«
»Dass das Kleid eigentlich Träger hat«, stellte ich klar und zerrte einen hervor. »Siehst du?«
Sie warf einen Blick über ihre sommersprossige Schulter. »Oh. Na ja, wenigstens sind sie schmal. Wärst du so gut, den andern auch noch rauszuzuppeln?«
Ich tat wie geheißen, während Bean mit ihren Patschhändchen nach Jilly grapschte. Jilly verließ mein Haus nie in dem Outfit, in dem sie gekommen war. In meinem Schrank war mittlerweile ein ganzes Fach voll mit ihren Klamotten, hübsch säuberlich zusammengelegt und ausnahmslos dort vergessen.
»Also, noch mal wegen heute Abend«, sagte sie. Dabei schob sie mit schlängelnden Bewegungen einen Arm durch den Träger und rückte ihre dralle Oberweite zurecht. Ich für meinen Teil hatte bestenfalls ein C-Körbchen, sie dagegen eine satte D, was meinen Klamotten einen Wow-Faktor verpasste, von dem ich nur träumen konnte. »Die Jungs kommen etwas später ins Bendo, nach dem Auftritt der letzten Band. Diese Katastrophen-irgendwas.«
»Spektakulär oder Katastrophal«, korrigierte ich sie.
»Genau.« Sie drehte mir den Rücken zu als stumme Aufforderung, den Reißverschluss zuzuziehen. »Du kannst ja nach der Arbeit noch dazustoßen. Du hast doch gemeint, du hast heute früher Schluss, richtig?«
»Nein. Ich habe gesagt, es ist eine Sechs-Uhr-Hochzeit. Schluss ist also um zehn oder später.«
»Das Kleid ist zu eng«, sagte Crawford in seiner für ihn typischen monotonen Stimmlage. Schon als Kleinkind hatte er so gesprochen. Damals waren er und seine Familie frisch in das Haus hinter unserem eingezogen, gleich auf der anderen Seite des Bachs, der unsere beiden Grundstücke voneinander trennte. Jilly und ich waren zehn Jahre alt gewesen, er zwei, und die Zwillinge und Bean hatte es noch gar nicht gegeben. Jillys Eltern legten bei allem, was sie taten, großen Fleiß an den Tag, einschließlich bei der Vermehrung.
»Lass das mal meine Sorge sein. Lies du einfach dein Buch«, erwiderte sie und schob ihren Busen noch ein Stückchen höher.
»Das ist Lounas Buch«, erwiderte er und blätterte eine Seite um. »Und Bean braucht eine frische Windel.«
Ach deshalb roch es hier so komisch! Crawford, dieser Intelligenzbolzen und notorische Sozialtollpatsch, war uns allen immer einen Schritt voraus. Kommentarlos nahm Jilly mir Bean ab, legte sie auf den Boden, gab ihr zum Draufrumkauen einen ihrer Armreifen und fuhr fort.
»Schluss mit den faulen Ausreden, ja?«, sagte sie an mich gewandt. »Es ist jetzt fast ein Jahr her. Wird langsam Zeit, sich wieder raus in die Welt zu wagen. Du kannst dich nicht ewig hinter deiner Arbeit verstecken.«
»Und mit ›raus in die Welt‹ ist ein schmieriger, versiffter Club gemeint?«
»In diesem speziellen Fall, ja.«
»Bakterien lösen Infektionen aus«, meldete Crawford sich zu Wort. »Und Infektionen können krank machen.«
»Ach komm, sag Ja. Lass uns zusammen ein bisschen Musik hören und danach schauen wir noch bei den Partys vorbei«, sagte Jilly, während Bean unter mein Bett krabbelte. »Das wird lustig, versprochen.«
»Moment mal. Von einer Party war nicht die Rede gewesen. Und schon gar nicht von Partys.«
Sie atmete hörbar aus. »Louna«, sagte sie, streckte sich nach mir aus und fasste mich bei den Armen. »Du bist meine beste Freundin. Ich weiß, was du durchgemacht hast, und ich weiß, dass du Schiss hast. Aber wir sind jung. Das ganze Leben liegt noch vor uns. Das ist doch ein Wahnsinnsprivileg, oder nicht? Verschleuder es nicht.«
Das war das wirklich Bemerkenswerte an Jilly. In vielerlei Hinsicht übertrieb sie es, dieses laute, poltrige, quirlige Mädchen, dem total schnurz war, was andere von ihr hielten. Immer hatte sie mindestens eines ihrer Geschwister im Schlepptau, riss sich ständig meine Klamotten unter den Nagel und war geradezu versessen darauf, mir einen neuen Freund klarzumachen, obwohl – oder gerade weil – ich keinen wollte. Aber so nervig sie auch sein konnte und so verschieden wir auch waren, hin und wieder sagte sie eben genau solche Dinge, die geradeheraus und tief empfunden und einfach nur so verdammt wahr waren. Wirklich, ein Wahnsinnsprivileg!
»Ich versuch zu kommen«, versprach ich.
»Mehr verlange ich ja gar nicht.« Sie lehnte sich vor und drückte mir einen leicht verrutschten Kuss auf die Wange, als im selben Moment ihr Telefon piepte. Sie zog es aus ihrem knapp sitzenden Oberteil heraus – ihr Lieblingsort, um Dinge zu verstauen – und warf einen Blick aufs Display. »Die Zwillis müssen jetzt zum Kinderturnen. Hab ich total verschwitzt.«
»Ich hasse Kinderturnen«, sagte Crawford. »Die ganze Halle stinkt nach Gummimatten und Käsefüßen.«
»Da hat er nicht ganz unrecht«, sagte Jilly und betrachtete sich prüfend im Spiegel. Dann wanderte ihr Blick in meinen Schrank und ihre Augenbrauen schossen in die Höhe. »Hallöchen, was sehen da meine entzündeten Augen? Neue Sandalen? Hier, halt mal mein Handy. Ich war gerade erst bei der Pediküre!«
Damit duckte sie sich um mich herum, langte in die hinterste Ecke meines Schrankes und angelte ein Paar zierliche schwarze Sandalen mit Goldschnalle hervor. Ich hatte sie genau ein einziges Mal getragen. Bei dem Anblick, wie sie an den dünnen Riemen von ihrem Daumen herabbaumelten, sank mir augenblicklich das Herz.
»Nein«, sagte ich knapp und mit schrofferer Stimme als beabsichtigt. »Die nicht!«
Sie sah auf die Sandalen und dann zu dem Platz, an dem sie gestanden hatten, abseits von all meinen anderen Schuhen. Nur ein Wimpernschlag, dann hatte sie begriffen. Behutsam stellte sie die Schuhe wieder zurück auf den Boden. »Oh, verstehe«, sagte sie. »Sorry.«
Ich sagte nichts, versuchte nur, meine Fassung wiederzugewinnen – wieso nur war das immer noch so schwer? – , während Jilly sich nach Bean bückte und sie hochhob. Crawford beobachtete mich mit gewohnt düsterer Miene, und obwohl ich wusste, dass er nur ein Kind und vollkommen ahnungslos war, musste ich mich wegdrehen.
Ein paar Minuten später zogen sie ab, unter dem üblichen Radau, von dem ihr Aufbruch jedes Mal begleitet war: Bean plärrte, während Jilly und Crawford sich den ganzen Weg die Treppe hinunter zankten. Draußen im Garten angekommen, sah sie zu meinem Fenster hinauf und wackelte mit den Fingern. Ich winkte zurück und sah ihnen nach, wie sie zusammen den Rasen überquerten. Jilly hüpfte über den Bach, leichtfüßig trotz Baby im Arm, aber Crawford blieb stehen, bückte sich und inspizierte irgendwas am Rand des Wassers. Eine Sekunde später trieb Jilly ihn brüllend zur Eile an und er setzte sich wieder in Bewegung.
In meinem Zimmer herrschte jetzt Ruhe, diese besondere Art von Ruhe, die nur dann eintrat, wenn die Bakers gerade das Haus verlassen hatten. Ihre geballte Familie war anstrengend, keine Frage, aber ich mochte mir nicht vorstellen, wie mein Leben ausgesehen hätte, wären sie nicht nebenan eingezogen. Mein eigenes Zuhause war so sauber und still, nur Mom und ich, alles hatte seine Ordnung. Das Wissen, dass nur einen Steinwurf entfernt das vertraute Baker-Chaos tobte, war enorm beruhigend für mich. Wir haben wohl alle ab und zu das Bedürfnis, in der Menge zu verschwinden.
Aber jetzt, da ich in meinen Kleiderschrank hineintrat, war ich allein. In dem kleinen dunklen Raum hob ich erst eine schwarze Sandale auf, dann die zweite und stellte beide an ihren alten Platz zurück, unter das schwarze Kleid, das ebenso nur ein einziges Mal getragen worden war. Die Sachen fühlten sich nicht mehr an wie meine; genauso gut hätten sie irgendeinem anderen Mädchen gehören können. Trotzdem konnte ich mich nicht von ihnen trennen. Noch nicht.
»Ich liebe dritte Hochzeiten«, erklärte William vergnügt, als wir neben dem Pool des Country Clubs standen und zusahen, wie die Gäste ihre Plätze einnahmen. »Alle sind immer so relaxt. Vielleicht sollten wir uns darauf spezialisieren. Wäre eine Möglichkeit, eine Marktnische zu besetzen.«
»Nicht profitabel genug«, entgegnete meine Mutter, die ewige Realistin. »Außerdem würdest du nach kürzester Zeit deine neurotischen Jungbräute vermissen. Das wäre die reinste Verschwendung deines Talents.«
»Stimmt auch wieder«, pflichtete er ihr bei, während sein Blick einem älteren Herrn in einem etwas zu knappen Anzug folgte, der gerade eine Sitzplatzreihe ansteuerte, die für Familienangehörige reserviert war. William war der wachsamste Mensch, den ich kannte; er war wie eine Katze, jederzeit zum Sprung bereit. Ich merkte, wie ich den Atem anhielt, bis die Ehefrau des Mannes ihn endlich am Ärmel fasste und eine Reihe weiter zog. »Apropos Jungbräute, ich habe mit Bee gesprochen und sie hat den Termin bestätigt. Montagmorgen ist Vorbesprechung.«
Meine Mutter seufzte. »William, du weißt genau, dass ich solche überstürzten Hauruck-Aktionen hasse wie die Pest.«
»Die Hochzeit ist im August. Jetzt haben wir April.«
»Ende April«, konterte meine Mutter. »Was in Ordnung ginge, wenn es eine dritte Hochzeit wäre. Das ist es aber nicht. Wir reden hier von High Society und höchsten Ansprüchen und das heißt, dass wir vor rund einem Jahr hätten anfangen müssen zu planen.«
»Du hast das sehr hohe Honorar vergessen«, fügte William trocken hinzu.
»Geld ist nicht alles.« Eine Sekunde lang wartete ich auf das, von dem ich wusste, dass es als Nächstes käme. Und Bingo: »Seelische Gesundheit ist nicht mit Geld aufzuwiegen.«
»Aber wenn einer das könnte, dann die.«
Sie verfielen beide in Schweigen. Ein weiterer Gast peilte die vorderste Stuhlreihe an. Es war nur eine Frage der Zeit, bis William die vorbereiteten RESERVIERT-Kärtchen (geschrieben in seiner kalligrafischen Handschrift, auch bekannt als die offizielle Natalie-Barrett-Hochzeiten-Typo) zücken und auf den Sitzen verteilen würde. Normalerweise hütete er sich davor, in das ausgefeilte Arrangement einer Location einzugreifen, auch nicht mit dekorativen Kärtchen. Aber den Deppenfaktor durfte man einfach nicht unterschätzen – ein weiteres Motto meiner Mutter.
»Zwanzig Minuten«, sagte sie jetzt mit einem knappen Blick auf ihre Uhr. »Am besten, du verteilst doch ein paar Kärtchen, dann brauchen wir nicht die ganze Zeit Wachhund zu spielen. Louna, machst du bitte HRR?«
Ich nickte und holte mein Telefon hervor, um sicherzugehen, dass es lautlos gestellt war. Bei Events wie diesem, wo es auf den Wegefaktor ankam, war ich fast immer für die hinterste Reihe rechts zuständig. Das war ein Teil unserer dreigleisigen Vorgehensweise, die wir routinemäßig anwandten: Meine Mutter gab der Braut und ihrer Entourage das Startsignal, ich überwachte den Einzug und William hatte die Position ganz vorn inne. Dort stand er bereit für den Notfall, dass jemand aus den Latschen kippte oder die Ringe herunterfielen (oder sie gar ganz vergessen worden waren) oder die Blumenmädchen und Ringträger mitten während der Zeremonie Faxen machten. (Sachen, die alle schon passiert waren, allerdings nur ein einziges Mal gleichzeitig, und zwar bei einer Hochzeit, die bei uns nur »Das Desaster« hieß.)
Jeder von uns nahm jetzt seine jeweilige Position ein. Die Veranstaltung heute, die Eve-Little-Hochzeit, hatte uns die vergangenen neun Monate lang beschäftigt, und William hatte recht: Es war ein Kinderspiel gewesen. Die Braut war über fünfzig, der Bräutigam jenseits der siebzig. Sie hatten Geld wie Heu und kaum konkrete Wünsche, außer dass die Hochzeit im Lakeview Country Club stattfinden sollte, wo das Paar sich kennengelernt hatte. Der Club hatte das Catering übernommen, sie hatten unseren Lieblings-DJ gebucht und Schlag zehn würde das Ganze vermutlich zu Ende sein.
Der einzige Wermutstropfen war die Brauttochter Beatrice. Sie hatte sich vor zwei Wochen verlobt und beschlossen, dass auch sie unbedingt eine Natalie-Barrett-Hochzeit haben musste. Richtig kompliziert wurde die Sache dadurch, dass sie und ihr Verlobter bereits Mitte August heiraten wollten, bevor sie im Spätsommer wegen einer Assistenzarztstelle ans andere Ende der Vereinigten Staaten ziehen würden. Also musste alles gleich jetzt und sofort passieren. Normalerweise kam für uns aufgrund der Warteliste und Moms Perfektionismus nichts in Betracht, was auch nur ansatzweise holterdiepolter erschien. Aber Eve Little hatte sich so umgänglich gezeigt und so wenig Kosten gescheut, dass zumindest William schließlich kapituliert hatte. Und damit war die Schlacht zu 49 Prozent gewonnen.
Ich marschierte durch zur letzten Stuhlreihe, die ich vor zwei Stunden mit aufgestellt hatte, und nahm ganz außen am Gang Platz. Wie immer gab es mal wieder eine Handvoll Leute, die sich in die hinterste Reihe verkrümelt hatten, was William mit Sicherheit auf die Palme bringen würde. »Was denken die sich bloß dabei? Als müssten sie fürchten, zum Mitmachen nach vorn geholt zu werden«, echauffierte er sich jedes Mal. Ich hatte sogar schon miterlebt, wie er in Extremfällen seine Autorität spielen ließ und die Leute kurzerhand umsetzte, obwohl das nur passierte, wenn er so richtig angefressen war.
Ich war, was das anging, deutlich entspannter und so nickte ich dem Pärchen, das ein paar Sitze weiter saß, einfach nur zu, während ich mein Telefon hervorholte, um nachzusehen, wie spät es war.
Fünfzehn Minuten bevor es losgehen sollte, trudelte die erste Gruppennachricht meiner Mom ein.
SCHWIMMER UNTERWEGS ZUM POOL.
Eine Sekunde später trat William wie aus dem Nichts hinter einem geschmückten Buchsbäumchen hervor, fing eine Frau und ein Kind in Badesachen ab und lotste beide diskret aus dem Bereich heraus, der mit einem »Geschlossene Gesellschaft«-Schild gekennzeichnet war.
In diesem Moment setzte laute Orgelmusik ein, so plötzlich, dass nicht nur ich vor Schreck in meinem Sitz zusammenfuhr. Noch bevor Mom das unumgängliche WTF? eingetippt hatte, glitt ich von meinem Stuhl und huschte ans andere Ende der Außenanlage, wo Monty, der DJ, bereits entschuldigend die Hände hob. Alles unter Kontrolle.
Noch zwölf Minuten. Vorne am Eingang zur Terrasse beugte sich meine Mutter gerade über einen flachsblonden Ringträger. Bei einer Hochzeitsfeier konnte viel schiefgehen und ganz besonders graute es Mom vor der Unberechenbarkeit von Kindern und Hunden. Aus diesem Grund ergriff sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, die sie für absolut angemessen und notwendig hielt. Für Vierbeiner waren das klein geschnittene Würstchen, die sie, in einer Tüte verpackt, in ihrem Ärmel bereithielt. Bei Kindern funktionierten Bonbonbestechungen und strenge Worte, wobei es bei Letzterem auf die richtige Dosis ankam. Die Stimmung war schon emotionsgeladen genug, auch ohne verängstigt weinende Kinder.
Noch sieben Minuten, bevor es losgehen sollte, und ich saß wieder an meinem Platz. Ich beobachtete William, der einen prüfenden Blick über die Menge gleiten ließ, während die letzten Gäste einen Sitzplatz fanden. Jedes Mal, wenn er die leeren Stühle zwischen der vierten und der letzten Reihe sah, zuckte er leicht zusammen. Aber außer mir bemerkte das niemand.
Um Punkt sechs Uhr sollte die Musik anfangen. Stattdessen vibrierte mein Telefon. Ich las die Nachricht zweimal, verstand aber trotzdem nur Bahnhof.
0 SDB FÜR EINZUG.
Vorne neben dem Altar erhielt William die gleiche Nachricht. Er sah mich an und zog die Augenbrauen hoch.
WAS?, tippte ich, während der Mann zwei Plätze neben mir auf seine Armbanduhr sah.
KOMM SOFORT HER lautete die Antwort, die ich noch nicht ganz zu Ende gelesen hatte, als ich mich auch schon in Bewegung setzte.
Nicht rennen, nicht rennen, ermahnte ich mich selbst und gab mir alle Mühe, zügig, aber ohne Anzeichen von Panik die Terrasse zu überqueren. Im Foyer stand die Braut-Entourage schon für den Einzug bereit, an ihrer Spitze der Ringträger, der jetzt ein rot verheultes Gesicht hatte. Hinter ihm waren die Brautjungfern und -begleiter, dahinter Eve Little, die strahlende Braut, in einem pastellgelben Kleid mit Tulpenärmeln (ich liebe dritte Hochzeiten!), daneben ihre Tochter Bee und meine Mutter. Alle redeten durcheinander.
»Wenn wir unseren Job gut machen sollen, müssen wir uns auf Absprachen verlassen können«, sagte meine Mutter genau in dem Moment, als ich hinzutrat. »Irgendwelche Änderungen oder Extras in allerletzter Minute gefährden den reibungslosen Ablauf.«
»Das ist mir klar«, sagte Eve, während Bee, ihr Telefon am Ohr, suchend den Blick durch den Raum schweifen ließ. »Aber gerade eben war er noch hier!«
»Das ist so typisch für ihn«, sagte Bee an mich gewandt, als wüsste ich, worum es ging. »Jemand sollte mal draußen nachsehen.«
Ich blickte zu meiner Mutter. »Du hast gehört, was sie gesagt hat. Sieh draußen nach!«
»Aber wen suchen wir überhaupt?«, erkundigte ich mich. »Es sind doch alle hier.« Das wusste ich deshalb so genau, weil ich für die Checkliste verantwortlich war. Am Abend vor jedem Event machte ich einen Laufzettel, der die Namen sämtlicher Hochzeitsgäste und Familienmitglieder enthielt sowie die Kontaktdaten der gebuchten Dienstleister (Caterer, DJ, Florist) plus einem minutiös getakteten Zeitplan, angefangen mit dem Eintreffen der Gäste bis hin zum Aufräumen am Schluss. Letzterer war jetzt nur noch ein Fall für die Tonne.
»Ambrose«, sagte Eve. Meine Mutter bemühte sich, ihre Verärgerung zu verbergen (oder nein, eigentlich nicht).
»Wer?«
»Mein Bruder«, erklärte Bee und wechselte ihr Bouquet aus weißen Rosen und Lilien von der einen Hand in die andere. Bee war eine absolute Traumfrau, blond, mit milchweißer Haut und strahlend blauen Augen – genau die Art von hübsch, die einen so richtig aufregen konnte, nur dass sie dafür viel zu nett war. »Eigentlich sollte er gar nicht hier sein, jetzt ist er es aber doch. Er ist groß, blond wie ich. Und hat sich vermutlich mit irgendeinem Mädchen festgequatscht. Wenn’s sein muss, gib ihm eine Ohrfeige.«
SDB bedeutete also Sohn der Braut.
»Bin schon unterwegs«, sagte ich zu Mom und ging los Richtung Haupteingang. Bevor ich die Tür aufdrückte, warf ich noch einen Blick zurück über die Schulter; William kam von der Terrasse herbeigeeilt, das Telefon zwischen Ohr und Schulter geklemmt. Wenn er und meine Mutter dazu übergegangen waren, richtig miteinander zu telefonieren, dann war das Ganze noch schlimmer als befürchtet.
Draußen scannte ich rasch den Parkplatz ab. Zwei Golfer standen ins Gespräch vertieft an einem Audi, aus dessen Kofferraum Schläger herausragten, neben dem Hintereingang zur Küche stapelte ein Typ in weißer Kochjacke Gemüsekisten aufeinander. Ansonsten: nichts zu sehen. Dachte ich, bis ich dieses glockenhelle Geräusch vernahm, das nur das Lachen eines hübschen Mädchens sein konnte.
Es kam von hinter dem Blumentransporter, der ein paar Meter von mir entfernt stand. Dann war ein gedämpftes Prusten zu hören, definitiv männlich. Langsam bewegte ich mich auf den Transporter zu, während ich mich zum x-ten Mal fragte, wieso ich nicht einfach in einem Café, Buchladen oder sonst wo jobben konnte. Ich ging ums Heck herum und räusperte mich.
Als ich Ambrose Little zum ersten Mal sah, schossen mir zwei Gedanken durch den Kopf, die meine Haltung ihm gegenüber prägen sollten. Damals war mir das allerdings noch nicht klar. In dem Moment nahm ich nur Folgendes wahr: Erstens, er sah wahnsinnig gut aus. Zweitens, sein bloßer Anblick – und zwar nur flüchtig im Profil und noch dazu von weiter weg – erregte meinen Unmut in einer Weise, die ich selber nicht verstand.
Was sein Aussehen anging: Bee hatte recht. Sie waren der gleiche Typ und ihre Gesichter ähnelten sich. Aber Ambrose, der einen Smoking und dazu ein weißes Hemd trug, war sehr groß, beinah schlaksig, mit langen Armen und Beinen, hohen Wangenknochen und einer blonden Stirnlocke, die perfekt zerzaust war, was ihn sehr viel Zeit gekostet haben musste. Er war wie dieses auf dem Kopf stehende Ausrufungszeichen am Anfang eines spanischen Satzes, das davor warnte, dass etwas Kompliziertes folgte.
Warum er mich so aufbrachte, war mir selbst ein Rätsel. Vielleicht lag es genau daran, dass er so attraktiv war. Als hätte meine Surferboy-Puppe aus Kindertagen, die mit der flachen Brust und dem kantigem Kinn, menschliche Gestalt angenommen. Noch nie war es mir passiert, dass ich jemanden instinktiv und auf Anhieb abgelehnt hatte. Es gab mir das unschöne Gefühl, oberflächlich und hohl zu sein.
Zu diesem Zeitpunkt jedoch hatte er mich noch nicht einmal bemerkt, so beschäftigt war er damit, sich an eine kurvenreiche junge Frau ranzuschmeißen. Sie lehnte in Shorts und Poloshirt mit Country-Club-Logo an einem roten Toyota und hielt in der locker herabhängenden Hand ein dickes Schlüsselbund. Die beiden standen so dicht beieinander, dass kaum noch ein Blatt dazwischenpasste. Weder er noch sie nahmen Notiz von mir.
»Ambrose«, sagte ich scharf. Jetzt drehte er den Kopf in meine Richtung und seine Stirnlocke rutschte auf die andere Seite. Trotzdem sah sie noch immer perfekt aus und ich ertappte mich beim Impuls, die Hand auszustrecken und sie zu berühren. Bei dem Gedanken wallte neuer Ärger in mir hoch. »Die Hochzeit fängt jetzt an. Wir brauchen dich an deinem Platz.«
Er lächelte – ein träges, Reiches-Söhnchen-Lächeln, strahlend weiß und selbstbewusst. »Hallöchen, wen haben wir denn da?«
Das Mädchen zog einen Flunsch, sichtlich genervt von der aktuellen Entwicklung. »Ich arbeite für Natalie Barrett, die Hochzeitsplaner. Du musst mitkommen. Sofort!«
Er lachte und salutierte, wobei er mit der Hand gegen seine Stirnlocke stupste. »Jawohl, Ma’am! Eine Sekunde noch.« Und damit drehte er sich wieder zu seiner Freundin um, die kokett den Kopf in den Nacken legte und ihn schwärmerisch ansah.
Es gibt Leute, die sich in schwierigen Situationen fragen: »Was würde Jesus tun?« Für mich gab es jedoch nur ein leuchtendes Vorbild, zumindest, was den Job anging, und ich wusste, dass sie an meiner Stelle bis zum Äußersten gehen würde, um den Zeitplan wieder einzuholen. Im nächsten Sommer Buchladen oder Café, schwor ich mir. Und dann ging ich zu ihm hin, fasste Ambrose Little am Handgelenk und begann, ihn Richtung Clubeingang zu ziehen.
»Was soll die Scheiße!«, rief das Mädchen und kniff böse die Augen zusammen. »Du kannst doch nicht einfach –«
Und ob ich konnte! Allerdings hatte ich mit Gegenwehr gerechnet und deshalb sehr energisch zugepackt. Augenblicklich verlor er das Gleichgewicht, strauchelte vorwärts gegen mich, suchte grapschend nach Halt und wurde an meinem linken Busen fündig. Jetzt zerrte ich also an einem Jungen, während er mich dabei befummelte, während die Golfer dabei zusahen. Richtig super.
»Uah, normalerweise mag ich willensstarke Frauen«, sagte Ambrose, als er die Balance wiedergewonnen hatte und ich seine Hand wegnahm. »Aber du bist mir eine Spur zu krass.«
Ich ignorierte die Bemerkung, aus Sorge davor, wie meine Antwort ausfallen könnte. Wir hatten den Clubeingang fast erreicht; sobald wir über die Schwelle traten, war er das Problem meiner Mutter und ich konnte mich wieder gemütlich ans HRR machen.
»Hey, wir wurden einander noch gar nicht richtig vorgestellt«, sagte er, als ich mit der freien Hand die Glastür aufriss. »Ich bin Ambrose. Und wer bist du?«
»Endlich!«, zischte Mom, die bereits hinter der Tür auf uns gelauert hatte. Ich warf einen Blick auf die Wanduhr: fünfzehn Minuten nach sechs. Meine Mutter war sehr stolz darauf, dass die Events unter ihrer Regie immer punktgenau getimt waren, und jede Minute mehr, die dem Zeitplan hinterherhinkte, verschärfte ihren Unmut. Wenn Ambrose so weitertrödelte, würde ihm am Ende nicht nur das Handgelenk wehtun. Aber davon ahnte er nichts. Und so schenkte er meiner Mom dieses vor Selbstbewusstsein strotzende Lächeln, das sie mit einem solch eisigen Blick quittierte, dass er mir fast schon leidtat. Aber nur fast.
»Hier lang«, bellte sie und ich gab seine Hand frei, erleichtert, dass ich endlich den Rückzug antreten konnte. Er folgte ihr brav und ohne den geringsten Protest. Selbst ihm war inzwischen klar, wer hier das Sagen hatte.
Mein Telefon vibrierte. William. UPDATE?
ALLES OK, antwortete ich. BIN WIEDER HRR.
Ich ging erst an Ambrose und seiner Mutter vorbei, dann an der versammelten Braut-Entourage, deren Mitglieder mittlerweile schon so lange in den Startlöchern standen, dass sie sichtlich unruhig waren. Ungefähr auf Höhe der Brautjungfern legte sich mir eine Hand auf den Arm. Ich drehte den Kopf und blickte in Bees lächelndes Gesicht. »Danke, dass du meinen Armleuchter von Bruder hergeschafft hast.«
Ich nickte, ohne Anstalten zu machen, ihre Wortwahl in irgendeiner Weise zu beschönigen. »Keine Ursache.«
Als ich an meinen Platz in der letzten Stuhlreihe zurückkehrte, schwirrten bereits reichlich Spekulationen hinsichtlich der Verzögerung durch den Raum. Für das ungeschulte Ohr mochten alle Wartegeräusche gleich klingen, ich aber kannte die Unterschiede und feinen Nuancen, genau wie William, der immer behauptete, ein verhunzter Auftakt habe die Kraft, alle nachfolgenden Ereignisse wie ein Fluch zu überschatten. Es überraschte mich also kein bisschen, dass sein Mund nur noch ein verkniffener Strich war.
Um 18.23 Uhr ertönte endlich die Einzugsmelodie. Ich drehte mich halb in meinem Sitz um, als Ringträger und Blumenmädchen ganz herzallerliebst zusammen den Gang entlangtapsten und dabei Rosenblätter vor sich herstreuten. Noch während William sie an ihre Plätze bugsierte, folgte die Braut-Entourage, immer paarweise wie Tiere beim Besteigen der Arche. Bee lächelte mir im Vorbeigehen noch einmal zu. Vermutlich kannte sie es nicht anders und musste sich ständig für ihren Bruder entschuldigen. Als dann schließlich Ambrose und Eve einzogen, ging ein bewunderndes Raunen durch die Menge. Im Gegensatz zu seiner Schwester nahm Ambrose nicht mal Notiz von mir.
Eine Hochzeit ist eine Aneinanderreihung besonderer Momente wie Perlen an einer Schnur. Jede einzeln für sich ist hübsch, aber fädelt man sie zusammen, erhält man ein richtiges Schmuckstück. Wenn wir unseren Job richtig machten, würde sich nach dem Eröffnungstanz, den Trinksprüchen und dem Anschneiden der Torte niemand mehr an das anfängliche Herumgeeiere erinnern. Aber na ja, für eine perfekte Hochzeit – oder Welt – wünschte man sich eben einfach den bestmöglichen Anfang. Denn wie sagt man gleich so schön? Wohl begonnen ist halb gewonnen.
Um 21.47 Uhr war die Tanzfläche immer noch rappelvoll, obwohl die Feier laut Plan um Punkt 22 Uhr hätte zu Ende sein sollen. Die Tatsache, dass ich Jilly bereits vorhin abgesagt hatte, war nur ein schwacher Trost. Es war ein ungewöhnlich heißer Tag für Ende April und die Kombination aus Stress, Sonne und stundenlangem Auf-den-Beinen-Sein hatte ihren Tribut gefordert. Ich wollte nicht ins Bendo gehen, geschweige denn »raus in die Welt«, und erst recht nicht mit zwei mir wildfremden Jungen. Und ich wollte ganz bestimmt nicht tanzen. Dementsprechend müde schüttelte ich also den Kopf, als mich Ambrose Little, der sich mit ein paar weiteren Gästen zum Linedance aufgestellt hatte, auf die Tanzfläche winkte.
Dass ich ablehnte, war ohnehin klar; der Grund dafür war allerdings nicht er. Die goldene Regel bei »Natalie-Barrett-Hochzeiten« lautete: Immer professionell bleiben. Es war keineswegs ungewöhnlich, dass Kunden im Laufe der sich monatelang hinziehenden Planungen eine gewisse Nähe zu uns aufbauten. Mit Emotionen befrachtete, einschneidende Lebensereignisse stiften nicht selten ein allgemeines Gefühlswirrwarr. Aber wie meine Mutter den Aushilfen, die wir gelegentlich bei größeren Veranstaltungen dazuengagierten, stets einbläute: »Keiner will beim späteren Ansehen der Fotos den Hochzeitsplaner zwischen den Gästen entdecken. Wenn wir mit auf dem Bild sind, heißt das einfach nur schlechte Arbeit.«
Es war also nichts Ungewöhnliches, dass ich zum Tanzen aufgefordert wurde. Das passierte oft, vor allem bei Events mit »All-you-can-drink«-Angebot. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, war das Kopfschütteln, mit dem Ambrose mein Kopfschütteln energisch quittierte, um dann mit ausgestreckten Armen auf mich zuzuhalten.
»Tanzen ist heilsam, tanzen versöhnt«, sagte er, als die letzten Takte der Musik verklungen waren und ein neuer Song einsetzte. »Na, komm schon!«
»Nein danke«, sagte ich.
Er wackelte wie wild mit den Fingern, als könnte er mich mit einer Seeanemonen-Imitation umstimmen.
»Ähm, nein. Aber danke trotzdem«, erklärte ich.
»Ambrose!« Eine junge Frau in einem rosa Minikleid und mit nackten Füßen voller Riemenabdrücke, die erkennen ließen, dass sie vorher Sandaletten getragen hatte, rief von der anderen Seite der Tanzfläche zu uns herüber. »Komm! Wir brauchen dich für die Polonaise.«
»Hast du gehört?«, sagte er zu mir. »Polonaise! Da musst du mitmachen!« Ich schüttelte erneut den Kopf. Mit einem Seufzen ließ er den Oberkörper vornüberfallen und stützte sich mit den Händen auf den Knien ab, so als hätte meine Antwort ihm schlagartig alle Kraft genommen. Eine Sekunde später hob er erst den Kopf, dann eine Hand und machte erneut die Seeanemone. »Polonaise. Versöhnung. Los, komm.«
»Nein danke«, sagte ich noch einmal.
Die Gäste fingen an, lachend und mit erhitzten Gesichtern eine Polonaiseschlange zu bilden. Wenn es ein sicheres Anzeichen für den Anfang vom Ende einer Hochzeitsfeier gab, dann war es dies. Ambrose sah zur Tanzfläche rüber, grinste, dann wandte er sich wieder zu mir um. »Keine Bange«, sagte er. »Ich werde auch nicht zu fest zupacken.«
»Du wirst überhaupt nicht zupacken«, sagte ich. »Weil die Antwort immer noch Nein ist.«
»Ich denke, du bist für diese Hochzeit engagiert worden.«
»Bin ich ja auch.«
»Dann solltest du auch tanzen.«
»So läuft das nicht.«
»Wieso nicht?«
Das Letzte, wonach mir der Sinn stand, war, ihm die Aufgaben meines Jobs zu erläutern, während eine chaotische Polonaise auf mich zuschwankte. »Ich bin kein Gast. Ich bin Angestellte. Wir tanzen nicht. Wir arbeiten.«
Er dachte kurz darüber nach. »Okay, dann frage ich dich eben, ob du mein Date sein willst. Du hast jetzt offiziell Feierabend.«
»So läuft das auch nicht«, entgegnete ich.
»Mannomann! Bist du stur!« Er schüttelte den Kopf. Die Stirnlocke, die ich offenbar nicht nicht bemerken konnte, wippte auf und ab. Die Polonaise wand sich jetzt, angeführt von einem rotbackigen Mann mit Zigarre zwischen den Zähnen, um einen Stuhl herum. »Soll das heißen, du wirst auf keinen Fall mit mir tanzen, wie sehr ich auch bitte und bettle? Noch nicht mal, wenn’s eine Polonaise ist?«
»Richtig«, sagte ich.
»Im Ernst?« Er schnitt eine Grimasse. »Mist. Ich hasse es, wenn ich nicht meinen Willen kriege.«
Der Spruch war dermaßen schräg – so arrogant und geradeheraus –, dass mir regelrecht die Spucke wegblieb. Doch noch während die Polonaise hinter ihm in mein Blickfeld rückte und die junge Frau in Rosa ihn johlend am Gürtel griff, keimte in mir der Wunsch auf, ich könnte diesen Gedanken weiterspinnen, den ich selber schon häufiger gehegt hatte, als ich zugeben wollte.
Ich hasse es, wenn ich nicht meinen Willen kriege.
»Tun wir das nicht alle?«, murmelte ich und sah der Polonaiseschlange dabei zu, wie sie an mir vorbeizog und dann zwischen den Tischen hindurchkroch. Und auf einmal war ich an dem Punkt, an dem mir das alles zu viel war – die Farben, die Lebendigkeit, das Lachen. Ich drehte mich um und ging.
3
Auch Ethan forderte mich bei einer Hochzeit zum Tanzen auf und ich sagte Nein. Zuerst.
Das geschah allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Geschichte. Jene Geschichte, die ich früher so gern mit anderen geteilt hatte, inzwischen aber nur noch mir selbst erzählte, ganz leise in meinem Kopf. Man könnte meinen, dass Zeit rückblickend linear verläuft, als würden die Ereignisse mit dem zeitlichen Abstand an die richtige Stelle rücken. Aber eine Geschichte wie diese hatte ein Eigenleben, wurde ständig neu erzählt und erweitert, ob man nun zuhören wollte oder nicht.
Ich tue es schon wieder. In der Zeit hin und her springen. Aber es ist so schwer, am Anfang zu beginnen, wenn man weiß, wie es enden wird.
Es geschah vorigen Sommer bei der Margy-Love-Hochzeit. Meine Mutter übernahm höchst ungern Events, die irgendwo außerhalb stattfanden, und ließ eigentlich immer die Finger davon. Ihr Credo lautete, sie könne selbst nur so gut sein wie ihre Dienstleister, und die waren nun mal allesamt hier vor Ort. Aber Margy Loves Großvater war ein enger Freund von Williams Mutter. Und als ursprüngliche Geldgeberin der Firma hatten die Wünsche von Miss May, wie sie genannt wurde, ein gewisses Gewicht, das konnte nicht mal meine Mutter bestreiten. Miss May war schon über achtzig und lebte in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Sie bat nur selten um einen Gefallen, aber wenn sie es tat, lautete die Antwort immer Ja.
Und so kam es, dass wir im August nach zehnmonatiger Planung via Telefon und Mail mit Margy (in DC
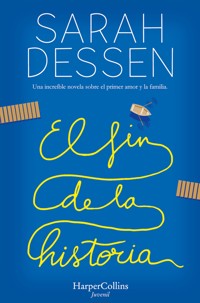

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










