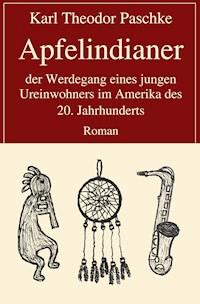
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Taschenbuchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Apfelindianer – außen rot, innen weiß: dieses Schimpfwort haben die Ureinwohner der USA für Angehörige ihres Volkes geprägt, die sich bemühen, in der Welt der Weißen Fuß zu fassen. Keanu Whiteriver gelingt es, die Zurücksetzung und Perspektivlosigkeit der Indianer zu überwinden und erfolgreicher Jurist zu werden, außerdem als Jazzmusiker Karriere zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1203
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Theodor Paschke
Apfelindianer
der Werdegang eines jungen Ureinwohners im Amerika des 20. Jahrhunderts
Roman
p u b l i c b o o k m e d i a v e r l a g
F R A N K F U R T A / M W E I M A R L O N D O N N E W Y O R K
Die neue Literatur, die – in Erinnerung an die Zusammenarbeit Heinrich Heines und Annette von Droste-Hülshoffs mit der Herausgeberin Elise von Hohenhausen – ein Wagnis ist, steht im Mittelpunkt der Verlagsarbeit. Das Lektorat nimmt daher Manuskripte an, um deren Einsendung das gebildete Publikum gebeten wird.
©2015 FRANKFURTER TASCHENBUCHVERLAG FRANKFURT AM MAIN
Ein Unternehmen der Holding
FRANKFURTER VERLAGSGRUPPE
AKTIENGESELLSCHAFT
In der Straße des Goethehauses/Großer Hirschgraben 15
D-60311 Frankfurt a/M
Tel. 069-40-894-0 ▪ Fax 069-40-894-194
E-Mail [email protected]
Medien- und Buchverlage
DR. VON HÄNSEL-HOHENHAUSEN
seit 1987
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.d-nb.de.
Websites der Verlagshäuser der
Frankfurter Verlagsgruppe:
www.frankfurter-verlagsgruppe.de
www.frankfurter-literaturverlag.de
www.frankfurter-taschenbuchverlag.de
www.publicbookmedia.de
www.august-goethe-literaturverlag.de
www.fouque-literaturverlag.de
www.weimarer-schiller-presse.de
www.deutsche-hochschulschriften.de
www.deutsche-bibliothek-der-wissenschaften.de
www.haensel-hohenhausen.de
www.prinz-von-hohenzollern-emden.de
Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, Speicherung, Sendung und Vervielfältigung in jeder Form, insbesondere Kopieren, Digitalisieren, Smoothing, Komprimierung, Konvertierung in andere Formate, Farbverfremdung sowie Bearbeitung und Übertragung des Werkes oder von Teilen desselben in andere Medien und Speicher sind ohne vorgehende schriftliche Zustimmung des Verlags unzulässig und werden auch strafrechtlich verfolgt.
ISBN 978-3-86369-237-7
Inhaltsverzeichnis
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
für Stefanie und Christoph, beide
in New Orleans, La. geboren
Die Vereinigten Staaten von Amerika – das gelobte Land, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten?
Die Gründerväter haben bereits 1776, als Amerika sich seiner kolonialen Fesseln entledigt hatte und seine eigene Staatsphilosophie definierte, in der feierlichen Erklärung der Unabhängigkeit das unveräußerliche „Recht auf Leben, Freyheit und das Streben nach Glückseligkeit“ formuliert. Und die Einwanderungsströme aus allen Himmelsrichtungen haben im Laufe der Jahrhunderte aus Nordamerika in der Tat einen ganz besonderen Kontinent gemacht. Es entstand eine ethnisch bunte Nation. Fast jeder Einwanderer wurde schnell zum hundertprozentigen Amerikaner, ob er nun aus England, Irland, Italien, Deutschland, Frankreich, Polen, Russland, China oder woher auch immer stammte. Soziologen erfanden dafür den bildhaften Begriff vom Schmelztiegel USA. Inzwischen sprechen sie lieber von der Salatschüssel Amerika, denn die Metapher vom Einschmelzen aller Unterschiede stimmt mit der Wirklichkeit der heutigen Vereinigten Staaten nicht mehr überein. Sie hat eigentlich noch nie gestimmt, schon gar nicht in Bezug auf die Indianer, die eingeborenen Amerikaner, die von den weißen Einwanderern nicht etwa integriert oder aufgesogen, sondern verdrängt, ausgegrenzt und teilweise brutal dezimiert wurden.
Die Farbpalette der Vereinigten Staaten ist bis heute von großer Vielfalt. Die Farbe Rot, die für die Ureinwohner steht, ist in dieser Palette aber nur ein kleiner Tupfer. Geht man in New York durch die Straßen und lässt die Leute an sich vorüberziehen, dann blickt man in viele weiße, schwarze, braune oder gelbe Gesichter. Ganz selten nur ist auch eine Rothaut dabei. 2,8 Millionen Menschen mit indianischer Abstammung stellen ja weniger als 2 Prozent der Bevölkerung des Landes dar.
Die meisten Amerikaner kennen Indianer nur aus dem Kino oder vom Fernsehen als gefährliche, mit Pfeil und Bogen bewaffnete, ohne Sattel reitende Wilde. Als lebende Wesen haben sie sie allenfalls in Gestalt der armseligen, wortkargen Schmuckverkäufer an Orten wahrgenommen, wo sich viele Touristen tummeln, so etwa am Grand Canyon oder im Monument Valley. Seltener noch scheu, untätig, betrunken oder mit Rauschmitteln völlig zugedröhnt in irgendeinem trostlosen, heruntergekommenen Reservat.
Wen wundert es da, dass Indianergeschichten in den USA kaum noch Interesse finden, schon gar nicht jetzt, im Zeitalter der Raumfahrt, des Internets und des Smartphones. Tecumseh und Geronimo sind verstaubt, vergessen.
Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen soll hier die Rede sein von einem heutigen Indianer, der unbeirrt daran glaubte, der alte amerikanische Traum, die große Verheißung von Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit der Chancen müsse doch auch für ihn gelten, und der schon als Junge beschloss, das tragische, durch Identitätsverlust, bittere Armut und völlige Perspektivlosigkeit gekennzeichnete Schicksal seines Volkes, der Ureinwohner Amerikas, nicht einfach hinzunehmen.
Nennen wir ihn Keanu Whiteriver.
I.
Im Frühsommer des Jahres 1954 war Keanu in Harlem im Staate Montana zur Welt gekommen, einem kleinen Ort am Rande des Reservats der Assiniboin und Gros Ventre Indianer, in dessen Nähe sich auch der Verwaltungssitz der beiden Stämme, Fort Belknap Agency, befindet. In Harlem gibt es ein kleines bescheidenes Krankenhaus, und Keanus Mutter, Rose Whiteriver, war, eigentlich gegen ihren Willen, da sie wie die meisten Assiniboin-Frauen zu Hause entbinden wollte, schließlich doch auf Anraten ihrer Hebamme dorthin gegangen, weil das zu erwartende Kind wohl über acht Pfund wiegen sollte. Keanu war tatsächlich ein großes, kräftiges Baby gewesen, und Rose hatte viel Blut verloren, aber sie war gut versorgt worden; danach konnte sie aber keine weiteren Kinder bekommen. So wuchs Keanu als Einzelkind auf. Er war Roses Wunschkind und brachte Lachen, Wärme und Zärtlichkeit in ihr Leben, die sie lange vermisst hatte.
Rose kümmerte sich viel um ihren kleinen Sohn. Sie beugte sich über seine Wiege und war glücklich, wenn er mit seinen winzigen Händen ihre Nase anfasste oder an ihren schwarzen glatten Haaren zog und dabei laut krähte. Keanu hatte die gleichen etwas schräg stehenden dunklen Augen über hohen Backenknochen wie seine Mutter. Er wuchs schnell.
Sein Vater, Thomas Whiteriver, nahm nicht viel Notiz von seinem Sohn. Er war ein stiller Mann. Im Reservat nannte man ihn den „Stummen“. Niemand hatte ihn je mehr als zwei Sätze zusammenhängend sprechen hören, meist wirkte er irgendwie teilnahmslos, und nichts schien ihn anzugehen. Dabei hatte er freundliche Augen, und sein Mund deutete ein halbes Lächeln an. Nur wenn er sich dem Alkohol hingab, und das geschah sehr regelmäßig, wurde sein Gesichtsausdruck trübsinnig, die Augen blickten ins Leere. Rose litt unter diesen Phasen. Keanu war ihr Trost.
Thomas Whiteriver hatte, wie so viele seiner Assiniboin-Stammesbrüder, keine regelmäßige Arbeit. Er war groß und schwer, Landwirtschaft erschien ihm zu mühsam, für einen handwerklichen Beruf fehlte es ihm an natürlichem Geschick und auch an einer entsprechenden Ausbildung. Gelegentlich fuhr er mit seinem Kleinlaster Ware für ein Haushaltsgeschäft in Harlem aus; ansonsten wurde der Unterhalt der kleinen Familie von der monatlichen Unterstützungszahlung bestritten, die Indianer in den Reservaten beanspruchen können.
Wie die meisten Indianer lebten die Whiterivers an der Armutsgrenze, und den größten Ausgabeposten in ihrem monatlichen Haushalt stellten der Bourbon Whisky und das Miller High Life Bier dar, mit dem Thomas sich betrank.
Für Rose war diese triste Art von Leben nicht einfach; sie war in einer Assiniboin-Familie aufgewachsen, in der es fröhlich und harmonisch zugegangen war. Sie hatte eine bewusste Erziehung und schulische Bildung genossen. Nach dem Schulabschluss hatte sie zunächst einige Zeit in der Reservatsverwaltung gearbeitet, bis sie ihren Mann kennen lernte. Thomas sackte erst im Laufe der folgenden Jahre rapide ab, er entwickelte Depressionen und kam darüber zum Nichtstun und zum Suff . Keanus Geburt war deshalb für Rose so etwas wie die Erlösung aus einem Dasein ohne jede Zukunftsperspektive.
Das kleine Haus der Whiterivers, ein schmuckloses flaches Holzgebäude mit einem mittelgroßen Wohnraum, einer Küche, einem Doppelschlafzimmer und einer daneben liegenden Kammer für den kleinen Keanu, lag in einer verstreuten und nicht besonders gegliederten Siedlung mitten in dem Reservat, etwa 15 Meilen südlich von Fort Belknap Agency und ebenso weit von der noch südlicher gelegenen kleinen Ortschaft Hays entfernt. Das Reservat der Assiniboins und Gros Ventres war ein Stück flachen, unfruchtbaren Landes, etwa 35 Meilen lang und 20 Meilen breit, im nördlichen Teil der weiten Ebene in der Mitte Montanas. Es wurde am oberen Rand, bei Fort Belknap Agency, begrenzt von der sogenannten Hi-Line, der wichtigen Bundesautostraße 2 und der parallel dazu verlaufenden Eisenbahnlinie der Great Northern Railway Company, weniger als 20 Meilen entfernt von der kanadischen Grenze.
Braun und Grau waren die vorherrschenden Farben in der flachen Savannen-Landschaft, in der die Siedlung wie etwas zufällig dort Hingestreutes lag. Die Vegetation war spärlich. Es gab nur einige kümmerliche Büsche und knorrige Bäume. Braun war auch die Farbe der meisten Häuser und lehmig-braun der Boden um die zwei Dutzend kleinen Anwesen. Der für Orte im ländlichen Amerika sonst so typische sattgrüne und gut gepflegte Rasen, hier fehlte er völlig. Man mochte glauben, die Indianer verzichteten bewusst auf Grün, die Statusfarbe der weißen Siedler, verzichteten damit auch auf das Wochenendritual des knatternden Rasenmähers, sondern bevorzugten die nackte, festgetretene Erde, die sich bei Regen in grauen Schlamm verwandelte. Allerdings regnete es selten in der nördlichen Mitte Montanas. Dagegen blies häufig ein starker Wind, im Sommer kühl, in den Wintermonaten eiskalt peitschend, aus Richtung Kanada, ein Wind, der alles austrocknete. Und über allem wölbte sich der große, weite Himmel Montanas.
Direkt vor den Häusern in der Siedlung parkten mindestens ein, oft auch mehrere Pickup-Trucks älterer Baujahre, so wie früher vor den indianischen Tipis die Pferde angepflockt waren. Zahl und Zustand der Pferde hatten Auskunft über den gesellschaftlichen Rang der Besitzer gegeben. Straßen oder befestigte Wege gab es nicht, auch keine Zäune und Rinnsteine. Eigentlich war das Ganze keine Siedlung, eher eine willkürliche Ansammlung von Häusern und Hütten, zusammengehalten nur durch Trostlosigkeit und sichtbare Verwahrlosung; niemand schien von den zahlreichen leeren Bierdosen und Plastikflaschen, die bei heftigeren Windstößen klappernd hin- und herrollten, und von Schrott- und Müllhaufen Notiz zu nehmen.
Das Anwesen der Whiterivers war noch eins der saubersten, außerdem wies es eine kleine Besonderheit auf. An seiner Rückseite hatte Rose ein bescheidenes Beet angelegt, immerhin ein grüner Fleck in dem braun-grauen Einerlei der Siedlung, auf dem sie Süßkartoffeln, Mangold, Karotten und mehrere Sorten Küchenkräuter zog. Keanu war als Baby zwischen den jungen Pflanzen herumgekrabbelt, später zeigte ihm seine Mutter im Frühjahr das Setzen der Saat und ließ ihn ein kleines Seitenbeet selbst bepflanzen. In den heißen trockenen Sommermonaten musste der Junge regelmäßig gießen – das war die erste selbstständige Pflicht, die er zu erfüllen hatte, wenn ihn Rose auch gelegentlich mit sanfter Stimme daran erinnern musste.
In den benachbarten Häusern der Siedlung wohnten etwa ein Dutzend Kinder, die ungefähr so alt wie Keanu waren, Jungen und Mädchen, denen die traurige, staubige Umgebung und das Fehlen jeglichen Spielgeräts nichts auszumachen schienen und die tagaus, tagein Stunden miteinander draußen verbrachten, mit Nachlaufen, Fangen, Verstecken, sich zankten und wieder vertrugen, lärmend umherzogen, dann zur Abwechslung in kleinen Gruppen flüsternd Verabredungen trafen und Pläne ausheckten, in allerlei Proben und Konkurrenzen ihre Kräfte aneinander maßen und immer neue Einfälle hatten, sich die Zeit zu vertreiben. Rose Whiteriver und andere Mütter hatten nur ab und an von weitem ein Auge auf die Schar und griffen selbst bei Gerangel und lautem Geheule nur ein, wenn es ihnen allzu bunt wurde.Keanu war schon als drei- und vierjähriger Junge recht groß und kräftig, ganz ohne Babyspeck, und seine Bewegungen hatten nichts unbeholfen Hastiges mehr. Er konnte rennen wie ein Blitz, wenn es im Spiel dessen bedurfte, aber ansonsten waren seine Gebärden keineswegs hektisch, eher ruhig, manchmal fast gemessen, wodurch er sich von den anderen Kindern deutlich unterschied. Ähnliches galt von seiner sprachlichen Fertigkeit. Keanu hatte bei seiner Mutter sehr früh und ohne alle kleinkindtypischen Verfremdungen sprechen gelernt. Er redete lebhaft, klar verständlich und verfügte über einen Wortschatz, der weit über den seiner Spielgenossen hinausging. Rose amüsierte sich darüber, war aber auch ein wenig stolz darauf, dass ihr Sohn unter den Nachbarskindern eine unbestreitbare Führungsrolle einnahm, die er sich nicht durch angsteinflößende Ruppigkeit oder körperliche Dominanz, sondern nur durch seine natürliche, freundliche Überlegenheit erworben hatte. Wenn etwas nicht nach seinen Vorstellungen lief, konnte Keanu allerdings recht zornig und aggressiv werden; er war eben ein typisches Einzelkind.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























