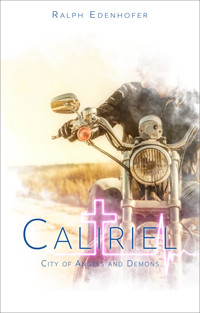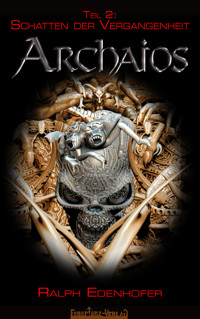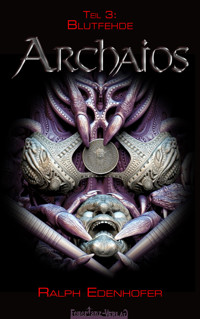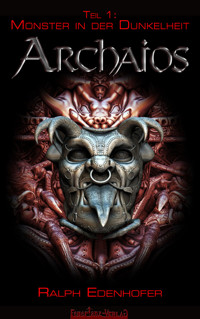
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FeuerTanz-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was ich bin? – Ein bluttrinkendes Monster. Was ich mache? – Ich jage jene, die noch monströser sind als ich. Mein Name ist Leonard von Montesaro. Die meisten meiner Art nennen mich allerdings den Templer. Und ja, einst habe ich tatsächlich dem Orden der kämpfenden Mönche angehört. Doch die Alte Welt habe ich schon vor langer Zeit verlassen. Meine Heimat ist New York. Hier bin ich der Älteste der Unsterblichen. Ich sorge dafür, dass unsere Gesetze eingehalten werden, dass niemand über die Stränge schlägt. Und wer es dennoch tut … Nun, die Unsterblichkeit kann schnell vorbei sein für die Unvorsichtigen. Der Neugeborene, den ich heute jage, scheint einer der üblichen Kandidaten zu sein. Unbeherrscht, unkoordiniert, leichte Beute. Doch bald wird mir klar, dass er nur der Vorbote eines größeren Unheils ist. Eines Unheils, das noch viel älter ist als ich. Und viel gefährlicher. Eines Unheils, das nicht nur mich, sondern die gesamte Stadt ins Verderben zu reißen droht. Teil 1 der Fantasy-Reihe ARCHAIOS
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Teil 1: Monster in der Dunkelheit
Ralph Edenhofer
Inhalt
Vorwort des Autors
Prolog: Erwachen
07. Juni 2003, etwa 100 km südlich von Bagdad, Irak
Teil 1: Monster in der Dunkelheit
Montag, 09. Mai 2005, New York City, USA
Dienstag, 10. Mai 2005, New York City, USA
Sommer 1096, Burg Montesaro, Herzogtum Burgund, Königreich Frankreich
Mittwoch, 11. Mai 2005, New York City, USA
Winter 1096/97, Konstantinopel, Byzantinisches Kaiserreich
Donnerstag, 12. Mai 2005, New York City, USA
Sommer 1099, Jerusalem, Reich der Fatimiden
Freitag, 13. Mai 2005, New York City, USA
Frühjahr 1125, Jerusalem, Königreich der Kreuzfahrer
Samstag, 14. Mai 2005, New York City, USA, Kampf in der Bronx
Frühjahr 1125, Konstantinopel, Byzantinisches Kaiserreich
Anhang
Wie geht es weiter?
Danke
Zum Autor
Personenverzeichnis
Impressum
Archaios
Teil 1: Monster in der DunkelheitTeil 2: Schatten der VergangenheitTeil 3: Blutfehde
Um keine Neuerscheinung aus der Feder von Ralph Edenhofer zu verpassen, gibt’s hier die Anmeldung zum Newsletter: http://eepurl.com/hKnuUH.
Vorwort des Autors
Wer sofort in die Geschichte starten will, kann das Folgende gern überspringen und zum Prolog fortfahren. Zum Verständnis des Romans ist das Vorwort nicht notwendig.
Wer aber neugierig ist, warum der Edenhofer plötzlich auch noch Vampirromane schreibt, für den gibt es hier ein paar Erklärungen.
»Archaios« ist kein abstruses Nebenprojekt und ganz bestimmt keine Abkehr von der Science Fiction, sondern ein Ausflug in meine Vergangenheit. Es ist der erste Roman, den ich geschrieben habe, lange vor »ex vitro«, meiner ersten Veröffentlichung. Vampirgeschichten waren damals mein Lieblingsgenre und ich habe viele Jahre lang eine »Vampire – the Masquerade«-Rollenspielrunde geleitet. Der Einfluss dieses Spiels auf »Archaios« wird dem Kenner im Folgenden nicht verborgen bleiben, auch wenn ich zahlreiche Aspekte des Szenarios verändert habe.
Die Frage, die sich nun unweigerlich stellt, ist, warum ich »Archaios« erst jetzt veröffentliche. Hierauf gibt es mehrere Antworten.
Zum Ersten war es damals bei Weitem nicht so einfach wie heute, einen Roman im Selbstverlag herauszubringen. Von daher wäre eine Verlagspublikation der Weg der Wahl gewesen. Mein erster zaghafter Versuch, in diese Richtung zu gehen, wurde allerdings schnell mit einer Ablehnung bedacht. Und das vollkommen zurecht, denn ich habe mich dabei, wie mir heute bewusst ist, ziemlich dilettantisch angestellt. Nicht weiter verwunderlich als ahnungsloser Anfänger, der ich war.
Ein weiterer Grund war, dass mein geliebtes Vampirgenre zu der Zeit eine recht einschneidende Veränderung durchlief. Die Ursache dafür war Stephenie Meyers Twilight-Reihe, die eine wahre Schwemme von Vampirromanen in Gang gesetzt und gleichzeitig das gesamte Genre in Richtung Liebesgeschichten verschoben hat. Auch Archaios ist nicht vollkommen frei von Romantik, gehört aber eher zur blutigen Unterfraktion des Genres und passte damals nicht in den Zeitgeist.
Infolge dieser thematischen Verschiebung habe ich mich von den Vampiren weitgehend abgewandt und auch das Schreiben eine Zeit lang auf Eis gelegt, so dass »Archaios« in den Untiefen meiner Festplatte Staub ansetzte.
Als ich einige Jahre später einen neuen Versuch gestartet habe, einen Roman zu vollenden, habe ich mich in die Science Fiction begeben und es entstand die c23-Reihe mit dem bereits erwähnten Debüt »ex vitro«. Das war dann auch, ebenso wie die Nachfolger, recht erfolgreich und hat mir großen Spaß bereitet, so dass ich – abgesehen von kleinen Ausflügen in die Urban Fantasy – dabei geblieben bin. »Archaios« habe ich als Übungsstück angesehen, als Test, an dem ich viel gelernt habe, der aber besser bleibt, wo er ist.
Anfang 2020 habe ich allerdings nach langer Zeit mal wieder einen Vampirroman gelesen – zugegebenermaßen einen der romantischen Sorte (hallo Sarah ;-) ) – und wieder ein wenig Geschmack an meinem einstigen Lieblingsgenre bekommen. In der Folge habe ich das alte »Archaios«-Manuskript aus der Versenkung befreit und beim Durchlesen festgestellt, dass mir einige Passagen doch recht gut gefallen. Es folgte eine komplette Überarbeitung, vor allem stilistisch, sowie die Aufteilung des Mammutwerks in drei Teile. Anschließend habe ich das Manuskript an mehrere meiner bewährten Testleser gegeben und mehrheitlich positive Rückmeldungen bekommen, so dass in mir ganz langsam der Entschluss Gestalt angenommen hat, das doch zu veröffentlichen. Und – tada! – hier ist es.
Stilistisch unterscheidet Archaios sich trotz der intensiven Überarbeitung immer noch erheblich von meinen jüngeren Werken. Die gröbsten Fehler, die ich damals gemacht habe, sind hoffentlich ausgemerzt, aber ich war halt noch recht unerfahren, was das Schreiben betrifft. Das eine oder andere würde ich heute anders angehen, doch ich wollte den Charakter des Buches nicht vollkommen umkrempeln. Es ist eben, wie es ist.
All den Lesern, die mich über meine Science Fiction-Romane kennen, rate ich, sich erst mal die Leseprobe zu Gemüte zu führen, bevor sie das Buch kaufen. Und wer erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkt, dass es ihm doch nicht so recht zusagt, der sei vielleicht dadurch getröstet, dass Band 1 der mit Abstand kürzeste und damit auch kostengünstigste der Reihe ist.
Aber natürlich hoffe ich, dass der eine oder andere bis zum Ende durchhält und vielleicht sogar die Folgebände erwerben möchte.
Wie auch immer, viel Spaß beim Lesen.
Ralph
P.S.: Um der Frage vorzugreifen, ob ich noch weitere unveröffentlichte Schätze auf meiner Festplatte horte: Nein. Zumindest keine, die über wenige Zeilen oder maximal ein einsames Testkapitel hinausgehen.
Prolog: Erwachen
07. Juni 2003, etwa 100 km südlich von Bagdad, Irak
Ireen schlug die Augen auf. Undeutlich erkannte sie das Innere ihres Zeltes. Mehr als verschwommene Konturen konnte sie allerdings nicht ausmachen. Helles Licht blendete sie und sie kniff die Augen unwillkürlich wieder zu. Die Finsternis, die sie empfing, war jedoch nicht vollständig. Bilder tanzten hinter den geschlossenen Lidern. Ein dunkler Raum, tief verborgen unter tausenden Tonnen massiven Gesteins. Ein Raum, der dort eigentlich nicht sein dürfte. Und in dem Raum … eine Gestalt? Ein Wesen? Nein, nur eine Stimme. Worte, die sie nicht verstand. Doch die Bedeutung war offensichtlich. Etwas rief sie zu sich. Wollte, dass sie zurückkehrte, tief unter die Erde.
»Alles in Ordnung, Doc?«
Sie brauchte eine Weile, bis sie den Inhalt des Gesagten erkannte. Diese Stimme war ihr vertraut. Und anders als die Einflüsterungen in der fremden Sprache, die körperlos durch ihren Geist hallten, nahm sie die besorgte Frage mit den Ohren wahr. Für einen Moment verbanden sich Realität und Fantasie zu einer Einheit. Dann verblasste der Nachhall des Traumes, der sie so unsanft geweckt hatte.
»Doc?«
Das einzelne Wort holte sie endgültig zurück in die Wirklichkeit. Etwas vorsichtiger als beim ersten Versuch wenige Augenblicke zuvor, öffnete sie die Augen. Aus den groben Schemen schälten sich die Umrisse eines Stuhls, eines Tischs und einer hochgewachsenen Person. Nach einem weiteren Blinzeln sah sie das Gesicht von Corporal Hausman über der Uniform des US-Militärs.
»Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen?«, brummte sie und setzte sich vorsichtig auf. »Ich bin kein Doc. Nicht mehr.«
»Für mich sind Sie’n Doc.« Er zwinkerte ihr zu und deutete mit dem Daumen zum Eingang des Zeltes. »Wir müssen los! Kommen Sie?«
Mit einer unkoordinierten Handbewegung scheuchte sie ihn davon. »Bin gleich da.«
»Alles klar.« Hausman wandte sich zum Gehen um, hielt dann jedoch inne und stand unschlüssig herum, ohne sie anzusehen. Er hatte offensichtlich noch etwas auf dem Herzen.
Ireen ahnte, worum es ging. »Was ist?«
Er zögerte einen Augenblick, bevor er antwortete, legte sich die Worte zurecht. »Sollen wir nicht doch den Boss informieren und mehr Leute anfordern?«
»Nein!« Ireen war selbst überrascht von der Schärfe ihrer Erwiderung. Eine vollkommen irrationale Furcht ergriff sie angesichts der schieren Erwähnung der Möglichkeit, weitere Personen mit einzubeziehen. Es war ihr Fund. Sie würde ihre Entdeckung mit niemandem teilen. Noch nicht.
»Nein«, wiederholte sie mit sanfterer Stimme, »zuerst führen wir die Erkundung zu Ende. Dann geben wir Mr. Dupré einen vollständigen Bericht.«
»Wie Sie meinen.« Die Zweifel in seinen Worten waren unüberhörbar, doch er fügte sich. »Ich richte schon mal alles her, damit wir gleich loslegen können.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ er sie allein.
Das Aufstehen wurde von heftigem Protest ihrer Muskeln begleitet. Die Plackerei der vergangenen Tage machte sich bemerkbar und verdeutlichte ihr, dass sie keine Zwanzig mehr war.
Hausmans Vorschlag, weitere Leute für die Drecksarbeit hinzuzuziehen, würde ihr ersparen, wieder selbst zu Hacke und Spaten greifen zu müssen. Doch um deren Bezahlung sicherzustellen, müsste sie ihrem Auftraggeber zumindest einen Zwischenbericht liefern. Und das wollte sie um jeden Preis vermeiden.
Woher ihre fast schon fanatische Abneigung, Mr. Dupré Bericht zu erstatten, kam, war ihr selbst nicht klar. Der Fund, den sie gemacht hatten, war ein mehr als ausreichender Grund, ihn einzuweihen. Mit Sicherheit würde er ihr unverzüglich mehr Mittel und Personal zur Verfügung stellen, was ihre Arbeit erheblich erleichtern könnte. Doch sie verspürte das tiefe Verlangen, so wenige Leute wie irgend möglich damit zu betrauen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Nicht wirklich professionell, aber sie hatte in der Vergangenheit gute Erfahrungen damit gemacht, ihrem Bauchgefühl zu vertrauen. Oder ging es weniger um ihre Intuition als um diese Träume? Seit sie die Kammern erforschten, wurden die Bilder, die sie jede Nacht heimsuchten, immer intensiver. Und auch die Stimme. Diese verführerische, lockende Stimme, die sie zu sich zu rufen schien. Wurde sie langsam verrückt? Auf imaginäre Traumstimmen zu hören, war definitiv kein Bestandteil ihrer Ausbildung. Obwohl sie schon seit Jahren von der akademischen Gemeinde ausgeschlossen war, prägte die Wissenschaft ihr Denken noch immer. Dennoch hatte sie das drängende Gefühl, erst einmal allein weitermachen zu müssen.
Also kein Bericht. Stattdessen auf zur Arbeit!
Stöhnend schwang sie die Beine aus dem Feldbett und nahm die Feldflasche von der über der Lehne ihres Klappstuhls zusammengelegten Trekkinghose. Mit fahrigen Bewegungen schüttete sie sich etwas Wasser in die linke Hand, um sich damit durchs Gesicht zu wischen. Das anschließende Zähneputzen fiel ebenso wie das Waschen eher kurz aus. Aber es half, den faden Geschmack des Schlafs aus ihrem Mund zu spülen.
Nach der minimalistischen Körperpflege schlüpfte sie in die Hose, zog die Weste über das T-Shirt, in dem sie geschlafen hatte, und steckte ihre Füße umständlich in ein Paar abgewetzte Armeestiefel. Sie band die hellblonden Haare zu einem Pferdeschwanz, hatte jedoch Mühe, sie alle zu bändigen. Wie üblich entkamen ihr einige Strähnen, so dass sie wieder ständig damit beschäftigt sein würde, sie sich aus dem Gesicht zu wischen, wenn sie den Kopf nach unten drehte. Was bei Ausgrabungen zwangsläufig öfter vorkam. Sie vervollständigte ihr Outfit mit der L.A. Raiders-Baseballmütze und bemühte sich erfolglos, die losen Haarsträhnen unter der Kappe zu sortieren. Dann verließ sie das Zelt.
Die Sonne, die sie nach dem Aufwachen noch geblendet hatte, wanderte zielstrebig zum Horizont. Es wurde wirklich Zeit aufzubrechen.
Hausman stand neben der Feuerstelle in der Mitte ihres Mini-Camps aus drei Zelten. Gemeinsam mit den beiden bärtigen einheimischen Helfern war er gerade dabei, die Rucksäcke auf den Humvee zu packen, den er besorgt hatte. Ireens Augen blieben an den ausgeprägten Muskeln hängen, die sich unter dem Army-T-Shirt abzeichneten. Sie schätzte den Corporal auf Mitte Zwanzig. Eigentlich viel zu jung für sie. Aber die Auswahl an Frauen war hier im Irak nicht sonderlich groß. Und sie war für ihr Alter noch recht ansehnlich, wie sie fand. In den Tagen, die sie zusammen arbeiteten, hatte er nie eine Frau oder Freundin erwähnt. Vielleicht …
Stopp!
Wirre Träume, imaginäre Stimmen und zu allem Überfluss noch das innige Verlangen ihrer Hormone nach blutjungen Soldaten. Sie war im Augenblick wirklich reichlich neben der Spur. Aber wenn sie heute Nacht endlich fanden, was sie erhoffte, wäre ein wenig Feiern durchaus angebracht. Die Sektflasche in ihrem Gepäck war zwar nicht kalt, aber an einem Ort wie diesem musste man Kompromisse schließen. Und wer weiß, wozu ausgehungerte GIs mit ein bisschen Alkohol zu animieren waren. Doch erstmal mussten sie die Arbeit vollenden. Ohne Ergebnis keine Belohnung.
Sobald alles, was sie benötigten, auf das Fahrzeug geladen war, stieg sie auf der Beifahrerseite ein. Hausman – erst jetzt wurde Ireen bewusst, dass sie seinen Vornamen gar nicht kannte – schnippte seinen Zigarettenstummel in den Sand und ließ sich auf dem Fahrersitz nieder. Die beiden Iraker kletterten auf die Ladefläche.
Das Minicamp befand sich am Rand eines gesicherten Bereiches, den die US-Truppen nahe den Ruinen des antiken Babylon eingerichtet hatten. Humvees, Lastwagen und Panzer standen in langen Reihen neben der Straße zum ersten Kontrollpunkt. Hausman lotste den Wagen und die drei zivilen Passagiere sicher an seinen Kameraden vorbei. In voller Gefechtsmontur und mit Sturmgewehren im Anschlag bewachten sie die schmalen Lücken zwischen den endlos erscheinenden Barrieren aus Gräben, Zäunen und NATO-Draht. Den üblichen Hinweis, dass es keine gute Idee war, das Lager nach Sonnenuntergang zu verlassen, nahmen die Insassen des Humvees dankend entgegen.
Offiziell war Ireen wissenschaftliche Beraterin der US-Truppen. Wie genau Dupré es geschafft hatte, ihr diesen Status zu verleihen, war ihr schleierhaft. Vermutlich mit Geld. Viel Geld. Damit löste er alle Probleme, die zwischen ihm und seinen Zielen lagen. Auch Hausman und sie selbst hatte er auf diese Weise für sich gewonnen. Was er ihr für einen Tag hier bezahlte, hätte sie als Archäologin nicht in einer Woche verdient.
Der Hungerlohn, den sie als Assistentin an einer Uni oder einem anderen Institut bekommen hätte, entsprach nicht ihren Vorstellungen vom Leben. Private Sammler exklusiver Antiquitäten wie Dupré waren da erheblich großzügiger. Sie hatte es nie bereut, die Seiten gewechselt zu haben, selbst wenn die arroganten Uni-Wichser ihr deshalb den hart erarbeiteten Doktortitel aberkannt hatten. Als Ausgleich wohnte sie zu Hause in Kalifornien in einem sündhaft teuren Strandhaus und fuhr ein Corvette Cabrio. Dafür verzichtete sie gern auf akademische Ehren.
Der Job hier bot die Chance, ihr endgültig ein sorgenfreies Leben zu bescheren. Der Krieg und die Besetzung des Irak durch die US-Truppen und ihre Verbündeten hatten alle Beschränkungen für unabhängige Grabungsteams aufgehoben. Zwar nicht offiziell – dass sie hauptsächlich nachts arbeiteten, war ein Zugeständnis an die Beteuerung der US-Regierung, sämtliche archäologischen Stätten zu schützen –, aber de facto scherte sich derzeit niemand darum, wer zwischen Euphrat und Tigris Löcher in den Boden grub.
Die Fahrt dauerte weniger als eine halbe Stunde. Als sie ihr Ziel erreichten, war die Sonne endgültig hinter dem Horizont verschwunden. Die Scheinwerfer des Humvees fielen auf ein paar unscheinbare, halb von Sand bedeckte Plastikplanen, die aussahen wie achtlos weggeworfener Müll.
Ungeduldig sprang Ireen aus dem Wagen und zog eine der Planen zur Seite. Der Schacht, der darunter zum Vorschein kam, sah exakt so aus, wie sie ihn am vergangenen Morgen verlassen hatten. Niemand hatte ihr Geheimnis entdeckt.
Die Höhle lag abseits aller bekannten Grabungsstätten, knapp zwanzig Kilometer von den Ruinen Babylons entfernt. Dass sie noch unerforscht war, beruhte auf einem absoluten Glücksfall. Ein Einheimischer hatte sie schon vor Jahren gefunden, aber – vermutlich nicht ganz zu Unrecht – befürchtet, das herrschende Regime würde ihn nicht angemessen dafür entlohnen, wenn er sein Wissen preisgab. Also hatte er sich auf verschlungenen Pfaden an ausländische Interessenten gewandt und war in Mr. Duprés weit offene Arme gelaufen. Dessen bisherige Bemühungen, den vermuteten Schatz zu heben, waren eher bescheiden gewesen. Die Iraker wachten eifersüchtig über alle Spuren der Antike. Saddam Hussein selbst war ein glühender Bewunderer der uralten Geschichte seines Landes. Doch all das stellte nun kein Hindernis mehr dar.
Im Gefolge der Invasionstruppen fluteten Heerscharen von Schatzsuchern und Raubgräbern den Irak. Die meisten von ihnen waren Amateure. Eine archäologische Ausbildung, wie Ireen sie genossen hatte, besaßen die Wenigsten von ihnen. Das ermöglichte es den Profis, sich auf die wirklich lohnenden Stätten zu konzentrieren.
Wie diese hier.
Nachdem Ireen zum ersten Mal in die Höhle eingedrungen war und in knapp zehn Metern Tiefe eine antike Mauer mit einem unbekannten Siegel entdeckt hatte, wusste sie, dass dort etwas Großes darauf wartete, ans Licht der Welt gebracht zu werden. Oder in den Verkaufsraum einer illegalen Versteigerung.
Unbändiger Eifer erfasste sie, sobald der Schacht sich vor ihren Stiefeln auftat. Ungeduldig trieb sie Hausman und die beiden Iraker zur Eile an. Einer der Einheimischen, Bahram mit Namen, hielt, wie üblich, oben Wache. Nur für den Fall, dass irgendjemand die nächtlichen Aktivitäten entdeckte. Sein Kamerad, Massoud, machte sich daran, zusammen mit ihr und Hausman die Arbeit fortzusetzen.
Wortlos stiegen sie auch heute wieder, schwer bepackt mit Werkzeugen, die improvisierte Leiter hinab in die Tiefe. Nur der Schein ihrer Taschenlampen durchschnitt die Finsternis. Der einheimische Entdecker hatte den Schacht bereits vor dem Krieg von Jahrhunderte altem Schutt befreit und die Wände provisorisch mit hölzernen Paletten verstärkt. Die Auskleidung wirkte nicht übermäßig stabil, doch bisher hatte sie gehalten. Warum sollte sich daran ausgerechnet in dieser Nacht etwas ändern?
Mit geübten Schritten folgte Ireen dem GI. Hinter ihr stieg Massoud hinab. Sie bewunderte sein Geschick, als er ihr, nur mit Sandalen an den Füßen, ohne Probleme hinterherkam.
In mehr als zehn Metern Tiefe erreichten sie den Boden des Schachtes. Die Lichtkegel der Taschenlampen fielen auf die Mauer, die den weiteren, von hier ab waagrechten Verlauf der Höhle unzählige Jahrhunderte lang verschlossen hatte. Einer nach dem anderen zwängten sie sich durch das Loch, das sie vor vier Tagen in die Lehmziegelwand gebrochen hatten.
Sie betraten eine Höhle, die mit der unscheinbaren Öffnung, durch die sie hierher gekrochen waren, nicht viel gemeinsam zu haben schien. Der Boden war eingeebnet und die Wände mit Lehmziegeln ausgekleidet. Hausmans Scheitel berührte fast die Decke, so dass er den Kopf ein wenig einzog, um nirgends anzustoßen. Ireen und der Iraker konnten problemlos aufrecht stehen. Langsam arbeiteten sie sich den Tunnel entlang zur ersten Kammer. Der Raum war ebenso hoch wie der Gang und hatte einen quadratischen Grundriss mit einer Seitenlänge von etwa vier Metern. In der Mitte jeder Wand führte ein Durchgang zu weiteren Kammern. Im Zentrum des Raumes stand eine massive Granitstele, die fast bis zur Decke reichte. Sie war von oben bis unten mit eingemeißelten Schriftzeichen bedeckt. Der Großteil bestand aus in Keilschrift geschriebenem Akkadisch, im antiken Mesopotamien die Sprache der Priester und Gelehrten, vergleichbar dem früheren Status des Lateins in Europa. Die Inschriften hatten Ireen endgültig überzeugt, einen bedeutenden Fund gemacht zu haben. Sie hatte nur Bruchstücke der Zeichen übersetzt, doch sie war sicher, dass es sich um Bannsprüche und Flüche handelte, wie sie auch von den ägyptischen Pharaonengräbern bekannt waren. Solche Zauberformeln fand man üblicherweise nur in den Grabstätten wichtiger Persönlichkeiten. Ireen hatte tagsüber bereits Stunden damit verbracht, einen Hinweis auf den Namen des Verstorbenen in den Inschriften zu suchen, außer den Bezeichnungen babylonischer Götter jedoch nichts gefunden.
Die Luft in der Kammer war stickig und es stank penetrant nach den Ausscheidungen von Fledermäusen. Bislang hatten sie aber keines der Tiere entdeckt. Ireen war darüber nicht böse. Sie holte ihr Halstuch aus dem Rucksack und band es sich über die Nase. Hausman schien der Gestank weniger auszumachen. Er zog die Hacke aus seinem Gepäck und lehnte den Rucksack gegen eine Ziegelwand.
»Auf geht’s!« Mit entschlossener Miene trat er in den Tunnel, der dem Eingang gegenüberlag. Was ihm an archäologischer Ausbildung fehlte, machte der junge Soldat durch Einsatzfreude wett. Auch ihn trieb die Aussicht auf Mr. Duprés fürstliche Bezahlung an, wenn sie das fanden, was Ireen erhoffte.
Sie und Massoud bewaffneten sich mit Schaufeln, ließen den Rest ihres Gepäcks in der Kammer zurück und folgten dem GI. Nach wenigen Metern gelangten sie in eine weitere, längliche Kammer von etwa der halben Grundfläche des vorherigen Raumes. Sie hatten die gesamte gestrige Nacht damit verbracht, den Schutt beiseite zu räumen, der den Boden bedeckt hatte und nun sorgsam in einer Ecke aufgehäuft lag. Vorsichtig hangelte Ireen sich an dem Seil, das Hausman mit Kletterhaken in die Wand geschlagen hatte, am Rand der Fallgrube entlang. Bis auf zwei handbreite Simse an den Seiten erstreckte das Loch sich über die ganze Breite der Kammer. Die Abdeckung der Grube war eingestürzt und lag als Trümmerhaufen fünf Meter tief zwischen den rostigen Überresten eiserner Pfähle, die in den Boden eingelassen und zweifellos dazu gedacht waren, Grabräubern ein schnelles Ende zu bereiten und sie von allem, was dahinter lag, fernzuhalten. Bis gestern hatte der Plan sogar funktioniert.
Hausman streckte ihr die Hand entgegen und half ihr, den Absatz auf der anderen Seite der Grube sicher zu erreichen. Ihr irakischer Begleiter blieb zurück und warf ihnen Hacke und Schaufel hinüber.
»Sie warten hier!«, wies Ireen ihn begleitet von Handzeichen an.
Ihr Arabisch war eher bescheiden, so dass sie lieber auf Englisch mit den Einheimischen sprach. Darin waren zwar weder Bahram noch Massoud besonders geübt, aber dank Fingerzeigen und sonstigen Gesten waren sie und ihre beiden Helfer mittlerweile recht eingespielt, so dass Massoud ihre Absicht offenbar erkannte. Er kauerte sich auf den Boden, nestelte die Tüte mit Gummibärchen, die sie ihm vorgestern geschenkt hatte, aus seiner Hosentasche und begann genüsslich, die Süßigkeiten zu kauen. Er hielt eines der Bärchen hoch und grinste ihr zu, um seinen Dank für das Geschenk zu signalisieren. Ireen lächelte zurück.
Dann wandte sie sich dem gemauerten Durchgang zu, der weiter in die Dunkelheit führte. Nach zwei Metern war der Gang von einem Schutthaufen versperrt. Bis hierher waren sie letzte Nacht gekommen, bevor sie Schluss gemacht hatten. Ireen erinnerte sich an ihren irrationalen Widerwillen, den Ort zu verlassen. Doch Hausman hatte sie davon überzeugt, dass es unklug gewesen wäre, über den Sonnenaufgang hinaus hier zu verweilen, wenn ihre Aktivitäten weiterhin unentdeckt bleiben sollten.
Nun ging es endlich weiter. Ireen konnte es kaum erwarten.
Der GI hatte bereits begonnen, die Fels- und Ziegelbrocken aus dem Weg zu räumen. Da der Tunnel zu eng war, sie auf der Seite aufzuhäufen, reichte er sie nach hinten an Ireen weiter, die sie mangels alternativer Plätze in die Fallgrube warf.
Die Arbeit in der stickigen Luft war anstrengend. Nach kurzer Zeit waren Hausmans und Ireens Haut von einem dichten Schweißfilm bedeckt. Die Plackerei lenkte sie von der unmittelbaren körperlichen Nähe zu dem Soldaten ab, worüber sie sehr froh war. Auf unkontrollierte Hormonschübe konnte sie momentan gut verzichten.
Sie ackerten fast zwanzig Minuten, bis sie den Durchgang so weit frei geräumt hatten, dass sie weiter vordringen konnten. Ireen wischte sich mit dem Ärmel ihres T-Shirts den Schweiß von der Stirn und bedeutete Hausman, dass sie vorgehen wollte. Mit der Schaufel in der einen und der Taschenlampe in der anderen Hand zwängte sie sich an ihm vorbei. Sie bemühte sich, ihn dabei möglichst wenig zu berühren, was ihr nur bedingt gelang.
Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen. Sie prüfte jeden Tritt sorgsam, bevor sie ihr Gewicht verlagerte. Eindringlich erinnerte sie sich an die Fallgrube hinter ihnen und hielt intensiv Ausschau nach weiteren Überraschungen, die die Architekten des Gewölbes vor über zweitausend Jahren für unvorsichtige Eindringlinge hinterlassen hatten. Der Tunnel erstreckte sich weitere zwei oder drei Meter, bevor er von einer Mauer versperrt wurde. Ireen befreite die Ziegel mit der Hand vom Staub und deckte eine eingemauerte Steinplatte mit weiteren Schriftzeichen auf. Sie nahm ihren Pinsel aus einer der Westentaschen und legte die Keilschrift vollständig frei.
»Können Sie das lesen?«, fragte Hausman hinter ihr, während er im Schein der Taschenlampen die Platte über ihre Schulter hinweg betrachtete.
Ireen konzentrierte sich. Ihr ehemaliger Professor an der Uni hätte damit keine Mühe gehabt. Er konnte Akkadisch nahezu ebenso schnell lesen wie Englisch. Doch auf seine Hilfe konnte sie derzeit schwerlich zurückgreifen.
»Hier wird wieder Marduk genannt.« Ihr Finger strich über die Zeichen, während sie ihre Sprachkenntnisse bemühte.
»Wer ist das?«, fragte Hausman. »Ein König, der hier begraben liegt?«
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Marduk war eine antike Gottheit. Der ehemalige Stadtgott von Babylon.« Sie strich sich eine vorwitzige Haarsträhne aus dem Gesicht. »Das Ganze ist ziemlich ungewöhnlich. Der Aufbau des Grabes und die Flüche in den Inschriften erinnern mich eher an ägyptische Anlagen als an babylonische.«
»Und das bedeutet?«
Ihre Antwort war ein Achselzucken. »Ich habe keine Ahnung. Alles reichlich merkwürdig hier.«
»Aber es ist ein Grab, oder? Ein bisher unentdecktes Grab einer bedeutenden Persönlichkeit.«
»Definitiv.«
Die Antwort schien ihn zufriedenzustellen.
»Los! Weiter!«
Trotz der zurückliegenden Strapazen wurde sie von neuem Elan erfasst. Sie verspürte das Bedürfnis, die Mauer vor ihr auf der Stelle einzureißen. Glücklicherweise verlangte Dupré nicht, dass alle Funde sorgfältig dokumentiert wurden, wie es unter Archäologen üblich war. Sein Interesse galt nicht theoretischen Studien, sondern handfesten Objekten, die er meistbietend verkaufen konnte.
Tatendurstig griff Ireen zu Hacke und Schaufel und begann, die uralte Ziegelwand abzutragen, während Hausman den Schutt zur Seite räumte. Lediglich bei der Entfernung der Steinplatte mit der Inschrift ließen sie Vorsicht walten. Sammler liebten solche Objekte.
Der Gestank, der von der anderen Seite der Mauer zu ihnen drang, war bestialisch.
»Riecht eher nach Verwesung als Fledermausscheiße«, stellte Hausman mit gequälter Miene fest.
Ireen nahm kurz ihr Halstuch vom Gesicht und schnüffelte vorsichtig.
»Sie haben recht.« Angeekelt wandte sie sich wieder ab.
Es dauerte eine Weile, bis Ireens Nase sich so weit an den neuen Gestank gewöhnt hatte, dass sie ihren Kopf durch das Loch streckte, das sie in die Wand geschlagen hatte. Der Lichtkegel ihrer Taschenlampe strich über das Innere einer weiteren Kammer. In ihrer Mitte erhob sich ein massives Steingebilde.
»Der Sarkophag!«, rief Ireen begeistert. Mit der Schaufel hieb sie einige weitere Ziegelsteine aus der Mauer. Dann reichte sie das Werkzeug nach hinten zu dem GI durch und begann, sich durch die Öffnung zu zwängen. In der Kammer angekommen, leuchtete sie Wände und Decke an und blieb mit offenem Mund stehen, während sie ihren Blick nicht abwenden konnte.
Furcht überkam sie. Nackte, ungefilterte Furcht. Sie hatte diesen Raum schon einmal gesehen, war bereits hier gewesen. Die Bilder aus ihren Träumen waren immer wenige Sekunden nach dem Erwachen verblasst, so dass es ihr unmöglich gewesen wäre, den Ort zu beschreiben, den ihr Geist Nacht für Nacht besuchte. Doch nun war sie vollkommen sicher, wie er aussah.
Sie stand darin. Wach. Real.
Ihr Verstand sagte ihr, dass das, was sie gerade sah, rundweg unmöglich war, und sie sich in ernsthaften Schwierigkeiten befand. Doch sie war absolut unfähig, auch nur in Erwägung zu ziehen, diesen Ort zu verlassen. Sie fühlte sich … willkommen. Als ob sie erwartet würde. Ihr Blick wandte sich dem massigen Sarkophag in der Mitte des Raumes zu. Erwartet von wem?
Hausmans Ankunft riss sie jäh aus ihren Überlegungen. Er hatte mit seinem breiten Kreuz und den langen Beinen deutlich mehr Mühe, durch das Loch in der Mauer zu kriechen als sie. Schließlich entschloss er sich dazu, mit Kopf und Händen voran hindurch zu schlüpfen und die Beine hinterherzuziehen. Ireen war immer noch zu gefangen von dem Anblick, der sich ihr darbot, als dass sie auf die Idee gekommen wäre, ihm zu helfen. Leise Flüche ausstoßend kam auch er auf allen vieren in der Kammer an.
Ein anerkennendes Pfeifen entwich seinen Lippen, als er sich aufrichtete und seine Taschenlampe auf die Wände richtete. »Nicht übel.«
Ireen hätte andere Worte verwendet, wäre sie nicht absolut sprachlos gewesen.
Die Lichtkegel der beiden Lampen strichen über fugenlosen polierten Rosenquarz, der vollständig mit Schriftzeichen bedeckt war. Abgesehen von den Trümmern der eingerissenen Ziegelwand lag kein einziger Krümel auf dem rot glänzenden Boden.
»Ist das die letzte Kammer?« Hausmans Faszination war offenbar weniger ausgeprägt als ihre. Er klang geradezu enttäuscht. »Kein Gold? Keine Grabbeigaben?«
Ireen ignorierte seine Feststellung. Schweigend wagte sie einen weiteren Schritt in dem Raum hinein und bestaunte, was sich ihren Augen darbot. »Das ist absolut unmöglich!«, hauchte sie schließlich. Ihre Finger strichen über die Wand. »Es sieht so aus, als wäre die gesamte Kammer aus einem einzigen Stein gehauen.«
»Und?« Hausman verstand nicht, worauf sie hinauswollte.
»Wie soll so ein Brocken hier herunterkommen?«, erklärte sie, ohne den Blick von den Wänden zu nehmen. »Durch das kleine Loch?« Sie deutete auf den aufgebrochenen Eingang. »Der Raum ist mindestens drei Meter in jeder Richtung. Das geht nicht durch eine Öffnung, die bloß einen Meter breit ist. Und außerdem, wie soll so etwas bearbeitet worden sein?«
Etwas Erstaunliches geschah in diesem Moment. Die Forscherin in ihr, die sie vor vielen Jahren an Dupré und andere seiner Art verkauft hatte, erwachte zu neuem Leben. Sie erkannte die Sensation, die sie entdeckt hatte. Vergleichbar mit dem Grab des Tut Ench Amun oder sogar noch gewaltiger. Wenn das bekannt würde, ging ihr Name in die Geschichte der Archäologie ein.
Doch neben der Aussicht auf Ruhm und Reichtum loderte in ihr noch ein weiteres, ungleich heißeres und unberechenbareres Feuer. Die jeder Rationalität widersprechende geometrische Beschaffenheit dieses Ortes reihte sich nahtlos ein in die aberwitzige Vertrautheit, die sie empfand. Und das, obwohl seit vermutlich tausenden von Jahren kein lebender Mensch diesen Ort betreten hatte. Die Übereinstimmung mit ihren Träumen stand im krassen Widerspruch zu Ireens festem Glauben an Logik und Kausalität.
Doch das Schlimmste war der unbändige Drang, den nächsten, den finalen Schritt auf dem Weg zu gehen, der sie hierher gebracht hatte.
Sie drehte sich zu dem Sarkophag, der ebenfalls aus rotem Quarz bestand. Im Gegensatz zu den Wänden war er vollständig schmucklos. Sie leuchtete auf den Sockel, hockte sich hin und strich mit dem Finger darüber.
»Der Sarkophag ist aus demselben Steinblock wie der restliche Raum«, hauchte sie ehrfürchtig.
Hausman gesellte sich zu ihr. »Ist da drin wenigstens Gold?« Seine Hand fuhr über den glatt polierten Stein und hielt an der Oberseite inne. »Der Deckel ist nur draufgelegt.«
Auch Ireen erhob sich aus der Hocke und betrachtete die steinerne Platte. Sie legte ihre Taschenlampe auf den Boden und ergriff den Deckel mit vor Erregung zitternden Händen. »Dann lassen Sie uns mal sehen, was da drin ist!«
Ohne weitere Worte legte der Soldat seine Lampe ebenfalls zur Seite und packte mit an. Zuerst schien es, als würde der Deckel sich keinen Millimeter von der Stelle rühren. Doch dann gab er mit einem Ruck nach. Stöhnend vor Anstrengung schoben sie weiter, bis sie eine etwa zwanzig Zentimeter große Öffnung freigelegt hatten.
Ireen hob ihre Lampe auf und leuchtete ins Innere des Sarkophags.
Die goldene Fratze eines Monsters starrte sie an. Unwillkürlich zuckte sie zusammen, ehe sie sich wieder unter Kontrolle gebracht hatte.
Hausman drängte sich fest an sie, um ebenfalls einen Blick in den Sarkophag zu erhaschen. »Endlich.« Tiefe Erleichterung sprach aus dem einen Wort, das er von sich gab. »So gefällt mir das schon besser.«
Ireen nahm den Kontakt zwischen ihren schweißbedeckten Armen nicht wahr. Ihr ganzes Bewusstsein war auf die goldene Maske gerichtet, die das Gesicht des Begrabenen bedeckte. Das vorstehende Maul mit den spitzen Zähnen erinnerte sie an einen Wolf, der sein Gebiss fletschte. Die kurze Nase glich den Nüstern eines Gorillas und die Augen waren drohend zusammengekniffen. Drei Reihen goldener Hörner zogen sich, beginnend auf der Stirn, der Länge nach über den Schädel. Insgesamt erweckte das Ungetüm den Eindruck, direkt der Hölle entsprungen zu sein, wirkte dabei aber so lebensecht, dass Ireen sich beinahe einbildete, das zum Anblick der Kreatur passende Grollen und Knurren zu hören.
Sie leuchtete tiefer in den Sarkophag und stieß erneut die Luft aus.
»Es ist eine Mumie«, keuchte sie mit bebender Stimme. »Ich kann die Arme sehen. Und Rippen.«
»Noch mehr Gold?«
Sie ignorierte Hausmans Frage und schaute genauer am Leib der Mumie hinab. »Sie scheint nicht bandagiert zu sein. Aber auf der Brust liegt ein weiteres Objekt. Irgendwas Längliches. Sieht fast so aus, als ob es eher in der Leiche drinsteckt als draufliegt.« Die Worte sprudelten aus ihr heraus. Ihre Begeisterung über den Fund erreichte einen neuen Höhepunkt. Brennende Ungeduld bemächtigte sich ihres sonst so analytischen Verstandes.
Der GI rümpfte die Nase und deutete mit dem Kinn auf die Mumie. »Der Kerl ist es, der hier so stinkt.«
Ireen hatte es in ihrer überwältigenden Faszination gar nicht bemerkt, aber jetzt, wo Hausman es erwähnte, musste sie ihm recht geben. Der Verwesungsgeruch, der die Grabkammer erfüllte, war im Sarkophag eindeutig am schlimmsten.
Sie ließ sich von dem Gestank nicht zurückhalten. »Halten Sie mal!« Sie reichte den Soldaten die Taschenlampe, bevor sie sich dem Leichnam zuwandte. »Dann wollen wir uns mal dein Gesicht ansehen.« Vorsichtig griff sie nach der goldenen Monstermaske.
Sie konnte das Verlangen, das Antlitz des Unbekannten zu enthüllen, nun endgültig nicht mehr unterdrücken. Unwiderstehlich fühlte sie sich von der Mumie angezogen und war nicht bereit, auch nur eine Minute länger zu warten, ihr das Geheimnis, das sie barg, zu entreißen.
Vorsichtig legte sie ihre Finger um den Rand der Maske, aus einem ihr nicht bewussten Grund unwillkürlich darauf bedacht, die spitzen Fangzähne des Mauls nicht zu berühren. Zentimeter um Zentimeter hob sie das massive Gold an. Es wog schwer in ihren Händen. Ganz langsam legte sie es auf dem schief über dem Sarkophag liegenden Quarzdeckel ab und zischte den GI an: »Leuchten Sie auf sein Gesicht!«
Er tat, wie ihm geheißen, und richtete den Lichtkegel wieder in den Sarkophag.
»Großer Gott!«, entfuhr es ihr und auch Hausmans Lippen entfleuchte ein gehauchter Fluch.
Die Leiche schien sie geradewegs anzustarren. Die Augen des Toten lagen tief in den Höhlen, doch es waren eindeutig Augäpfel vorhanden, mit kleinen Pupillen inmitten einer im Licht der Taschenlampe rötlich schimmernden Iris. Der Blick durch die geöffneten Lider erweckte den Eindruck, direkt auf Ireen gerichtet zu sein.
Augenblicklich schlug er sie in seinen Bann. Vertrieb die Erkenntnis, dass das, was sie sah, jeglicher Vernunft widersprach.
Sie nahm die Züge des Gesichtes der Mumie kaum wahr. Die hervortretenden Wangenknochen, über die sich vertrocknete Haut spannte. Die verschrumpelten Lippen, unter denen die makellosen Zähne der Leiche hervorlugten. Die kunstvoll geflochtenen Locken des Bartes, der bis auf die Brust reichte. Die langen schwarzen Haare, die das Gesicht einrahmten.
Sie sah nur die Augen. War wie gelähmt. Konnte sich keinen Millimeter bewegen. Nicht einmal zu blinzeln vermochte sie, als wollte sie es nicht riskieren, auch nur den Bruchteil einer Sekunde lang dem Blick des Toten auszuweichen. Sie hörte sogar auf zu atmen. Verlor jegliches Gefühl für die Zeit oder ihre Umgebung. Ihr gesamtes Denken war bestimmt von den beiden roten Augen, deren Blick sich in ihr Innerstes zu bohren schien, ihr ganzes Dasein restlos ausfüllte.
»Doc! Was ist mit Ihnen?«
Sie konnte Hausmans Stimme hören, doch der Sinn der Worte erreichte ihr Bewusstsein nicht. Wie in Trance hob Ireen schließlich den rechten Arm und griff in den Sarkophag. Ihr Blick wich dabei nicht von den Augen des Toten. Ohne hinzusehen, legte sich ihre Hand zielsicher um das Objekt, das in seiner Brust steckte. Tief in ihrem Inneren hatte sie das Gefühl, etwas ganz furchtbar Falsches zu tun. Doch sie hatte jegliche Macht über ihren Körper verloren.
»Doc! Was tun Sie da?« Hausman packte sie mit der freien Hand und versuchte, sie von der Leiche wegzuzerren. Ireen packte mit der Linken den steinernen Rand des Sarkophags und hielt sich daran fest. Konnte nicht zulassen, den Blick von den roten Augen abzuwenden. Den Augen, die ihr alles bedeuteten. Denen sie ihr Leben geben würde. Für die sie töten würde.
Sie legte all ihre Kraft in ihren rechten Arm und zerrte an dem Pflock in der Brust der Leiche. Er steckte tief, doch Ireen spürte, wie er sich bewegte, zuerst langsam, dann gab er mit einem Ruck nach und war heraus.
»Doc!«, rief Hausman erneut.
Von einem Augenblick zum nächsten war sie wieder Herr ihrer selbst. Sie gab dem Zerren des GIs nach. Abrupt zog er sie einen Meter zurück. Um ein Haar wären beide hingefallen, doch Hausman fing den Sturz mit einer Hand an der polierten Steinwand der Kammer ab. Die Taschenlampe, die er gehalten hatte, fiel scheppernd zu Boden, ging jedoch nicht aus.
Ireen sah dem Soldaten in die Augen. Sie hob ihre rechte Hand und blickte entsetzt auf den blutigen Pflock, den sie umklammert hielt. Ein einzelner Tropfen rann an seiner Spitze hinab. Langsam ließ Hausman sie los. Ihre Augen suchten erneut die seinen, doch sein Blick war auf etwas hinter ihr gerichtet.
Atemlos drehte sie sich um. Sie sah vier Finger, nur aus Haut bestehend, die sich lose über die Knochen legte. Die umfassten den Rand des Sarkophags. Die beiden Grabräuber starrten wie gelähmt auf das Unmögliche, das sich unmittelbar vor ihnen abspielte. Langsam erhob der Kopf der Mumie sich über die Kante. Die roten Augen richteten sich auf Ireen. Die verschrumpelten Lippen des Toten öffneten sich und gaben den Blick frei auf lange Fangzähne. Laute verließen den schwarzen Schlund, Worte ein einer fremden Sprache.
Ireen kannte die Stimme nur zu gut. In vielen Nächten hatte sie zu ihr gesprochen.
Ein mumifizierter Arm schnellte vor und griff nach Ireens Hals. Wie ein Schraubstock bohrten die knöchernen Finger sich in ihr Fleisch, zogen sie zu dem weit aufgerissenen Maul. Sie wollte sich wehren, doch ihre Gliedmaßen versagten ihr den Dienst. Sie war zur Zuschauerrolle verdammt. Nicht einmal in der Lage zu schreien, als die Zähne ihre Haut perforierten.
Dann starb sie.
Teil 1: Monster in der Dunkelheit
Montag, 09. Mai 2005, New York City, USA
Als ich hier angekommen bin, habe ich New York gehasst. Die Stadt war schmutzig und aus allen Ecken drang der Gestank, den zu viele Menschen auf zu engem Raum zwangsläufig hervorrufen.
Seitdem hat sich einiges geändert. Mittlerweile habe ich gelernt, die Vorzüge der Stadt, die niemals schläft, zu schätzen. Man kann sich daran gewöhnen, dass man überall Läden findet, die vierundzwanzig Stunden am Tag geöffnet sind. Besonders, wenn man einen Tagesrhythmus hat wie ich.
Ich stehe, wie so oft, auf der Aussichtsplattform des Empire State Buildings und genieße die Weite um mich herum. Hier oben ist die Luft rein. Speziell heute Nacht, da eine leichte Brise vom nahen Atlantik herüberweht. Am Nachthimmel über mir treiben nur wenige Wolken träge dahin, so dass der Mond und viele Sterne zu sehen sind. Zumindest für New Yorker Verhältnisse viele. Das Lichtermeer des urbanen Organismus unter mir überstrahlt alle bis auf die hellsten. Abertausende beleuchtete Fenster zeichnen die Konturen der Hochhäuser und Wolkenkratzer überdeutlich nach. Obwohl streng nach dem Schachbrett der Straßen und Avenues ausgerichtet, wuchern Glas, Stahl und Beton einem Dschungel gleich in sämtliche Richtungen und dem Himmel entgegen. So weit das Auge reicht, ist das Land bereits unter der Metropole begraben. Noch tiefer leuchten die Laternen und die Scheinwerfer der unzähligen Autos. Hupend und lärmend drängen sie sich durch die Straßen wie Blutkörperchen durch die Adern eines Menschen und halten das urbane Monstrum aus Stein, Stahl und Beton am Leben.
Hier oben ist das Konzert von Manhattans Bodenlevel nur als fernes Wirrwarr wahrzunehmen, als unausweichliches Hintergrundrauschen der Metropole. In das unablässige Hupen mischen sich die Sirenen aus den Dienstwagen übereifriger Polizisten. Die Streifencops haben es sich zur Aufgabe gemacht, durch ständiges An- und Ausschalten der Signalhörner einen individuellen Stil zu kreieren und sind sehr erpicht darauf, ihre neuesten musikalischen Errungenschaften dem Rest der Stadt kundzutun. Neuankömmlingen beschert der Lärm, der Manhattan rund um die Uhr erfüllt, meist einige schlaflose Nächte. Aber nach wenigen Tagen haben die meisten sich daran gewöhnt. Und wenn man ein paar Jahre hier gelebt hat, empfindet man es gar als unangenehm, wenn es nachts ruhig ist. Dies betrifft diejenigen, die des Nachts schlafen, genauso wie die anderen, die in der Dunkelheit zu Hause sind. So wie ich.
Die letzten Touristen verlassen die Aussichtsplattform. Höflich macht William, der bullige Sicherheitsmann mit dem tadellos gebügelten Zweireiher, sie darauf aufmerksam, dass das ›Empire‹ nun für den Publikumsverkehr schließt.
Der uniformierte Hüne sieht zu mir herüber. »N’Abend, Sir.« Er hebt seine Hand an die Schirmmütze, bevor auch er im Inneren des Wolkenkratzers verschwindet. Ob er weiß, dass der Gruß auf das Mittelalter zurückgeht und das Aufklappen des Helmvisiers symbolisiert?
Dass ich noch bleiben darf, hat zwei Gründe: Erstens wohne ich in einem Luxusappartement wenige Stockwerke tiefer. Wahnsinnig exklusiv und geradezu obszön teuer. Nicht der einzige, aber mit Sicherheit der kostspieligste Luxus, den ich mir gönne. Und zweitens habe ich bei Williams Aufstieg vom Ex-Häftling zum stellvertretenden Sicherheitschef des Empire State Buildings tatkräftig nachgeholfen. Seine ewige Dankbarkeit garantiert, dass ich keine Schwierigkeiten bekomme, wenn ich mir die eine oder andere Freiheit im Umgang mit den Vorschriften herausnehme.
Ich erfreue mich an dem Moment der Einsamkeit mitten in einer der größten Städte, die die Menschheit hervorgebracht hat. Aus dem Stand springe ich nach oben und komme auf zwei weit nach innen gekröpften Stahlstreben zum Stehen. Sie halten den mehr als mannshohen Zaun, der die Aussichtsplattform umschließt. Die Sohlen meiner Stiefel mit den unter dem Leder verborgenen Stahlkappen finden wenig Halt auf den nur zentimeterbreiten gebogenen Streben. Nur ein einziger Schritt trennt mich von dreihundertzwanzig Metern senkrechtem Fall in den einladend beleuchteten Abgrund. Mein Trenchcoat flattert offen im Wind. Ich schließe die Augen. Sauge begierig die kühle Luft in meine Lungen. Inhaliere den Geruch der Nacht. Ich bleibe mehrere Minuten unbewegt hier oben stehen. Frage mich, ob ich irgendwann vielleicht doch den einen, letzten Schritt gehen werde, der mir die Erlösung bringt. Erlösung von meinem Dasein. Erlösung von so vielen Erinnerungen, die mich Nacht für Nacht peinigen. Erlösung von den Anklagen der Gesichter, die vor meinem geistigen Auge erscheinen. Gesichter von Personen, denen ich großes Leid zugefügt habe. Unzählige Gesichter. Vielleicht gehe ich den Schritt sogar heute? Warum nicht jetzt gleich?
Ich schiebe den linken Fuß langsam nach vorne, bis nur noch der Absatz den Stahl berührt. Strecke ihn so weit vor, dass sich unter der Stahlkappe lediglich Luft erstreckt – dreihundertzwanzig Meter bis zum Asphalt.
Erlösung.
Dann kriecht die Angst in meine Eingeweide. Nackte panische Furcht steigt in mir auf. Furcht vor dem, was mich erwartet, wenn ich den Schritt gehe. Ich ziehe den Fuß wieder zurück. Zwinge mich dazu, es ebenso langsam zu tun, wie ich ihn nach vorne geschoben habe, obwohl die Panik mir befiehlt, diesen Ort so schnell wie möglich zu verlassen. Ich kämpfe gegen die Furcht an. Versuche, sie in ihre Schranken zu weisen. Unter großer Anstrengung gelingt es mir, noch eine Minute still auf dem Zaun zu stehen. Die Angst weiß, dass sie gewonnen hat, und zieht sich langsam zurück. Heute werde ich den Schritt nicht gehen. Ebenso wie in den unzähligen Nächten zuvor, in denen ich hier gestanden habe. Schließlich beende ich das Ritual, das ich mindestens ein Mal in der Woche hier oben veranstalte. Springe auf den Boden der Aussichtsplattform. Schüttele die Schwermut ab und konzentriere mich stattdessen auf die Arbeit, die heute Nacht ansteht. Wenn ich es schon nicht schaffe, meinem Dasein ein Ende zu setzen, dann sollte ich es wenigstens mit etwas Nützlichem füllen.
Mit schnellen Schritten strebe ich dem Ausgang entgegen und gehe zum Fahrstuhl. Wenige Stockwerke tiefer betrete ich mein Appartement und lege den Trenchcoat ab. Ich öffne den Kleiderschrank und hole meine Berufskleidung heraus: ein langärmliges Kettenhemd aus matt geschwärzten Stahlringen mit einer Lage Kevlar darunter. Letzteres ist eine überaus stillose Entweihung des altehrwürdigen Kleidungsstückes, aber ein notwendiges Zugeständnis an die Weiterentwicklung der Feuerwaffen in den letzten paar hundert Jahren.
Mit geübten Handgriffen lege ich die Rüstung an, stecke den Saum des Hemdes unter den Bund der Jeanshose und ziehe einen anthrazitfarbenen Rollkragenpullover darüber, der auch die Halspanzerung aus Kettengeflecht gut bedeckt. Dann schnalle ich meinen ledernen Schwertgurt um. Oben drüber kommt wieder der graue Trenchcoat. Derart gewappnet verlasse ich mein Domizil und fahre mit dem Fahrstuhl ganz nach unten.
Zeit, zur Arbeit zu gehen.
Auf der Straße angekommen, wandere ich zielstrebig durch die Straßenschluchten von Midtown Manhattan. Fifth Avenue. Die Promenade der Reichen und Schönen. Den immer hastigen Gang der New Yorker, der den Eindruck vermittelt, die Einwohner des urbanen Molochs wären ständig auf der Flucht vor imaginären Verfolgern, habe ich mir schon lange zu eigen gemacht. Das Schwert baumelt unter dem Trenchcoat leicht hin und her. Bei jedem Schritt stößt es gegen meinen Oberschenkel. Ein beruhigendes Gefühl. Links und rechts von mir erheben sich die Giganten aus Stahl und Beton, die von ferne die berühmte Skyline bilden. Hier unmittelbar zwischen den Wolkenkratzern haben sie auf mich die gleiche Wirkung wie ein dunkler Wald. Sie bieten Schutz durch ihre undurchdringlichen, wie urzeitliche Baumriesen aufragenden Fassaden mit unzähligen Schlupflöchern, in denen man sich vor Gefahr verbergen kann. Dieselben Löcher gewähren jedoch auch meinen Feinden Zuflucht. Der Trick bei dem uralten Spiel des Jagens und gejagt Werdens ist, die anderen zuerst zu sehen. Darin bin ich recht gut. Deswegen wandele ich immer noch durch diese Welt.
Meine Sinne sind geschärft. Mein Blick taxiert jeden Passanten, dringt in jeden Hauseingang ein. Meine Ohren horchen auf jedes Gespräch, jeden Schritt, jedes Grummeln und Fauchen der Motoren in den vorbeirauschenden Autos. Meine Nase riecht Schweiß, Parfüm, Autoabgase. Meine trainierten Instinkte kategorisieren alle Wahrnehmungen verlässlich in Gefährliches und Harmloses.
Diejenigen Passanten, die über ähnliche Instinkte verfügen, erkenne ich sofort daran, dass sie unwillkürlich Abstand zu mir halten. Sie können weder die Rüstung noch das Schwert sehen, doch sie spüren unbewusst die Gefahr, die von mir ausgeht. Erahnen das Raubtier in ihrer Mitte.
Die meisten Menschen sind für derartige Empfindungen blind. Alles, was sie erblicken, ist ein nicht übermäßig hochgewachsener Mann mit kurzgeschorenem dunklen Haar und einem schmal geschnittenen Bart. Das Auffälligste an mir sind zwei alte Narben, die das Geflecht erster Faltenansätze durchkreuzen, wie sie typisch für einen Mittvierziger sind. Eine erstreckt sich über der rechten Augenbraue. Die andere zieht sich die linke Wange entlang und verschwindet unter den Haaren des Bartes. Erinnerungen an lang vergangene Kämpfe.
Doch weder diese offensichtlichen Spuren noch meine stets in alle Richtungen wachsamen Augen vermögen die Normalbürger korrekt zu interpretieren. Die Ignoranten verlassen sich darauf, von Polizisten, Sicherheitsdiensten und anderen Institutionen vor sämtlichen Gefahren bewahrt zu werden. Sie haben verlernt, ihren Instinkten zu vertrauen. Für diejenigen, die ich jage, sind sie wie Vieh, das sich bereitwillig zur Schlachtbank führen lässt.
Mein Blick trifft auf ein Augenpaar keine zwanzig Zentimeter über dem Boden. Der Yorkshire-Terrier sieht mich direkt an, gibt ein unterwürfiges Jaulen von sich. Es ist so leise, dass sein junges Frauchen, das in ein angeregtes Gespräch mit einem versnobten Mittfünfziger verwickelt ist, es nicht hört. Der Hund beeilt sich, hinter ihren hochhackigen Schuhen Sicherheit vor mir zu suchen. Das Erbe des Wolfes, von dem es abstammt, ist dem Schoßhündchen kaum anzusehen, doch seine Instinkte hat es noch nicht gänzlich verloren. Ganz im Gegensatz zum Begleiter seines Frauchens, der mich beinahe angerempelt hätte und meine Nase mit einer penetranten Wolke eines reichlich missratenen Aftershaves beleidigt. Für einen Augenblick lodert ein Anflug von Wut in mir auf. Ich verspüre das Bedürfnis, dem aufgetakelten Gecken die gerechte Strafe für seine Ignoranz zukommen zu lassen. Doch so schnell, wie er gekommen ist, verfliegt der Zorn wieder. Ich lasse das Pärchen seiner Wege ziehen. Der Terrier wirft mir noch einen Blick zu, als wolle er sicherstellen, dass ich ihnen nicht folge. Sein Wunsch wird erfüllt. Diese Nacht habe ich ein anderes Ziel.
Ich gehe am Plaza Hotel vorbei, dessen einst luxuriöse Suiten vor wenigen Jahren in Eigentumswohnungen für Leute umgewandelt worden sind, die nicht wissen, wo sie ihr Geld hinstecken sollen. Angesichts meines exklusiven Appartements steht es mir allerdings wohl kaum zu, mich über diese Darstellungsform übertriebenen Reichtums zu echauffieren. Je ein kurzer Blick nach links und rechts in die neunundfünfzigste Straße zeigen keine Anzeichen von Gefahr. Mit schnellen Schritten überquere ich die Grand Army Plaza und strebe dem Eingang des Central Parks entgegen. Die mobilen Hot Dog-Buden, die tagsüber an jeder Ecke des Parks ihre stinkenden Waren unters Volk schmeißen, stehen zugeklappt und sauber aufgereiht am Straßenrand.
Der Übergang von der selbst nachts noch geschäftigen Einkaufsstraße zur Einsamkeit des Parks könnte kaum drastischer sein. Schon nach wenigen Schritten bleibt der Lärm der Metropole hinter mir zurück. Das Grummeln der Motoren, das unablässige Plappern der Menschen und das allgegenwärtige Hupen verschwimmen zu einem fernen Geräuschbrei, in dem jedes Detail verschwindet.
Tagsüber ist der Central Park überfüllt mit Menschen, die danach trachten, der Hektik der Großstadt für kurze Zeit zu entfliehen und sich der Illusion von freier Natur hinzugeben. Nachts gibt es in der ganzen Stadt keinen verlasseneren Ort als diesen. Zumindest was die braven und rechtschaffenen Bürger angeht. Nach Sonnenuntergang gehört der Park dem lichtscheuen Gesindel. Penner, Gangster und Dealer bevölkern nun die Bänke, Beete mit immer frischen Blumen der Saison und lichten Wäldchen. Wohl geordnete Gärten wechseln sich mit der Illusion unberührter Natur ab. Doch auch die scheinbar wild wachsenden Bäume sind ausnahmslos von Heerscharen von Gärtnern gepflanzt worden und werden fürsorglich gehegt und gepflegt. Zumindest tagsüber. Um diese Uhrzeit haben die Besucher des Parks anderes im Sinn.
Ich kann die Gestalten hören, die sich in den Büschen verkriechen, wenn ich an ihnen vorbeimarschiere und meine Schritte im Kies des Weges knirschen. Keiner von ihnen wagt es, sich mir in den Weg zu stellen oder gar, mich anzugreifen. Ich rieche ihre Furcht, während sie sich hinter Sträucher und Mäuerchen ducken und glauben, ich würde sie nicht bemerken. Sie wissen, dass es gefährlichere Bewohner der Nacht gibt als Gangster und Räuber und lassen vorsichtshalber die Finger von allem, was sie nicht einschätzen können. Ein einsamer Mann im Trenchcoat, der mittig den Kiesweg entlangschreitet, gehört offenbar in diese Kategorie. Um auch die Anfänger unter den Banditen davon zu überzeugen, dass es keine gute Idee ist, mir mit einem Messer in der Hand den Weg zu versperren und nach meiner Brieftasche zu verlangen, öffne ich den Trenchcoat und lasse die Schwertscheide hervorlugen. Ein weiterer Grund, New York zu mögen, ist die unüberschaubare Zahl von wirren Exzentrikern und grundehrlichen Verrückten, die hier in aller Öffentlichkeit ihr Unwesen treiben. In dieser obskuren Versammlung fällt ein einsamer Wanderer mit vernarbtem Gesicht und Schwert unterm Mantel kaum auf. Zumindest innerhalb gewisser gesellschaftlicher Schichten. Die nächtlichen Parkbewohner gehören dazu. Sie werden sich vermutlich kopfschüttelnd über den durchgeknallten Freak amüsieren, wenn sie hinter mir aus ihren Verstecken kriechen und sich wieder ihren illegalen Geschäften widmen. Hauptsache, sie lassen mich in Ruhe.
Nach einer knappen Viertelstunde Fußmarsch durch den Park nähere ich mich meinem Ziel, dem Teich, der unter der wenig einfallsreichen Bezeichnung ›The Lake‹ bekannt ist. Seit mehreren Minuten habe ich kein Anzeichen menschlichen Lebens mehr wahrgenommen. Selbst die Unterwelt der Stadt meidet diesen Ort neuerdings. Auch ich werde etwas vorsichtiger und schleiche abseits der Wege zwischen Bäumen und Büschen zum Ufer. An einem Baumstamm hängt noch ein Rest schwarz-gelb gestreiften Plastikbandes. Damit hat die Polizei heute Morgen den Fundort der letzten Leiche abgesperrt, bis die Spurensicherung fertig war. Vier Menschen sind dem Täter bisher zum Opfer gefallen. Zumindest nach den Angaben aus der Zeitung. Allesamt Obdachlose und Gangster, die kein ehrbarer Bürger der Stadt vermisst. Entsprechend unmotiviert verlaufen die Nachforschungen der Polizei. Die Presse hingegen hat sich der Morde mit großem Eifer angenommen und nennt den Täter in einem geradezu poetischen Anfall publizistischen Irrsinns den ›Reißwolf‹. Die aufgeschlitzten Leichen sowie das Fehlen von Herzen und Lungen in den zerstückelten Leibern einiger der Opfer wird offiziell dahingehend gedeutet, dass es sich bei dem Täter um einen Organräuber handelt. Wenn meine Vermutung stimmt, ist dies gar nicht mal so weit von der Wirklichkeit entfernt. Im Gegensatz zu den Sensationsjournalisten glaube ich jedoch nicht, dass die fehlenden Körperteile auf irgendeinem schwarzen Markt für Transplantationsmediziner landen. Ich befürchte, der Reißwolf hat eine viel unmittelbarere Verwendung für seine Beute.
Ich hocke mich ins sauber gemähte und von zahllosen Schuhen plattgedrückte Gras. Die Schwertscheide liegt auf dem Boden auf. Ich suche. Rieche.
Obwohl seit dem Mord fast vierundzwanzig Stunden vergangen sind, hängt immer noch ein Hauch von Blut in der Luft. Ich sehe Spuren geronnener Flüssigkeit im niedergetretenen Gras. Das einst kräftige Rot ist zu einem stumpfen Braun verkommen. Ich erkenne, wo die Leiche gelegen hat, reiße einige Halme aus und halte sie mir vor die Nase. Bemühe meinen wertvollen Verbündeten, meinen Instinkt, und frage ihn um Rat. Was würde ein Wesen, dessen Triebe seinen Verstand vollends ausgelöscht haben, tun, nachdem es hier gehockt und in rasender Gier das Herz seines Opfers verschlungen hat? Ich lasse den Blick in die Umgebung schweifen. Der Mond ist aufgegangen und hüllt den Park in fahles Licht. Meine Augen bleiben an einer kleinen Gruppe Bäume hängen. Sie stehen dicht gedrängt am gegenüberliegenden Ufer des Teicharmes, an dem ich kauere. Weit und breit stellen sie den besten Sichtschutz dar. Dorthin würde ich gehen, um mich nach vollendeter Mahlzeit zu verbergen und auszuruhen. Zumindest, wenn ich mein Großhirn nicht bemühen und mich voll und ganz den Einflüsterungen des Stammhirns ergeben würde. So wie jemand es tut, der seine Opfer ausweidet, um ihre noch warmen Innereien zu fressen.
Ich stehe auf und gehe um den Teich herum zu der Baumgruppe. Kein Zweig oder trockenes Blatt gerät unter meine Stiefelsohlen. Mit weicher Lautlosigkeit absorbiert das Gras meine Schritte. Ich sende alle meine Sinne in die Umgebung.
Nichts.
An den Bäumen angekommen, wische ich einige Zweige zur Seite und trete in das Gehölz. Die Äste stehen hier zu nah zusammen, um sich geräuschlos weiter zu bewegen, also versuche ich, die Tücken des Geländes durch Langsamkeit wettzumachen. Ein kleines Bächlein rinnt durch das Unterholz in den Teich. Sein leises Plätschern übertönt meine zeitlupenartigen Schritte. Ich bücke mich und finde frisch abgebrochene Zweige. Wer auch immer hier vor mir eingedrungen ist, war weitaus weniger vorsichtig, als ich es bin. Ich sauge Luft ein. Rieche an den Blättern. Werde fündig. Noch mehr geronnenes Blut. Ich bin auf dem richtigen Weg.
Ich folge den Spuren, die der Mörder hinterlassen hat, bis zu einem Gullydeckel. In dem beinahe natürlich wirkenden Gestrüpp wirkt er furchtbar fehl am Platz. Doch wie der gesamte Central Park inklusive aller Teiche und Bäche, Hügel und Felsen, ist auch dieses hübsche Uferwäldchen komplett künstlichen Ursprungs. Die Architekten des Parks haben ihre Spuren allerdings sehr kunstvoll vor dem ungeschulten Auge verborgen. Die Tore zur Welt hinter dem Park liegen in unzugänglichen Ecken wie eben diesem Wäldchen versteckt. Ich knie mich neben den Gully und streiche mit dem Finger über den Rand des Deckels. Viele Zugänge zur Unterwelt des Central Parks werden nur zur jährlichen Wartung oder gar nicht mehr geöffnet. Moos und Rost versiegeln sie regelmäßig. Diesen hier nicht. Die Fugen sind offen und neben dem Deckel sind eindeutig die frischen Spuren zu sehen, wo er nach dem Öffnen abgelegt worden ist.
Ich sitze ganz still, horche und rieche erneut. Nichts deutet darauf hin, dass außer mir noch jemand hier ist. Ich stecke meine Finger in die Löcher des eisernen Gullydeckels, hebe ihn ohne Mühe an und lege ihn möglichst leise neben den Eingang des Schachtes, der vor mir senkrecht nach unten in die Dunkelheit führt. Der Geruch nach Fäulnis und Moder dringt aus der Schwärze herauf. Doch noch ein weiterer Duft strömt mir aus der Tiefe entgegen.
Blut.
Er war hier.
Erneut halte ich inne und horche angestrengt. Nichts zu hören.
Ich stemme die Hände auf den Boden und schwinge meine Beine in das Loch. Meine Stiefel finden die rostigen Steigeisen. Bedacht klettere ich hinab. Der Schacht führt nur drei Meter nach unten. Ich hole die Stifttaschenlampe aus der Brusttasche des Trenchcoats. Der schwache Lichtschein reicht aus, um meinen an die Dunkelheit gewöhnten Augen einen Überblick zu verschaffen. Ich stehe in einer kleinen, aus Ziegeln gemauerten Kammer. Aus der Wand ragt eine rostige Ventilarmatur wie das Steuerrad eines Lastwagens. Vermutlich kann man damit den Zufluss des Bächleins verschließen. Auf dem Boden liegt ein unappetitlicher roter Haufen. Er ist die Quelle des Blutgeruches. Ich halte den Lichtkegel darauf. Halb zerkaute Innereien. Der Reißwolf hat wohl gemerkt, dass sein Magen das Fleisch nicht behalten kann. Nur das Blut zählt. Der Rest kommt wieder heraus. Wie ich vermutet habe: Er ist vollkommen unerfahren. Ein neugeborener Vampir ohne Mentor, der ihm beibringt, sein neues Dasein zu meistern. Wild, aber wenig berechnend. Eine lösbare Aufgabe.
Ich sehe mich weiter um. Der einzige Ausweg neben dem Schacht, durch den ich heruntergekommen bin, ist ein niedriger gemauerter Tunnel, der waagerecht in die Finsternis führt. Ich leuchte mit der Lampe hinein. Einige Ratten flüchten mit hastigen Trippelschritten aus dem Lichtkegel. Danach kehrt Stille ein. Nur das leise Tropfen von Wasser dringt an meine Ohren. Es rinnt durch die Decke in den Tunnel und überzieht den Boden mit einem feuchten Film. Unter diesen widrigen Bedingungen versagen selbst meine lang trainierten Schleichkünste. Jeder meiner Schritte wird von einem Schmatzen auf dem nassen Boden begleitet, während ich mich mit eingezogenem Kopf langsam vorwärts bewege. Kakerlaken und Asseln sind meine einzigen Begleiter. Gelegentlich kann ich das Fiepen der Ratten hören. Doch sie verkriechen sich in einem der zahlreichen Ziegelrohre, die in den Tunnel münden, sobald das trübe Licht meiner Stiftlampe die Dunkelheit beiseiteschiebt.
Nach einem Weg von mindestens zweihundert Metern endet der Gang vor mir in einem größeren Quertunnel. Dem Rauschen von Wasser und Fäkaliengestank nach zu urteilen, hat mich mein Weg in die Kanalisation geführt. An solchen Tagen frage ich mich, ob ich den richtigen Job gewählt habe. Aber irgendjemand muss ihn machen und ich bin nun mal einer der besten darin. Jeder das, was er kann. Ich beschränke mich auf einen stummen Seufzer, um dem Universum meine Begeisterung für die Aussicht darauf kundzutun, wieder einmal nass und stinkend nach Hause zu kommen, und gehe weiter.
Der Abwasserkanal ist fast zwei Meter breit und besitzt auf jeder Seite einen schmalen Sims, auf dem ich zumindest aufrecht stehen kann.
Meine Freude darüber, den Kopf wieder ausstrecken zu können, ist jedoch von kurzer Dauer. Kaum dass ich den Kanal betreten habe, höre ich unmittelbar neben mir ein grollendes Knurren, das sich nur zu deutlich über das Rauschen des Abwassers erhebt. Aus dem Augenwinkel sehe ich gerade noch, wie eine in flatternde Lumpen gehüllte Gestalt auf mich zu springt, bevor sie schwer auf meine rechte Schulter prallt. Der Schwung der plötzlichen Attacke reißt mich von den Füßen. Gemeinsam mit dem Angreifer stürze ich von dem schmalen Sims mitten in Richtung der übelriechenden Brühe. Noch im Fallen ramme ich der Kreatur den Ellbogen gegen den Kiefer und halte sie auf diese Weise davon ab, ihre unmenschlich langen Fangzähne in meinen gepanzerten Hals zu versenken. Mit lautem Platschen durchdringen wir die Wasseroberfläche. Mein Versuch, mich im Fall mitsamt meinem Gegner zu drehen, so dass er zuunterst aufkommt, schlägt fehl. Der Inhalt der Kloake schwappt über mir zusammen und die wild brüllende Bestie drückt mich in die Tiefe. Für einen Moment verliere ich das Gefühl für meine Umgebung. Weiß nicht, wo oben ist und wo unten. Dann spüre ich den steinernen Grund des Abwasserkanals an der Schulter und die Orientierung kehrt zurück. Immer noch unter Wasser, taste ich nach dem Griff meines Schwertes und bekomme ihn zu fassen, während krallenbewehrte Klauen an meinem Kettenhemd abprallen. Das Monster zerrt und reißt an mir, zieht mich mit übermenschlicher Kraft aus der Brühe und schleudert mich gegen die Kante eines der Simse. Der Aufprall lässt das Kettenhemd knirschen und hätte mir ohne die Rüstung vermutlich das Rückgrat gebrochen.
Meine Stiftlampe ist auf dem Sims gelandet und erleuchtet die Szenerie mit trübem Schein. Übermannshoch erhebt sich der Schatten der Bestie, die vor mir im hüfthohen Wasser steht, an der Tunnelwand. Offenbar überrascht, dass ich noch stehe, wirft mein Gegner mir einen missbilligenden Blick aus gelblichen Augen zu, verliert dabei jedoch nicht viel Zeit, sondern stürzt sich sofort wieder auf mich. Die Abwässer spritzen bis an die gewölbte Decke des Tunnels. Es gelingt mir gerade noch, endlich das Schwert aus der Scheide zu ziehen, bevor das Monster erneut beginnt, mit wirbelnden Armen auf mich einzudreschen. Ob es unter dem zerfetzten Pullover das Kettenhemd entdeckt hat oder sich daran erinnert, dass seine Attacken gegen meinen Körper keine Wirkung erzielt haben, kann ich nicht sagen. In jedem Fall zielen seine Hiebe nun auf meinen ungeschützten Kopf. Nur mit Mühe gelingt es mir, unter den messerscharfen Klauen ins Wasser abzutauchen. Für einen Neugeborenen ist das Biest erstaunlich schnell.
Mit ein paar von Schwimmzügen unterstützten Schritten versuche ich, einen oder zwei Meter zwischen mich und meinen Gegner zu bringen. Dann tauche ich mit erhobenem Schwert auf, nur um zu sehen, wie er mich sofort wieder anspringt. Diesmal treffen mich seine Schläge. Meine Haut zerreißt auf der Stirn, als seine Krallen in mein Fleisch eindringen. Blut fließt mir in die Augen. Halb blind drehe ich mich, einen gellenden Schrei ausstoßend, um meine Körperachse, das Schwert ausgestreckt. Die Drehung wirft die Bestie von mir ab. Kurz bevor meine Augen endgültig von Blut bedeckt sind, erkenne ich, dass sie in perfekter Entfernung für einen Schwerthieb zum Stehen kommt. Meine kreisende Klinge trifft, dringt in die Kreatur ein. Das vertraute Geräusch von aufplatzendem Fleisch und brechenden Knochen klingt wie süßeste Musik in meinen Ohren. Dann reißt mein eigener Schwung mich von den Beinen und ich lande wieder platschend in der Kloake.