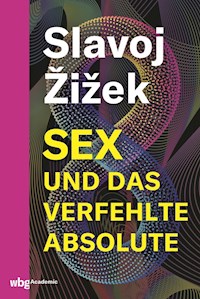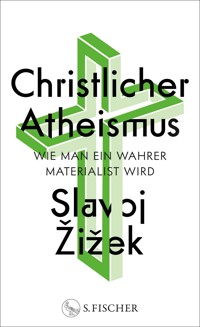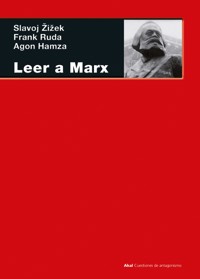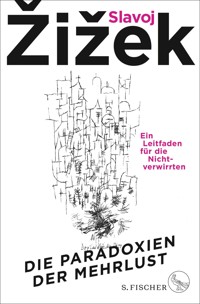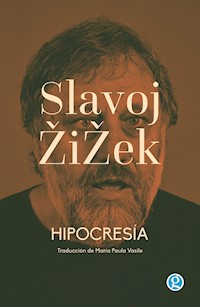9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Kommunismus ist tot, es lebe der Kommunismus! Der Kommunismus ist tot. Der Kapitalismus ist das neue Paradies. Doch warum gibt es dann so viel Ärger dort? In seinem neuen Buch analysiert der »gefährlichste Philosoph des Westens« (New Republic) den Zustand der Welt nach dem angeblichen Ende der Geschichte und zeigt, dass das wahre Abenteuer immer noch der Kampf um Emanzipation ist – aus kommunistischer Perspektive, natürlich. Mit Batman, Marx und Lacan, mit Gangnam Style, Lubitsch und Prokofjew zeigt Žižek, dass unsere Helden Julian Assange, Chelsea Manning und Edward Snowden sein sollten – und dass die Idee des Kommunismus noch lange nicht ausgedient hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Slavoj Zizek
Ärger im Paradies – Vom Ende der Geschichte zum Ende des Kapitalismus
Über dieses Buch
Der Kommunismus ist tot, es lebe der Kommunismus!
Der Kommunismus ist tot. Der Kapitalismus ist das neue Paradies. Doch warum gibt es dann so viel Ärger dort? In seinem neuen Buch analysiert der »gefährlichste Philosoph des Westens« (New Republic) den Zustand der Welt nach dem angeblichen Ende der Geschichte und zeigt, dass das wahre Abenteuer immer noch der Kampf um Emanzipation ist – aus kommunistischer Perspektive, natürlich. Mit Batman, Marx und Lacan, mit Gangnam Style, Lubitsch und Prokofjew zeigt Žižek, dass unsere Helden Julian Assange, Chelsea Manning und Edward Snowden sein sollten – und dass die Idee des Kommunismus noch lange nicht ausgedient hat.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Slavoj Žižek, geboren 1949, ist Philosoph, Psychoanalytiker und Kulturkritiker. Er lehrt Philosophie an der Universität von Ljubljana in Slowenien und an der European Graduate School in Saas-Fee und ist derzeit International Director am Birkbeck Institute for the Humanities in London. Seine zahlreichen Bücher sind in über 20 Sprachen übersetzt. Im S. Fischer Verlag sind zuletzt erschienen »Was ist ein Ereignis?« (2014) und »Das Jahr der gefährlichen Träume« (2013).
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Sonja Steven
Coverabbildung: Matt Carr / Getty Images
Erschienen bei S. FISCHER
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Trouble in Paradise. From the End of History to the End of Capitalism« im Verlag Allen Lane/Penguin Books, London.
© Slavoj Žižek 2014
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403384-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einleitung – Getrennt sind wir stark!
1 Diagnose – Hors d’œuvre?
Krise, welche Krise?
Eier zerbrechen, ohne ein Omelette zu bekommen
Jetzt wissen wir, wer John Galt ist!
Sein-zu-den-Schulden als Lebensform
2 Cardiognosis – Du jambon cru?
Freiheit in den Wolken
Vampire vs. Zombies
Die Naivität des Zynikers
Die obszöne Kehrseite des Gesetzes
Über-Ich oder das verbotene Verbot
3 Prognosis – Un faut-filet, peut-être?
Tode auf dem Nil
Forderungen … und mehr
Die Faszination des Leidens
Wut und Depression im globalen Dorf
Mamihlapinatapei
Lenin in der Ukraine
4 Epignosis – J’ai hâte de vous servir
Zurück zur Ökonomie der Gabe
Die Wunde des Eurozentrismus
A, nicht Ges
Auf dem Weg zu einem neuen Herrn
»Das Notrecht«
Appendix: Nota bene!
Batman, Joker, Bane
Spuren von Utopia
Gewalt, welche Gewalt?
Die Familienwerte der Weathermen
Aus Malttukbakgi
Einleitung – Getrennt sind wir stark!
Ärger im Paradies, Ernst Lubitschs Meisterwerk von 1932, erzählt die Geschichte von Gaston und Lily, einem fröhlichen Betrügerpaar, das die Reichen bestiehlt, dessen Leben aber kompliziert wird, als Gaston sich in Mariette, eines ihrer wohlhabenden Opfer, verliebt. Der Text des Liedes, das während des Vorspanns zu hören ist, gibt eine erste Definition von der Art des »Ärgers«, um den es gehen wird (wie auch das Bild, das das Lied begleitet: Wir sehen zunächst die Worte »Ärger im«, unter den Worten erscheint ein großes Ehebett und dann auf der Oberfläche des Bettes in großen Buchstaben »Paradies«). Das »Paradies« ist also das Paradies einer vollständigen sexuellen Beziehung: »Das ist das Paradies, / wenn sich Arme umschlingen und Lippen sich küssen, / aber wenn etwas fehlt, / bedeutet das / Ärger im Paradies«.[1] Um es in drastisch direkter Weise zu formulieren: »Ärger im Paradies« ist Lubitschs Bezeichnung für il n’y a pas de rapport sexuel.
Worin besteht also der Ärger im Paradies in Ärger im Paradies? In Bezug auf diese Schlüsselfrage gibt es eine grundlegende Zweideutigkeit. Die erste Antwort, die sich aufdrängt, ist: Obwohl Gaston Lily ebenso wie Mariette liebt, wäre die eigentlich »paradiesische« sexuelle Beziehung diejenige zu Mariette gewesen, und genau aus diesem Grund ist es diese Beziehung, die unmöglich und unerfüllt bleiben muss. Diese Unerfülltheit verleiht dem Ende des Films einen Hauch von Melancholie: Das Gelächter und die Ausgelassenheit der letzten Minuten des Films, die fröhliche Zurschaustellung der Partnerschaft zwischen Gaston und Lily füllen nur die Lücke dieser Melancholie. Zielt Lubitsch nicht in diese Richtung mit der wiederholten Einstellung auf das große Doppelbett in Mariettes Haus, einer Einstellung, die an das Bett des Vorspanns erinnert? Man kann es aber auch in genau der gegenteiligen Weise interpretieren:
Könnte es sein, dass das Paradies eigentlich die skandalöse Liebesaffäre von Gaston und Lily ist, zwei eleganten Dieben, die für sich selbst sorgen, und der Ärger die erhaben statuenhafte Mariette ist? Diese Mariette ist, in einer quälenden Ironie, die Schlange, die Gaston von seinem glücklichen, sündigen Garten Eden weglocken will. […] Das Paradies, das gute Leben, ist das Verbrecherleben voller Glamour und Risiko; die böse Versuchung kommt von Madame Colet, deren Vermögen das Versprechen eines bequemen Dolce vita ohne wirkliche kriminelle Kühnheit und List in sich birgt, nur die fade Scheinheiligkeit der ehrbaren Klassen.[2]
Die Schönheit dieser Lesart liegt darin, dass die paradiesische Unschuld in der glamourösen und dynamischen Welt des Verbrechens verortet ist, so dass der Garten Eden mit der Verbrecherwelt gleichgesetzt wird, der Lockruf der besseren Gesellschaft hingegen mit der Versuchung durch die Schlange. Diese paradoxe Umkehrung lässt sich allerdings leicht durch Gastons ehrlichen und rohen Ausbruch erklären, den er ohne Eleganz oder ironische Distanz inszeniert, den ersten und einzigen im Film, als Mariette es ablehnt, die Polizei zu rufen, nachdem Gaston ihr mitgeteilt hat, dass der Vorstandsvorsitzende ihrer Firma sie über die Jahre systematisch um Millionen betrogen hat. Gaston wirft ihr vor, dass sie sofort bereit war, die Polizei zu rufen, als ein gewöhnlicher Taschendieb wie er ihr einen vergleichsweise geringen Betrag entwendet hat, sie aber wegsieht, als ein Mitglied ihrer eigenen ehrbaren Oberschicht Millionen von ihr stiehlt. Paraphrasiert Gaston hier nicht Brechts berühmten Satz: »Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?« Was ist ein direkter Diebstahl wie der von Gaston und Lily im Vergleich zum Raub von Millionen unter dem Deckmantel obskurer Finanzgeschäfte?
Es gibt allerdings einen weiteren Aspekt, der hier bemerkt werden muss: Ist Gastons und Lilys Verbrecherleben tatsächlich so »voller Glamour und Risiko«? Sind die beiden unter dem oberflächlichen Glamour ihrer Diebstähle nicht die Quintessenz eines bürgerlichen Paares, gewissenhafte, professionelle Leute mit teuren Vorlieben – Yuppies, die ihrer Zeit voraus sind? Gaston und Mariette sind dagegen das eigentlich romantische Paar, die abenteuerlustigen und risikobereiten Liebenden. Indem er zu Lily und zur Gesetzlosigkeit zurückkehrt, tut Gaston das Vernünftige – er kehrt sozusagen zu seiner Basisstation zurück und entscheidet sich für das ihm vertraute mondäne Leben. Er tut dies mit Bedauern, welches in seinem letzten langen, von Reue und graziöser Leidenschaft auf beiden Seiten erfüllten Gespräch mit Mariette deutlich wird.[3]
G. K. Chesterton hat bemerkt, dass die Kriminalgeschichte
in gewissem Sinne selbst daran [erinnert], daß die Zivilisation selbst der sensationellste Aufbruch und die romantischste Rebellion ist. […] Wenn der Detektiv in einer Polizeiabenteuergeschichte allein und auf etwas törichte Weise furchtlos inmitten der Messer und Fäuste einer Räuberhöhle steht, dann hilft das sicherlich, uns daran zu erinnern, daß der Vertreter der sozialen Gerechtigkeit die ursprüngliche und poetische Gestalt darstellt, während die Einbrecher und Straßenräuber bloß brave alte kosmische Konservative sind, glücklich mit der uralten Respektabilität von Affen und Wölfen. Die Romantik der Polizei […] beruht auf der Tatsache, daß die Moral die finsterste und waghalsigste aller Konspirationen ist.[4]
Ist dies nicht auch die zutreffendste Definition von Gaston und Lily? Leben diese beiden Taschendiebe nicht in ihrem Paradies vor dem Fall in die ethische Passion? Entscheidend ist hier die Parallele zwischen Verbrechen (Diebstahl) und sexueller Promiskuität: Was wäre, wenn in unserer postmodernen Welt von angeordneter Transgression, in der eheliche Bindung als lächerlich veraltet wahrgenommen wird, diejenigen, die daran festhalten, die eigentlich Subversiven sind? Was, wenn die normale Ehe ebendiese »dunkelste und gewagteste aller Transgressionen« ist? Genau das ist die Prämisse, die Lubitschs Serenade zu dritt zugrunde liegt: Eine Frau führt ein zufriedenes ruhiges Leben mit zwei Männern; als waghalsiges Experiment probiert sie die monogame Ehe aus, der Versuch scheitert jedoch kläglich, und sie kehrt zu ihrem sicheren Leben mit zwei Männern zurück, so dass das Endergebnis mit den oben zitierten Worten Chestertons paraphrasiert werden kann:
Heirat selbst ist die sensationellste Lossagung und der romantischste Aufruhr. Wenn das Liebespaar sein Eheversprechen ablegt, allein und wahnwitzig furchtlos unter den Versuchungen zu promiskuitiven Genüssen, dient es sicherlich dazu, uns daran zu erinnern, daß die Ehe die eigentlich originelle und poetische Figur ist, während die Ehebrecher und Teilnehmer an Orgien bloß friedliche, alte, kosmische Konservative sind, glücklich in den uralten Anstandsbegriffen der promisken Affen und Wölfe. Das Eheversprechen gründet sich auf die Tatsache, daß Ehe der dunkelste und gewagteste aller sexuellen Exzesse ist.
Eine entsprechende Doppeldeutigkeit ist in Bezug auf die grundlegende politische Wahl am Werk, der wir uns heute gegenübersehen. Der zynische Konformismus sagt uns, dass die emanzipatorischen Ideale von mehr Gleichheit, Demokratie und Solidarität langweilig und sogar gefährlich sind und zu einer überregulierten grauen Gesellschaft führen, dass unser wahres und einziges Paradies das existierende »korrupte« kapitalistische Universum ist. Radikales emanzipatorisches Engagement geht von der Prämisse aus, dass es die kapitalistische Dynamik ist, die langweilt und nur mehr von demselben im Gewand ständiger Erneuerung bietet und dass der Kampf für Emanzipation nach wie vor die wagemutigste aller Unternehmungen ist. Unser Ziel ist es, für diese zweite Option zu argumentieren.
Es gibt eine wunderbare französische Anekdote über einen britischen Snob, der nach Paris kommt und glaubt, der französischen Sprache mächtig zu sein. Er geht in ein teures Restaurant im Quartier Latin, und als er vom Kellner gefragt wird »Hors d’œuvre?«, antwortet er: »Nein, ich bin nicht arbeitslos, ich verdiene genug, um mir das Essen hier leisten zu können! Was empfehlen Sie als Vorspeise?« Der Kellner schlägt rohen Schinken vor: »Du jambon cru?« Der Snob antwortet: »Nein, ich glaube nicht, dass ich beim letzten Mal Schinken hatte. Aber gut, dann nehme ich noch mal Schinken – und als Hauptgericht?« »Un faut-filet, peut-être?« Der Snob verliert die Fassung: »Bringen Sie mir das Richtige, ich sagte Ihnen, dass ich genug Geld habe! Aber bitte gleich!« Der Kellner versichert ihm: »J’ai hâte de vous servir!«, worauf der Snob schnauzt: »Warum sollten Sie es hassen, mich zu bedienen? Ich werde Ihnen ein gutes Trinkgeld geben.« Schließlich sieht der Snob ein, dass seine Französischkenntnisse beschränkt sind; um sein Ansehen wiederherzustellen und zu beweisen, dass er ein kultivierter Mann ist, beschließt er bei seinem Aufbruch spät am Abend, dem Kellner auf Lateinisch eine gute Nacht zu wünschen, da sich das Restaurant im Quartier Latin befindet, und sagt: »Nota bene!«
Dieses Buch wird in fünf Schritten vorgehen und dabei den Schnitzern des glücklosen britischen Snobs folgen. Wir werden mit der Diagnose der grundlegenden Koordinaten unseres globalen kapitalistischen Systems beginnen; dann werden wir fortschreiten zur Kardiognosie, zur »Herzenserkenntnis« dieses Systems, d.h. der Ideologie, die uns dazu bringt, es zu akzeptieren. Darauf folgt die Prognose, der Blick in die Zukunft, die uns erwartet, wenn die Dinge weiterlaufen, wie sie es derzeit tun, ebenso wie die mutmaßlichen Möglichkeiten oder Auswege. Wir werden mit der Epignose schließen (einem theologischen Begriff des Wissens, an das wir glauben, das unser subjektiv angenommenes Handeln bestimmt) und die subjektiven und organisatorischen Formen umreißen, die für die neue Phase unseres emanzipatorischen Kampfes geeignet sind. Der Appendix wird den Sackgassen des heutigen emanzipatorischen Kampfes anhand des letzten Batman-Films auf den Grund gehen.
Das »Paradies« im Titel dieses Buchs bezieht sich auf das Ende der Geschichte (wie von Francis Fukuyama ausgearbeitet: ein liberaldemokratischer Kapitalismus als die letztlich für am besten befundene soziale Ordnung), und der »Ärger« ist natürlich die anhaltende Krise, die selbst Fukuyama dazu genötigt hat, seine Idee vom Ende der Geschichte fallenzulassen. Meine Prämisse lautet, dass das, was Alain Badiou die »kommunistische Hypothese« genannt hat, der einzig angemessene Rahmen ist, in dem sich die Krise diagnostizieren lässt. Die Eingebung dazu entstand während einer Vorlesungsreihe, die ich im Oktober 2013 als »Eminent Scholar« an der Kyung-Hee-Universität in Seoul hielt. Als ich die Einladung annahm, war meine erste Reaktion: Ist es nicht vollkommen verrückt, in Südkorea über die Idee des Kommunismus zu sprechen? Ist das geteilte Korea nicht das am deutlichsten denkbare, geradezu klinische Beispiel dafür, wo wir heute nach dem Ende des Kalten Krieges stehen? Auf der einen Seite verkörpert Nordkorea die Sackgasse des kommunistischen Projekts im 20. Jahrhundert; auf der anderen Seite befindet sich Südkorea inmitten einer explosionsartigen kapitalistischen Entwicklung, die neue Maßstäbe von Wohlstand und technologischer Modernisierung erreicht – und innerhalb deren Samsung selbst die Vorherrschaft von Apple unterläuft. Ist Südkorea in diesem Sinne nicht der beste Beweis dafür, wie falsch das ganze Gerede von der globalen Krise ist?
Das Leid der Koreaner im 20. Jahrhundert war unermesslich, es verwundert daher nicht, dass es – wie mir gesagt wurde – selbst heute noch ein Tabu in Korea ist, von den Gräueltaten zu sprechen, die die Japaner dort während der Besatzung im Zweiten Weltkrieg verübten. Sie fürchten, dass das Sprechen darüber den geistigen Frieden der älteren Generation aufstören könnte: Die Zerstörung war so vollständig, dass die Koreaner alles tun, um diese Zeit zu vergessen und weiterzumachen, als wäre nichts geschehen. Ihre Haltung beinhaltet daher eine zutiefst nietzscheanische Verkehrung der gängigen Formulierung »Wir vergeben, aber wir vergessen nicht«. Im Hinblick auf die japanischen Gräueltaten haben die Koreaner eine Redensart: Vergessen, aber niemals vergeben. Und sie haben recht, denn etwas zutiefst Scheinheiliges liegt in der Formel »Vergeben, aber niemals vergessen«, die äußerst manipulativ ist, weil sie eine Erpressung des Über-Ichs voraussetzt: »Ich vergebe dir, aber indem ich dein Vergehen nicht vergesse, stelle ich sicher, dass du dich für immer schuldig dafür fühlen wirst.« Ich möchte mit einem Bericht von Franco Berardi beginnen, einem italienischen Sozialwissenschaftler, über seine jüngste Reise nach Seoul:
Am Ende des 20. Jahrhunderts – nach Jahrzehnten des Kriegs, der Erniedrigung, des Hungers und fürchterlicher Bombardements – waren sowohl die physische als auch die anthropologische Landschaft dieses Landes auf eine Art verwüstete Abstraktion reduziert. Zu diesem Zeitpunkt begaben sich das menschliche Leben und die Stadt folgsam in die transformierende Hand der höchsten Form zeitgenössischen Nihilismus.
Korea ist der Ground Zero der Welt, eine Blaupause für die Zukunft des Planeten. […]
Nach der Kolonisierung und den Kriegen, nach Diktatur und Hungersnöten betrat der südkoreanische Geist, befreit von den Bürden des natürlichen Körpers, sanft die digitale Sphäre, mit einem niedrigeren Grad an kulturellem Widerstand als irgendein anderes Volk auf dieser Welt. Meines Erachtens liegt darin die Hauptursache der unglaublichen wirtschaftlichen Leistung dieses Landes in den Jahren der digitalen Revolution. Im leeren kulturellen Raum ist die koreanische Erfahrung von einem extremen Grad an Individualisierung gezeichnet, und gleichzeitig eilt es dabei der endgültigen Verkabelung des kollektiven Geistes entgegen.
Diese einsame Monade durchwandert den städtischen Raum in andauernder zärtlicher Interaktion mit den Bildern, Tweets und Spielen, die aus ihren kleinen Bildschirmen kommen, vollkommen isoliert und vollkommen verkabelt mit der glatten Schnittstelle des Datenstroms. […] Südkorea hat die höchste Selbstmordrate der Welt. […] Selbstmord ist der häufigste Grund für Todesfälle bei unter Vierzigjährigen. […] Interessanterweise hat sich die Selbstmordrate in den letzten zehn Jahren verdoppelt. […] Im Zeitraum von zwei Generationen hat sich der Standard der Bevölkerung im Hinblick auf Einkommen, Ernährung, Freiheit und Reisemöglichkeiten sicher gesteigert. Aber der Preis für diese Steigerung ist die Entleerung des alltäglichen Lebens, die hochgradige Beschleunigung des Rhythmus, die extreme Individualisierung der Biographien, die berufliche Unsicherheit, die auch den hemmungslosen Wettbewerb einschließt. […]
Der hochtechnisierte Kapitalismus beinhaltet stetig wachsende Produktivität und unaufhörliche Steigerung des Arbeitsrhythmus, aber er ist zugleich die Bedingung für die beeindruckende Verbesserung des Lebensstandards, der Ernährung, der Kaufkraft. […] Aber die heutige Entfremdung ist eine andere Art von Hölle. Die Beschleunigung des Arbeitsrhythmus, die Versteppung der Landschaft und die Virtualisierung des Gefühlslebens arbeiten zusammen daran, ein Niveau von Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit zu schaffen, das bewusst kaum abzulehnen und zu unterlaufen ist. […] Isolation, Wettbewerb, das Gefühl von Bedeutungslosigkeit, Druck und Scheitern: 28 Personen von 100000 gelingt jedes Jahr die Flucht, und deutlich mehr noch versuchen es erfolglos.
Weil Selbstmord als stärkstes Zeichen der anthropologischen Mutation betrachtet werden kann, die mit der digitalen Umwälzung und der Prekarisierung verbunden ist, erstaunt es nicht, dass Südkorea die Nummer eins in Bezug auf die Selbstmordrate ist.[5]
Berardis Südkorea-Porträt scheint dem unübertroffenen Modell derartiger Beschreibungen in den letzten Jahrzehnten zu folgen, Baudrillards berühmtem Porträt von Los Angeles als hyperrealer Hölle (in seinem Buch America). Es wäre zu einfach, dieses Porträtgenre als großspurige pseudointellektuelle Übung europäischer Postmodernisten abzutun, die ein fremdes Land oder eine fremde Stadt als Schirm benutzen, auf den sie ihre morbiden Dystopien projizieren. Trotz aller Übertreibungen liegt in ihnen ein Körnchen Wahrheit, oder um Adornos bekanntes Diktum über die Psychoanalyse zu paraphrasieren: in Baudrillards Los-Angeles-Porträt ist nichts wahr außer seinen Übertreibungen. Dasselbe gilt für Berardis Impressionen von Seoul: Sie liefern das Bild eines seiner Geschichte entkleideten Orts, eines weltlosen Orts. Badious Reflexionen zufolge empfinden wir den zeitgenössischen sozialen Raum als zunehmend weltlos. Selbst der Antisemitismus der Nazis hat, wie schrecklich er auch war, eine Welt eröffnet: Er beschrieb seine eigene kritische Situation, indem er einen Feind in Stellung brachte, die »jüdische Weltverschwörung«. Er benannte ein Ziel und die Mittel, es zu erreichen. Der Nazismus enthüllte die Wirklichkeit in einer Art und Weise, die es den Subjekten erlaubte, eine globale kognitive Karte zu entwerfen, die ihnen einen Raum für bedeutungsvolles Engagement eröffnete. Vielleicht sollte man hier eine der Hauptgefahren des Kapitalismus verorten: Obwohl er global ist und die ganze Welt einschließt, unterstützt er stricto sensu eine weltlose ideologische Konstellation und entzieht der großen Mehrheit der Menschen jede Möglichkeit einer bedeutungsvollen kognitiven Karte. Der Kapitalismus ist die erste sozioökonomische Ordnung, die Bedeutung ent-totalisiert: Auf der Ebene der Bedeutung ist er gerade nicht global. Denn es gibt keine globale »kapitalistische Weltanschauung«, keine »kapitalistische Zivilisation« im eigentlichen Sinne: Die grundlegende Lektion besteht genau darin, dass sich der Kapitalismus an alle Zivilisationen anpassen kann, von der christlichen bis zu hinduistischen oder buddhistischen, vom Westen zum Osten. Die globale Dimension des Kapitalismus kann als »Wahrheit ohne Bedeutung« formuliert werden, als das Reale des globalen Marktmechanismus.
Da die Modernisierung in Europa über Jahrhunderte verlief, hatten wir genügend Zeit, uns an sie anzupassen, ihren erschütternden Einfluss durch Kulturarbeit [dt. im Original], durch die Formierung neuer sozialer Narrative und Mythen abzumildern, während andere Gesellschaften – in exemplarischer Weise die muslimischen – ihrer Wucht direkt ausgesetzt gewesen sind, ohne jeden schützenden Schirm oder zeitlichen Aufschub, so dass ihr symbolisches Universum viel brutaler erschüttert wurde. Dadurch verloren sie ihre (symbolische) Grundlage, ohne die Zeit für die Erschaffung eines neuen symbolischen Gleichgewichts zu haben. Es ist nicht verwunderlich, dass der einzige Weg für einige dieser Gesellschaften, den vollständigen Zusammenbruch zu vermeiden, darin besteht, panisch ein Schutzschild aus »Fundamentalismus« zu errichten, das psychotisch-delirante, inzestuöse Geltendmachen der Religion als direkte Einsicht in das göttliche Reale – mit all den erschreckenden Konsequenzen, die ein solches Geltendmachen beinhaltet, einschließlich der Rückkehr einer obszönen Über-Ich-Gottheit mit voller Kraft, die nach Opfern verlangt. Der Aufstieg des Über-Ichs ist ein weiteres Merkmal, das der postmodernen Permissivität und dem neuen Fundamentalismus gemeinsam ist. Was beide unterscheidet, ist der Ort des Genießens, um den es jeweils geht: unser eigener in der Permissivität, der Gottes im Fundamentalismus.[6]
Das vielleicht endgültige Symbol des zerstörten posthistorischen Korea ist das popmusikalische Ereignis des Sommers 2012: »Gangnam Style« von Psy. Als Kuriosität sollte man feststellen, dass das Gangnam-Style-Video sogar das von Justin Biebers »Beauty and a Beat« auf YouTube übertrumpfte und damit zum meistgesehenen Video aller Zeiten wurde. Am 21. Dezember 2012 erreichte es die magische Zahl von einer Milliarde Klicks – und man könnte, da am 21. Dezember diejenigen, die die Voraussagen des Mayakalenders ernst nehmen, das Ende der Welt erwarteten, sagen, dass die alten Mayas recht hatten: Das »Gangnam-Style«-Video ist tatsächlich das Zeichen für den Kollaps der Zivilisation. Der Song ist nicht nur weithin populär, er versetzt auch ein großes Publikum in eine kollektive Trance, mit Zehntausenden schreienden Menschen, deren Tanz den Ritt auf einem Pferd imitierte, alle im selben Rhythmus und mit einer Intensität, die man seit den frühen Beatles nicht mehr gesehen hatte und die Psy als neuen Messias erscheinen ließ. Die Musik ist die schlimmste Form von Psydance, vollkommen flach und mechanisch einfach, zumeist computergeneriert (der Name des Sängers, Psy, ist eine abgekürzte Version von Psytrance); was sie interessant macht, ist die Art und Weise, in der sie kollektive Trance mit Selbstironie kombiniert. Die Worte des Songs (und die Inszenierung des Videoclips) machen sich offensichtlich lustig über die Bedeutungslosigkeit und die Leere des Gangnam-Style, manche behaupten sogar, in einer subtil subversiven Art und Weise – aber wir werden dennoch in den stupiden Marschrhythmus hineingezogen und nehmen daran in reiner Mimesis teil; Flashmobs tauchten überall auf der Welt auf, um Teile aus dem Video nachzumachen.
Gangnam-Style ist keine Ideologie trotz der ironischen Distanz, sondern genau wegen ihr. Ironie spielt hier dieselbe Rolle wie der dokumentarische Stil in Lars von Triers Film Breaking the Waves, in dem eine gedämpfte pseudodokumentarische Form den exzessiven Inhalt fassbar macht – in einer streng homologen Weise macht die Selbstironie von Gangnam-Style das stumpfe Genießen der Rave-Musik greifbar. Viele Zuhörer finden das Lied ekelerregend anziehend, »sie lieben, es zu hassen«, oder genauer: Sie genießen, es abstoßend zu finden, so dass sie es wiederholt abspielen, um ihren Abscheu hinauszuziehen. Von dieser zwanghaften Natur des obszönen Genießens in all seiner Dummheit sollte uns die wirkliche Kunst befreien. Müssen wir aber nicht noch einen Schritt weiter gehen und eine Parallele zwischen einer Gangnam-Style-Darbietung in einem gigantischen Stadion in Seoul und den Darbietungen ziehen, die in nicht allzu großer Entfernung, jenseits der Grenze, in Pjönjang, stattfinden, um den Ruhm der geliebten nordkoreanischen Führer zu feiern? Erhalten wir nicht in beiden Fällen ein ähnliches neosakrales Ritual obszönen Genießens?
Es könnte den Anschein haben, dass in Korea, wie auch anderswo, verschiedene Formen traditioneller Weisheit überleben, um als schützendes Polster gegen den Modernisierungsschock zu wirken. Allerdings ist es leicht zu erkennen, wie diese Überbleibsel traditioneller Ideologie bereits transfunktionalisiert sind und in ideologische Werkzeuge verwandelt werden, die eine schnelle Modernisierung unterstützen sollen – wie die sogenannte östliche Spiritualität mit ihrem sanfteren, ausgewogeneren, ganzheitlichen Zugang (all die Geschichten darüber, wie zum Beispiel tibetische Buddhisten darauf achtgeben, beim Umgraben des Bodens für den Hausbau keine Würmer zu töten). Der westliche Buddhismus, dieses popkulturelle Phänomen, das inneren Abstand und Gleichgültigkeit im Angesicht des wahnsinnigen Voranschreitens von Marktwettbewerb predigt, ist nicht nur der wohl effizienteste Weg für uns, vollständig an der kapitalistischen Dynamik teilzuhaben, während wir uns den Anschein geben, geistig gesund zu sein – kurz: an der paradigmatischen Ideologie des Spätkapitalismus. Man sollte hinzufügen, dass es nicht mehr möglich ist, den westlichen Buddhismus gegen seine »authentische« östliche Form in Anschlag zu bringen, und hier liefert Japan den entscheidenden Beweis. Es existiert nicht nur heutzutage unter japanischen Topmanagern das weitverbreitete »corporate-zen«-Phänomen, auch die letzten 150 Jahre rapider japanischer Industrialisierung und Militarisierung mit seiner Ethik der Disziplin und des Opfers wurden von der überwältigenden Mehrheit der Zen-Denker unterstützt.
Wir begegnen hier der dialektischen Logik der historischen Transfunktionalisierung: In einer sich verändernden historischen Konstellation kann dem Überbleibsel aus der vormodernen Zeit die Funktion eines Symbols zukommen, das für dasjenige steht, was traumatisch und unerträglich an der extremen Modernität ist. Dasselbe gilt für die Rolle des Vampirs in unserer ideologischen Vorstellungswelt. Stacey Abbott[7] hat gezeigt, wie das Medium Film den Archetyp des Vampirs neu erfunden hat: Anstatt das Primitive und Folkloristische zu repräsentieren, verkörpert er heute genau die Erfahrung von Modernität. Die heutigen Vampire sind nicht mehr mit Umhang und Sarg ausgestattet, sondern in Großstädten zu Hause, hören Punk-Musik, sind technologisch auf dem neuesten Stand und passen sich an jede Situation an.
Das bedeutet natürlich nicht, dass der Buddhismus auf die kapitalistische Ideologie reduziert werden kann. Greifen wir, um diesen Punkt klarzumachen, auf ein überraschendes Beispiel zurück. 1991 veröffentlichte Richard Taruskin eine Rezension, in der er Prokofjews Musik insgesamt, ausgenommen das Jugendwerk, in vernichtender Weise als schlecht abtat. Alles, was Prokofjew im Westen geschrieben hatte, sei in seiner oberflächlichen Modernität »Schrott oder verrottet, zu Recht verworfen und nicht wiederzubeleben«; es sollte Strawinsky Konkurrenz machen, was aber misslang. Als Prokofjew dies bemerkte, kroch er nach Russland und zu Stalin zurück, wo seine Arbeiten durch »Karrierismus« verdorben wurden und eine »wahrscheinlich schuldige Gleichgültigkeit […], verborgen unter seiner apolitischen Fassade«. In der Sowjetunion war er erst ein Zugpferd für Stalin und dann sein Opfer, aber darunter lauerte immer die »perfekte Leere« eines »absoluten Musikers«, der »nur Musik schrieb oder eher, der nur Musik schrieb«.[8] Auch wenn sie unfair sind, weisen diese Behauptungen auf eine quasipsychotische Haltung Prokofjews hin: Im Gegensatz zu anderen sowjetischen Komponisten, die in den Tumult stalinistischer Anschuldigungen hineingezogen wurden (Schostakowitsch, Chatschaturjan und andere), gibt es bei Prokofjew keine inneren Zweifel, Hysterie oder Angst: Er überstand die antiformalistische Kampagne von 1948 mit einer fast psychotischen Gelassenheit, als ginge es ihn alles nichts an. (Der Wahnsinn seiner Rückkehr in die UdSSR 1936, dem Jahr der schärfsten stalinistischen Säuberungen, ist ein verräterisches Zeichen für seinen Geisteszustand.) Das Schicksal seiner Arbeiten unter dem Stalinismus ist nicht frei von Ironie: Die meisten seiner linientreuen Arbeiten wurden kritisiert und als unehrlich und schwach zurückgewiesen (was sie waren), während er Stalin-Preise für seine »dissidente« intime Kammermusik bekam (die Klaviersonaten 7 und 8, die erste Violinsonate, die Cellosonate). Besonders interessant ist Prokofjews (offensichtlich ehrliche) ideologische Rechtfertigung für seine vollständige Konformität mit den stalinistischen Forderungen: Er nahm den Stalinismus als Fortsetzung seiner Anhängerschaft an die Christliche Wissenschaft an. Im gnostischen Universum der Christlichen Wissenschaft ist die materielle Realität nur eine Erscheinung: Man sollte sich darüber erheben und spirituelle Glückseligkeit durch harte Arbeit und Verzicht erreichen. Prokofjew übertrug dieselbe Haltung auf den Stalinismus und las die Kernforderungen der stalinistischen Ästhetik – Einfachheit, Harmonie, Freude – durch diese Brille. Um es in einen Begriff von Jean-Claude Milner zu fassen, könnte man sagen, dass Prokofjew zwar nicht homogen mit dem Stalinismus, gewiss aber »homogénéisable« (homogenisierbar) war, denn Prokofjew arrangierte sich nicht einfach opportunistisch mit der stalinistischen Realität. Dieselbe Frage wäre heute aufzuwerfen: Obwohl es dumm wäre zu behaupten, die buddhistische Spiritualität sei homogen mit dem globalen Kapitalismus, ist sie eindeutig homogenisierbar mit ihm.
Um nun wieder auf Korea zurückzukommen, scheint sich diese Analyse in Propaganda zu bestätigen, einem Dokumentarfilm von 2012 (online verfügbar), der vom Kapitalismus, Imperialismus und der Massenmanipulation der westlichen Kultur zum Zweck der Kommodifizierung handelt, davon, wie sie jeden Aspekt des Lebens der glücklich ahnungslosen, zombifizierten Massen durchdringen. Es handelt sich um eine »Mockumentary«, die so tut, als sei sie nordkoreanisch, obwohl sie von einer Gruppe aus Neuseeland gemacht wurde – aber wie man in Italien sagt: Se non è vero, è ben trovato. Der Gebrauch von Angst und Religion, um die Massen zu manipulieren, ebenso wie die Rolle der Medien, die farbenfrohe Ablenkungen zur Verfügung stellen, um uns davon abzuhalten, über die wahren Probleme nachzudenken – all das wird darin angesprochen. Eine der stärksten Sequenzen des Films handelt von der Vernichtung der Verehrungskultur gegenüber Prominenten: wenn über Madonna und Brad und Angelinas »Shoppen für die Kinder der Dritten Welt« gesprochen wird; die westliche Besessenheit vom glamourösen Leben der Prominenten und die Ich-Bezogenheit, während man die Not der Obdachlosen und Leidenden ignoriert; Prominente, die so sehr zu Werkzeugen der Kommodifizierung werden, dass sie es nicht einmal bemerken, bis zum Wahnsinn – all dies ist eine so zutreffende Analyse, dass es fast unheimlich ist. Das ist genau die Welt, die uns umgibt. Alles, insbesondere der Teil über Michael Jackson – ein Blick auf das, »was Amerika diesem Mann angetan hat« –, klingt so wahr, dass es nur schwer zu verkraften ist. Wenn man aus Propaganda die eine oder andere kurze Passage streichen würde, in der die Weisheit des großen Führers gepriesen wird etc., erhielte man eine klassische – nicht einmal traditionell marxistische, sondern spezifisch westlich-marxistische nach Art der Frankfurter Schule – Kritik des Konsumverhaltens, der Kommodifizierung und der Kulturindustrie [dt. im Original]. Was man beachten sollte, ist eine Warnung zu Beginn des Films: Der Kommentar aus dem Off teilt den Zuschauern mit, dass der im Folgenden zu sehende Schmutz und die Perversion sie zwar unangenehm berühren und schockieren werden, der große geliebte Führer sie aber für reif genug hält, die fürchterliche Wahrheit über die Welt draußen zu erkennen – Worte, die eine wohlgesinnte schützende Mutter verwenden würde, wenn sie beschließt, ihre Kinder über eine unangenehme Wahrheit aufzuklären.
Um den besonderen ideologischen Status Nordkoreas zu begreifen, muss man auf den Vergleich mit dem mythischen Shangri-la aus James Hiltons The Lost Horizon zurückgreifen, einem abgeschiedenen Tal in Tibet, in dem die Menschen ein glückliches, bescheidenes Leben führen, vollkommen isoliert von der verdorbenen globalen Zivilisation und unter dem wohlwollenden Gesetz einer gebildeten Elite. Nordkorea kommt Shangri-la heutzutage am nächsten – in welchem Sinn? Die von Pierre Legendre und anderen Lacanianern formulierte Idee lautet, dass das Problem heute in der Abwesenheit des Namens-des-Vaters besteht, einer paternalistischen symbolischen Autorität: In seiner Abwesenheit greift der pathologische Narzissmus um sich und evoziert den Geist des ursprünglichen Realen Vaters. Obwohl diese Vorstellung an sich zurückgewiesen werden muss, ist es dennoch gerechtfertigt, herauszustellen, wie der Untergang des Herrn und Meisters keineswegs automatisch Emanzipation garantiert, sondern noch unterdrückerischere Herrscherfiguren hervorbringen kann. In Nordkorea wird das Patriarchat tatsächlich untergraben, aber in unerwarteter Weise. Ist das Land wirklich die letzte Bastion des Stalinismus, in der sich totalitäre Kontrolle mit konfuzianischem Autoritarismus paart? Hier der Text des beliebtesten Polit-Songs aus Nordkorea:
Oh, koreanische Arbeiterpartei, an deren Brust mein
Leben beginnt und endet.
Bin ich auch begraben in der Erde oder in den Wind verstreut,
bleibe ich immer dein Sohn und kehre an deine Brust zurück!
Ich vertraue meinen Körper deinem liebenden Blick an,
deiner liebenden ausgestreckten Hand,
ich weine immer mit der Stimme eines Kindes,
Mutter! Ich kann nicht ohne Mutter sein!
In ähnlicher Weise drückte sich auch die exzessive Trauer nach Kim Il Sungs Tod aus: Ich kann nicht ohne Mutter sein! Als weiterer Beweis hier die zwei Einträge »Mutter« und »Vater« aus einem nordkoreanischen Lexikon der koreanischen Sprache aus dem Jahr 1964:
Mutter: 1) Die Frau, die einen geboren hat: Vater und Mutter; die Liebe einer Mutter. Die Güte einer Mutter ist größer als ein Berg und tiefer als der Ozean. Auch verwendet im Sinne von »eine Frau, die ein Kind hat«: Alle Mütter wünschen sehnlichst für ihre Kinder, dass sie gesund aufwachsen und ausgezeichnete rote Baumeister werden. 2) Ein respektvoller Ausdruck für jemanden ähnlichen Alters wie die eigene Mutter: der Genosse Kolonnenführer nannte Dongmanis Mutter »Mutter« und half ihr immer bei ihrer Arbeit. 3) Eine Metapher dafür, freundlich zu sein, sich um alles zu kümmern und sich um andere zu sorgen: Parteifunktionäre müssen Mütter werden, die die Partei unaufhörlich lieben und sie Rang und Disziplin lehren und vorbildlich an der vordersten Front des Handelns stehen. In anderen Worten muss jemand, der für Unterkünfte verantwortlich ist, eine Mutter für die Mieter werden. Das bedeutet, umsichtig nach allem zu schauen: ob jemand krank ist oder friert, wie sie essen und so weiter. 4) Eine Metapher für die Quelle, aus der man hervorgegangen ist: Die Partei ist die große Mutter alles Neuen. Not ist die Mutter der Erfindung.
Vater: der Ehemann der eigenen Mutter.[9]
Vielleicht ist das der Grund, warum die Frau des Führers nicht öffentlich in Erscheinung trat: Der Führer ist eine Zwitterfigur mit ausgeprägt weiblichen Zügen. Steht dies im Widerspruch zu Nordkoreas militaristischer Politik mit seinem militärischen Disziplinieren und Drillen? Nein, es sind zwei Seiten derselben Medaille. Die Figur der Mutter, mit der wir es hier zu tun haben, ist die sogenannte »nicht-kastrierte« allmächtige, verschlingende Mutter. Jacques-Alain Miller hat in Bezug auf die reale Mutter angemerkt, dass es »nicht nur eine unbefriedigte Mutter, sondern auch eine allmächtige gibt. Der erschreckende Aspekt dieser Figur der Lacan’schen Mutter ist, dass sie allmächtig und unbefriedigt zugleich ist.«[10] Darin liegt das Paradox: je omnipotenter eine Mutter erscheint, desto unbefriedigter (d.h. »mangelnd«) ist sie: »Die Lacan’sche Mutter entspricht der Formel quaerens quem devoret: Sie sucht jemanden, den sie verschlingen kann, und so präsentiert Lacan sie als Krokodil, das Subjekt mit aufgerissenem Maul.«[11] Diese verschlingende Mutter antwortet nicht (auf das Verlangen des Kindes nach einem Zeichen der Liebe), und in dieser Weise erscheint sie als allmächtig: »Da die Mutter nicht antwortet […], verwandelt sie sich in eine reale Handelnde, die reine Macht erzeugt […] wenn der Andere nicht antwortet, wird er in eine verschlingende Macht verwandelt.«[12] Aus diesem Grund sind die feminisierten Züge, die in offiziellen Porträts beider Kims klar erkennbar sind, nicht zufällig. Um B.R. Myers zu zitieren:
Kim [Il Sung] war für sein Volk eher eine Mutter als ein strenger konfuzianischer Patriarch: Er wird noch immer rosig und fürsorglich gezeigt, wie er schluchzende Erwachsene an seinen ausufernden Busen drückt, sich hinkniet, um einem jungen Soldaten die Schnürsenkel zu binden, oder ausgelassene Kinder an sich herumklettern lässt. Die Tradition setzt sich unter Kim Jong Il fort, der »mütterlicher als alle Mütter der Welt« genannt worden ist. Seine militaristische Politik mag von dem Titel »General« herrühren, aber Berichte über seine endlosen Reisen zu Militärstützpunkten konzentrieren sich in direkter Weise auf seine penible Sorge um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Truppen. Der internationale Spott über sein Äußeres ist deshalb so unfair wie eintönig. Jeder, der eine Menge von koreanischen Müttern gesehen hat, die vor einem Obduktionssaal warten, wird keine Schwierigkeit haben, Kims trüben Parka und abfallende Schultern zu erkennen oder den duldsamen Gesichtsausdruck unter einer von Kissen zerdrückten Dauerwelle: Dies ist eine Mutter, die keine Zeit hat, an sich selbst zu denken.[13]
Steht Nordkorea also für etwas wie die indische Göttin Kali an der Macht – die wohlgesinnte/mörderische Göttin? Man sollte hier verschiedene Ebenen unterscheiden: In Nordkorea wird die oberflächliche Ebene des männlich-militärischen Diskurses des Führers als »General«, mit der zugrundeliegenden Chuch’e-Vorstellung des Selbstvertrauens, der Menschheit als Meister ihrer selbst und ihres Schicksals, von einer tieferen Dimension des Führers als mütterlichen Beschützers getragen. Myers formuliert das grundlegende Axiom nordkoreanischer Ideologie so: »Das koreanische Volk ist zu reinblütig, deshalb zu tugendhaft, um in einer schlechten Welt ohne einen großen väterlichen Führer zu überleben.«[14] Ist das nicht ein schönes Beispiel für Lacans Formel der Vater-Metapher, des Namens-des-Vaters als metaphorischen Ersatzes für das Begehren nach der Mutter? Der Name-des-Vaters (Führer/General) und darunter das schützend-zerstörerische Begehren der Mutter?[15]
Einer der Gemeinplätze des New Age ist, dass wir im Westen zu sehr beherrscht werden vom männlichen/väterlichen Prinzip der Herrschaft, Disziplin, des Kampfes usw. und dass wir, um die Balance wiederherzustellen, das weibliche Prinzip der liebevollen Fürsorge und des Beschützens stark machen sollten. Allerdings sollten uns Fälle von »harten« weiblichen Politikern von Indira Gandhi bis Margaret Thatcher zu denken geben. Heutzutage ist die vorherrschende Figur nicht mehr der patriarchalische Herr. Selbst der Totalitarismus ist kein Diskurs des Herrn; dennoch sollte uns die tragische Lehre vieler Revolutionen, in denen der Sturz des alten Herrschers in einem noch mörderischeren Terror endete, keinesfalls dazu bringen, uns für eine paternalistische symbolische Autorität in die Bresche zu werfen, als einziger Ausweg aus der selbstzerstörerischen Sackgasse des spätkapitalistischen narzisstischen proteischen Selbst. Und das führt uns zu Berardi zurück. Obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten, teilen Nord- und Südkorea eine grundsätzliche Eigenschaft: Beide sind postpatriarchalische Gesellschaften. Der Grund, weshalb Propaganda über weite Strecken so glaubwürdig klingt, dass es schwer zu ertragen ist, liegt nicht einfach in der – aus Montesquieus Persischen Briefen bekannten – Tatsache, dass der naive Blick von außen etwas in unserer Kultur erkennen kann, das uns, die wir von ihr umgeben sind, verborgen bleibt, sondern darin, dass der extreme Gegensatz zwischen Nord- und Südkorea von einer darunterliegenden Gleichheit getragen wird, die der Titel des Films verrät: zwei extreme Weisen der Zeitlosigkeit, des Aussetzens von Geschichtlichkeit selbst. (Aus diesem Grund ist der Begriff »Propaganda« verräterisch: Der Dokumentarfilm verwendet ein Wort, das am besten zu seinem eigenen – nordkoreanischen – ideologischen Universum passt.)
Es gibt eine bekannte jüdische Geschichte über ein Kind, das, nachdem ein Rabbi eine wunderschöne alte Legende erzählt hat, diesen fragt: »Aber ist das wirklich passiert? Ist es wahr?« Der Rabbi antwortet: »Es ist nicht wirklich geschehen, aber es ist wahr.« Die Behauptung einer tieferen symbolischen Wahrheit im Gegensatz zum Faktischen sollte durch sein Gegenteil ergänzt werden – unsere Reaktion auf viele wirklich spektakuläre Ereignisse kann nur sein: »Es ist passiert, aber es ist nicht wahr.« Wir sollten also umso dankbarer für jedes Zeichen von Hoffnung sein, so klein es auch erscheinen mag, wie die Existenz des Café Photo in São Paulo. Als »Unterhaltung mit spezieller Note« beworben, ist es – so wurde mir berichtet – ein Treffpunkt für Oberklasse-Prostituierte mit ihren künftigen Kunden. Obwohl diese Tatsache dem Publikum bekannt ist, wird diese Information nicht auf der Webseite explizit gemacht; offiziell ist es ein »Ort, an dem man die beste Begleitung für seinen Abend treffen kann«. Die Dinge gehen dort wirklich in spezieller Weise vor sich: Die Prostituierten selbst – meistens Studentinnen der Geisteswissenschaften – wählen ihre Kunden. Die Männer (künftige Kunden) kommen herein, setzen sich an einen Tisch, bestellen sich einen Drink und warten, während sie von den Frauen beobachtet werden. Wenn eine Frau einen von ihnen annehmbar findet, setzt sie sich an seinen Tisch und beginnt ein Gespräch über ein intellektuelles Thema, normalerweise über das kulturelle Leben, manchmal sogar über Kunsttheorie. Wenn sie den Mann intelligent und attraktiv genug findet, fragt sie ihn, ob er mit ihr ins Bett gehen möchte, und nennt ihm ihren Preis. Das ist Prostitution mit einem feministischen Dreh im wahrsten Sinne – auch wenn der feministische Dreh mit einer Klassenschranke bezahlt wird: Beide, Prostituierte und Kunden, stammen aus der Oberschicht oder mindestens der oberen Mittelschicht. Ich widme dieses Buch also in aller Bescheidenheit den Prostituierten des Café Photo in São Paulo.
1 Diagnose – Hors d’œuvre?
Krise, welche Krise?
Die heutige Situation Südkoreas lässt an die Anfangszeilen aus Charles Dickens’ Eine Geschichte von zwei Städten denken: »Es war der Frühling der Hoffnung und der Winter des Verzweifelns. Wir hatten alles, wir hatten nichts vor uns; wir steuerten alle unmittelbar dem Himmel zu und auch alle unmittelbar in die entgegengesetzte Richtung […]«.[1] In Südkorea finden wir höchste Wirtschaftsleistung, gepaart mit der verrückten Intensität des Arbeitsrhythmus; den ungezügelten Himmel des Konsums, durchdrungen von der Hölle der Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit; überfließenden materiellen Reichtum, aber die Verwüstung der Landschaft; die Imitation alter Tradition, aber mit der höchsten Selbstmordrate der Welt. Diese radikale Zweideutigkeit stört auch das Bild des heutigen Südkorea als einer vollendeten Erfolgsgeschichte – Erfolg ja, aber was für ein Erfolg?
Die Weihnachtsausgabe 2012 des Spectator eröffnete mit dem Editorial »Warum 2012 das beste Jahr aller Zeiten war«, das sich gegen die Wahrnehmung richtet, dass wir in »einer gefährlichen, grausamen Welt leben, in der die Dinge immer schlimmer werden«:
Es mag sich nicht so anfühlen, aber 2012 ist das beste Jahr in der Weltgeschichte gewesen. Wenn es zwar nach einer extravaganten Behauptung klingt, stützt sie sich doch auf klare Beweise. Nie hat es weniger Hunger gegeben, weniger Krankheit oder weniger Wohlstand. Der Westen steckt zwar weiterhin in einer ökonomischen Flaute, aber die meisten Schwellenländer stürmen weiter nach vorne, und die Menschen werden schneller denn je aus der Armut hinausbefördert. Die Todesraten aufgrund von Krieg und Naturkatastrophen sind denkbar niedrig. Wir leben in einem goldenen Zeitalter.[2]
Dieselbe Idee legt Matt Ridley detailliert dar – hier der englische Klappentext für sein Buch Wenn Ideen Sex haben [engl. Rational Optimist]:
Als Gegenschlag gegen den vorherrschenden Pessimismus unserer Zeit beweist das Buch, sosehr wir auch das Gegenteil glauben mögen, dass die Dinge besser werden. Vor 10000 Jahren lebten weniger als zehn Millionen Menschen auf der Erde. Heute sind es mehr als sechs Milliarden, von denen 99 Prozent besser ernährt, besser behaust, besser unterhalten und besser vor Krankheit geschützt sind als ihre Vorfahren aus der Steinzeit. Die Verfügbarkeit von fast allem, was eine Person wollen oder benötigen kann, ist in den letzten 10000 Jahren sprunghaft angestiegen und hat sich in den letzten 200 Jahren stark beschleunigt: Kalorien, Vitamine, Trinkwasser, Maschinen, Privatheit, die Möglichkeit, schneller zu reisen, als wir laufen können, die Fähigkeit, über weitere Entfernungen zu kommunizieren, als wir rufen können. Doch obwohl viele Dinge besser werden, als sie vorher waren, scheinen die Menschen groteskerweise zu glauben, dass die Zukunft eine einzige Katastrophe sein wird.[3]
Und in Steven Pinkers Gewalt [engl. The Better Angels of Our Nature] heißt es ähnlich – hier der englische Klappentext:
Ob Sie es glauben oder nicht, wir leben heutzutage im friedvollsten Moment in der Geschichte unserer Gattung. In seinem packenden und kontroversen neuen Buch zeigt New York Times-Bestseller-Autor Steven Pinker, dass trotz der nicht abreißenden Nachrichten von Krieg, Verbrechen und Terrorismus die Gewalt über weite Abschnitte der Geschichte auf dem Rückmarsch ist. Gegen die Mythen von der den Menschen eigenen Gewalt und gegen den Fluch der Moderne setzt dieses ehrgeizige Buch Steven Pinkers Forschung über die Essenz der menschlichen Natur fort und greift auf Psychologie und Geschichte zurück, um ein bemerkenswertes Bild einer zunehmend aufgeklärten Welt zu zeichnen.[4]
In den Massenmedien, speziell der nichteuropäischen Länder, hört man öfter einer bescheidenere Version dieses Optimismus, der sich auf die Wirtschaft konzentriert: Krise, welche Krise? Man betrachte die BRIC-Staaten oder Polen, Südkorea, Singapur, Peru, etliche subsaharische afrikanische Länder: Sie alle wachsen. Die Verlierer sind nur Westeuropa und, bis zu einem gewissen Grad, die USA; wir haben es also mit keiner globalen Krise zu tun, sondern befinden uns an einem Wendepunkt der Fortschrittsdynamik, die sich vom Westen entfernt. Ist ein mächtiges Symbol für diesen Wandel nicht die Tatsache, dass in jüngerer Zeit viele Menschen aus Portugal, einem Land in tiefer Krise, nach Mosambik und Angola, die Exkolonien Portugals, zurückkehren, aber diesmal als Wirtschaftsimmigranten und nicht als Kolonialherren? Unsere vielbeweinte Krise ist ihren Namen kaum wert, wenn sie lediglich eine lokale Krise innerhalb eines Gesamtrahmens des Fortschritts ist. Selbst in Bezug auf die Menschenrechte ließe sich fragen: Ist die Situation in China und Russland heute nicht viel besser als vor fünfzig Jahren? Die derzeitige Krise als globales Phänomen zu beweinen ist einer typisch eurozentristischen Sicht geschuldet und noch dazu einer Sicht der Linken, die sich für gewöhnlich für ihren Anti-Eurozentrismus auf die Schulter klopfen.
Mit vielen Einschränkungen kann man grob die Daten akzeptieren, auf die sich diese »Rationalisten« beziehen. In der Tat leben wir heute eindeutig besser als unsere Vorfahren vor 10000 Jahren, und selbst ein durchschnittlicher Häftling in Dachau (dem Nazi-Arbeitslager, nicht Auschwitz, dem Todeslager) lebte wenigstens etwas besser als wahrscheinlich ein Sklave der Mongolen. Die Vergleiche ließen sich fortsetzen – aber diese Erfolgsgeschichte verfehlt einen entscheidenden Punkt.
Zunächst einmal – wir sollten hier unsere antikolonialistische Freude dämpfen – stellt sich die Frage: Wenn Europa sich in allmählichem Verfall befindet, was ersetzt dann seine Hegemonie? Die Antwort lautet: »Der asiatische Kapitalismus« (der selbstverständlich nichts mit dem asiatischen Volk, dafür alles mit der gegenwärtigen klaren Tendenz des Kapitalismus zu tun hat, die Demokratie außer Kraft zu setzen). Seit Marx war die wahrhaft radikale Linke nie einfach »fortschrittlich«; sie war besessen von der Frage: Was ist der Preis des Fortschritts? Marx war vom Kapitalismus fasziniert, von der nie dagewesenen Produktivität, die er entfesselte; er bestand aber darauf, dass ebendieser Erfolg Antagonismen hervorbringt. Wir sollten dasselbe in Bezug auf den heutigen Kapitalismus tun: seine dunkle Kehrseite im Auge behalten, die Revolten schürt.
Das alles beinhaltet, dass die heutigen Konservativen in Wirklichkeit nicht konservativ sind. Während sie die permanente Selbstrevolutionierung des Kapitalismus vollständig billigen, wollen sie ihn letztlich nur effizienter gestalten, indem sie ihn mit einigen traditionellen Institutionen ausstatten (Religion beispielsweise), um seine zerstörerischen Folgen für das soziale Leben zu begrenzen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stützen. Ein wahrer Konservativer ist heutzutage jemand, der die Antagonismen und Sackgassen des Kapitalismus voll und ganz eingesteht, derjenige, der einfachen Fortschritt zurückweist und sich der dunklen Kehrseite des Fortschritts bewusst ist. In diesem Sinne kann nur ein radikaler Linker heute ein wahrer Konservativer sein.
Die Leute rebellieren nicht, wenn die »Dinge wirklich schlecht stehen«, sondern wenn ihre Erwartungen enttäuscht werden. Die Französische Revolution ereignete sich, nachdem der König und die Adligen allmählich über Jahrzehnte ihren Zugriff auf die Macht verloren hatten; die antikommunistische Revolte von 1956 in Ungarn brach aus, nachdem Imre Nagy bereits seit zwei Jahren Ministerpräsident gewesen war und es bereits (relativ) freie Debatten unter Intellektuellen gegeben hatte; 2011 rebellierte das Volk in Ägypten, weil es wirtschaftlichen Fortschritt unter Mubarak gegeben hatte. Dieser hatte eine ganze Schicht von gutausgebildeten jungen Menschen hervorgebracht, die sich an der globalen digitalen Kultur beteiligten. Aus diesem Grund tun die chinesischen Kommunisten recht daran, in Panik zu verfallen, weil die Chinesen im Durchschnitt heute besser leben als vor 40 Jahren, die sozialen Antagonismen (zwischen den Neureichen und dem Rest) sich aber verschärft haben und die Erwartungen der Menschen nun deutlich höher sind. Genau das ist das Problem an Entwicklung und Fortschritt: Sie sind immer ungleichmäßig, sie bringen neue Instabilität und neue Antagonismen hervor und wecken Erwartungen, die nicht erfüllt werden können. In Tunesien oder Ägypten kurz vor dem Arabischen Frühling lebte die Mehrheit der Bevölkerung wahrscheinlich etwas besser als einige Jahrzehnte zuvor, aber die Standards, in denen sie ihre (Un-)Zufriedenheit bemaßen, waren deutlich höher.
Also haben der Spectator, Ridley, Pinker und ihre Gleichgesinnten im Prinzip recht, aber genau die Tatsachen, die sie hervorheben, schaffen die Voraussetzungen für Revolten und Rebellionen. Der Fehler, den man vermeiden muss, lässt sich am besten am Beispiel einer (möglicherweise apokryphen) Geschichte über den linken keynesianischen Ökonomen John Galbraith zeigen. Vor einer Reise in die Sowjetunion in den späten 1950er Jahren schrieb er seinem antikommunistischen Freund Sidney Hook: »Keine Sorge, ich werde mich von den Sowjets nicht verführen lassen und bei meiner Rückkehr behaupten, sie hätten dort Sozialismus!« Hook antwortete umgehend: »Genau das ist meine Sorge – dass Du zurückkommst und behauptest, die Sowjetunion sei nicht sozialistisch!« Was Hook bekümmerte, war die naive Verteidigung der Reinheit des Begriffs: Wenn etwas schiefläuft bei dem Aufbau der sozialistischen Gesellschaft, macht dies nicht die Idee an sich zunichte, es heißt nur, dass sie nicht richtig umgesetzt wurde. Können wir heute nicht die gleiche Naivität aufseiten der Marktfundamentalisten erkennen? Als Guy Sorman kürzlich während einer Fernsehdebatte behauptete, Demokratie und Kapitalismus gehören notwendig zusammen, konnte ich nicht widerstehen, die offensichtliche Frage zu stellen: »Aber wie sieht es mit dem aktuellen China aus?« Er konterte: »In China gibt es keinen Kapitalismus!« Für den fanatisch prokapitalistischen Sorman ist ein nichtdemokratisches Land schlicht kein wirklich kapitalistisches Land, sondern praktiziert lediglich eine verformte Version des Kapitalismus, in genau der Weise, in der für einen demokratischen Kommunisten der Stalinismus ganz einfach keine authentische Form des Kommunismus war. Der Fehler, der diesem Denken zugrunde liegt, ist leicht auszumachen. Er ist der gleiche, der aus folgendem Witz bekannt ist: »Meine Verlobte kommt nie zu spät zu einer Verabredung, denn sobald sie zu spät kommt, ist sie nicht mehr meine Verlobte.« Auf diese Weise erklärt ein heutiger Apologet des freien Markts diese Krise von 2008: Nicht das Versagen des freien Markts verursachte diese Krise, sondern die exzessive staatliche Regulierung, das heißt die Tatsache, dass unsere Marktwirtschaft keine wirkliche war, sondern sich noch immer in den Fängen des Wohlfahrtsstaates befand. Wenn wir uns an solche Reinheit des Marktkapitalismus halten und seine Fehler als versehentliche Panne betrachten, enden wir in einem naiven Fortschrittsglauben, der den irren Tanz der Gegensätze ignoriert.
Einer der bemerkenswertesten Fälle dieses irren Tanzes in der Wirtschaftssphäre ist die Koexistenz von hoher Beschäftigung und der Bedrohung durch Arbeitslosigkeit: Je mehr Arbeitnehmer arbeiten, desto verbreiteter ist die Bedrohung durch Arbeitslosigkeit. Die heutige Situation zwingt uns deshalb dazu, den Akzent unserer Lesart von Marx’ Kapital von dem allgemeinen Thema der kapitalistischen Reproduktion auf – wie Fredric Jameson formuliert – die »grundlegende strukturelle Schlüsselrolle der Arbeitslosigkeit im Kapital selbst« zu verschieben: »Arbeitslosigkeit ist strukturell untrennbar von der Dynamik der Akkumulation und Expansion, die die Natur des Kapitalismus selbst darstellt.«[5] Der wohl äußerste Punkt der »Einheit der Gegensätze« in der Wirtschaftssphäre liegt genau im Herzen des Erfolgs des Kapitalismus (erhöhte Produktivität etc.), der Arbeitslosigkeit hervorbringt (indem er mehr und mehr Arbeiter nutzlos macht): Was ein Segen sein sollte (weniger harte Arbeit, die nötig ist), wird zum Fluch. Auf diese Weise ist der Weltmarkt in Bezug auf seine immanente Dynamik »ein Raum, in dem jeder einmal ein produktiver Arbeiter war und in dem die Arbeit sich überall als nicht mehr wettbewerbsfähig selbst aus dem System geworfen hat«.[6] Das bedeutet, dass im laufenden Prozess der kapitalistischen Globalisierung die Kategorie der Arbeitslosigkeit eine neue Qualität erlangt hat, die über den klassischen Begriff der »industriellen Reservearmee« hinausgeht. Man sollte in Bezug auf die Kategorie der Arbeitslosigkeit »die massiven Bevölkerungsgruppen überall auf der Welt betrachten, die, im wahrsten Sinne des Wortes, ›aus der Geschichte gefallen sind‹, die absichtsvoll aus dem Modernisierungsprojekt des Erste-Welt-Kapitalismus ausgeschlossen und als hoffnungslose oder zum Sterben verurteilte Fälle abgeschrieben werden«[7]: sogenannte gescheiterte Staaten (Kongo, Somalia), Opfer von Hungersnöten oder ökologischen Katastrophen und in pseudoarchaischem »ethnischem Hass« gefangen, Objekte der Philanthropie und der NGOs oder (oftmals die gleichen Leute) des »Kriegs gegen den Terror«. Die Kategorie des Arbeitslosen sollte also ausgedehnt werden, um die ganze Spanne der temporär Arbeitslosen, der Nicht-mehr-zu-Gebrauchenden und Dauerarbeitslosen bis zu den Menschen in Slums und anderen Arten von Ghettos (von Marx selbst als »Lumpenproletariat« bezeichnet) einzuschließen und schließlich auch ganze Gegenden, Bevölkerungen oder Staaten, die von dem globalen kapitalistischen Prozess ausgeschlossen sind, wie die weißen Flecken auf alten Landkarten. Führt diese Erweiterung des Kreises der »Arbeitslosen« uns nicht von Marx wieder zu Hegel zurück: Der »Pöbel« kehrt wieder und taucht im Herzen selbst der emanzipatorischen Kämpfe auf? Das bedeutet, dass eine solche Neukategorisierung die gesamte »kognitive Karte« der Situation ändert: Der träge Hintergrund der Geschichte wird zum potentiellen Akteur des emanzipatorischen Kampfes.
Wir sollten Jamesons Ausführungen jedoch drei Änderungen hinzufügen. Zunächst sollten wir das von ihm vorgeschlagene semiotische Viereck korrigieren, dessen Begriffe aus 1. den Arbeitern bestehen, 2. der industriellen Reservearmee der (temporär) Arbeitslosen, 3. den (dauerhaft) Nicht-Vermittelbaren und 4. den »ehemals Arbeitenden«,[8] die nun aber überflüssig geworden sind. Wäre es nicht angebrachter, als vierten Begriff die illegal Arbeitenden einzusetzen, diejenigen, die in Schwarzmärkten und Slums in verschiedenen Formen der Sklaverei arbeiten? Zweitens verfehlt Jameson herauszuheben, wie die »Ausgeschlossenen« oft dennoch eingeschlossen sind in den Weltmarkt. Betrachten wir beispielsweise den Fall Kongos: Hinter der Fassade »primitiver ethnischer Leidenschaften«, die wieder in Afrikas »Herz der Finsternis« ausbrechen, lassen sich leicht die Konturen des globalen Kapitalismus nachzeichnen. Seit dem Sturz Mobutos existiert der Kongo nicht mehr als vereinter funktionierender Staat; sein östlicher Teil besteht aus einer Vielzahl von Territorien, die von lokalen Warlords beherrscht werden, die ihr jeweiliges Stück Land durch Armeen drogensüchtiger Kindersoldaten kontrollieren. Jeder Warlord hat Geschäftsverbindungen zu einem ausländischen Unternehmen oder Konzern, der die Reichtümer – meist Bodenschätze – der Region ausbeutet. Diese Arrangements nützen beiden Partnern: Der Konzern erhält Ausbeutungsrechte, ohne Steuern zu zahlen etc., während die Warlords dafür bezahlt werden. Ironischerweise werden die meisten dieser Bodenschätze in technologischen Produkten wie Laptops oder Mobiltelefonen verwendet. Wir sollten es folglich unterlassen, den Konflikt auf die »wilden Sitten« der lokalen Bevölkerung zu schieben: Wenn wir aus der Gleichung die ausländischen Technologie-Konzerne herausrechnen, fällt das gesamte Gebäude des »ethnischen, von alten Leidenschaften angefachten Kriegs« in sich zusammen.[9] Und drittens sollte die Kategorie der »ehemals Arbeitenden« durch ihr Gegenteil ergänzt werden: die gutausgebildeten Arbeitslosen. Heute hat eine ganze Generation von Studenten fast keine Chance, eine angemessene Arbeit zu finden, was zu Massenprotesten führt. Der schlechteste Weg, diese Lücke zu schließen, ist es, die Bildung direkt den Bedürfnissen des Marktes unterzuordnen – aus keinem anderen Grund als dem, dass der Markt selbst die von den Universitäten bereitgestellte Bildung obsolet macht. Diese nicht zu vermittelnden Studenten sind dazu bestimmt, eine Schlüsselrolle in der Organisation der ausstehenden Emanzipationsbewegungen zu spielen – wie sie es bereits in Ägypten und in den europäischen Protesten von Griechenland bis England getan haben. Ein radikaler Wandel wird nie von den Armen allein in Gang gesetzt. Wenn eine Generation von nicht vermittelbaren gutausgebildeten Jungen hinzukommt, kombiniert mit der weithin verfügbaren digitalen Technologie, bietet sich die Perspektive einer eigentlichen revolutionären Situation.
Jameson geht hier einen weiteren (paradoxalen, aber zutiefst gerechtfertigten) Schritt: Er charakterisiert die neue strukturelle Arbeitslosigkeit als eine Form der Ausbeutung