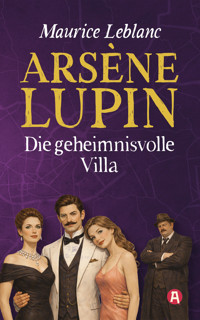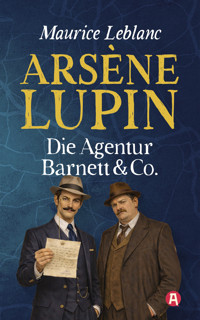2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: aionas
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Mord, der alte Wunden öffnet, ein gestohlenes Schmuckstück und eine Frau, die nicht vergessen hat Der Tod der jungen Élisabeth Gaverel und der Diebstahl einer kostbaren Perlenkette scheinen zunächst ein gewöhnlicher Kriminalfall zu sein. Doch für Arsène Lupin führen die Spuren bald in eine Vergangenheit, die er hinter sich lassen wollte. Intrigen, Erpressung und familiäre Geheimnisse verdichten sich und im Hintergrund wirkt der lange Schatten der Gräfin von Cagliostro. Was einst zwischen Lupin und Cagliostro begann, fordert nun seinen Tribut. Ihr Einfluss ist subtil, ihre Rache sorgfältig vorbereitet. Lupin muss nicht nur Täter entlarven, sondern sich einer alten Schuld stellen, die sein Leben bis heute prägt. "Die Rache der Cagliostro", Band 18 der Lupin-Collection, ist ein dunkler, konzentrierter Lupin-Roman über Vergeltung und Erinnerung. Ein Band, in dem sich zeigt, dass manche Gegner nie wirklich verschwinden und dass Vergangenheit manchmal tödlicher ist als jedes Verbrechen. Zur Lupin-Collection Die Lupin-Collection vereint nahezu alle Romane und Erzählungen rund um Arsène Lupin in einer sorgfältig kuratierten Reihe und ist in diesem Umfang im deutschen Sprachraum einmalig. Sie enthält auch bisher noch nicht ins Deutsche übersetzte Bände. Die Serie folgt der Chronologie der Erscheinungsjahre und zeigte die innere Entwicklung der Figur vom jungen Abenteurer über den brillanten Meister der Täuschung bis hin zum reifen Strategen und Ermittler. Klassiker, seltene Texte und spätere Werke stehen gleichberechtigt nebeneinander und machen sichtbar, wie vielfältig und wandelbar Lupin ist: Gentleman-Gauner, Detektiv, Patriot, Liebhaber und Spieler mit Identitäten. Die Collection lädt dazu ein, Arsène Lupin nicht nur als legendäre Figur, sondern als literarisches Gesamtwerk neu zu entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Maurice Leblanc
Arsène Lupin
Die Rache der Cagliostro
Detektivroman
Inhalt
Vorwort des Arsène Lupin
ERSTER TEIL. DAS ZWEITE DER BEIDEN DRAMEN
1 Auf Kriegsfährte
2 Bluttaten
3 Raoul greift ein
4 Inspektor Goussot greift an
5 Faustine Cortina und Simon Lorient
6 Die Statue
7 Zanzi-Bar
8 Thomas Le Bouc
9 Der Chef
10 Gräfin von Cagliostro befielt
ZWEITER TEIL. DAS ERSTE DER BEIDEN DRAMEN
1 Verlobung
2 Geheimnisvoller Besuch
3 Die Entführung
4 Das blaue Etui
5 Heirat?
6 Hass
7 Jemand stirbt
8 Phryné
Orientierungsmarken
Cover
Vorwort des Arsène Lupin
Ich möchte gleich zu Beginn festhalten, dass ich die Abenteuer, die mir mein offizieller Chronist zuschreibt, durchaus zu schätzen weiß und ihre wesentliche Richtigkeit bestätige. Doch habe ich Vorbehalte gegen die Art, wie er sie erzählt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, ein echtes Abenteuer auf den Geschmack des Publikums abzustimmen. Vielleicht ist es nicht ideal, mich ständig im strahlendsten Licht erscheinen zu lassen und mich mit aller Kraft in den Mittelpunkt zu rücken.
Mein Chronist begnügt sich nicht damit, all die Episoden meines Lebens zu übergehen, in denen mich die Umstände niederdrückten, meine Gegner mir überlegen waren oder die ehrenwerten Vertreter der Ordnung mich zurechtstutzten. Er ordnet, glättet, dehnt aus, übertreibt. Und ohne je die Fakten zu verfälschen, arrangiert er alles so geschickt, dass selbst ich mich bei so viel Glanz gelegentlich unwohl fühle.
Diese Art des Erzählens missfällt mir. Ich weiß nicht, wer sagte: „Man muss seine Grenzen kennen und lieben.“ Aber ich kenne meine. Und ich gestehe sogar, dass ich mich an ihnen orientiere, denn ich verabscheue alles Übermenschliche, Maßlose oder zu sehr Aufgebauschte. Was ich bin, reicht mir. Alles darüber hinaus wäre unglaubwürdig und, schlimmer noch, lächerlich. Und ja, eine meiner Schwächen ist die Angst, lächerlich zu wirken.
Lächerlich wirke ich zweifellos, und das ist der eigentliche Grund für dieses Vorwort, wenn man mich dem Publikum immer wieder in der gleichen, ewigen Rolle des Liebhabers vorführt. Gewiss habe ich ein empfindsames Herz, und Amor lauert an jeder Straßenecke. Und ich leugne nicht, dass mir die Frauen im Allgemeinen wohlgesinnt waren. Ich habe Erinnerungen, die mir schmeicheln. Ich durfte manche Schwäche genießen, auf die jeder andere voller Stolz verweisen würde.
Aber daraus zu machen, ich sei ein Don Juan, ein unwiderstehlicher Lovelace, ist eine Verzerrung, gegen die ich mich ausdrücklich wehre. Auch ich wurde abgewiesen. Man zog mir Rivalen vor, die es kaum wert waren. Ich kenne Demütigung und Verrat. Ich habe Niederlagen erlebt, die man kaum versteht, doch sie gehören dazu, wenn man ein wahres Bild von mir zeichnen will.
Deshalb wollte ich, dass dieses Abenteuer erzählt wird. Offen, direkt und ohne Beschönigung. Hier werde ich mich nicht mit jener ärgerlichen Unfehlbarkeit schmücken, die mir mein Chronist gern andichtet. Mein Herz funkt nicht ständig dazwischen. Meine Verführungskunst stößt auf klare Grenzen. Vielleicht wird mir dies die Nachsicht jener einbringen, die sich durch meine angeblichen Erfolge und Verdienste, und das nicht ganz ohne Grund, gelegentlich irritiert fühlten.
Noch ein Wort. Joséphine Balsamo, die große Leidenschaft meines zwanzigsten Lebensjahres, die sich als Tochter des Grafen Cagliostro ausgab und behauptete, von ihm das Geheimnis ewiger Jugend erhalten zu haben, tritt in diesem Buch nicht auf. Sie fehlt aus einem Grund, dessen Gewicht der Leser selbst ermessen wird. Und doch: Wie könnte man ihren Namen nicht mit einer Geschichte verbinden, über die ihr Bild einen so tragischen Schatten wirft, in der Liebe und Hass einander so innig verflechten und Rache in so tiefe Dunkelheit führt?
ERSTER TEIL DAS ZWEITE DER BEIDEN DRAMEN
1 Auf Kriegsfährte
Die klaren Morgen des Januar, in denen die Luft schon einen Hauch von Frühling trägt, besitzen eine eigene Kraft. Die Tage wachsen, das Licht gewinnt und man selbst fühlt sich leichter. Genau so ging es Arsène Lupin, als er gegen elf Uhr über die Boulevards schlenderte.
Er ging beschwingt, stand bei jedem Schritt einen Moment zu sehr auf den Zehenspitzen, als trainiere er heimlich. Und tatsächlich: Auf jeden Schritt mit dem linken Fuß folgte ein tiefes Einatmen, das seinen ohnehin beeindruckenden Brustkorb beinahe verdoppelte.
Der Kopf leicht zurückgelehnt, der Rücken entspannt durchgebogen. Kein Mantel. Ein hellgrauer Sommeranzug, dazu ein weicher Filzhut unter dem Arm.
Sein Gesicht, das die Vorübergehenden und besonders die hübschen unter ihnen wie mit einem flüchtigen, stillen Gruß streifte, gehörte einem Mann, der auf die Fünfzig zuging, wenn er sie nicht längst überschritten hatte. Doch von hinten oder aus der Ferne sah man nur einen schlanken, eleganten Herrn, der jedem Alter über fünfundzwanzig entschieden widersprochen hätte.
„Und selbst das“, dachte er, während er in den Schaufensterscheiben sein Spiegelbild betrachtete. „Wie viele Jünglinge könnten mich beneiden.“
Was jedoch am meisten Neid weckte, war dieser Ausdruck von Kraft und Selbstgewissheit, die Ruhe eines Menschen mit gutem Gleichgewicht, heiterem Gemüt und der dreifachen Zufriedenheit eines starken Magens, einer perfekten Verdauung und eines reinen Gewissens. Mit solchen Vorteilen geht man mühelos erhobenen Hauptes durch die Welt.
Dazu kam ein gut gefülltes Portemonnaie. In seiner Revolvertasche steckten vier Scheckblöcke, von verschiedenen Banken und auf verschiedene Namen. Und überall im Land, in verborgenen Verstecken von Flussbetten bis Felsnischen, lagen Goldbarren und Säcke voller Edelsteine für ihn bereit.
Ganz zu schweigen von dem Kredit, den er genoss, ob als Raoul de Limésy, Raoul d’Avenac, Raoul d’Enneris oder Raoul d’Averny. Unauffällige Namen des Landadels, durch einen einzigen Vornamen verbunden und in allen Kreisen angesehen. So kam er gerade an der Banque des Provinces vorbei, wo er einen hohen Scheck einzureichen hatte, ausgestellt auf den Namen Raoul d’Averny. Er trat ein, erledigte die Formalitäten, stieg dann zu den Schließfächern hinab, unterschrieb das Register und öffnete sein Fach, um einige Unterlagen zu entnehmen.
Während er suchte, bemerkte er einen schwarz gekleideten Herrn mit dem verstaubten Stil eines altmodischen Provinznotars. Der Mann zog aus dem Nachbarfach mehrere Pakete hervor, schnitt die Kordeln durch und begann, Bündel um Bündel von Zehntausend-Franc-Scheinen abzuzählen, sauber mit Nadeln zusammengefasst. Kurzsichtig, nervös, immer wieder um sich blickend. Und doch merkte er nicht, dass Arsène Lupin jede seiner Bewegungen verfolgte. Am Ende verstaut er achtzig, vielleicht neunzig dieser Bündel, acht- bis neunhunderttausend Francs, ordentlich in einer Ledermappe.
Lupin zählte mit und dachte: „Was treibt dieser ehrenwerte Rentier? Kassierer? Zahlmeister? Oder einer jener Schlaumeier, die ihren Schatz vor dem Fiskus verstecken? Solche Leute verachte ich. Den Staat zu prellen, welch Niedertracht.“
Der Mann schloss die Mappe, verließ den Raum. Lupin folgte ihm. Selbst das reinste Gewissen hält einen nicht davon ab, einem Herrn mit einer Million in bar hinterherzugehen. Eine solche Summe hat eine eigene Anziehungskraft. Und Lupin war ein guter Jagdhund, mit sicherem Spürsinn und wachsender Vorfreude.
Ganz ohne Plan übrigens. Ohne Hintergedanken. Was bedeutete schon ein Bündel Banknoten für jemanden mit seinen Reserven.
Der Mann ging in eine Konditorei in der Rue du Havre, kam mit einem Päckchen Gebäck wieder heraus und steuerte den Bahnhof Saint-Lazare an.
„Potzblitz“, dachte Lupin. „Verschleppt er mich etwa ans andere Ende der Welt?“
Der Herr stieg in einen Zug. Lupin folgte, leise protestierend, aber entschlossen. Der Großraumwagen war überfüllt. Man fuhr gemeinsam auf der Linie nach Saint-Germain. Der Mann hielt die Mappe fest an sich gedrückt, wie eine Mutter ihr Kind. Er stieg hinter Chatou, in Le Vésinet, aus. Lupin freute sich. Er liebte diesen Ort.
Zwölf Kilometer vor Paris, in einer Schleife der Seine, lag ein Viertel nach strengem Bauplan. Um einen stillen See reihten sich breite Alleen, gepflegte Gärten, elegante Villen. Der Frost glitzerte im Geäst. Der Boden klang hart unter den Schritten. Ein Genuss, so dahinzugehen, mit nichts im Sinn außer der Frage, was im Koffer des Nächsten steckte.
Ein kleiner Teich, umsäumt von hübschen Häusern, führte zum Weg der Roseraie, dann zur Orangerie. Dort klopfte der Herr an die Tür einer Villa namens Les Clématites.
Lupin blieb auf Abstand. Die Tür öffnete sich. Zwei junge Mädchen stürzten heraus.
„Zu spät, Onkel. Das Essen wartet. Was hast du uns mitgebracht?“
Lupin war entzückt. Der liebevolle Empfang, die fröhlichen Stimmen, die schlichte Villa mit ihrem warmen Flair. Man fühlte sich eingeladen, das kleine Glück einer vereinten Familie zu teilen.
Fünfhundert Meter weiter lag der große See mit einer kleinen Insel, die über eine Holzbrücke erreicht werden konnte. In dem Restaurant dort stärkte sich Lupin und umrundete anschließend den See. Die winterlichen Villen wirkten friedlich.
Eine jedoch fiel ihm besonders auf. Nicht nur, weil sie hübsch war, sondern weil am Tor ein Schild hing: „Clair-Logis. Anwesen zu verkaufen. Besichtigung hier. Auskünfte in der Villa Les Clématites.“
Les Clématites! Genau jene Villa also. Wie hätte die Ledermappe nichts damit zu tun haben sollen.
Zwei kleine Pavillons flankierten den Eingang. Im rechten wohnte der Gärtner. Lupin ließ sich das Anwesen zeigen und war sofort hingerissen. Ein zauberhaftes Häuschen, etwas vernachlässigt, aber ideal für eine geschickte Sanierung. Das ist es, dachte er. Ein Refugium nahe Paris, ein Ort für ruhige Wochenenden. Mehr brauche ich nicht.
Und welch glücklicher Zufall. Das Schicksal bot ihm ein Haus an und gleich daneben die Mittel, es ohne eigenen Aufwand zu erwerben. Die Ledermappe schien wie dafür geschaffen.
Fünf Minuten später wurde Monsieur Raoul d’Averny im Salon empfangen. Philippe Gaverel, der Besitzer, wartete bereits. Die Nichten waren ebenfalls da. Und noch immer trug Gaverel die Mappe unter dem Arm, verbissen wie an einem Körperteil.
Lupin erklärte seine Kaufabsicht. Gaverel nannte seine Bedingungen. Lupin zögerte kurz, sah zu den Schwestern hinüber. Der Bräutigam der älteren Schwester war hinzugetreten, und die drei lachten. Lupin wurde verlegen. Gewissenhaft wie immer fragte er sich, ob sein Plan die jungen Frauen benachteiligen könnte.
Er bat um achtundvierzig Stunden Bedenkzeit.
„Einverstanden“, sagte Gaverel. „Aber dann verhandeln Sie mit meinem Notar. Ich reise heute Nachmittag in den Süden.“
Er erzählte, dass er seit acht Monaten Witwer sei und sein Sohn ihn nach Nizza eingeladen habe. Er wohne nicht bei seinen Nichten, sondern drüben in seiner Villa, der Orangerie.
Lupin blieb noch eine Stunde, plauderte, erzählte Anekdoten. Die Mädchen waren begeistert. Doch Lupin beobachtete Gaverel genau.
Man ging in die Gärten. Gaverel gab seinem Diener Anweisungen, der das Gepäck ins Auto lud, Richtung Gare de Lyon.
„Nimmst du deine Mappe mit, Onkel?“, fragte eine Schwester.
„Aber nein“, sagte er. „Nur ein paar unwichtige Papiere, die ich drüben weglegen muss.“
Er ging ins Haus. Zwanzig Minuten später kam er ohne Mappe wieder heraus. Keine der Taschen war ausgebeult genug für die Bündel. Also hat er sie versteckt, dachte Lupin. Natürlich. Die Erbschaft seiner Frau, sauber am Fiskus vorbeigeschmuggelt. Solche Leute verdienen keine Schonung.
Er nahm Gaverel beiseite.
„Ich habe es mir überlegt, Monsieur. Ich kaufe.“
„Sehr gut“, sagte Gaverel und übergab seinen Nichten den Schlüssel.
Sie fuhren zum Bahnhof. Gaverel trug die Mappe tatsächlich nicht bei sich.
Zwei Wochen später unterschrieb Lupin einen Scheck, eine bloße Anzahlung. Der eigentliche Kaufpreis lag hundertfach im Versteck der Orangerie. Er hatte es nicht eilig. Ein Versteck ist umso besser, je weniger Menschen davon wissen. Nun wusste nur noch er davon, und das genügte.
Er brauchte nur noch einen Architekten. Der Zufall half. Ein befreundeter Arzt empfahl ihm einen jungen Architekten namens Félicien Charles, talentiert und frisch diplomiert. Es war ein scheuer, zurückhaltender Mann, bemüht zu gefallen, klug, künstlerisch begabt. Er verstand sofort, was zu tun war, und bot an, auch Innengestaltung und Garten zu übernehmen. Er zog in den linken Pavillon ein.
Die Monate vergingen.
Lupin kam drei oder vier Mal vorbei. Er stellte Félicien den Schwestern vor und blieb so in ihrem Alltag präsent. Die ältere Schwester erkrankte schwer, die Hochzeit verzögerte sich.
Schließlich legte man den 9. Juli fest. Da Onkel Gaverel anreisen wollte, beschloss Lupin, gerade auf einer Reise in Holland, früher zurückzukehren und die Banknoten zu organisieren.
Der Plan war einfach. Er hatte bemerkt, dass man am Ende eines schmalen Durchgangs zwischen zwei Mauern ein Boot einer Nachbarvilla heranziehen konnte. So würde er nachts ungesehen in den Garten der Orangerie gelangen.
Sobald er die Bündel hätte, würde er sie neu ordnen, ihnen ihr ursprüngliches Aussehen geben. Gaverel würde, da er vor der Hochzeit bei den Nichten bleiben wollte, kaum mehr tun als nachzusehen, ob die Mappe noch an ihrem Platz lag. Der Diebstahl würde erst im Oktober bemerkt werden.
Doch als Lupin eines Morgens eintraf, hatte am Vortag ein furchtbares Drama den stillen kleinen See erschüttert. Ein Drama voller tragischer Wendungen…
2 Bluttaten
Vorweg: Das Mittagessen in Les Clématites, kurz vor jener entsetzlichen Zwölfstundenspanne, in der alles kippte, war heiter und sorglos. Zwei junge Frauen, zwei junge Männer, Pläne für heute, morgen, die ganze Woche. Kein Vorzeichen, kein Druck auf den Herzen derer, die der Sturm gleich treffen würde.
Die Schwestern Gaverel lebten seit dem Tod der Eltern, sieben, acht Jahre her, in Les Clématites, betreut von ihrer alten Gouvernante Amélie, die beide zur Welt hatte kommen sehen, und deren Mann Édouard, dem Diener.
Élisabeth, groß, blond, noch etwas blass nach der Krankheit, lächelte schlicht und sprach vor allem mit ihrem Verlobten, Jérôme Helmas, einem kräftigen, offenen Kerl, derzeit ohne Stellung. Als Waise hatte er das Haus seiner Mutter behalten, im Vésinet, an der Nationalstraße nach Paris. Er war erst Élisabeths Freund, dann ihr Bräutigam geworden. Rolande kannte er seit Kindertagen, duzte sie und aß fast täglich in Les Clématites.
Rolande, deutlich jünger, hatte mehr Ausstrahlung und jene dunklere, leidenschaftliche Schönheit, die lange nachwirkt. Sie zog unverkennbar den Blick von Félicien Charles auf sich, der sie heimlich beobachtete, als wage er den direkten Blick nicht. War er verliebt? Rolande hätte es nicht sagen können. Er war einer jener Menschen, deren Miene nichts verrät und die nie zu fühlen scheinen, was sie fühlen.
Nach dem Essen gingen alle vier ins Studio, einen großen, doch durch Möbel, Nippes und Bücher behaglich wirkenden Raum. Das weit geöffnete englische Fenster gab den Blick frei auf den schmalen Rasenstreifen zwischen Villa und Teich. Das unbewegte Wasser spiegelte dichtes Geäst, dessen lange Zweige sich im Bild berührten. Rechts, gut sechzig Meter entfernt, lag die Orangerie, Onkel Philippes Haus. Eine niedrige Hecke markierte die Grenze, doch der Rasen zog sich ununterbrochen am Teich entlang.
Élisabeth und Rolande hielten kurz Händchen. Sie liebten einander innig. Vor allem Rolande war voller Fürsorge für die noch schwache Schwester und voller leiser Unruhe.
Rolande setzte sich ans Klavier und winkte Félicien zu sich. Er wollte sich entziehen.
„Verzeihen Sie, Mademoiselle, heute aßen wir später, und ich beginne jeden Tag zur gleichen Zeit.“
„Gibt Ihnen Ihre Arbeit nicht völlige Freiheit?“
„Gerade deshalb muss ich pünktlich sein. Monsieur d’Averny kommt morgen früh. Er fährt die Nacht durch.“
„Welch Glück, ihn wiederzusehen“, sagte sie. „Er ist so sympathisch, so interessant.“
„Dann verstehen Sie, dass ich ihm gefallen will.“
„Bleiben Sie trotzdem… nur eine halbe Minute…“
Er gehorchte und schwieg.
„Sprechen Sie mit mir“, sagte sie.
„Soll ich sprechen oder zuhören?“
„Beides zugleich.“
„Ich kann nur sprechen, wenn Sie nicht spielen.“
Sie antwortete nicht. Sie ließ weiche, hingebungsvolle Phrasen fließen, die wie ein Geständnis klangen. Versuchte sie, ihm etwas zu sagen, oder wollte sie ihn wärmer machen? Er schwieg weiter.
„Gehen Sie“, befahl sie schließlich.
„Gehen… warum?“
„Wir haben heute genug geredet“, neckte sie.
Er zögerte, dann ging er.
Rolande zuckte die Schultern und spielte weiter, während sie Élisabeth und Jérôme beobachtete, die leise sprachen, Seite an Seite auf dem Divan, vom Klang näher aneinandergeschoben. Zwanzig Minuten vergingen.
Dann stand Élisabeth auf: „Jérôme, Zeit für unseren Spaziergang. Es ist so schön, zwischen den Zweigen über das Wasser zu gleiten.“
„Ist das klug? Du bist noch nicht ganz wiederhergestellt.“
„Doch. Es ist Erholung und tut mir gut.“
„Indessen…“
„Indessen bleibt es dabei, mein lieber Jérôme. Ich hole das Boot. Bleib sitzen.“
Wie jeden Tag ging sie in ihr Zimmer, öffnete den Sekretär und schrieb ihrer Gewohnheit nach ein paar Zeilen in ihr Tagebuch, die später als ihre letzten Worte gefunden wurden:
„Jérôme schien mir zerstreut. Ich fragte nach dem Grund. Er widersprach. Als ich nachhakte, wiederholte er es, doch unsicherer: ‚Nein, Élisabeth, ich habe nichts. Was sollte ich mir mehr wünschen, da wir doch heiraten und mein Traum, schon fast ein Jahr alt, wahr wird. Nur…‘ – ‚Nur?‘ – ‚Manchmal sorge ich mich um die Zukunft. Du weißt, ich bin nicht reich und habe mit fast dreißig keine Stellung.‘ Ich legte ihm lachend die Hand auf den Mund: ‚Aber ich bin reich. Wir werden keine Dummheiten machen… doch weshalb so ehrgeizig?‘ – ‚Für dich bin ich ehrgeizig, Élisabeth.‘ – ‚Ich brauche auch nicht viel. Ich gebe mich mit nichts zufrieden, zum Beispiel damit, glücklich zu sein‘, lachte ich. ‚Leben wir einfach hier, bis uns eine gute Fee den Schatz bringt, der uns zusteht.‘ – ‚Ach, an Schätze glaube ich wenig.‘ – ‚Wie? Unser Schatz existiert, Jérôme… Erinnerst du dich? Der alte Freund unserer Eltern, ein entfernter Vetter, von dem man nichts mehr hört, der uns aber gut war… Wie oft sagte Amélie: „Mademoiselle Élisabeth, Sie werden sehr reich. Ihr alter Vetter Georges Dugrival vermacht Ihnen sein Vermögen, ja Ihnen, Élisabeth. Und er soll krank sein.“‘ – Jérôme flüsterte: ‚Das Geld… gut. Aber ich will Arbeit. Ich will, dass der Mann an deiner Seite dir Ehre macht.‘ Er sprach nicht weiter. Ich lächelte nur. Denkt man an die Zukunft, wenn man so liebt wie wir?“
Élisabeth legte die Feder weg, puderte sich, legte einen Hauch Rouge auf, prüfte den Verschluss der Perlenkette, ein Erbstück der Mutter, das sie nie ablegte, und ging hinunter in Onkel Philippes Garten, zu den drei Holzstufen, neben denen das Boot vertäut war.
Jérôme hatte seit ihrem Weggang nicht aufgesehen. Er hörte Rolandes Improvisationen, ohne sie zu hören.
Sie brach ab. „Ich bin so glücklich, Jérôme. Und Sie?“
„Ich auch“, sagte er.
„Nicht wahr? Élisabeth ist ein Wunder. Könnten Sie nur ihre Güte ahnen! Aber Sie werden es sehen.“
Sie spielte wieder, jetzt einen kleinen Triumphmarsch. Dann hielt sie abrupt inne.
„Jemand hat geschrien… Haben Sie es gehört, Jérôme?“
Sie lauschten. Nichts als die Stille des Rasens, des Teichs. Rolande hatte sich wohl geirrt. Sie setzte an, kräftig, freudig.
Wieder fuhr sie hoch. Jetzt war sie sicher: Ein Schrei.
„Élisabeth…“, stöhnte sie und stürzte zum Fenster.
„Zu Hilfe!“, schrie sie mit zugeschnürter Kehle.
Jérôme war schon neben ihr. Er beugte sich hinaus und sah, dicht am Ufer bei den Stufen, einen Mann, der Élisabeth an der Kehle packte. Sie lag, die Beine im Wasser. Jérôme schrie auf und wollte Rolande hinterher über den Rasen stürmen.
Der Mann wandte sich ihnen zu, ließ sofort von seinem Opfer ab, raffte etwas auf und floh durch den Garten der Orangerie.
Jérôme änderte den Plan, rannte ins Nebenzimmer, riss das Luftgewehr von der Wand, womit die Schwestern oft übten, und trat auf die Terrasse, die über die Gärten blickte.
Der Mann sprintete, schon vor dem Haus, offenbar Richtung Gemüsegarten der Orangerie, der einen direkten Ausgang zur Ringallee bot. Jérôme legte an. Ein Schuss. Der Mann überschlug sich kopfüber und stürzte in ein Blumenbeet, zuckte, blieb liegen. Jérôme rannte los.
„Lebt sie?“, rief er, als er zu Rolande kam, die kniend ihre Schwester umklammerte.
„Das Herz schlägt nicht“, schluchzte sie.
„Nein, unmöglich… man kann sie wiederbeleben…“, keuchte er.
Er warf sich auf den Körper, doch bevor er prüfen konnte, rang er: „Ihre Kette… sie ist weg… Er hat ihr die Kehle zugedrückt, um die Perlen zu rauben… Oh Gott… sie ist tot…“
Wie von Sinnen rannte er davon, Édouard hinterher. Sie fanden den Mann bäuchlings im Beet. Die Kugel hatte ihn zwischen den Schulterblättern getroffen, wohl ins Herz.