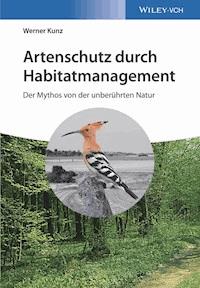
55,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Debatte über die Zukunft des Natur- und Artenschutzes, der zeigt, wie durch aktive Gestaltung von Lebensräumen die historische Artenvielfalt in Mitteleuropa erhalten werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Autor
Impressum
Prolog: Schutz seltener Arten – ein neuer Ansatz ist dringend geboten
Vorwort
Literatur
1 Einführung: Seltene Arten und naturnahe Biotope in Mitteleuropa
1.1 Vorbemerkung
1.2 Ein Plädoyer für das Offenland
1.3 Mitteleuropa ist nicht Brasilien: ein Plädoyer für technisches Biotopmanagement
Literatur
2 Ein Blick zurück in die verlorene Landschaftsstruktur der Vergangenheit
2.1 Der Artenreichtum früherer Biotope
2.2 Der Rückgang der „Biomasse“ in Mitteleuropa
2.3 Verlorene Landschaftsstrukturen – wo sind sie heute noch zu finden?
Literatur
3 Was will der Naturschutz: saubere Luft, Unberührtheit, seltene Arten häufig machen?
3.1 Was ist Natur? Was ist Naturschutz?
3.2 Welche Arten sollen geschützt werden?
3.3 Trennung der Begriffe Umweltschutz, Naturschutz, Artenschutz und Tierschutz
3.4 Falsch verstandener Naturschutz – Kampf an falschen Fronten
3.5 Was sind Naturschutzgebiete?
3.6 Der Schutz der einen Art ist der Tod der anderen Art
3.7 Wer tötet mehr Vögel – die Vogelfänger Westeuropas und des Mittelmeers oder unsere Hauskatzen?
Literatur
4 Ziele, Inhalt und Grenzen der Roten Listen der gefährdeten Arten
4.1 Ziele und Entstehung der Roten Listen der gefährdeten Arten
4.2 Die Einstufung bedrohter Arten in Gefährdungskategorien
4.3 Die nationale Verantwortlichkeit für bestimmte Arten
4.4 Arten oder genetisch isolierte Populationen – Was soll geschützt werden?
Literatur
5 Veränderungen im Bestand der Vögel und Tagfalter in Mitteleuropa und in Deutschland
5.1 Veränderungen im Bestand der Vögel in Deutschland
5.2 Veränderungen im Bestand der Tagfalter in Mitteleuropa
Literatur
6 Die besondere Situation der Arten in Mitteleuropa
6.1 Mitteleuropa ist kein Naturland
6.2 Werden in Mitteleuropa bedrohte Arten durch Waldnationalparks gerettet?
6.3 Stickstoff erstickt die Biodiversität in Mitteleuropa
6.4 Die Rettung vieler Rote-Liste-Arten in Mitteleuropa erfordert technische Eingriffe in die Natur
6.5 Goldregenpfeifer, Uferschnepfe und Großtrappe als Kulturfolger in Mitteleuropa
Literatur
7 Mythos Wald
7.1 Warum lieben die Deutschen den Wald so sehr? Der Ursprung des Menschen liegt doch in der Savanne
7.2 Der Eingriff des Menschen in die mitteleuropäischen Wälder in der Jungsteinzeit und Bronzezeit
7.3 Der Wald in Mitteleuropa von der Römerzeit bis in die Neuzeit
Literatur
8 Die Apokalypse des weltweiten Artensterbens
8.1 Wie viele Arten leben auf der Welt?
8.2 Gibt es heute ein weltweites Artensterben?
Literatur
Tafeln
Tiernamenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
List of Tables
4 Ziele, Inhalt und Grenzen der Roten Listen der gefährdeten Arten
Tab. 4.1 Die Artenzahl der Brutvögel und Tagfalter in Deutschland hat sich in den letzten 100 Jahren kaum geändert. Betrachtet man nur die Artenzahlen, dann bekommt man ein falsches Bild über den Rückgang der Arten. Wenn man die Populationstrends beachtet, dann zeichnet sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Vögeln und den Tagfaltern ab. Während ein beachtlicher Prozentsatz der Vogelarten in den letzten Jahrzehnten wieder häufiger geworden ist, zeichnet sich bei den Tagfaltern ein unbegrenzter fortdauernder Rückgang ab.
Tab. 4.2 Vergleich der Gefährdungskategorien und Einstufungskriterien zwischen der globalen Roten Liste der IUCN und den deutschen Roten Listen. Während die Gefährdungskategorien ungefähr dieselben sind, gibt es in den Einstufungskriterien, nach denen die Arten in die Gefährdungskategorien eingeordnet werden, zwischen der IUCN-Liste und den deutschen Roten Listen erhebliche Unterschiede. Die IUCN-Kriterien schreiben quantitative Werte vor, während die Einstufungen in den deutschen Listen nach qualitativen Kriterien vorgenommen werden. Außerdem benutzen die deutschen Roten Listen den Begriff der Statuskategorie, um zwischen etablierten heimischen Arten, Gelegenheitsgästen und Neobionten zu unterscheiden.
6 Building Audiences
Tab 6.1. Dauer der Perioden des Quartärs in Mitteleuropa.
List of Illustrations
Tafeln
Tafel 1 Grauammer (rechts) und Wiesenpieper (links) sind heute aus vielen Gebieten im westlichen Mitteleuropa verschwunden, wo sie noch vor einigen Jahrzehnten sehr häufige Brutvögel waren. Sie finden ihre Nahrung am Boden, der nur locker bewachsen sein darf und freie Stellen mit warmem Erdboden enthalten muss (oberer Bildteil). Auf den gedüngten Wiesen der heutigen Zeit, die überall lückenlos mit hohem, dichtem Gras zugedeckt sind (unterer Bildteil) finden diesen beiden Arten, die ehemals typische Vögel der Agrarlandschaft waren, keine Nahrung mehr. Die meisten Insekten können im kalten Milieu am Boden einer dichten und feuchten Grasdecke nicht mehr leben, und die wenigen Insekten, die dort noch vorkommen, können von den Vögeln unter dem Gras nicht mehr gesehen und erbeutet werden. Die heutigen landwirtschaftlich genutzten Flächen Mitteleuropas sind für Arten wie die Grauammer und den Wiesenpieper verloren. Es ist unrealistisch, mit der Zielsetzung einer „biologischen Landwirtschaft“ Wiesen und Weiden wieder auf das karge Ertragsniveau früherer Jahrhunderte zurückzuversetzen. Inzwischen sind die Folgelandschaften von Tagebauabgrabungen (oberer Bildteil: Königshovener Höhe westlich von Köln), Flugplätze, Militär- und Industriegelände zu den Brutplätzen dieser Arten geworden und haben den Agrar- und Wiesenflächen ihre jahrhundertelange Bedeutung abgenommen.
Tafel 2 Ein Charakterfalter Mitteleuropas ist der Schwalbenschwanz; auch diese Art ist heute selten geworden. Zum morgendlichen Aufwärmen (unten links) und zur Eiablage benötigt der Schwalbenschwanz freie Erdflächen auf offenem Rasengelände. Nur am warmen Erdboden kann der Schwalbenschwanz seine Eier an junge Möhrenpflanzen ablegen (unten rechts). Die heutigen Ackerflächen, Wiesen und Viehweiden im überdüngten Mitteleuropa sind für die Fortpflanzung des Schwalbenschwanzes nicht mehr geeignet. Der Schwalbenschwanz hat sich neue Biotope gesucht, die an die Stelle des ehemaligen Artenreichtums der landwirtschaftlichen Flächen in Mitteleuropa getreten sind und die heute längst auf dem Wege sind, selbst einigen Naturschutzgebieten den Rang abzulaufen: Braunkohletagebauflächen und deren unmittelbare Folgestadien (oberes Bild: Königshovener Höhe westlich von Köln), Truppenübungsplätze, Flugplätze, Industriebrachen, Autobahnböschungen und stillgelegte Gleisanlagen.
Tafel 3 Viele Tagfalter Mitteleuropas sind auf die Erwärmung des Erdbodens angewiesen. Dazu gehören der phlaeas-Feuerfalter (oben), der argus-Bläuling (links) und der pamphilus-Augenfalter (rechts). Nur ein offener Boden mit Sand und Steinen erwärmt sich in genügendem Maße bei Sonneneinstrahlung (oberes Bild). Die heutigen Wiesen und sonstigen Grasflächen Mitteleuropas enthalten keine eingestreuten Sand- und Steinflächen mehr. Stattdessen überdeckt ein dichter und hoher Graswuchs fast lückenlos den gesamten Boden (unteres Bild) und lässt keinen Sonnenstrahl mehr durch, sodass der Erdboden feucht und kühl bleibt. Die drei o. g. Tagfalter, die noch vor 60 Jahren an vielen Stellen häufig waren, haben die meisten ihrer ehemaligen Verbreitungsgebiete im westlichen Mitteleuropa geräumt.
Tafel 4 Die Sehnsucht nach ursprünglicher, unberührter Natur nimmt oft nicht wahr, welches die Habitate sind, in denen in Mitteleuropa viele seltene Arten zu finden sind, z. B. hier auf einer kleinen Brachfläche im Industriegebiet, wo das filipendulae-Blutströpfchen (links), der jacobaeae-Blutbär (Imago und Raupe rechts), aber auch viele andere Arten zu Hause sind, die in Deutschland nicht mehr häufig zu sehen sind. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Naturschutzverbände ihre Ideologie überdenken müssen und sich in stärkerem Maße den technisch manipulierten Habitaten zuwenden müssen, wenn es darum geht, selten gewordene Arten zu retten.
Tafel 5 Nackte Erdflächen an steilen Abbruchkanten sind heute selten geworden, weil Hochwasserschäden eingedämmt und Hohlwege verschwunden sind. Solche wertvollen Habitate entstehen heute in Mitteleuropa fast nur noch durch die wirtschaftliche Nutzung bestimmter Flächen in der Landschaft. Sobald die Nutzung eingestellt ist, werden die Steilwände gewöhnlich recht schnell wieder mit Maschinen abgeflacht, eingesät oder sogar aufgeforstet. Abbruchkanten werden in der Öffentlichkeit als „hässliche Landschaft“ bezeichnet, die es zu „verschönern“ gilt, und es wird geltend gemacht, dass hier für den Spaziergänger eine Absturzgefahr besteht. Daher werden Abbruchkanten aus ästhetischen und juristischen Gründen in den meisten Fällen zügig wieder vernichtet, sobald sie nicht mehr wirtschaftlich gebraucht werden, und dieser Prozess wird „Renaturierung“ genannt, obwohl er nichts mit einer Wiederherstellung der Natur zu tun hat. Der Begriff der „Renaturierung“ ist in den Augen des Artenschutzes eine paradoxe Bezeichnung. Als Resultat dieser „Renaturierung“ werden hoch wertvolle Habitate für Hymenopteren, Tagfalter (im Bild Männchen und Weibchen des Mauerfuchses am Rande der Aschedeponie im Braunkohletagebau der Königshovener Höhe westlich von Köln), andere Insekten und Vögel vernichtet.
Tafel 6 Der Steinschmätzer (links Männchen, rechts Weibchen) steht in mehreren Bundesländern Deutschlands auf der Roten Liste und wird als vom Aussterben bedrohte Art eingestuft. Um den Steinschmätzer vor dem Verschwinden zu bewahren, ist keine einzige Maßnahme erforderlich, die irgendetwas mit der Erhaltung der Natur oder mit Naturschutz zu tun hat. Wie der Name sagt, brauchen Steinschmätzer Steine. Diese standen in den vergangenen Jahrhunderten fast überall zur Verfügung, weil die Landstriche kahl waren, während sie heute zugewachsen sind. Die Hänge der Hügel und die Flächen zwischen den Äckern und Wiesen waren früher nur wenig von Gräsern, Büschen und Bäumen bewachsen, weil das Holz eingesammelt wurde und die Grasnarbe als Streu für den Viehstall an vielen Orten abgeplaggt wurde. Zudem wurden die Flächen früher von Ziegen und Schafen abgeweidet, und die Vegetation war ohnedies nicht so üppig, weil aus der Luft nicht so viel Stickstoff herabregnete wie heute. Heutzutage sind alle diese Flächen überwachsen, und die Steinhaufen liegen nicht mehr frei. Zur Erhaltung des Steinschmätzers ist kein Naturschutz nötig, sondern es sind maschinelle Eingriffe erforderlich. Kaum eine Art kann mit technischen Mitteln so leicht gefördert und vor dem Aussterben gerettet werden wie der Steinschmätzer. Es ist lediglich vonnöten, großflächige Steinhaufen in der Landschaft aufzuschütten und in regelmäßigen Abständen von der Vegetation frei zu halten. Dass solche Artenschutzmaßnahmen nicht durchgeführt werden, liegt nicht an der Finanzierung; denn die Errichtung einer Steinfläche, wie sie in der Bildmitte zu sehen ist, ist um Größenordnungen billiger als die Schaffung eines Nationalparks. Das Problem liegt darin, dass eine solche Artenschutzmaßnahme mit Naturschutz nichts zu tun hat und deshalb wenig Befürwortung findet. Das Bild zeigt eine Steinaufschüttung im Bereich der Aschedeponie der Königshovener Höhe im Braunkohletagebau westlich von Köln. Dieser Platz, der eher einer Müllhalde gleicht und deshalb niemals als Naturschutzgebiet ins Auge gefasst werden würde, ist der Brutplatz von mehreren Paaren des Steinschmätzers. Das linke Foto des Steinschmätzermännchens wurde mir freundlicherweise von Christine Jensen/naturgucker.de für die Veröffentlichung überlassen.
Tafel 7 Hochwasser und starke Überschwemmungen haben in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden Steilwände in das Land geschnitten, die für mehrere Vogelarten, vor allem aber für Insekten einmalige Biotope darstellten, die es in Mitteleuropa ohne Naturkatastrophen nicht gegeben hätte. Da in der heutigen Zeit die Folgen der Naturkatastrophen unter Kontrolle sind, sind wertvolle Biotope verschwunden. Abbruchkanten entstehen heute fast nur noch durch massive maschinelle Eingriffe in die Landschaft (Bild oben: Aschedeponie der Königshovener Höhe westlich von Köln). Ohne diese technischen Eingriffe würden viele Vogel- und Insektenarten nicht mehr die Biotope vorfinden, die sie für ihre Fortpflanzung brauchen. Umso bedauerlicher ist die übliche Praxis, diese Habitate sofort nach Beendigung der wirtschaftlichen Nutzung zu vernichten. Die Steilwände werden abgeflacht und eingesät, ein Prozess, der „Renaturierung“ genannt wird (Bild Mitte: „rekultivierte“ und dadurch für die Arten wertlos gemachte Fläche im Bereich der ehemaligen Braunkohleabgrabung Fortuna-Garsdorf westlich von Köln). Dieser Begriff „Renaturierung“ ist missverständlich, weil hier in keiner Weise das hergestellt wird, was den Namen „Natur“ verdient. Es handelt sich in Wahrheit lediglich um eine „sanfte“ Kunstlandschaft, die für eine Mehrheit der Bevölkerung gefällig aussieht (Bild Mitte im Vergleich zum Bild oben). Für die Erhaltung seltener Arten ist die „Renaturierung“ jedoch alles andere als erstrebenswert. Die „renaturierte“ Landschaft beherbergt deutlich weniger seltene Arten als die vorhergehende Abbruchkante. In vielen Fällen wird der Prozess der „Renaturierung“ noch weiter fortgesetzt, und die abgeflachte Abbruchkante wird aufgeforstet (Bild unten: Vollrather Höhe bei Grevenbroich westlich von Köln). Auf den aufgeforsteten Hängen kommen dann fast überhaupt keine seltenen Tier- und Pflanzenarten mehr vor. Viele Menschen empfinden den Wald als schön, aber sie wissen nicht, wie vielen Rote-Liste-Arten durch die Aufforstung der Lebensraum entzogen wird.
Tafel 8 Der Baumpieper war noch vor einem halben Jahrhundert im gesamten Nordwest- und Westdeutschland ein häufiger Brutvogel offener Waldlandschaften mit breiten Wegen und nur schütter bewachsenen, insektenreichen Wegrändern, an denen der Baumpieper seine Nahrung fand (oberes Bild: Königshovener Mulde im ehemaligen Tagebaugebiet westlich von Köln). Heutzutage haben die Wälder an Fläche enorm zugenommen, und sie engen freie Schneisen zwischen den Wäldern immer mehr ein. Waldwege sind heute schmal und beschattet. Oft sind es in heutiger Zeit nur noch die Stromtrassen der Überlandleitungen, auf denen noch genügend freie, besonnte und daher artenreiche Flächen zwischen den dichten Wäldern erhalten geblieben sind oder neu geschaffen wurden. Aber auch dort, wo die Wegränder zwischen den Wäldern noch breit genug sind, sind sie von dichter Vegetation zugewachsen und lassen keine warmen Erdflächen mehr frei, auf denen die Insekten noch leben können (unteres Bild). Die Wegränder in Mitteleuropa sind heute üppig bewachsen, saftig, feucht und grün. Ein solches Habitat ist besonders für Insekten lebensfeindlich; es bietet dem Baumpieper keine Ernährungsmöglichkeiten mehr.
Tafel 9 Jahrhunderte und Jahrtausende lang prägte der Stickstoffmangel die mitteleuropäische Landwirtschaft. Die Äcker der Jungsteinzeit und der Bronzezeit mussten oft bereits nach einem Jahrzehnt der Besiedlung wieder verlassen werden, weil die Felder kaum noch Ertrag brachten. Der Stickstoffmangel plagte die Landwirtschaft dann bis vor 100 Jahren. Über die Jahrtausende waren die Äcker Mitteleuropas oft nur kärglich bewachsen; die Landwirtschaft war ertragsarm und von Hungersnöten begleitet. Aber auf solchen Flächen florierte das Leben der Tier- und Pflanzenarten, die heute auf den Roten Listen stehen. Der Reichtum der Arten lebte von der Armut der Bevölkerung. Die Landwirtschaft hatte in der mitteleuropäischen Waldlandschaft des Holozäns Biotope geschaffen, die die tierreichen Steppen der vergangenen Eiszeit simulierten. Die heutigen Äcker und Wiesen sind anders. Sie sind viel zu dicht bewachsen und daher für die meisten Tiere und Pflanzen keine Heimat mehr. Zum Beispiel benötigt der Ortolan karge Ackerflächen mit spärlichem Halmbewuchs, wie das Foto eines Getreidefeldes aus Nordostpolen aus dem Jahre 2010 zeigt, noch bevor die Agrarpolitik der Europäischen Union dort Fuß gefasst hat (Bild oben). Der Ortolan ist im westlichen Mitteleuropa inzwischen fast ausgestorben. Die heutige ertragreiche Landwirtschaft Mitteleuropas bietet dem Ortolan keinen Platz mehr. Lebenswichtig für den Ortolan ist das Kümmerliche des Ackers. Ein solcher Biotop kann auch durch eine Reform der Landwirtschaft nicht hergestellt werde. Die von der Verbraucherschutzpolitik angestrebte gesunde Biolandwirtschaft ist auf die Bedürfnisse des Menschen zugeschnitten: Sie hat mit der Rettung bedrohter Arten wenig zu tun und bringt uns den Ortolan nicht zurück. Der heutige Umwelt- und Verbraucherschutz kann von keinem Landwirt verlangen, wieder zu einem solchen Acker zurückzukehren, wie ihn das obere Bild zeigt, obwohl dies der einzige Weg wäre, den Ortolan wieder anzusiedeln. Die Zukunft des Ortolans in Mitteleuropa liegt nicht in der Biobewegung und einer Reform der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft kann nicht auf das Niveau zurückgeschraubt werden, das sie vor 100 Jahren hatte. Daher ist die Landwirtschaft für die Artenvielfalt wahrscheinlich für immer verloren. Zur Rettung der Artenvielfalt der früheren mitteleuropäischen Landwirtschaft müssen künstliche Biotope mit technischen Mitteln neben der Landwirtschaft aufgebaut und erhalten werden, die den vergangenen Zustand der kümmerlichen Äcker und Wiesen simulieren. Das Foto des Ortolans wurde mir freundlicherweise von Angela Najak/naturgucker.de für die Veröffentlichung überlassen.
Guide
Cover
Inhaltsverzeichnis
Begin Reading
Pages
C1
III
IV
V
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
287
288
289
290
291
292
Werner Kunz
Artenschutz durch Habitatmanagement
Der Mythos von der unberührten Natur
Autor
Werner Kunz
Institut für Genetik Heinrich-Heine-Universität Universitätsstraße 1 40225 Düsseldorf Deutschland
Mit einem Prolog von Josef H. Reichholf, Neuötting
Mit 9 Farbtafeln
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
©2017 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Umschlaggestaltung Werner Kunz und Monika Dörkes mit einem Foto des Wiedehopfes von Josef Salzmann/naturgucker.de
Satz le-tex publishing services GmbH, Leipzig, Deutschland
Print ISBN 978-3-527-34240-2
ePDF ISBN 978-3-527-80621-8
ePub ISBN 978-3-527-80622-5
Mobi ISBN 978-3-527-80623-2
oBook ISBN 978-3-527-80620-1
Prolog: Schutz seltener Arten – ein neuer Ansatz ist dringend geboten
Gegenwärtig nehmen in Mitteleuropa die Bestände vieler Arten stark ab, obwohl sie formal unter Schutz stehen. Ein beträchtlicher Anteil hat sich aus den Fluren weitgehend zurückgezogen oder fehlt schon ganz. Manche fanden eine alternative Existenz in den (Groß)Städten, auf Flugplätzen, Industriegeländen und anderen „unnatürlichen“ Flächen. Für geschützte Arten wurden diese attraktiver als manche Schutzgebiete.
Was geht da vor in unserer Natur? Warum wirkt unser moderner und auf strengen Bestimmungen begründeter Naturschutz im Allgemeinen und bei den kleineren Arten so wenig, obgleich einige der größeren Säugetier- und Vogelarten ihr Areal gerade beträchtlich ausweiten und an Häufigkeit zunehmen? Für global seltene und streng geschützte Arten, wie Seeadler (Haliaeetus albicilla) und Fischadler (Pandion haliaetus), gibt es in Deutschland inzwischen bedeutende Teilpopulationen, die sich jeweils tausend Brutpaaren nähern. Aber auch die Bestände der höchst intensiv bejagten Wildschweine (Sus scrofa) nehmen massiv zu und gehen in die Hunderttausende. In Ostdeutschland etablierte sich eine zwar noch kleine, aber durchaus vitale Population von Wölfen. Schneeweiße Silberreiher (Egretta alba) können winters fast überall in Mitteleuropa beobachtet werden, auch bei Schneelage. Ihr Winterbestand in Deutschland übertrifft die frühere Größe der Restvorkommen, die vornehmlich in den Sperrgebieten an den ehemaligen Grenzen zwischen Ost und West, dem so genannten Eisernen Vorhang, überlebt hatten, wie im österreichisch-ungarischen Grenzgebiet im Neusiedler See südöstlich von Wien. Damals fuhren Ornithologen extra dorthin, um einige Blicke auf die raren weißen Reiher werfen zu können. Und nun sieht man sie im Winter fast überall und häufiger als den „gewöhnlichen“ Graureiher (Ardea cinerea). Im Winter! Die Silberreiher stellen mit diesem gänzlich unerwarteten Verhalten ihre auch in Lehrbüchern der Ökologie enthaltene Einstufung als Vogelart der Tropen mit warmen Lagunen als Lebensraum (ökologische Nische) in Frage. Auch bei manch anderer Vogel- und Säugetierart erwies sich die ökologische Zuordnung als unzureichend begründet, ja offensichtlich falsch, weil einfach nicht hinreichend bekannt war, wo und unter welchen Bedingungen sie leben können.
Daher nochmals: Was geht da vor „draußen in der Natur“, wie wir zu sagen pflegen, weil wir die „freie Natur“ von unserer Menschenwelt getrennt zu betrachten pflegen? Warum wurden so viele Arten selten oder sind ganz verschwunden aus unserer doch so sauber gewordenen Umwelt und viel weniger als früher belasteten Umwelt? Warum haben die Gesetze und Verordnungen zum Artenschutz und die Naturschutzverbände trotz des Einsatzes vieler Millionen Euros so wenig erreicht, dass die Roten Listen länger und länger werden?
Es heißt, dass dies an der immer noch zu stark belasteten und zu sehr vergifteten Umwelt läge. Das Ausmaß an Störungen seitens der Menschen sei viel zu hoch. Es werden zu viele Straßen gebaut. Siedlungen breiten sich aus und „fressen das Land“. Vögel und Bienen, Schmetterlinge und Fledermäuse und all das übrige gefährdete Getier finden nicht mehr genügend Lebensraum für überlebensfähige Populationen. So die Klage. Doch selbst wenn dies in einigen Fällen selten gewordener Arten durchaus zutrifft, so gilt es keineswegs für die Gesamtheit der gefährdeten Arten. Vielmehr sind es Vorurteile, die daraus sprechen; Voreingenommenheiten, die ausdrücken, was die betreffenden Menschen selbst nicht wollen oder ablehnen. Die „Sicht“ der zu schützenden Arten geben sie nicht wieder. Eine genauere Betrachtung der Ursachen für Rückgänge und Zunahmen der Arten legt dieses Vorurteil offen.
So ist es dem stark verminderten Ausmaß der Verfolgung zuzuschreiben, dass sich Wölfe und Adler, Silberreiher und Schwarzstörche oder die Wanderfalken wieder vermehren und dass Biber in fast ganz Europa und sogar Bartgeier in den Alpen erfolgreich wieder eingebürgert werden konnten. Ihre Bestände waren bis zum 2. Weltkrieg durch intensive Bejagung extrem dezimiert und weithin völlig vernichtet worden. Schutz vor Jagd und Gift und allmähliche Abnahme der Scheu, weil sie nicht mehr verfolgt wurden, ermöglichten das Comeback dieser Arten. Denn sie waren selten geworden oder verschwunden, weil man sie nicht hatte leben lassen, und nicht, weil sie keine Lebensmöglichkeiten gehabt hätten. Der Schutz vor Verfolgung und Vergiftung wirkte umfassend in den Städten, also dort, wo die Menschen in hoher Dichte leben. Vielen Arten geht es da am besten. Die Städte sind außerordentlich artenreich; nach gängigen Kriterien zur Beurteilung der Artenvielfalt geradezu naturschutzwürdig.
Doch in größerem Maßstab ist für Europa ein weiterer, kaum berücksichtigter Zusammenhang aufschlussreich. Für viele Arten von Vögeln, (größeren) Säugetieren und auch bezüglich der Artenvielfalt der Kleintiere und von Pflanzen zerteilt Europa eine Grenze, die im Verlauf weitgehend dem ehemaligen Eisernen Vorhang entspricht. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gibt es ihn politisch zwar nicht mehr, aber nach wie vor ist er sehr ausgeprägt in der Natur vorhanden, obgleich es dafür keine (rein) natürlichen Gründe gibt, sehr wohl aber eine ökologisch äußerst wirksame Gegebenheit, die sich in Art und Intensität der Landnutzung ausdrückt. Diese wird „im Osten“ immer noch weniger intensiv betrieben. Man lässt mehr Flächen ungenutzt und richtet nicht die extrem hohen Erwartungen an die Erträge wie „im Westen“. Es gibt viele Dörfer mit starker Abwanderung der Bevölkerung und ausgedehnte Flächen mit so genannten Altlasten, kontaminiert von früheren sozialistischen Nutzungsformen, die bei weitem nicht den westlichen Umweltstandards entsprochen hatten. Riesige „Eingriffe in den Naturhaushalt“ ohne gleich nachfolgende Rekultivierung waren getätigt worden und blieben dann vielfach sich selbst überlassen, während in der alten Bundesrepublik schon kleine Kiesgruben als „Wunden in der Landschaft“ deklariert worden waren und schnellstmöglich rekultiviert werden mussten. Auch wenn dadurch den Kröten und Fröschen, den Molchen und Libellen und vielen anderen Arten die Lebensmöglichkeiten entzogen wurden. Es galt eben, die Wunden, die der Natur zugefügt worden waren, möglichst schnell – optisch – zu schließen, denn sie waren „Bildstörung“ und mussten als Eingriffe „ausgeglichen“ werden. Koste es an Geld und an Natur, was es wolle. Die Vorschriften griffen nirgends so hart wie bei der Eingriffs-Ausgleichs-Regelung. Das Eigenurteil der seltenen und offiziell geschützten Tier- und Pflanzenarten zählte dabei nicht. So lange nicht „rekultiviert“ war, blieb das Gelände „Unland“. Genau darum geht es schwerpunktmäßig in diesem Buch. Und um Vorurteile, die zu Fehleinschätzungen und falschen, weil dem Artenschutz abträglichen Maßnahmen führen.
Den anderen Schwerpunkt bildet ein Stoff, dessen deutscher Name Stickstoff sich geradezu anbietet, die Folgen seines übermäßigen Einsatzes zu bezeichnen: „Erstick-Stoff“ für die Artenvielfalt. Seit Jahrzehnten überflutet Stickstoff das Land in viel zu großen Mengen; in Form von Gülle allein mit dem Mehrfachen der Abwässer der 83 Millionen Menschen in Deutschland. Die Überdüngung begünstigt das Wachsen und Gedeihen einiger weniger Stickstoff-toleranter oder -bedürftiger Pflanzen, die den Großteil der übrigen Flora zurück- oder ganz verdrängen. Das bodennahe Kleinklima wird unter Einfluss der Überdüngung feuchter und kühler, weil dichte Pflanzenbestände stark wachsen und intensiv transpirieren. Die Folge ist, dass gerade die ihrer Natur nach wärmebedürftigen Arten trotz Klimaerwärmung seltener werden und sich in wärmere Regionen in den Süden und Südosten zurückziehen. Sie füllen bei uns die Roten Listen. Aufgrund der Verdichtung der Vegetation, die von der Überdüngung ausgelöst wurde, ist es in den meisten Lebensräumen Mitteleuropas im vergangenen halben Jahrhundert nicht wärmer, sondern kühler geworden. Das zeigen die Veränderungen in Vorkommen und Häufigkeit der Arten ganz klar an. Sollte die Zielsetzung, das Artenspektrum zu erhalten, erfüllt werden, sind vor allem offene, an Vegetation arme, trockenwarme und magere Flächen vorrangig nötig. Unproduktives Gelände also, das nicht gedüngt und rekultiviert wird, sondern durch zerstörerisch erscheinende Maßnahmen in diesem Zustand erhalten oder wieder zurück versetzt werden muss. Zu bekämpfen ist die Überdüngung. Sie betrifft auch die Stickstoff-Einträge auf dem Luftweg, die düngen, ohne dass direkt Dünger ausgebracht wird. Vorbildflächen hierfür, zu denen jedoch nur wenige privilegierte Forscher Zugang haben, bieten die massiv „gestörten“ militärischen Übungsgebiete. Sie übertreffen an Artenreichtum und Bedeutung für den Schutz viele, wenn nicht die meisten Naturschutzgebiete. Zudem handelt es sich bei ihnen um weite, zusammenhängende Flächen, die hinreichend großen Populationen gefährdeter Arten das Überleben ermöglichen. An zweiter Stelle zu nennen sind Großstädte, sofern sie noch größere unbebaute Flächen enthalten, die keiner landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen. Berlin ist immens artenreich. Berlin ist „Hauptstadt der Nachtigallen“ mit über Tausend, die im Stadtgebiet singen. Einen insgesamt hohen Artenreichtum bietet das Ruhrgebiet. Hervorzuheben sind die Stickstoff- und Bergbaufolgegebiete. Dort leben viele gefährdete Arten; viel mehr als in natürlichen Biotopen.
Für Naturfreunde sind sie das Eldorado, in dem Entdeckungen gemacht werden können und besondere Naturerlebnisse zu erwarten sind. Dort singen nicht nur die Feldlerchen, sondern sie sind anders als an Großflughäfen auch zu hören und in ihrem Aufstieg in die Lüfte zu beobachten. Aus der Intensivlandwirtschaft sind sie wie die bunte Vielfalt der Schmetterlinge und die für die Bestäubung der Blüten wichtige Mannigfaltigkeit der Wildbienen längst weitestgehend verschwunden. Doch Landwirtschaft kann nicht mehr wie im 19. Jahrhundert auf dem Hungerniveau der Landbevölkerung betrieben werden. Damals war die Flur außerordentlich artenreich. Aber die Bewirtschaftung müsste nicht so extrem intensiv sein, wie gegenwärtig vor allem im Westen, zunehmend aber auch im Osten. Wir sollten uns im Naturschutz daher von den romantischen Wunschbildern lösen, die aus der Zeit des Mangels stammen, und uns weit mehr als bisher an dem orientieren, was sich aus Vorkommen und Häufigkeit der Arten ableiten lässt. Die Beispiele, die Werner Kunz aus seiner langen Praxis in der Artenschutzforschung in diesem Buch zusammengestellt hat, eröffnen eine neue Sicht und zukunftsträchtige Ansätze. Vorurteilsfrei und sorgfältig studiert, kann sein Buch ein ähnlicher Meilenstein und Wendepunkt für den Naturschutz werden, wie Rachel Carsons „Stummer Frühling“. Ein solcher droht gegenwärtig mehr denn je. Werner Kunz hält eine mächtige Stimme dagegen. Hoffentlich dringt sie durch zu den Naturschutzbehörden und -organisationen. Sie tragen die Verantwortung dafür, wie es weitergeht im Naturschutz.
Josef H. Reichholf
Vorwort
Naturschutz ist eine gute Sache. Wer würde es wagen, dagegen Einwände zu erheben. Aber gerade die moralisch-ideologische Überhöhung, mit der die Naturschutzbewegung seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts verbunden ist, verleitet zu falschen Schlussfolgerungen. Natur- und Artenschutz waren ursprünglich einmal auf spezielle Ziele ausgerichtet, nämlich auf den Schutz der Natur und der Arten. Vor mehr als einem halben Jahrhundert gab es noch kaum einen Umweltschutz, und die Erhaltung bedrohter Naturräume (etwa bestimmter Teiche und Feuchtgebiete) und gefährdeter Arten wurde nicht direkt mit der Sauberkeit des Wassers, des Bodens und der Luft in Verbindung gebracht.
In den 1970er- und 1980er-Jahren jedoch wurde ein Ganzheitsdenken propagiert, das den Natur- und Artenschutz in eine saubere Umwelt und in die Gesundheit der Bevölkerung einbettete. Diese Entwicklung erweiterte einen Bereich, der vorher nur die Interessen bestimmter Menschen widerspiegelte, zu einem allgemeinverpflichtenden moralischen Postulat. Dem Menschen sollte bewusst gemacht werden, dass der Schutz der Arten eine intakte Natur voraussetzt und dass Unrat und Verschmutzungen in der Umwelt die Arten gefährden. Da es eine moralische Pflicht war, Umweltverschmutzungen zu vermeiden, musste jeder automatisch auch für den Naturschutz und den Schutz der Arten eintreten.
Aber der Schutz mancher Arten hat mit Naturschutz nichts zu tun, und mit einer sauberen Umwelt schon gar nichts. Hygiene, Sauberkeit und Ordnung sind etwas, das der Mensch braucht; aber es ist nicht das, was viele Arten unbedingt benötigen, zumindest nicht in der Form, wie es der Mensch gerne sieht. Oft ist genau das Gegenteil der Fall. Hygiene und Ordnung im Haus haben in den letzten Jahrhunderten viele ehemals verbreitete Tiere zu bedrohten Arten gemacht. Die Hausratte Rattus rattus (nicht zu verwechseln mit der Wanderratte Rattus norvegicus) wurde aus unseren Häusern verbannt und ist dadurch extrem selten geworden; die musste in der Roten Liste der gefährdeten Tiere Deutschlands als „vom Aussterben bedroht“ (Stufe 1) eingestuft werden. Die Bettwanze (oder: Hauswanze) ist in Mitteleuropa im Vergleich zu früheren Jahrhunderten stark zurückgegangen. Das Gleiche gilt für Flöhe und Läuse. Alle hier genannten Tierarten waren in Mitteleuropa früher weitverbreitet und sind es heute noch in anderen Ländern der Welt. Sie wurden in Mitteleuropa durch Hygiene und Sauberkeit und Maßnahmen, die der Gesundheit des Menschen dienen, zu seltenen Tieren gemacht.
So wie es die Zivilisation schon in früheren Zeiten mit sich gebracht hat, dass die Wohnungen immer gründlicher von Unrat und Schmutz gesäubert werden konnten, so bringt es die moderne Agrikultur mit sich, die Landschaft immer mehr zu säubern. Wir sind auf dem Wege, einen Prozess, der früher der Wohnkultur und Gesundheit gedient hat, heute auf die Landschaft zu übertragen. Acker- und Weideflächen wurden im letzten halben Jahrhundert in Mitteleuropa für einen maximalen Ertrag optimiert und für die Bearbeitung mit Maschinen gesäubert. Die Agrarflächen wurden von Steinen und Unkraut gereinigt, sandige oder schlammige Flächen und Unebenheiten der Ackeroberfläche wurden beseitigt. Ungenutzte Zwischenräume, Ecken und Randflächen wurden bis auf den letzten Quadratmeter in die Produktionsflächen eingegliedert, und Abfälle und Ernterückstände blieben nicht mehr liegen. Der moderne Acker ist absolut sauber, homogen und tischeben.
Doch im selben Ausmaß, wie die Äcker von „Unrat“ bereinigt wurden, wurden sie auch von den Tieren bereinigt. Der moderne Acker ist fast artenfrei. Er macht einen „ordentlichen“ Eindruck, ist sauber und hygienisch einwandfrei, in Bezug auf die Arten aber zur lebensfeindlichen Wüste geworden. Ganz analog wie die Reinigung der Häuser den Ratten, Wanzen und Flöhen in den Wohnungen die Lebensmöglichkeiten weggenommen hat, hat auch die Reinigung der Feldflur den Arten keinen Raum mehr gelassen. Hasen, Rebhühner, Feldlerchen und Grauammern finden keine Nahrungs- und Brutplätze mehr. Wandert man heute über die Felder, so singt an den meisten Orten keine Lerche mehr, aus ähnlichen Gründen wie heute kein Heimchen mehr in der Wohnung singt oder keine Ratte mehr durch den Keller läuft. Es sind nicht nur die Gifte, die die Agrarflächen zur Wüste gemacht haben. Ein bisschen mehr Schmutz und Schlampigkeit hätte den Tieren gutgetan – eine Einsicht, die durch den provozierenden Satz zum Ausdruck gebracht wird: „Ein fauler Bauer fördert die Arten mehr als zehn fleißige Naturschützer“.
Ordnung und Sauberkeit haben erheblich dazu beigetragen, dass viele Arten auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgerottet wurden. Aber der Glaube vieler Menschen ist nicht auszurotten, dass eine saubere Umwelt auch den Arten zugutekommt. Das gilt zwar für viele aquatische Arten, die im Wasser atmen, aber für viele terrestrisch lebende Arten gilt es nicht. Selbstverständlich ist es unhygienisch und unästhetisch, wenn der Müll auf Parkstreifen abgeladen wird oder wenn Essensreste in Ortschaften einfach auf die Straße geworfen werden. Das sollte im Interesse der allermeisten Menschen verhindert werden; aber nur im Interesse unserer eigenen Ordnungs- und Hygienebedürfnisse. Man darf dann nicht gleichzeitig bedauern, dass die Spatzen aus den Ortschaften und die Goldammern aus der Feldflur verschwinden (Meyer et al., 2003). Das Vorkommen des Schillerfalters auf den Straßen inmitten einiger Ortschaften Rumäniens ist nur der Tatsache zu verdanken, dass es dort keine Kanalisation gibt.
Ungepflasterte Wege verursachen Staub und Dreck. Wenn die Wege asphaltiert werden, machen wir uns nicht mehr die Schuhe schmutzig, und es ist nicht mehr so viel Staub in der Luft. Aber die Schwalben finden dann keinen Schlamm mehr, um ihre Nester zu bauen. Auf sauber asphaltierten Straßen gibt es keine Pfützen mehr; und deswegen gibt es dort auch keine Mücken mehr. Und auch das gefällt nur uns Menschen, aber nicht den Schwalben.
Bröckelndes Gemäuer ist ein Zeugnis der Vernachlässigung der Gebäude, und es wird als Unordnung empfunden. „Ordentliche“ und fleißige Hausbesitzer sorgen für gut verputzte Mauern. Aber eine größereZahl von Mauerbienenarten und anderen Hymenopteren kann an ordentlich verputzten Mauern nicht mehr leben und steht deswegen heute in Deutschland auf der Roten Liste. Hohlräume unter den Dachgeschossen und an den Fassaden der Häuser sind die Brutplätze der Fledermäuse, Eulen und Mauersegler. Aber das setzt überalterte, sanierungsbedürftige Häuser voraus. Es gibt keine Hohlräume und Löcher mehr in und an den modernen Gebäuden, die aus Gründen der Energieersparnis effektiv gegen Wärmeverlust abgeschirmt sind. Hier wird jede konsequente Maßnahme des Umweltschutzes zu einem Opponenten des Artenschutzes. Die Liste ließe sich fortsetzen.
Müllbeseitigung und Sauberkeit sind ein Ideal des Umweltschutzes. Aber dieses Ideal darf nicht mit dem Artenschutz gleichgesetzt werden. Diesen Irrtum gilt es, im Bewusstsein vieler Menschen zu korrigieren. Wir leben heutzutage im Zeitalter eines drastischen Rückgangs vieler Arten. Aber für viele Arten ist es der falsche Weg, diesen Rückgang durch eine saubere Umwelt stoppen zu wollen. Es gilt zu erkennen, dass die Ziele des Umweltschutzes und des Artenschutzes nicht die gleichen sind, besonders nicht in Mitteleuropa.
Und auch die Ziele des Naturschutzes und des Artenschutzes sind nicht die gleichen. Die Erhaltung einer störungsfreien, unberührten Natur hat ihren Eigenwert und ist in Mitteleuropa in vielen Fällen nicht die korrekte Maßnahme, gefährdete oder aussterbende Arten zu retten. Die im Bewusstsein vieler Menschen vorhandene Gleichsetzung der Begriffe Umweltschutz, Naturschutz und Artenschutz hat ihre Ursache u. a. darin, dass die drei Ziele unter dem Dach derselben Vereine vertreten werden. Das erweckt den Eindruck, dass alles derselben Sache dient.
Seit publik geworden ist, dass Städte einen größeren Artenreichtum aufweisen können als manche Naturschutzgebiete (Reichholf, 2005, 2010) und dass Militärgelände und Tagebauabgrabungen zum Refugium vieler Rote-Liste-Arten geworden sind, hätte es im Artenschutz zu einem Umdenken kommen müssen. Ein solches Umdenken hat aber in der breiten Öffentlichkeit bis heute nicht stattgefunden.
Zwar wissen viele Menschen, dass Truppenübungsplätze viele seltene Arten beherbergen, aber sie empfinden das so, dass dies halt neben anderen Gebieten zusätzliche artenreiche Lebensräume sind. Stattdessen rüttelt diese Erfahrung an den Grundfesten über die Voraussetzungen des Artenschutzes. Wer zum ersten Mal hört, dass Städte und Müllplätze artenreiche Biotope sein können, der darf diese Tatsache nicht einfach als neue Erfahrung hinnehmen; stattdessen muss er sich fragen, ob nicht etwas an den Grundfesten unseres Natur- und Artenschutzes falsch ist. Viele bedrohte Arten findet man in Mitteleuropa eben gerade nicht in den Gebieten, in denen eine möglichst störungsfreie, unberührte Natur angestrebt wird, sondern stattdessen in Habitaten, die keine Naturschutzgebiete sind. Viele bedrohte Arten haben sich in Habitate zurückgezogen, die mit Natur nichts zu tun haben, ja die ihre Existenz überhaupt nur der Tatsache verdanken, dass in diesen Gebieten die Natur zerstört worden ist.
Dieser Sachverhalt wird als paradox empfunden, was aber seine Ursache nur darin hat, dass Naturschutz und Artenschutz gleichgesetzt werden. An diesem Problem liegt es auch, dass die Rekultivierungsmaßnahmen auf den großen Braunkohleabgrabungsflächen in Westdeutschland in die falsche Richtung gelaufen sind, was den Artenschutz betrifft. Anstatt die Offenflächen mit ihren seltenen Arten zu bewahren, wurde die „Natur“ wieder hergestellt, und dadurch verschwanden die seltenen Arten (siehe Tafel 7).
Arten, die heute in Mitteleuropa auf der Roten Liste stehen, sind häufig die Bewohner von Extremhabitaten. Solche Habitate wurden in früheren Jahrhunderten durch Naturkatastrophen wie Großbrände, Orkane und Überschwemmungen geschaffen. Da die Naturkatastrophen heute vielfach eingedämmt sind und die Natur vor Zerstörungen geschützt ist, wurden die Habitate vieler Rote-Liste-Arten zur Mangelware. Die ehemaligen Militärflugplätze des Zweiten Weltkriegs, die gegenwärtigen Militärübungsplätze und Munitionslager und die Kies- und Kohleabgrabungen traten an die Stelle ehemals durch die Natur verursachter Zerstörungen.
Habitate, auf denen viele Rote-Liste-Arten überlebt haben, sind oft durch mehrere Merkmale gekennzeichnet. Erstens sind es kilometerweite baum- und strauchlose Flächen. Zweitens sind es Ebenen mit sehr heterogener Oberfläche (ein Beispiel sind die vielen Bombentrichter auf den zerstörten Militärflugplätzen) und drittens sind die Gelände nur karg mit Vegetation bewachsen: Die Grasschichten sind mit nackten Erd-, Stein- und Sandflächen durchsetzt (was durch die zerstörten Betonpisten der ehemaligen Flugzeuglandebahnen noch verstärkt wurde). Diese Flächen entsprechen nicht dem gegenwärtigen Landschaftsbild Mitteleuropas. Sie erinnern eher an die vom Raubbau zerstörten Landschaften früherer Jahrhunderte, als es noch keine Aufforstung und keine Mineraldüngung gab.
Auf den zerstörten Flugplatzflächen der Nachkriegszeit in Deutschland hatten sich viele Vogel- und Schmetterlingsarten angesiedelt, die andernorts der Aufforstung und Eutrophierung weichen mussten. Auf den trockenen Geländen brüteten Lerchen in großer Zahl, Bekassinen, Rotschenkel und Sumpfhühner nisteten auf den nassen Binsenflächen, Flussregenpfeifer fanden auf den zerstörten Rollbahnen geeignete Stellen, um ihre Eier zu legen und ihre Jungen großzuziehen, Steinschmätzer besiedelten die Ruinen der ehemaligen Flughafengebäude, und Brachpieper brüteten in beachtlicher Zahl auf den sandigen Erdwällen der ehemaligen Flughafenbegrenzung (Kunz, 1959). Auf den vegetationsarmen, nur schütter bewachsenen Böden flogen argus-Bläulinge, auf den feuchten Flächen fanden alcon-Ameisenbläulinge geeignete Lebensbedingungen vor und waren selene-Perlmutterfalter häufige Tagfalter.
Seit einigen Jahrzehnten sind die Militärflugplätze der Nachkriegszeit entweder ein Opfer der Landwirtschaft, der Aufforstung oder der Bebauung geworden, oder sie wurden als artenreiche Habitate von der Natur selbst zerstört, indem sie mit Gebüsch und dann mit Bäumen zugewachsen sind und damit für die seltenen Arten wertlos geworden sind. An die Stelle der Militärflugplätze traten die Truppenübungsplätze und die großflächigen Braunkohletagebauabgrabungen. Sie sind eine Alternative zu den überdüngten Feldern der heutigen Landwirtschaft, aber auch zu den zugewachsenen Böden der nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen, auf denen viele Arten wegen der dichten Vegetation nicht mehr leben können. Bei den Truppenübungs- und Abgrabungsflächen handelte es sich wiederum um Gelände, die weder Naturschutzgebiete sind, noch dass sie auch nur die Kriterien erfüllen, Natur genannt zu werden. Stattdessen werden diese Gelände von den Natur- und Umweltschutzverbänden der Bevölkerung (zu Recht) als abschreckendes Beispiel der Naturzerstörung vorgestellt. Aber es sind halt die Refugien vieler bedrohter Arten. Genau wie die Militärflugplätze der Nachkriegszeit sind auch diese Flächen wieder durch drei Merkmale gekennzeichnet, die die Voraussetzungen für das Vorkommen vieler seltener Arten sind: weite baumlose Flächen, heterogene Oberflächenstruktur und nackte Erde.
Auf den aus der Tiefe heraufgeholten stickstoffarmen Rohböden der Braunkoh-letagebauabgrabungen und auf den Folgestadien dieser Böden, wenn noch nicht alles mit Vegetation zugedeckt ist, brüten Wiesenpieper, Grauammern, Steinschmätzer und Heidelerchen, die in Deutschland heute alle auf der Roten Liste stehen (Südbeck et al., 2007) (Tafel 1). Auf den großen Tagebauabgrabungsflächen westlich von Köln sind einige der andernorts heutzutage vielfach selten gewordenen Tagfalter häufig vertreten, so z. B. der Schwalbenschwanz und der pamphilus-Augenfalter (Tafeln 2 und 3). Mehr als 15 Orchideenarten, deren Vorkommen in ganz Deutschland auf Restbestände zusammengeschrumpft ist und deren Standorte deswegen zum Teil streng geheim gehalten werden, sind auf den Tagebauflächen zum Teil in großer Zahl zu finden (Albrecht et al., 2005).
Auf dem Gelände der Tagebauabgrabungsflächen westlich von Köln treffen sich viele Naturbeobachter, die bemerkt haben, dass hier die seltenen Arten zu finden sind, die andernorts verschwunden sind. Aber im Bewusstsein eines großen Teils der Bevölkerung sind die Tagebauabgrabungen eine Verwüstung der Landschaft, die Abscheu erregt und die es eigentlich gar nicht hätte geben dürfen. Manche Menschen wissen nicht, dass die Erhaltung vieler bedrohter Arten in Mitteleuropa weder etwas mit der Ästhetik einer Landschaft zu tun hat, noch dadurch erreicht werden kann, dass man die Natur unberührt lässt.
Es ist eine Zielsetzung dieses Buches, deutlich zu machen, dass der Schutz seltener und in ihrer Existenz bedrohter Arten in Mitteleuropa in einer ganzen Reihe von Fällen nichts mit dem Schutz der Natur zu tun hat. In der Tat ist es richtig, dass der Schutz der Natur in erster Linie bedeutet, die Natur vor den Eingriffen des Menschen zu schützen; denn die Eingriffe des Menschen führen zu Störungen, weil sie die natürlichen Entwicklungsprozesse beeinträchtigen. Aber das ist nicht immer der Schutz der Arten. Lebt eine seltene Art noch in einem bestimmten Habitat, so strebt der Naturschutz an, dieses Habitat unter Schutz zu stellen, damit der Mensch es nicht umgestaltet. Es ist in der Tat richtig, dass die Veränderung des Habitats die zu schützende Art vertreiben würde. Was manche Menschen aber nicht wahrnehmen (oder nicht wahrnehmen wollen), ist dass es in vielen Fällen nicht der Mensch, sondern die Natur selber ist, die im Laufe der Zeit die Habitate verändert und sie dadurch für die zu schützenden Arten unbewohnbar macht.
Fast alle Habitate Mitteleuropas würden langfristig mit Wald zuwachsen, wenn man sie sich selbst überließe und der Mensch nicht eingreifen würde. Mitteleuropa würde fast flächendeckend zum Waldland. Nun kann man die Auffassung vertreten, dass dies ja wünschenswert wäre. Dem ist vom Standpunkt des Naturschutzes aus nicht zu widersprechen. Jedoch, der Artenschutz verfolgt eine andere Zielsetzung. In Mitteleuropa gibt es kaum eine gefährdete Vogel- oder Tagfalterart, die in Wäldern lebt, wenn man von einigen Spezialisten absieht, die ganz bestimmte (heute fehlende) Waldstrukturen brauchen (Südbeck et al., 2007). Kleiber und fast alle Arten von Eulen und Spechten sind heute so häufig wie seit langer Zeit nicht mehr. Die in Mitteleuropa heute gefährdeten Arten sind fast ausnahmslos die Arten der Offenländer. Dazu gehören viele Vogelarten und fast alle Tagfalterarten. Offenländer sind die Biotope, an denen es heute mangelt. Wälder haben wir genug. Wem es darum geht, eine möglichst große Zahl an bedrohten Arten zu retten, der wird sich nicht an vorderster Front für die Schaffung neuer Wälder einsetzen.
Dieser Sachverhalt unterscheidet Mitteleuropa von den Regenwaldgebieten der Erde, wo der Verlust an Wäldern die Arten gefährdet. In Mitteleuropa aber sind viele Arten eher durch ein Zuviel an Wald gefährdet. Dies kommt daher, dass Mitteleuropa seit Jahrtausenden vom Menschen entwaldet worden ist und daher heute überwiegend von Arten besiedelt ist, die sich an Offenbiotope angepasst haben. Das Dilemma des Artenschutzes ist, dass die Offenlandarten in Mitteleuropa jahrhundertelang nicht bedroht waren, weil sie problemlos die landwirtschaftlichen Flächen besiedeln konnten. Äcker, Wiesen und Weiden boten genügend geeignete Habitate, in denen die Offenlandarten leben und sich fortpflanzen konnten. Seit einem halben Jahrhundert aber ist dies nicht mehr gegeben, weil die landwirtschaftlichen Flächen mit moderner Technik für den Ertrag optimiert wurden und daher für die Arten keinen Platz und keine Nahrung mehr bieten. Daher sind die Offenlandarten von den Agrar- und Wiesenflächen verschwunden und auf nicht bewirtschaftete Offenflächen ausgewichen. Diese Gebiete (wie z. B. Berghänge oder Talsohlen) aber beginnen in den letzten Jahrzehnten, flächendeckend zuzuwachsen, eben weil sie nicht mehr genutzt werden und zusätzlich noch durch den aus der Luft herabregnenden Stickstoff gedüngt werden. Was den bedrohten Offenlandarten an karg bewachsenen Flächen heute fast nur noch bleibt, sind die Ruderalzonen in den Städten (Tafel 4), Industriegebieten und Hafenanlagen, die Verkehrsflächen (etwa Autobahnböschungen) oder Kies- und Braunkohleabgrabungen und Militärgelände.
Das Problem des gegenwärtigen Artenschwundes in Mitteleuropa kann nur unzureichend dadurch gelöst werden, dass bestimmte Habitate, in denen seltene Arten noch vorkommen, der Bewirtschaftung entzogen werden, zu Naturschutzgebieten erklärt werden und im Wesentlichen sich selber überlassen werden. Stattdessen müssen die unter Schutz gestellten Gebiete vor der Natur geschützt werden. Dazu ist ein ständiges Biotopmanagement mit technischem Gerät erforderlich, das auf die Habitatbedürfnisse besonders gefährdeter Arten ausgerichtet ist und ihnen die erforderlichen Nahrungs- und Fortpflanzungsmöglichkeiten durch zum Teil massive Eingriffe in die Landschaft bereitstellt.
Aber gerade darin liegt das Problem. Für die Durchführung dieser Praxis des Artenschutzes fehlt das erforderliche Bewusstsein in der Bevölkerung. Das gefühlsmäßige Verlangen nach einer ungestörten Natur, die man in Ruhe lassen muss, ist weitverbreitet und ideologisch überhöht. Daher gibt es einen erheblichen Widerstand dagegen, zu akzeptieren, dass viele Arten in Mitteleuropa eben nicht dadurch gefördert werden, dass man die Natur in Ruhe lässt. Beginnt man, für die Rettung gefährdeter Arten Bäume zu fällen, bestimmte Flächen partiell abzubrennen oder zur Rückgewinnung der verlorenen Heiden oder Trockenrasen auf großen Flächen den Mutterboden mit Forstmaschinen abzutragen, so sind die Proteststürme der Bevölkerung bereits vorprogrammiert. Die Maßnahmen werden als Naturzerstörung wahrgenommen (was sie ja auch sind) und erregen Unverständnis und Empörung. Das Empfinden, dass Natur- und Artenschutz eine Einheit bilden, sitzt dermaßen tief, dass eine rationale Aufklärung ergebnislos gegen Gefühle anzukämpfen hat. Daher ist ein großflächiges technisches Biotopmanagement gegenwärtig politisch kaum durchsetzbar. Besonders in Deutschland sind die politischen Voraussetzungen mangels Aufklärung (auch seitens der Naturschutzverbände) nicht gegeben. Man kann nur behutsam in sehr kleinen Schritten vorgehen (wie das an der Basis bei einigen Ortsverbänden der Naturschutzvereine heute zu finden ist); aber dann kann es für manche Arten zu spät sein.
Literatur
Albrecht, C., Dworschak, U.-R., Esser, T., Klein, H. und Weglau, J. (2005) Tiere und Pflanzen in der Rekultivierung – 40 Jahre Freilandforschung im Rheinischen Braunkohlenrevier. Acta Biologica Benrodis, Suppl. 10, 1–238.
Kunz, W. (1959) Die Vogelwelt des Kreises Bersenbrück. Schriftenreihe Kreisheimatbund Bersenbrück, 6, 1–159.
Meyer, W., Eilers, G. und Schnapper, A. (2003) Müll als Nahrungsquelle für Vögel undSäugetiere, Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben.
Reichholf, J. (2005) Die Zukunft der Arten, C.H. Beck, München.
Reichholf, J. (2010) Naturschutz. Krise und Zukunft, Suhrkamp, Berlin.
Südbeck, P., Bauer, H.-G., Boschert, M., Boye, P. und Knief, W. (2007) The Red List of breeding birds of Germany, 4. Aufl. Berichte zum Vogelschutz, 44, 23–81.
1Einführung: Seltene Arten und naturnahe Biotope in Mitteleuropa
Die Fortschritte im Umweltschutz in den letzten Jahrzehnten konnten den Rückgang vieler bedrohter Arten kaum aufhalten.
Die Vorzeigeerfolge in der Rettung einiger Flaggschiffarten (Seeadler, Kranich, Schwarzstorch, Wanderfalke) täuschen ein falsches Bild vom wahren Zustand des gegenwärtigen Artenrückgangs vor.
Die Erhaltung vieler Naturschutzgebiete ist nicht durch den Menschen gefährdet, sondern durch die Natur selbst.
Viele Rote-Liste-Arten sind die Bewohner von Extrembiotopen, und gerade solche Biotope sind in Mitteleuropa keine unberührte und ursprüngliche Natur.
Der Artenschwund in Mitteleuropa hat ganz andere Ursachen als der Artenschwund in den Regenwaldgebieten der Erde. Folglich müssen auch die Artenschutzmaßnahmen ganz anders aussehen.
Es ist eine Illusion zu denken, man könne zum Zwecke der Erhaltung der Arten die vergangenen landwirtschaftlichen Praktiken wieder aufleben lassen.
Mit biologischen Anbaumethoden ist der Gesundheit der Menschen geholfen; der Erhaltung bedrohter Arten ist damit nur wenig geholfen.
Die Naturschutzverbände müssen sich dazu durchringen, den Artenschutz gegebenenfalls auch gegen die Interessen des Naturschutzes durchzusetzen.
1.1 Vorbemerkung
Das Buch behandelt den Artenrückgang in Mitteleuropa. Das wird schwerpunktmäßig am Beispiel ausgewählter Vogel- und Tagfalterarten gezeigt. Mitteleuropa hat in den letzten Jahrzehnten über die Hälfte seiner Vögel und eine noch viel größere Zahl an Tagfaltern verloren, und dieser Trend hält trotz Umwelt- und Naturschutz weiter an (Thomas et al., 2004). Das Buch behandelt dieses vielfach als paradox empfundene Phänomen. Der Schwund vieler Arten schreitet gegenwärtig unaufhaltsam fort, obwohl sich durch die medienwirksamen Aktivitäten der Naturschutzverbände in den 70er- und 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts das ökologische Bewusstsein der Bevölkerung geändert hat und zahlreiche politische Maßnahmen mittlerweile sichtbare Erfolge im Umweltschutz erwirkt haben.
Doch die Fortschritte im Umweltschutz in den letzten Jahrzehnten konnten den Rückgang vieler bedrohter Arten kaum aufhalten. Der Schwund vieler Arten geht weiter, und gerade die meisten Rote-Liste-Arten profitieren weniger als erwartet vom Aufwärtstrend im Umweltschutz. Die verbreitete Überzeugung, dass eine saubere Umwelt quasi automatisch auch den Arten zugutekommt, wird auf den Prüfstand gestellt. Umweltschutz (und auch Naturschutz) sind nicht dasselbe wie Artenschutz.
Schmetterlinge sind weniger bekannt und populär als Vögel und daher weniger werbewirksam für die Durchsetzung von Natur- und Umweltschutzzielen. Daher widmen ihnen die Naturschutzverbände weniger Aufmerksamkeit. Wer kennt schon Scheckenfalter und bedauert ihr drastisches Verschwinden in den letzten Jahrzehnten? Die meisten Menschen denken beim Artenschutz an den Rückgang vieler Vogelarten. Die Fokussierung der Schutzbemühungen auf die Vögel aber gibt ein falsches Bild der wahren Artenbedrohung. Die Vorzeigeerfolge in der Rettung einiger Flaggschiffarten (Seeadler, Kranich, Schwarzstorch, Wanderfalke) täuschen ein falsches Bild vor.
Wenn Vogelbeobachter („Birder“) oder Insektenkenner in Mitteleuropa seltene und daher begehrenswerte Arten sehen möchten, dann gehen sie in vielen Fällen nicht in die Waldnationalparks und oft auch nicht in die Naturschutzgebiete. Wer nicht alltägliche Vogelarten als Brutvögel oder Durchzügler sucht (etwa Grauammern oder Steinschmätzer und im Winter Kornweihen oder Raufußbussarde) oder wer selten gewordene Tagfalter sehen möchte (etwa den megera-Augenfalter oder den pamphilus-Heufalter; Tafeln 3 und 5), der sucht in vielen Fällen nicht die naturnahen Biotope auf, sondern er geht auf die anthropogen geschaffenen Offenflächen, seien es Tagebauabgrabungsflächen, Sandgruben oder Rieselfelder. Dort findet er eher die seltenen Arten, die wegen ihrer Gefährdung auf den Roten Listen stehen als in den Gebieten, die der ursprünglichen Natur Mitteleuropas nahekommen.
Wir alle wissen, dass man sich keinen Illusionen hingeben darf und dass man sich damit abfinden muss, dass die Förderung der Arten meist nicht den Vortritt haben kann und fast immer hinter der Ökonomie zurückstehen muss. Finanzielle Investitionen in die Landschaftsgestaltung zum Zwecke des Artenschutzes haben oft eine geringe Chance, realisiert zu werden, weil sie zu teuer sind. Aber ein Faktor wird bei der Landschaftsgestaltung oft außer Acht gelassen. Das macht sich besonders bei der sogenannten Renaturierung der Braunkohletagebauflächen bemerkbar (Kunz, 2004) (Tafeln 6 und 7). Die Landschaft so zu gestalten, wie sie uns Menschen gefällt, ist nicht der richtige Weg, gefährdete Arten zu retten. Das menschengefällige Bild von Natur ist oft sehr artenfeindlich. Oder umgekehrt ausgedrückt: Das Habitat, das bestimmte Arten brauchen (besonders Rote-Liste-Arten), das gefällt uns Menschen oft nicht.
Dieses Buch ist ein Plädoyer für den Artenschutz. Viele Gedankengänge sind darauf fokussiert, dass in Mitteleuropa gerade solche Arten gerettet werden müssen, die in Lebensräumen leben, die mit unberührter Natur wenig zu tun haben. Diese Habitate sind in erster Linie durch die Sukzession gefährdet und können nur durch technische Eingriffe erhalten oder optimiert werden. Solche Eingriffe müssen zum Teil massiv ausfallen. Damit wird der unberührten Natur (und vor allem dem Wald) nicht die vordere Priorität eingeräumt. Das ist nicht das, was man unter Naturschutz versteht. Viele Menschen werden das nicht wollen; sie wünschen sich stattdessen eine ursprüngliche Natur (und vor allem den Wald). Das ist verständlich, und das wird in diesem Buch auch nicht negativ bewertet. Es wird jedoch klargestellt, dass das Verlangen nach Natur und der Wunsch nach Artenreichtum in Mitteleuropa zwei verschiedene Sachen sind, die nicht immer mit den gleichen Mitteln erreicht werden. Wer unberührte Natur (und möglichst viel Wald) haben möchte, der muss eingestehen, dass er nicht den Artenreichtum haben will.
1.2 Ein Plädoyer für das Offenland
In den 70er- und 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts entstand eine ökologische Bewegung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, gegen das mangelnde ökologische Bewusstsein der Industriegesellschaft vorzugehen (Engels, 2006). In Deutschland begründete das medienwirksame Auftreten von Persönlichkeiten wie Heinz Sielmann, Bernhard Grzimek, Horst Stern und anderen eine Ideologie von angeblichen intakten Ökosystemen, die durch die Eingriffe des Menschen gestört werden. Den Arten wurde eine ökologische Bedeutung zugesprochen, und es wurde das Bewusstsein geschaffen, dass das Aussterben bestimmter Arten ganze Naturhaushalte zum Zusammenbrechen bringen könne. Die Bedrohung vieler Arten wurde mit einer Gefährdung auch der menschlichen Gesundheit und vergifteten Lebensmitteln in Verbindung gebracht. Der Öko-Klassiker „Der stumme Frühling“ von Rachel Carson (Carson, 1962) wurde zur Bibel. Die Frage, was ein „gesunder Naturhaushalt“ oder ein „intaktes Ökosystem“ überhaupt sind (und ob es das überhaupt gibt), wurde von vielen Menschen nicht gestellt oder wurde verdrängt, weil dahinter von vornherein eine nicht angreifbare wertvolle Gesinnung stand. Dabei hat das Aussterben mancher Arten mit einer Gefährdung des Naturhaushaltes nichts zu tun. Der Wert einer Art gleicht oft eher dem Wert eines historischen Denkmals (Reichholf, 2010). Der Verlust einer Art ist oft rein ideeller Natur; da ist kein Haushalt gefährdet. Sollte der Weißstorch in Deutschland aussterben, dann bricht kein Ökosystem zusammen. Das Verschwinden des Weißstorchs ist eher zu vergleichen mit dem Verlust des Kölner Doms.
Der Mensch wurde als Hauptfeind vieler bedrohter Arten eingestuft. Ordnende Eingriffe des Menschen zur Biotopregulierung waren verpönt, und der Sinn der Naturschutzgebiete wurde darin gesehen, die noch vorhandene „Restnatur“ vor weiteren Eingriffen des Menschen zu schützen. Für viele Naturschutzgebiete stellte sich jedoch heraus, dass ihre Erhaltung nicht durch den Menschen gefährdet ist, sondern durch die Natur selbst. Kies- und Sandflächen sind von der Natur bedroht: sie überwachsen. Trockenrasen verbuschen und flache Gewässer verlanden. Natur ist ungelenkte Sukzession.
Die natürliche Sukzession wandelt viele unter Schutz gestellte Gebiete in eine Richtung um, die noch viel mehr Natur ist, aber eben dadurch den Wert der Gebiete als Refugien für viele bedrohte Arten vermindert. Die Umwandlung vieler unter Schutz gestellter Habitate in zugewachsene, verbuschte und bewaldete Flächen ist Natur pur, aber eben dadurch eine Hauptgefahr für die Erhaltung der Arten. Eben weil viele Naturschutzgebiete in Mitteleuropa keine ursprüngliche Natur sind, sondern vom Menschen geschaffene Biotope, müssen diese Gebiete überwiegend nicht vor menschlichen Eingriffen, sondern vor der Natur selbst geschützt werden, weil die Natur ihre Flächen durch die Sukzession zurückerobern würde, wenn man sie nicht daran hindern würde (siehe Abschnitt 3.1.3).
Als Rückzugsgebiete bedrohter Arten erhielten viele Naturschutzgebiete in den letzten Jahrzehnten eine beachtliche Konkurrenz durch Flächen, denen man die Bedeutung für die Erhaltung gefährdeter Arten nicht zugetraut hätte. Es handelt sich um Flächen, die für Militär, Wirtschaft und Verkehr eingerichtet wurden, also um Flächen, deren Planung und Schaffung nicht das Ziel verfolgte, ein Refugium für bedrohte Arten einzurichten. Ruderalflächen in Städten und auf Industriegeländen, Autobahnböschungen, Kiesgruben, Kläranlagen, Tagebauflächen und Truppenübungsplätze wurden seit einigen Jahrzehnten die Gebiete, in denen man seltene Vögel wie Birkhühner, Rebhühner, Wachteln, Kiebitze, Baum- und Wiesenpieper, Heidelerchen, Steinschmätzer, Grauammern und viele andere Arten sowie Schwalbenschwänze, Goldene Acht und Postillion sowie Mauerfüchse und andere selten gewordene Schmetterlinge noch am ehesten zu Gesicht bekommt (Tafeln 1, 2, 5 und 6). Alle diese Arten verdanken ihre Erhaltung nicht irgendwelchen aktiven Artenschutzmaßnahmen, sondern ihre Bewahrung entwickelte sich passiv als Nebenprodukt einer Landschaftsgestaltung, die für ganz andere Zwecke gedacht war. Solche Lebensräume haben mit Natur nichts zu tun und wären in Mitteleuropa gar nicht vorhanden, hätte der Mensch sie nicht errichtet. Die Existenz solcher artenreicher Flächen, die alle erst in den letzten Jahrzehnten entstanden sind, sollte in stärkerem Maße bedacht werden, wenn es um Entscheidungen geht, welche Gebiete unter Naturschutz gestellt werden sollen.
Diesen Gebieten ist gemeinsam, dass sie der Mensch für seine eigenen Zwecke und Bedürfnisse von der Vegetation frei hält; aber davon profitieren bestimmte Pflanzen- und Tierarten, für die diese Flächen ursprünglich gar nicht gedacht waren. Früher waren solche karg bewachsenen Offenbiotope fast überall vorhanden, heutzutage sind sie in Mitteleuropa jedoch zu den Mangelbiotopen geworden und beschränken sich fast nur noch auf Industriegebiete, Siedlungsflächen, Verkehrsflächen und Militärgebiete (Tafel 4). Zwar ist es korrekt, dass die gegenwärtige Ausweitung von Industrie, Siedlung und Verkehr die Natur immer mehr zurückdrängt; aber es wäre falsch, damit auch immer den Rückgang der Arten zu beklagen. Arten brauchen nicht immer Natur. Gerade viele Rote-Liste-Arten weichen immer mehr auf Industriebrachen aus, oder sie siedeln sich in den Städten an (Reichholf, 2010).
Ein ganze Reihe von heutzutage gefährdeten Arten sind die Bewohner von Extrembiotopen, und gerade solche Biotope sind in Mitteleuropa meist keine unberührte und ursprüngliche Natur. Es handelt sich (nur scheinbar paradoxerweise) um Habitate, die sich in einem Zustand befinden, den Umweltschützer möglichst vermeiden und beseitigen möchten (Anonym, 2008). Kiebitze und Rebhühner (beides Rote-Liste-Arten) brüten auf Industriebrachen und auf den platt gefahrenen Geländen der Binnenhäfen an Rhein und Elbe, wo Lastenkräne und Lkws das Landschaftsbild bestimmen. Einige seltene Pflanzenarten haben sich auf brüchige Asphaltflächen auf Parkplätzen zwischen Kaufhäusern zurückgezogen, weil sie dort davor bewahrt sind, von üppiger Vegetation überwuchert zu werden. Vom Aussterben bedrohte Salzpflanzen (Halophyten) haben wieder günstige Lebensbedingungen auf den Randstreifen der Autobahnen gefunden und sich dort ausgebreitet, weil sie vom Einsatz des Streusalzes profitieren (Feder, 2014). Es gibt kaum bessere Beispiele dafür, dass Artenschutz, Naturschutz und Umweltschutz nicht dasselbe sind, sondern oft genug im Gegensatz zueinander stehen.
In Nationalparks und Naturschutzgebieten wird (wie der Name sagt) angestrebt, ein möglichst naturnahes Ökosystem zu erhalten oder zu schaffen. Aber ganz abgesehen davon, dass es schwer ist zu begründen, was in Mitteleuropa wirklich ein naturnahes Ökosystem ist (siehe Abschnitt 3.1.1), und ebenso abgesehen davon, dass es fraglich ist, ob eine ursprüngliche Natur in Mitteleuropa nach jahrtausendelanger menschlicher Einwirkung überhaupt wiederhergestellt werden kann (siehe Abschnitt 7.2), scheint Eines sicher zu sein: Die Habitate, in denen sich ein Großteil der gefährdeten Rote-Liste-Arten aufhält, sind nicht die naturnahen Biotope.
In Mitteleuropa leben viele Rote-Liste-Arten auf offenen Magerflächen mit schütterer Vegetation, dort wo Bäume und Büsche nur spärlich wachsen. Sie brauchen offene Erd- oder Steinflächen, Abbruchkanten mit bröckelnder Erde oder Kiesbänke, also Flächen, die sich bei Sonneneinstrahlung schnell aufwärmen. Dichter Graswuchs, der zwar für das menschliche Auge so schön grün und gesund aussieht (und den Eindruck einer intakten Natur vermittelt), bietet ihnen keine Lebensmöglichkeiten, weil der Boden unter den dicht bewachsenen Flächen zu feucht und zu kühl ist. Folglich sind spärlich bewachsene Grasflächen artenreicher als grüne Wiesen (Tafel 4).
In den vergangenen Jahrhunderten hat sich eine Vielfalt an Blumen, Schmetterlingen und anderen Insekten gerade auf den übernutzten, nährstoffarmen Böden entwickelt. In Mitteleuropa ist es fast eine ökologische Grundregel, dass nährstoffarme Gebiete eine große Biodiversität hervorbringen, nährstoffreiche dagegen eine geringe. Allein diese Grundregel macht es schon verständlich, warum heute so viele Arten in Mitteleuropa selten werden. Wir verlieren die nährstoffarmen Gebiete. Die intensive Düngung in der Landwirtschaft und der Stickstoffregen aus der Luft auch weit abseits der Agrarflächen haben im letzten halben Jahrhundert vielen Arten die Existenzmöglichkeit weggenommen. Der Artenschwund in Mitteleuropa hat ganz andere Ursachen als der Artenschwund in den Regenwaldgebieten der Erde. Folglich müssen auch die Artenschutzmaßnahmen ganz anders aussehen. Es ist bemerkenswert, dass dies in den öffentlichen Stellungnahmen zum Artenschutz so wenig betont wird.
Das erhebliche Missverständnis, das immer wieder zum Ausdruck kommt, wenn heute in Deutschland die Existenz artenreicher Gebiete mit „Bewahrung





























