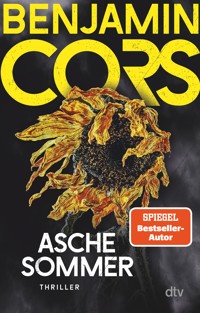
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gruppe 4 ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine geheimnisvolle Botschaft Ein grausamer Fund Ein tödliches Rätsel In der brütenden Hochsommerhitze markiert der Fund zweier Leichen in einem Kühlhaus den Beginn einer beispiellosen Mordserie. Jakob Krogh und Mila Weiss ahnen schon in den ersten Stunden, dass sie es mit einem äußerst intelligenten und penibel planenden Täter zu tun haben müssen. Der zweite Fall für ein außergewöhnliches Ermittlerteam - das neue Thrillerhighlight von Bestsellerautor Benjamin Cors Gemeinsam mit ihrem Team – der Sonderermittlungsgruppe 4 – müssen sie all ihre Kräfte aufbieten, um das Sterben zu stoppen. Doch die Tatsache, dass der Hauptverdächtige in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt sitzt, macht die Jagd auf den gnadenlosen Mörder nicht einfacher … »Ein mörderischer Sommer steht uns bevor, wir folgen der Spur der Asche und hoffen, dass das Böse nicht gewinnt ...« Benjamin Cors »Der Autor versteht einfach sein Handwerk. Sein Schreibstil ist exzellent. (…) Wer harte Lektüre mag, sollte Cors' Thriller unbedingt lesen. Er wird es nicht bereuen.« Hannoversche Allgemeine Zeitung über ›Krähentage‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
In der brütenden Hochsommerhitze markiert der Fund zweier Leichen in einem Kühlhaus den Beginn einer beispiellosen Mordserie. Jakob Krogh und Mila Weiss ahnen schon in den ersten Stunden, dass sie es mit einem äußerst intelligenten und penibel planenden Täter zu tun haben. Gemeinsam mit ihrem Team müssen sie all ihre Kräfte aufbieten, um das Sterben zu stoppen. Doch die Tatsache, dass der Hauptverdächtige in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt sitzt, macht die Jagd auf den gnadenlosen Mörder nicht einfacher …
Benjamin Cors
ASCHESOMMER
Gruppe 4 ermitteltBand 2
Thriller
Die vorliegende Geschichte beruht auf wahren Ereignissen.
Ereignisse, die viele Millionen Jahre zurückliegen.
Als Asche sich über die Welt legte.
Prolog
Er hatte ihre Namen vergessen.
Vielleicht Jonas. Oder Paul. Womöglich auch Niklas, einige hatten diesen Namen getragen, damals. Er dachte nicht oft über sie nach, eigentlich nie. Und wenn, dann waren es weder ihre Namen noch ihre Gesichter, an die er sich erinnerte. Auch nicht die Blicke, die eben noch von dieser jugendlichen Arroganz geprägt waren, die er so sehr verabscheute. Und die sich erst in Erstaunen gewandelt hatte, dann in Entsetzen. Zumindest beim Zweiten. Der Erste hatte keine Zeit gehabt, erstaunt oder gar entsetzt zu sein. Er war sofort tot gewesen.
Nein, wenn er jetzt auf seinem Stuhl saß, vor sich das Fenster, hinter dem der letzte Schnee des Jahres auf den Feldern lag, erinnerte er sich nur an das Gefühl, das ihn damals überkommen hatte.
Ruhe.
Weil auf einmal alles an seinem Platz war, Sinn ergab und ein Bild heraufbeschwor, das schön war und rein. Stille war eingekehrt. So wie schon viele Male zuvor, als Pflanzen und Tiere verstummt waren, bevor sie von diesem Planeten verschwanden. Es war der unabänderliche Lauf der Zeit. Die Natur nahm sich ihr Recht, sie wusste, was ihr zustand.
Die Stimmen aus dem Fernseher drangen an sein Ohr, er hörte kaum hin. Eine Pressekonferenz, sie sprachen über Vögel. Über Krähen.
Er wusste nichts anzufangen mit diesen Geschöpfen, die manchmal die Felder draußen vor dem Fenster besetzten wie Pusteln auf einem kranken Boden. Gerne hätte er sie abgeschossen, er war ein guter Schütze gewesen, damals. Aber jetzt war er hier drinnen, wo sie ausgerechnet ihn, den einzig Gesunden unter so vielen Kranken, eingesperrt hatten. So lange schon.
Nur eine schmale Straße verband diesen Ort mit dem Rest der Welt, sie führte durch kahle Felder bis hinüber zu den Sonnenblumen. Jetzt, im spät endenden Winter, waren keine zu sehen, aber sie würden wachsen und ihre Köpfe der Sonne entgegenrecken – wenn die Zeit gekommen war.
Der erste Junge hatte Mats geheißen, jetzt fiel es ihm ein. Aber noch viel deutlicher erinnerte er sich an das Knacken. Das Geräusch eines berstenden Nasenknochens, als das schwere Holzscheit, das er mit einem Handschuh aus dem Kamin geangelt hatte, das Gesicht des Jungen traf.
Das Sirren in der Luft, als er in einer fließenden Bewegung den Schwung aufgenommen und sein Arm einen perfekten Bogen beschrieben hatte, um nur eine halbe Sekunde später den zweiten Jungen niederzustrecken.
Alexander. Oder Benedikt. Söhne aus gutem Hause jedenfalls, mit einer verheißungsvollen Zukunft vor sich. Dabei verschwendeten sie nur die Luft, die sie atmeten.
Er hatte einfach weitergemacht, nicht aus Lust, es war kein Rausch, der über ihn gekommen war. Nein, er hatte die Ruhe genossen, die plötzlich um ihn herum war. Endlich Frieden. Das dumme Geplapper der beiden hatte aufgehört.
Irgendwann war das Holzscheit schwarz vor Blut gewesen. Die Gesichter unkenntlich. Und als er den Schlüssel in der Tür gehört hatte, als seine Frau erschienen war, blass und müde, da hatte er nicht eingesehen, warum die Ruhe so plötzlich enden sollte.
Im Fernseher wurden jetzt Fragen gestellt. Er blickte auf den Apparat, der in einer Ecke auf der Kommode stand. Der Mann, der über den Bildschirm flimmerte, trug einen dunklen Bart, er sah müde aus. Die Journalisten stellten ihm Fragen, aufgeregt und laut. Es strengte ihn an, er konnte es sehen.
Die Frau hatte braune kurze Haare, saß aufrecht, spielte ihre Rolle, wollte stark wirken. Dabei war sie schwach, die Kraft schien ihr auszugehen. Warum sah das niemand außer ihm?
Er hatte den Fall des Kommissars und der Kommissarin in der Presse verfolgt: die Jagd auf den Krähenmann. Dabei war ihm bewusst geworden, dass er genau auf diese beiden gewartet hatte.
Jakob Krogh. Und Mila Weiss. Die Leiter der sogenannten Gruppe 4, zuständig für Serienstraftaten. Endlich waren da zwei würdige Gegner. Sie würden seiner Spur folgen und erleben, wie er Ruhe und Stille über sie alle brachte. So, wie es lange vor ihrer Zeit schon geschehen war. Und sie würden seinem Werk Respekt zollen, im Gegensatz zu all den anderen.
Aber zuvor würde er sie studieren und kennenlernen. Ihre Geheimnisse ans Licht bringen, denn wer wusste schon, was sich hinter der Fassade verbarg.
Der Winter vor dem Fenster würde bald vergehen. Und mit ihm die Kälte.
Der Frühling würde kommen. Dann der Sommer.
Und mit ihm die Hitze.
Dann würde das Sterben beginnen.
Tag 1
1
Das Geräusch von Wasser in der Dunkelheit. Sanft fast, wie das Schaukeln von Wellen in einem Schwimmbecken. Als würde jemand auf dem Rücken liegen und sich treiben lassen, mit geschlossenen Augen. Nur ab und zu ein kurzer Schlag mit den Armen, um nicht unterzugehen. Sie möchte so gerne glauben, dass es so ist – dass dort vorne, am Ende des Ganges, wirklich jemand glücklich im Wasser liegt.
Sie weiß, dass es nicht sein kann. Es gibt kein Glück an diesem Ort.
Sie macht einen Schritt nach vorne, etwas knackt unter ihren Füßen. Käfer, ihre dunklen Panzer sind vertrocknet. Und Scherben, sie sieht sie funkeln im Schein ihrer Taschenlampe. Das Geräusch von brechendem Glas hallt wie ein dunkles Echo die Wände entlang. Sie flucht leise, weil ihr klar ist, was das bedeutet: Er weiß jetzt, dass sie kommt.
Sie lauscht kurz in die Dunkelheit hinein, bis sie wieder das Plätschern des Wassers hört, nur lauter, unruhiger.
Sie wischt sich mit dem linken Handrücken den Schweiß von der Stirn. Es ist heiß hier unten, ihr blaues T-Shirt ist durchtränkt, wie ein Film liegt die Feuchtigkeit auf ihren Armen. Seit einer Ewigkeit schon irrt sie durch diese Gänge. Ihr Atem geht keuchend, der Lichtkegel der Taschenlampe huscht über den Boden, dann über die Wände, an denen Wasser hinunterläuft. In den Ecken hat sich die Dunkelheit festgesetzt. Sie spürt ihr Herz schlagen, in einem irren Rhythmus, ein pochender Alarm: Geh. Nicht. Weiter.
Dann endlich, nach einigen weiteren Schritten durch die Finsternis, erkennt sie einen schwachen Lichtschimmer. Sie umfasst ihre Waffe, langsam schiebt sie sich nach vorn, über die Käfer und die Scherben und auch über ihre Angst hinweg.
Feine grünliche Linien zittern über ihr wie ein Nordlicht an einem fernen Nachthimmel. Sie war noch nie am Polarkreis, aber so stellt sie es sich vor. Immer wieder muss sie sich den Schweiß aus den Augen wischen, er läuft ihr über die Nase, tropft auf ihre Hand, die die Waffe hält. Es ist warmer Dampf, den sie jetzt einatmet, er bringt noch mehr Hitze in ihren Körper, alles pulsiert, das Blut, die Nerven.
Sie zwingt sich, ruhig zu atmen.
Irgendwo ist eine Pumpe zu hören, Wasser schießt zischend durch Rohre. Ein Durchgang öffnet sich vor ihr, sie erkennt jetzt, was die feinen Linien über ihr bedeuten. Das Wasser des tiefen Beckens in der Mitte der Halle wird von unten angestrahlt. Alles ist grün vor ihren Augen, die Lampen am Beckenboden werfen die Konturen der Wasseroberfläche an die gekachelten Wände und die Decke. Tropfen an den Wänden, Risse an der Decke und graugrünes Moos in den Ecken. Ihr Blick fliegt durch den weiten Raum, er ist bestimmt so groß wie ein Tennisfeld. An der gegenüberliegenden Wand sieht sie zwei weitere Durchgänge. Wo ist sie hier?
Langsam schleicht sie am Rand des gewaltigen Schwimmbeckens entlang, ihr Herz zerspringt bei jedem Schlag, jede Faser ihres Körpers ist angespannt.
Wieder das Plätschern, ein heftiges Platschen jetzt. Die Gestalt im Becken ist kaum mehr als ein Schatten.
»Oh bitte, lass es nicht wahr sein«, flüstert sie.
Sie beschleunigt ihren Schritt, umrundet das Wasser, verliert kurz den Halt auf den feuchten Fliesen, leuchtet mit der Taschenlampe in das Becken.
Ein zweiter Schatten treibt dort. Und dann hört sie es: das verzweifelte Strampeln. Das Keuchen. Den Kampf ums Überleben.
Ein Kampf, der bereits verloren scheint. Sie kommt zu spät. Sie hat versagt.
»Nein!«, schreit sie. Sie schlittert über die Fliesen, lässt ihre Taschenlampe fallen, auch ihre Waffe. Dann springt sie.
Das Wasser ist warm, kurz hat sie das Gefühl, in einen heißen Schlund zu tauchen. Grünes Licht empfängt sie, hüllt sie ein, sie macht einen Schwimmzug in Richtung der beiden Schatten.
Der kleinere Körper sinkt bereits, mit weit ausgestreckten Armen.
Ihre Lungen schmerzen, die schweren Stiefel zerren an ihr, aber sie muss dorthin, muss zu dem Mädchen, das allmählich entschwindet. Panisch stößt sie sich nach vorne, sieht unten den grünen Belag auf dem Beckengrund und die Scheinwerfer, die gleißendes Licht werfen.
Ihre Hand umfasst die Kinderfinger. Mila greift nach dem Handgelenk, zieht das Mädchen an sich heran, hält es fest.
Sie brauchen Luft, alle beide.
Ihre Füße finden am Grund Halt, sie stößt sich ab. Es sind keine vier Meter bis zur Oberfläche, ihre Lunge droht zu platzen. Sie schießt empor, tritt mit den Beinen. Das Mädchen ist schwer, ihre Kleidung vollgesogen, die Jeans, der dünne pinke Pullover mit dem glitzernden Stern darauf.
Mit einem gellenden Schrei durchbricht sie die Oberfläche, schnappt nach der dampfigen Luft, ringt nach Sauerstoff. Sie hat jetzt schon keine Kraft mehr. Aber das Mädchen atmet, saugt jetzt ebenfalls gierig die schwere Luft ein.
»Bleib bei mir«, murmelt sie, blickt auf die braunen nassen Haare und auf das blasse Gesicht. »Hörst du, Mathilda? Ich hab dich, bleib einfach bei mir. Es ist alles gut.«
Es ist eine Lüge und sie beide wissen es.
Jemand greift nach ihr.
»Romy«, ruft sie und fasst mit ihrer freien Hand nach der großen Schwester, die sichtlich erschöpft ist und nicht mehr lange durchhalten wird.
»Ich bin da, ich habe euch!«
Aber es ist zu viel für sie, sie kann nicht beide halten. Zu dritt sinken sie wieder hinab. Grüne Sterne funkeln vor ihren Augen, Mathilda droht ihr aus dem Arm zu rutschen. Mit letzter Kraft kämpft sie sich nach oben. Luft kommt wieder in ihre Lungen, dann Wasser und schließlich die Erkenntnis, dass sie sterben wird, hier im Becken unter der Stadt.
Sie werden alle drei sterben.
Sie hat die Mädchen gefunden. Aber sie wird sie wieder verlieren.
Ihr Blick fliegt hoch zum Beckenrand. Es gibt kein Entkommen, das Wasser steht zu niedrig, sie sind gefangen.
»Du musst schwimmen«, sagt sie zu Romy. »Ich kann euch nicht beide halten …«
Sie hält inne, weil sie den Blick des Mädchens sieht. Voller Entsetzen blickt sie an ihr vorbei.
»Ich kann nicht«, flüstert das Mädchen plötzlich. Und dann sieht sie, was das Mädchen sieht.
»Geben Sie mir die beiden.«
Die Stimme ist heiser und rau. Mila sieht zuerst nur eine Kontur im grünen Licht. In ihrem Arm ist Mathilda jetzt ganz still.
Direkt über ihnen, am unerreichbaren Beckenrand, hockt eine Gestalt. Ein Mann in dunklen Hosen und schwarzem Pullover, eine Kapuze über dem Kopf. Aber sie kann sein Gesicht sehen, das ohne jeden Ausdruck ist, glatt und weich. Die dunklen Brauen, die hohen Wangenknochen, die Augen, die auf sie niederblicken, emotionslos.
Sie starrt ihn an. Den Mann, den sie seit Monaten jagt wie ein Phantom. Für einen kurzen Moment vergisst sie das Wasser, die Mädchen und die Angst.
»Toblach«, flüstert sie. »Endlich.«
Aber er antwortet nicht, legt nur den Kopf schief. Und hält plötzlich eine Waffe in der Hand. Es ist ihre eigene.
»Geben Sie mir die Mädchen.«
»Nein!«
Sie versucht, sich über Wasser zu halten, spürt Mathildas Gewicht. Neben ihr wimmert Romy. Ihr Blick fliegt über das Becken, es muss einen Ausweg geben! Irgendwo muss es eine Leiter geben, dann …
»Sie sterben. Alle drei. Wollen Sie das?«
Dann ist er still. Da ist nur die Verzweiflung der Mädchen neben ihr und ihr eigener panischer Atem.
Sie sind verloren.
Mit letzter Kraft und einer Wut, die sie nie vergessen wird, schiebt sie Mathilda nach oben. Er streckt den Arm aus, packt das Kind, zerrt es über den Beckenrand.
»Jetzt das andere.«
Sie weiß, dass sie keine Wahl hat.
»Nein«, wimmert Romy neben ihr.
Mila dreht sich zu ihr, blickt sie an: »Ich finde euch«, flüstert sie. »Ich finde euch alle beide, hörst du? Euch wird nichts passieren. Sei stark, noch ein kleines bisschen!«
Tränen vermischen sich mit dem warmen Wasser, es sind nicht die des Mädchens, es sind ihre eigenen.
»Nein«, wimmert Romy, aber Mila weiß, dass das Kind verstanden hat.
»Ich hole euch. Versprochen.« Und mit diesen Worten schiebt sie auch Romy ihrem unausweichlichen Schicksal entgegen.
Er zerrt das Mädchen hoch wie eine Trophäe. »Es hat mich gefreut, wirklich.«
»Ich finde Sie, Toblach! Ich schwöre, ich finde Sie und die Mädchen. Krümmen Sie den beiden auch nur ein Haar und ich bringe Sie persönlich um, hören Sie!«
Hinter ihr erklingt ein Geräusch. Sie dreht sich um und weiß sofort, was der kreischende Ton zu bedeuten hat.
»Wissen Sie«, hört sie Toblachs kalte Stimme. »Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Ich glaube vielmehr, dass es hier endet. Zumindest für Sie.«
Mit einem metallischen Kratzen schiebt sich eine Abdeckung über das Becken.
Er hat recht. Hier endet es.
»Romy! Mathilda! Ich finde euch!«
Aber es kommt keine Antwort mehr. Sie ist allein im Wasser, umgeben von grünlichem Licht und vom Plätschern der Wellen. Die Abdeckung kommt immer näher, nur noch wenige Meter, bis das Metall sie einschließt.
»Mila!«
Milas Kopf schlug hart gegen die Scheibe, sie riss die Augen auf und wusste im ersten Augenblick nicht, wo sie war. Immer noch war da Licht, es war jetzt gelblich, verschwommen sah sie weite Felder und den Staub, den der Wagen aufwirbelte, in dem sie saß.
»Hey, ist alles in Ordnung?«
Sie richtete sich auf und rieb sich die Schläfe. Erneut wurde sie durchgeschüttelt, als sie durch ein Schlagloch fuhren. Weizenfelder schossen an ihr vorbei wie eine helle Mauer, vom Himmel brannte eine gleißende Sonne. Sie sah an sich herab. Trotz der Klimaanlage war ihr T-Shirt feucht, die Haare klebten an ihrer Stirn.
»Ja … es ist … es ist alles in Ordnung.«
»Sieht irgendwie nicht so aus.«
Mila rieb sich ihren schmerzenden Nacken. Neben ihr lenkte Jakob den Wagen über einen Feldweg, immer wieder versuchte er, tiefen Unebenheiten auszuweichen. Die Hitze der vergangenen Wochen hatte harte Furchen in den Boden gerissen.
»Alles okay«, murmelte sie und fuhr sich durchs Gesicht, um das Bild fortzuwischen, das sich auf ihre Netzhaut gelegt hatte und nicht mehr verschwinden wollte.
Toblach. Die Mädchen.
Sie atmete mehrmals tief ein und nickte Jakob zu, der ihr einen besorgten Seitenblick zuwarf. Sie wusste, dass er nicht fragen würde, warum sie schweißnass aus ihrem kurzen Schlaf erwacht war. Sie würde ihm ohnehin keine Antworten geben können.
Zumindest nicht jetzt.
»Einfach ein wirrer Traum, nichts weiter. Und dann diese verdammt Hitze.« Sie atmete langsam aus, um sich zu sammeln, und versuchte, Jakobs eindringlichen Blick zu ignorieren.
»Vielleicht war es keine gute Idee, dich mitzunehmen«, sagte er. »Ich hätte allein hier rausfahren können, ist doch ohnehin nichts los. Und du siehst aus, als könntest du mal Urlaub gebrauchen, ein paar Tage raus aus dem Ganzen.«
»Geh du doch, du siehst auch nicht sehr frisch aus.«
Mila bereute ihre Worte sofort. Vielleicht hatte Jakob recht, sie war gereizt, müde und zunehmend dünnhäutig. Irgendwann würde sie ihn vollständig ins Vertrauen ziehen. Bis dahin musste er mit ihrer angespannten Gemütslage umgehen.
»Tut mir leid«, murmelte sie. »Das war ein blöder Spruch …«
»Schon okay«, erwiderte er beiläufig, aber seine Stimme klang gepresst.
Sie betrachtete ihn kurz, während er fluchend ein weiteres Schlagloch umkurvte. Den dunklen Bart, die Linien um seine Augen, die Falte auf der Stirn.
Jakob Krogh, zweiundvierzig Jahre, gemeinsam mit ihr Leiter der Gruppe 4, einer Sondereinheit zur Aufklärung von »Straftaten mit seriellem Muster« – so jedenfalls lautete die bürokratische Formulierung innerhalb des Polizeiapparats. Er trug ein weißes Hemd, die Ärmel waren hochgekrempelt, am Handgelenk eine Uhr mit großem Ziffernblatt.
Es war kurz nach elf am Vormittag, und schon jetzt war die Temperatur draußen jenseits der dreißig Grad. Siebenunddreißig waren für heute angesagt, die zweite Woche in Folge. Mila griff nach ihrer Wasserflasche und nahm einen tiefen Schluck.
»Wir sind gleich da«, sagte Jakob. Er blickte auf das Display seines Handys am Armaturenbrett und zeigte dann nach vorn zu einer Abzweigung auf einen kleinen Feldweg.
»Da lang, danach sind es noch zwei Kilometer.«
»Wird auch Zeit«, stöhnte sie. »Wenn das so weitergeht, ist jeder Knochen in meinem Körper zerbröselt, die Straße ist ja unterirdisch. Gibst du mir noch mal die Anzeige?«
Jakob griff ins Seitenfach der Fahrertür und reichte ihr einen abgetrennten Zeitungsausschnitt, den er in eine durchsichtige Folie gesteckt hatte. Dabei lenkte er den Wagen an der Abzweigung um die Kurve.
»Wie gesagt, das ist bestimmt nur ein schlechter Scherz.«
Sie glaubte keine Sekunde daran und er auch nicht, das spürte sie. Jakob Krogh hatte sie vor einer Stunde angerufen und sie hatte die Beunruhigung in seiner Stimme hören können.
Nervös trommelte er mit den Fingern auf das Lenkrad und starrte durch die dreckige Windschutzscheibe.
»Ich kann das Haus sehen«, sagte er und deutete nach vorne.
Mila senkte den Blick auf das Stück Papier in ihrer Hand. Es war eine Anzeige, die nur wenige Stunden zuvor in der lokalen Tageszeitung erschienen war. Sie umfasste eine halbe Zeitungsseite und war von einem schwarzen Rahmen eingefasst.
Eine Traueranzeige.
»Daniel Wissmer«, murmelte Mila, als könnte sie der mysteriösen Anzeige eine Antwort entlocken, wenn sie den Namen des Mannes vorlas, von dem bis heute Morgen niemand gewusst hatte, dass er gestorben sein sollte.
Der Name prangte mittig und in riesigen Lettern auf der Seite, darunter der Todestag: gestern.
Ein Geburtsdatum fehlte, ebenso jegliche Form von Beileidsbekundung. Diese Anzeige war der Grund für Jakobs Anruf gewesen und auch für die Fahrt durch die verdorrten Felder.
»Wir sind da«, bemerkte Jakob knapp und parkte in einiger Entfernung von einem verlassen wirkenden Hof. Der Zaun, der das Gelände umschloss, sah heruntergekommen aus, zahlreiche Pfosten waren morsch oder bereits umgefallen. Ein Stück zerrissenen Stoffs hing an dem Drahtgewebe. Unweigerlich drängte sich Mila das Bild eines Menschen auf, der panisch versuchte, diesen Ort zu verlassen, dabei am Zaun hängen blieb, sich losriss und schließlich von den endlosen Weizenfeldern verschluckt wurde.
Sie schüttelte den Gedanken ab und konzentrierte sich wieder auf die Todesanzeige. Ganz unten war ein Hinweis auf den Ort der Trauerfeier aufgeführt. Keine Adresse, sondern eine Koordinatenangabe. Sie verwies auf diesen verlassenen Bauernhof, der – so schien es ihr bereits jetzt – der dunkle Mittelpunkt dieser Glutlandschaft zu sein schien.
Jakob war am frühen Morgen von einem Kollegen alarmiert worden, nachdem ein Suchalgorithmus im Netz einen Treffer gemeldet hatte. Daniel Wissmer, siebenunddreißig Jahre alt, war Inhaber des Lehrstuhls für Paläontologie, einer Disziplin im Fachbereich der Geowissenschaften. Mila hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal gewusst, dass es einen solchen Studienzweig überhaupt gab. Das Erscheinen von Wissmers Namen in der Zeitung, vor allem in der digitalen Ausgabe, hatte zu dem Treffer und der sofortigen Reaktion geführt.
Denn Daniel Wissmer war vor drei Tagen als vermisst gemeldet worden. Spurlos verschwunden nach einer Vorlesung am späten Nachmittag. Zuletzt hatten ihn Studierende gesehen, auf dem Campus. Danach schien er sich in Luft aufgelöst zu haben.
Nur um Tage später in einer Todesanzeige aufzutauchen.
Irgendetwas an dieser Geschichte stimmte ganz und gar nicht. Nicht zuletzt wegen des kurzen Zusatzes, der unter den Koordinaten abgedruckt war.
Die erste von weiteren Trauerfeiern findet im engsten Kreise statt.
Nicht ein Luftzug bewegte die verdorrten Halme. Der Boden war ausgetrocknet und schien um Wasser zu flehen. Breite Risse zogen sich über den Feldweg, der bis wenige Meter vor den Hof reichte. Das dunkle Dach und die dreckigen Holzwände hoben sich vom gleißenden Sonnenlicht ab. Kaputte Fensterscheiben, Holzläden, die schief in den Angeln hingen, dahinter die Felder, über denen die Luft vor Hitze flirrte.
Jakob überprüfte seine Waffe.
»Lass uns Schutzwesten anziehen«, sagte er kaum hörbar und öffnete vorsichtig die Tür. »Sicher ist sicher.«
Mila atmete tief ein, immer noch flackerte das grünliche Licht des Beckens vor ihren Augen, immer noch spürte sie Toblachs dunklen Blick auf ihrer Haut.
Sollte Jakob ruhig glauben, dass sie geträumt hatte. Sie selbst konnte sehr wohl unterscheiden.
Zwischen einem Traum. Und einer Erinnerung.
2
Jakob Krogh war angespannt, als er langsam auf den Hof zuging. Er wusste nicht warum, aber der Anruf aus dem Präsidium und die geheimnisvolle Anzeige, die er im Büro hektisch überflogen hatte, hatten etwas in ihm ausgelöst. Als wäre etwas losgetreten worden, von dem er noch nicht wusste, was es war.
Hinter ihm, leicht versetzt, ging Mila. Auch sie trug ihre Schutzweste.
»Wir gehen zum Haus«, sagte Jakob ruhig, während sein Blick das Gelände absuchte. Links von ihnen befand sich eine Scheune, das Tor stand offen, er konnte einen alten Traktor erkennen. Die Sonne knallte gnadenlos herunter, nur das Knirschen von Kieselsteinen unter ihren Füßen war zu hören. Bereits nach wenigen Metern musste er sich den Schweiß von der Stirn wischen.
Er blickte sich zu Mila um, die ihm kurz zunickte.
Das Holz unter seinen Füßen knarzte, als er die Veranda des Haupthauses betrat. Niemand war zu sehen, kein Spielzeug lag auf dem Boden, keine Schuhe vor der Tür. Mila blickte durch eines der Fenster, schüttelte den Kopf.
»Nichts.«
Jakob klopfte an die Tür, nachdem er vergeblich nach einer Klingel gesucht hatte.
»Hier ist die Polizei! Ist jemand zu Hause?«
Laut den Unterlagen aus dem Präsidium war der Hof seit mehr als einem Jahr verlassen. Und doch wollte Jakob keinen Fehler machen, denn irgendjemand hatte gewollt, dass sie diesen Ort besuchten, und vielleicht war dieser Jemand jetzt hier.
»Wir kommen jetzt rein!«
Das Öffnen der Tür verursachte ein schleifendes Geräusch auf dem Holzboden. Muffige, abgestandene Luft drang ihm entgegen, als er eintrat. Ein großes Wohnzimmer, in dessen einer Ecke ein Holztisch stand, daneben waren einige Stühle gestapelt. Der fleckige Teppich in der Mitte des Raumes wurde durch die wenigen, schmutzigen Fenster nur spärlich beleuchtet. Staub wirbelte auf, als sie weiter hineingingen.
»Kein Leichengeruch«, konstatierte Mila und ging in Richtung der Küche, die in einer Nische untergebracht war. Eine breite Fensterfront bildete die Westseite des Hauses, draußen waren die Felder zu erkennen. Eine einsame Vogelscheuche stand zwischen den trockenen Getreidehalmen.
Es war kein Leben in diesem Haus, man konnte es spüren.
Mila stieg eine schmale Treppe hoch, er hörte ihre Schritte über sich, einen Augenblick später rief sie von oben: »Hier ist niemand.«
Jakob folgte einem kleinen Gang, der zu einer Abstellkammer führte. Als er das Licht anknipste, leuchtete die Glühbirne tatsächlich kurz auf, bevor sie nach einem Flackern wieder erlosch.
Einige Meter weiter fand er ein Badezimmer, die Wanne war fleckig. Fliegen hatten sich auf dem Duschvorhang breitgemacht.
»Hier unten ist auch keiner«, stellte er fest. »Das Haus ist komplett verlassen.«
»Lass uns zur Scheune gehen«, hörte er Mila rufen. »Ich hab durchs Fenster was entdeckt.«
Einen Augenblick später kam sie die Treppe herunter und deutete nach draußen.
»Da sind Spuren.«
Beide verließen das Haus durch den Hintereingang. Vor ihnen erstreckten sich die Felder, ein Bretterzaun bildete die Grenze des Grundstücks. An einem der Balken hing eine schlaffe Wimpelgirlande, ein rotes Windrad steckte im Holz, vollkommen regungslos. Die Luft schien vor ihren Augen zu schwimmen.
»Hier drüben!«
Mila war schon ein paar Schritte gegangen und stand jetzt vor dem weit geöffneten Scheunentor. Sie betraten gemeinsam das Innere und blickten im Halbdunkel auf unzählige Gerätschaften, die in einer Ecke gestapelt waren. An den Wänden hingen Schaufeln, Rechen und eine rostige Sense.
»Meinst du, der fährt noch?«, fragte Mila. Sie deutete auf den alten Traktor in der Mitte des Schuppens, die Motorhaube zeigte Richtung Ausgang.
»Das ist eine Steyr 188, ein echter Oldtimer. Wer den hiergelassen hat, hat definitiv keine Ahnung.«
Mila blickte ihn überrascht an. »Seit wann kennst du dich mit Traktoren aus? Ich dachte, du bist in der Stadt groß geworden?«
»Bin ich auch. Aber auch in der Stadt spielt man unter der Schulbank stundenlang Quartett mit seinen Freunden. Autos, Flugzeuge, Rennwagen. Und zufälligerweise auch Traktoren, die Karten hat ein Freund von mir damals zum Geburtstag bekommen. Der hier hat einen Zwei-Zylinder-Dieselmotor und einen Wenderadius von … warte … knapp 3,5 Metern. Er schafft in der Spitze gut 28 Kilometer pro Stunde und hat ein Leergewicht von 1.390 Kilogramm.«
»So was nennt man unnützes Wissen«, frotzelte Mila.
Jakob lächelte.
»Mit der Steyr 188 konnte man leider kein Spiel gewinnen, die bringt nicht genug Tonnen auf die Waage. Also, was wolltest du mir zeigen?«
Mila deutete auf den Boden vor dem Traktor.
»Die Reifenspuren«, sagte sie leise. »Deine Steyr 188 ist vor Kurzem bewegt worden. Siehst du, hier kann man es genau erkennen, obwohl der Boden steinhart ist. Die Maschine ist einige Meter nach vorne gerollt, bis kurz hinter das Tor.«
Jakob folgte den Spuren nach draußen, wo sie plötzlich endeten.
»Okay«, sagte er. »Der Hof ist schon lange verlassen. Aber irgendjemand muss das Ding ja in Gang gesetzt haben.« Unbewusst blickte er zurück zum Haupthaus, dessen schmutzige Fenster ihn wie dunkle Augen anzustarren schienen.
»Aber die Frage ist doch«, sagte Mila, »warum jemand den Traktor nur wenige Meter vorwärtsbewegt. Und dann wieder zurück.«
Jakobs Anspannung stieg. Es war, als hätte ihn ein leichter Stromschlag in Alarmbereitschaft versetzt. Sein Instinkt sagte ihm, dass sie hier, an einem der verlassensten Orte der Welt, genau richtig waren.
Mila kniete jetzt vor dem Traktor und sah prüfend unter das Gefährt.
»Da ist eine Klappe im Boden.«
Und spätestens jetzt wusste Jakob, dass ihn sein Instinkt nicht täuschte.
Er schwang sich auf den Sitzbock und griff nach dem Anlasserschlüssel, der tatsächlich im Schloss steckte. Mit einiger Mühe erweckte er die alte Maschine zum Leben. Hustend startete der Motor, schwarzer Qualm drang aus dem Auspuff. Jakob legte krachend den ersten Gang ein und bewegte den Traktor ruckelnd bis vor das Scheunentor, wo er in der prallen Hitze zum Stehen kam. Als der Motor verstummte, legte sich eine gespenstische Stille über den Hof. Sie sprachen kein Wort, als sie kurz darauf auf die rostige Klappe im Boden blickten, an der ein eiserner Ring befestigt war.
Genau hierhin hatte die Traueranzeige sie führen sollen, dessen war sich Jakob jetzt sicher. Er griff nach dem Ring und konnte die Klappe erstaunlich leicht nach oben ziehen.
Eine Eisenleiter führte nach unten, wo ein abknickender Gang erkennbar war.
»Das muss mal ein Versteck gewesen sein. Vielleicht im Krieg. Oder der Ort diente als eine Art Lagerraum. Warte, ich hole schnell zwei Taschenlampen aus dem Wagen.« Mila eilte davon.
Jakob setzte sich an den Rand der Öffnung und tastete mit dem rechten Fuß, bis er die erste Sprosse der Leiter spürte. Nachdem Mila zurückgekehrt war und ihm eine der Taschenlampen in die Hand gedrückt hatte, holte er tief Luft und stieg rasch hinab. Nach wenigen Metern erreichte er den Grund. Es war zwar kühl hier unten, dennoch war die Erde knochentrocken und rissig. An den Wänden waren zahlreiche Holzpfosten zu erkennen, die die flache Decke gegen das Erdreich abstützten. Einige wirkten morsch und waren notdürftig verstärkt worden. Jakob hatte ein ungutes Gefühl, als er sich umblickte.
»Okay«, rief er nach oben. »Die Klappe ist leicht, versteck sie irgendwo hinter der Scheune. Ich will nicht, dass uns jemand hier unten einschließt.«
Kurz darauf standen Mila und er in der Dunkelheit des schmalen Ganges. Die Lichtkegel ihrer Taschenlampen zuckten umher. An den Seiten waren einige Haken ins Erdreich getrieben, daran hingen vergammelte Seile und eine rostige Kette.
»Oben hat es mir besser gefallen«, murmelte Mila.
Jakob sah, wie sie ihre freie Hand an eine der Wände legte und für einen Augenblick verharrte.
»Hier entlang«, sagte er.
»Was ist das bloß für ein Ort?«, flüsterte Mila, als sie langsam vorwärtsgingen, jetzt mit gezogenen Waffen. Die Hitze des Tages war hier unten bereits nach wenigen Sekunden einer kriechenden Kälte gewichen.
»Der Gang muss tatsächlich noch aus Kriegszeiten stammen«, antwortete Jakob. »Vielleicht der Zugang zu einem Bunker. Der Hof ist groß, kann schon sein, dass er damals einem reichen Bauern gehörte, der sich hier ein Versteck für seine Familie gebaut hat.«
»Dann hat er jedenfalls die Heizung vergessen«, murmelte Mila, und auch Jakob spürte, dass es immer kälter wurde.
Sie waren etwa zwanzig Meter weit gegangen, als der unebene Gang nach rechts abknickte und abrupt vor einer massiven Stahltür endete. In ihrer Mitte befand sich eine große, kreisrunde Luke, ähnlich wie bei einem U-Boot. Ein großer Hebel stand senkrecht nach oben ab. Als Jakob ihn berührte, zuckte er kurz zusammen.
»Das Metall ist eiskalt«, stellte er verwundert fest und ließ den Schein seiner Taschenlampe über die Tür gleiten. Sie glich einem gewaltigen Safe tief unter der Erde.
»Beginnt dahinter die Eiszeit, oder was?«, fragte Mila. Auch sie hatte ihre Hand auf das Metall gelegt und wirkte irritiert. Sie überprüfte die Kanten und Streben der Tür, aber sie schien hermetisch abgeriegelt. Es kam Jakob vor, als versperrte sie seit Anbeginn der Zeit jedem Eindringling den Zugang.
Später, viel später, würde er sich an diesen Moment zurückerinnern.
Und er würde sich immer wieder fragen, ob manches, was unter der Erde lauerte, einfach nicht geweckt werden sollte. Aber dafür war es nun zu spät.
Er steckte seine Waffe weg und legte die Hände ungeachtet der klirrenden Kälte auf den Hebel. Mila zog sich etwas zurück, ihre Taschenlampe, aber auch ihre Waffe auf die Tür gerichtet. Jakob stemmte sich mit seinem ganzen Gewicht gegen den Hebel. Zunächst tat sich nichts, doch schließlich knackte es kurz, ein merkwürdiges Geräusch war zu hören, ähnlich einem Saugnapf, der von einer glatten Oberfläche gelöst wurde. Und dann kam die Kälte.
Plötzlich strömte eiskalte Luft in den Gang, weiße Schwaden entwichen. Es schien, als hätten sie eine Tür zu den Polkappen entdeckt – tiefster Winter empfing sie.
Mila und Jakob mussten husten, die ungewohnte Kälte brannte in der Lunge, das Luftholen wurde schwer. Für einen Augenblick stützte Jakob sich an der Wand ab und blinzelte in den gespenstisch beleuchteten Raum. Es flackerte vor seinen Augen, eine Neonröhre knisterte. Dann zog er den Kopf ein und ging als Erster durch die Öffnung, hinein in das kalte Herz dieses Ortes.
»Oh mein Gott«, hörte er Mila neben sich flüstern. Sie griff nach seiner Hand, er spürte ihre Finger, aber es ging keine Wärme von ihnen aus.
Sie standen in einer Grabkammer. Und alles darin war erfroren.
Ihr Atem bildete weiße Wolken, die sich schnell verloren. An den Wänden standen Kondensatoren, die die Raumtemperatur offenbar konstant weit unter null hielten. Die Wände wirkten massiv, keine Öffnung war zu erkennen, kein Spalt, durch den Wärme hätte eindringen können.
Während Jakob noch überlegte, wie kalt es wohl war, deutete Mila bereits zitternd auf eine Anzeige an der Wand.
»Minus neunzehn Grad«, sagte sie mit brüchiger Stimme.
Sie würden nur wenige Momente hier verweilen können. Schließlich trugen sie T-Shirts, denn nur wenige Meter über ihnen brannte die Sonne erbarmungslos vom Himmel. Von der Kälte hier unten hatten sie nichts ahnen können.
Eine feine Schicht gefrorenen Kondenswassers überzog die Wände und den Boden. Die Maschinen waren mit Eiskristallen überzogen, genau wie die Innenseite der Tür, durch die sie eben eingetreten waren.
Und diese feine Schicht hatte sich auch auf die beiden Körper gelegt.
Gefangen in einem Kokon aus Kälte und Eis hingen sie im Tragegurt an einem gewaltigen Haken in der Mitte des Raumes von der Decke. Der Gedanke an die Kühlkammer einer Fleischerei durchzuckte Jakob. Wo gewaltige Rinderhälften von der Decke baumelten, die man mit einer Kette heranziehen konnte, um sie zu bearbeiten, mit einem scharfen Messer.
Aber das, was unter der Schicht aus Eis zu erkennen war, erinnerte nicht einmal entfernt an Rinder.
Mila ging einen Schritt auf die beiden Körper zu. Ohne zu zögern, griff sie nach einem kleinen Schemel, der in einer Ecke stand.
»Wir müssen hier gleich raus«, sagte Jakob. »Es ist zu kalt.« Aber Mila schien ihn nicht zu hören. Offenbar war sie zu sehr gefangen vom Anblick der beiden Körper.
»Sie konnten sich nicht mal gegenseitig wärmen«, sagte Mila leise. »Ihre Hände sind auf den Rücken gebunden. Sie haben sich dicht aneinandergedrängt, aber sie hatten keine Chance. Sie sind hier unten einfach … einfach erfroren.«
Behutsam wischte sie mit dem Unterarm über das Eis, bis sie durch die Schicht aus Kristallen etwas erkennen konnte.
Es waren ein Mann und eine Frau. Sie hatte braune Haare und blaue Augen. Schöne blaue Augen.
»Das ist doch Wahnsinn«, sagte Jakob, der vor Kälte bereits schlotterte.
Mila zog ihr Handy aus einer Hosentasche und machte einige Aufnahmen. Rasch stieg sie vom Schemel und zeigte Jakob eines der Bilder.
Er verstand sofort.
»Daniel Wissmer. Der verschwundene Dozent von der Uni.«
Es war der Mann, dessen Todesanzeige in der Zeitung erschienen war. Und jetzt hatten sie seinen Körper gefunden. Aufgehängt wie Vieh an einem Haken, eingeschlossen in einer Kältekammer tief unter der Erde.
Dunkler konnte ein Tod nicht sein.
»Schau dir das an«, sagte Mila, während sie die Wände mit der Taschenlampe ableuchtete.
»Da steht etwas.« Unter der dünnen Eisschicht war deutlich eine schwarze Schrift zu erkennen. Die Linien waren nicht sonderlich fein, die Buchstaben ungleichmäßig.
»Wer das geschrieben hat, hat bereits sehr gefroren«, stellte Jakob fest und leuchtete die Stelle nun ebenfalls an. Für einen Moment stockte ihm der Atem.
Das Sterben hat begonnen.
Mila schwieg und machte erneut einige Aufnahmen. Sie blickte Jakob mit ernster Miene an.
»Wir lagen richtig«, flüsterte sie. Als sie sah, wie sehr er zitterte, schob sie ihn in Richtung Ausgang. Auch sie hielt es kaum noch aus.
»Ab nach oben. Wir müssen das Team alarmieren. Und wir brauchen Jacken und Mützen und jede Menge heißen Grog. Dann wird uns schon warm werden.«
Doch als sie durch den Gang zurückeilten und kurz darauf wieder in die Hitze des Tages eintauchten, da wusste Jakob bereits, dass sie falschlag. Es würde nicht helfen, in der Sonne zu stehen, Grog zu trinken oder sich etwas Warmes anzuziehen.
Die Kälte würde bleiben. Für sehr lange Zeit.
3
Alles kam ihnen unwirklich vor in den Stunden, die folgten. Die Hitze, die durch jede Ritze ins Innere der Scheune kroch, ebenso wie die beißende Kälte, die nur langsam aus der unterirdischen Kammer zu weichen schien. Vor allem war es der ständige Wechsel zwischen den Extremen, der ihnen zu schaffen machte. Immer wieder kletterten sie hinunter in die Dunkelheit, zeigten Mitarbeitern der Spurensuche sowie den übrigen Mitgliedern der Gruppe 4 das eisige Grab. Schlimmer noch war der Aufstieg zum Licht, jedes Mal mit einem frischen Bild der gefrorenen Leichen vor Augen und dem Gefühl, in der Scheune wie unter einem Tuch aus dampfender Schwüle zu ersticken. Bereits nach einer Stunde saßen sie alle schwer atmend auf den herumliegenden Heuballen.
Lucy Chang war als Erste auf dem Hof angekommen.
Mila und Jakob hatten den Staub, den die Kawasaki bei voller Fahrt aufgewirbelt hatte, bereits von Weitem gesehen. Die schwere Maschine, die im krassen Kontrast zu der Frau stand, die sie lenkte, war den Schlaglöchern gekonnt ausgewichen. Lucy Chang war eine talentierte Fahrerin, was auch daran lag, dass sie keine Furcht kannte, zumindest nicht auf dem Sitz ihres Motorrades. Sie war auf den Hof eingebogen, hatte die Maschine abgestellt und das dunkle Visier des Helmes geöffnet. Dann war sie kaugummikauend auf das Team zugekommen, während sie die Melodie von Katy Perrys »Roar« summte. Lucy hatte gerade ihre Plastik-Pop-Phase und das gesamte Team musste es ertragen.
»Hello People!«, hatte sie ihnen zugerufen und sich rasch ihrer Motorradkluft entledigt. Darunter trug sie grüne Hotpants und ein weißes Shirt mit der ikonografisch herausgestreckten Zunge im Glitzerlook.
»Ich wette, sie kennt die Rolling Stones gar nicht«, hatte Jakob gemurmelt. Aber er war froh, dass das jüngste Mitglied der Gruppe 4 so schnell zu ihnen gestoßen war. Lucys Welt waren eigentlich Computerdateien und komplizierte Algorithmen, aber die beiden Leiter der Gruppe 4 hatten schnell gemerkt, dass sie auch hier im Nirgendwo von unschätzbarem Wert war. Sie konnte die Datenbanken noch effizienter durchforsten, wenn sie sich vor Ort ein Bild gemacht hatte.
»Das ist wirklich grausig da unten«, sagte Lucy, die jetzt im Schneidersitz auf einem Heuballen saß. »Ich meine, zwei Menschen einfach zum Sterben aufgehängt – schrecklich. Und außerdem frieren mir da unten die Eierstöcke weg und hier oben läuft mir die Brühe runter. Das geht ja gut los.«
Die kleine IT-Spezialistin war für ihre derben Sprüche fast schon berüchtigt und wurde dafür von Frauke Ibsen, der Assistentin der Gruppe 4, ständig gemaßregelt. Aber Frauke war nicht hier und Jakob war schlicht zu erschöpft, um sich mit Lucy über angemessene Ausdrucksweisen angesichts eines grausamen Verbrechens zu unterhalten. Zumal sie recht hatte: Der extreme Temperaturunterschied zwischen den Räumen setzte auch ihm zu, er fühlte sich innerlich weich gekocht, und gleichzeitig steckte ihm die Kälte in den Knochen.
Hinter Lucy saß der Finne.
Tuure Salo wischte sich mit einem Taschentuch über den kahlen Schädel, er trug ein enges weißes T-Shirt und war der Einzige, der auch dort unten eine Jacke kategorisch abgelehnt hatte. Die Minusgrade schienen ihn nicht aus der Ruhe zu bringen. Er maß über zwei Meter und glich nicht nur auf den ersten Blick eher einem Hooligan als einem Mitglied der Sondereinheit der Mordkommission.
»So kalt ist es dort unten gar nicht«, brummte er jetzt. »Es sind nur noch minus zehn Grad mittlerweile, da braucht man nicht mal einen Pullover.«
Lucy warf ihm einen finsteren Blick zu.
»Und gleich behauptest du noch, dass Stahl nicht friert.«
»Allerdings«, erwiderte Tuure und spannte kurz seinen Bizeps an.
Mila hatte Tuure, den alle nur den Finnen nannten, anfangs mit großer Skepsis im Team begrüßt. Sie hatte nicht verstanden, warum Jakob ausgerechnet den Zwei-Meter-Mann, der bereits zweimal wegen übertriebener Härte gegen Verdächtige im Polizeidienst aufgefallen war, in die Gruppe 4 geholt hatte. Erst nach und nach hatte sie begriffen, dass Tuure ein zuverlässiger und äußerst analytisch denkender Kollege war. Inzwischen war er auch für Mila unverzichtbar.
Frauke Ibsen, die Assistentin des Teams, hielt im Büro die Stellung. Und Ludger Palm war für ein langes Wochenende nach Malmö gefahren. Aber sie waren ausreichend besetzt und es wurde ohnehin alles für den Rest des Teams dokumentiert.
Lucys Blick löste sich vom beeindruckenden Umfang des Bizeps ihres Kollegen und wanderte über die Felder.
»Ist er das?«
Jakob erhob sich von seinem Heuballen, verließ die Scheune und trat in den Hof. Dort standen ein Dutzend Polizeifahrzeuge, auch der weiße Dienstwagen von Björn Thomsen, dem Leiter der Gerichtsmedizin. Jakob war bereits mehrfach unten bei Thomsen gewesen und hatte sich mit vorläufigen Informationen versorgen lassen.
»Ja, das ist er«, sagte er über die Schulter zu Lucy. Die junge Kollegin blies genervt die Backen auf und konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: »Na, dann kommt ja jetzt endlich die gute Laune ins Spiel.«
Ein brauner Kombi zuckelte über den trockenen Feldweg in Richtung des Hofes, gefolgt von einer trägen Staubwolke.
In diesem Augenblick knackte Milas Funkgerät.
»Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt runterkommen«, hörte sie die blecherne Stimme von Björn Thomsen.
»Alles klar. Bender ist auch gerade angekommen.«
»Kommt der etwa auch hier runter? Wie wollt ihr das machen? Abgesehen davon, dass die Temperaturen dann noch stärker ins Minus rutschen.«
Mila konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen und blickte Jakob an.
»Das wird nicht so einfach, ihn nach unten zu bekommen.«
Jakob zuckte nur die Schultern.
»Deswegen ist er hier, er muss dort runter. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen.«
Während der Kombi jetzt neben den Einsatzfahrzeugen der Spurensicherung parkte, warf Jakob Mila einen Seitenblick zu.
»Du siehst müde aus«, sagte er. »Ist wirklich alles in Ordnung?«
Sie nickte, zu schnell.
»Das sagte ich doch vorhin schon.«
Sie wandte sich ab und beugte sich zum Finnen hinüber, um ihn auf einen kleinen Sondereinsatz vorzubereiten. Jakob betrachtete die Szene nachdenklich, dann blickte er durch die flimmernd heiße Luft zu Benders Wagen. Er wartete, bis sich die Heckklappe öffnete und der Kollege über eine kleine Rampe auf ihn zugerollt kam.
Max Bender saß seit einem Einsatz vor einigen Jahren im Rollstuhl, er war von der Hüfte abwärts gelähmt. Vor allem aber hatte er seitdem einen menschenverachtenden Wesenszug entwickelt, der in den letzten Jahren seiner Dienstzeit zu einer echten Belastung für das gesamte Polizeipräsidium geworden war. Er hatte nie verwinden können, dass er für die Arbeit draußen im Feld zwar noch immer den Kopf, aber nicht mehr den Körper hatte. Er hatte diesen Frust immer häufiger an den anderen ausgelassen, hatte Kollegen angeschrien, weil sie in seinen Augen inkompetent, wenn nicht sogar völlig nichtsnutzig und ohne eigenes Denkvermögen waren. Bis die Behörde ihn und die Kollegen schließlich erlöst und ihn mit einundsechzig Jahren vorzeitig in Pension geschickt hatte.
Was jedoch zunächst niemand geahnt hatte: Max Bender hatte sich parallel zu seinem Niedergang im Präsidium zu einer Spezialausbildung aufgerafft. In den letzten Jahren hatte er sich auf eigene Kosten zu einem veritablen Experten der menschlichen Psyche entwickelt.
Der pensionierte Polizist und offensichtliche Menschenfeind war tatsächlich einer der besten Profiler, die Jakob kannte. Bender hatte sie bei der Suche nach dem Krähenmörder unterstützt und war kurz darauf zu einem festen Mitglied der Gruppe 4 geworden.
Jetzt hingen unter ihren Füßen zwei tiefgefrorene Tote am Haken in einer Kühlkammer. Und dazu gab es eine ebenso eindeutige wie besorgniserregende Botschaft.
Das Sterben hat begonnen.
Was immer sich daraus ergeben würde, wohin auch immer ihre Ermittlungen sie führen würden: Benders Sicht auf die Dinge würde ihnen helfen, auch wenn das Team von seiner Anwesenheit alles andere als begeistert war. Immer wieder geriet er mit Tuure und vor allem mit Lucy aneinander.
»Verdammte Hitze«, fluchte Bender auch sofort, als er seinen Rollstuhl neben Jakob zum Stehen brachte und sich umsah. »Und ein ganz schön abgelegener Ort.«
Jakob wollte seine Hände gerade nach den Griffen des Rollstuhls ausstrecken, hielt sich aber zurück, als Bender ihn aus dunklen Augen anfunkelte.
»Hier oben komm ich klar. Wo ist es? Ich will so schnell wie möglich aus der Hitze raus.«
»Sie werden sich noch wünschen, in der Hitze geblieben zu sein, glauben Sie mir.«
Jakob holte Benders schwere Winterjacke aus dem Kofferraum und gemeinsam bewegten sie sich über den Hof in Richtung der Kollegen.
»Ganz schön viel Aufwand«, stellte der Profiler fest. »Es ist eine lange Fahrt hier raus. Ihr sagtet, da unten seien Kondensatoren und Kühlgeräte, die muss man alle hierherbekommen. Vermutlich muss man das nachts machen, selbst hier draußen ist das Risiko am Tag zu groß, irgendwann entdeckt zu werden. Außerdem braucht es Strom, er darf nicht ausfallen, sonst ist die ganze Mühe umsonst«
»Die ganze Mühe?«, hakte Jakob nach. »Was meinen Sie damit?«
Jakob hatte sich immer noch nicht dazu durchringen können, Bender das Du anzubieten, und auch der Profiler siezte das gesamte Team. Vielleicht war es auch besser so, denn die Laune der anderen sank in Anwesenheit des Profilers immer recht deutlich. Daran würde auch das Duzen nichts ändern.
Max Bender studierte die Umgebung, während er sich den Schweiß vom Gesicht wischte. Er musterte das Haupthaus, dann die Scheune und den morschen Bretterzaun, der das Gelände von den Getreidefeldern abgrenzte.
»Der oder die Täter haben einen abgelegenen Hof gesucht, ich nehme an, ihr habt schon geprüft, wem er gehört.«
»Der Bank. Er ist verlassen. Seit einem Jahr.«
Der Profiler nickte.
»Es dauert, so einen Ort zu finden, das macht man nicht mal eben bei einem Spaziergang. Ich vermute sogar, dass jemand über die Räumlichkeiten Bescheid wusste. Das spricht dafür, dass unser Mann – ich vereinfache es jetzt mal, sicher bin ich mir natürlich nicht – sich ein bisschen hier auskennt. Ja, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass der Täter diesen Ort nicht zufällig gewählt hat. Wir haben es nicht mit einem durchreisenden Touristen zu tun. So, da bin ich, guten Tag, liebe Frau Weiss.«
Mila reichte Bender die Hand, sie hatte die letzten Sätze ebenfalls gehört.
»Freut mich, dass Sie hier sind, Herr Bender. Und gut, dass Sie Ihre Jacke mitgebracht haben. Da unten wird es zwar wärmer, aber es ist immer noch verdammt kalt.«
Während auch die anderen Bender mehr oder weniger freundlich begrüßten, rollte hinter ihnen der Wagen eines Bestattungsunternehmens auf den Hof. Inmitten der geblichen Felder und der Hitze des Tages wirkte das schwarze Auto vollkommen fehl am Platz, wie ein dunkler Fleck auf einer ansonsten makellosen Leinwand.
»Okay, wie komme ich runter? Ich nehme an, der kräftige Herr Salo nimmt mich huckepack?«
Bender sah den Finnen auffordernd an.
»Alle anderen haben ihre Vorzüge ja eher im intellektuellen Bereich, nicht wahr? Ich lege mein Schicksal für die nächsten Meter lieber in Ihre kräftigen Hände.«
Angesichts der unverschämten Bemerkung des Profilers verdunkelte sich Milas Miene für einen Moment, aber Tuure hatte sich offenbar auf eine solche Beleidigung vorbereitet. »Nein«, antwortete er lächelnd, »wir machen es anders, sehr geehrter Herr Bender. Ich gehe vor und Sie springen, was halten Sie davon? Ich fange Sie bestimmt auf, nachdem mein kleines finnisches Hirn den richtigen Zeitpunkt berechnet hat.«
Nur Lucys Kichern war zu hören. Max Bender funkelte Tuure an, bevor er schließlich zu der Öffnung im Boden rollte.
»Auf geht’s«, sagte er. »Meine Jacke bitte, Herr Krogh. Und sobald wir unten sind, brauche ich den Rollstuhl wieder, sehen Sie zu, wie Sie das schaffen.«
Die Teammitglieder warfen sich wissende Blicke zu, während der Profiler seine Jacke anzog. Schließlich zuckte Tuure mit den Schultern und kniete sich rücklings vor den Rollstuhl, sodass Bender seinen gewaltigen Rücken mit den Armen umschlingen konnte. Mit einem kurzen Ächzen stemmte Tuure sich hoch, Bender hing jetzt wie ein Sack an seinem Rücken.
»Ich gehe vor, falls du ihn nicht halten kannst«, sagte Jakob und stieg die Leiter hinunter, nachdem er sich, wieder mal, eine Winterjacke samt Wollmütze angezogen hatte. Kurz hatte er das Gefühl, in den warmen Sachen zu ersticken, doch dann umschloss ihn bereits die Kühle des unterirdischen Ganges. Über sich sah er Tuures gewaltigen Schatten, vorsichtig stieg der Finne Stufe um Stufe hinab, Bender auf dem Rücken.
»Der Mann mit dem Stiernacken wird mich nicht fallen lassen«, sagte Bender mit beißendem Unterton. »Weil er dann eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung am Hals hat, nicht wahr, Herr Salo?«
»Halten Sie die Klappe, sonst lasse ich Sie nachher hier unten.«
»Das würden Sie nie tun, dafür mögen Sie mich zu sehr.«
»Schluss jetzt!«
Es war Milas Stimme, die von oben schneidend durch die Kälte drang.
»Herr Bender, Sie halten die Klappe, bis wir in der Kammer sind. Tuure, du kommst zurück nach oben, wir rufen dich dann. Wenn ich noch eine Bemerkung höre, von wem auch immer, dann melde ich gleich mehrere Dienstvergehen. Wir haben einen Fall vor uns, da können wir so was nicht gebrauchen.«
Während sie Augenblicke später in der Dunkelheit auf den Rollstuhl warteten, lächelte Bender Jakob an.
»Sie ist die Härtere von Ihnen beiden. Aber ist sie auch die Bessere? Auf Dauer kann doch diese Doppelspitze keine Lösung sein, oder? Ich habe gehört, das Präsidium könnte sich ein Gehalt sparen wollen. Wird es Ihres sein? Oder das Ihrer Kollegin?«
»Halten Sie die Klappe, Bender.«
Mehr sagte Jakob nicht, auch wenn er ebenfalls von diesen Gerüchten gehört hatte. Aber sie waren ihm egal. Noch.
Wenig später, nachdem sie Bender und den Rollstuhl durch die kreisrunde Öffnung bugsiert hatten, standen sie gemeinsam in der Kammer. Björn Thomsen trug eine dicke rote Daunenjacke, aber Jakob fiel auf, dass es tatsächlich langsam wärmer wurde hier unten.
Thomsen wollte gerade mit einem Bericht anfangen, aber Mila hielt ihn zurück. Sie warteten, während Max Bender durch den Raum rollte und seinen Blick schweifen ließ. Für einen Augenblick war es still, nur das Knarzen der Räder auf dem harten Boden war zu hören. Jakob konnte sehen, dass Thomsen die Eisschicht von der rechten Wand entfernt hatte, die schwarze Schrift war jetzt gut sichtbar.
»Das ist mehr als nur ›Mühe‹«, sagte Bender schließlich. »Das alles hier ist über einen sehr langen Zeitraum hinweg geplant worden. Wer auch immer es war, er hatte es seit Längerem vor. Die ganzen Apparate, die Stromversorgung, die gesichert werden musste, die abgedichtete Tür. Das ist die Arbeit von Wochen, wenn nicht gar Monaten. Vor allem wenn man bedenkt, dass er nicht ständig hier gewesen sein kann. Das wäre zu riskant gewesen.«
»Er? Du weißt also schon, dass es ein Mann ist?«
Es war der Gerichtsmediziner, der diese Frage mit süffisantem Unterton gestellt hatte. Er kannte Bender schon lange, sie hatten oft zusammengearbeitet, sich aber nie geschätzt, und aus dieser Gleichgültigkeit war in den vergangenen Jahren eine echte Abneigung geworden.
»Mach dich nicht lächerlich, Thomsen«, herrschte Bender ihn an. »Natürlich weiß ich das nicht, woher auch? Aber wenn du willst, dass wir bei einer Mordermittlung korrekt gendern, dann schick deinen Vorschlag an die Polizeibehörde. Hier geht es um Fakten, und die haben wir noch nicht. Also lass mich meine Arbeit machen.«
»Vielleicht sagst du mir bei Gelegenheit einfach mal, was genau das bedeutet: deine Arbeit«, entfuhr es Thomsen. »Ich bin seit einer gefühlten Ewigkeit hier unten, ich würde gerne den Kollegen einen ersten Bericht abgeben und dann wieder hochgehen, zurück in die Wärme.«
Aber Bender hörte ihm schon nicht mehr zu, er war direkt vor die beiden Körper gerollt, die von der Decke hingen. Mittlerweile war die Eisschicht dünner geworden, unter den Füßen der Opfer bildete sich eine Pfütze.
»Sie hat den Kopf auf seiner Brust«, sagte Bender leise. »Sie haben bestimmt versucht, sich zu befreien.«
»Ihre Hände sind mit Kabelbindern am Rücken gefesselt«, sagte Thomsen. »Sie hatten keine Chance.«
Bender neigte den Kopf zur Seite.
»Und das haben sie irgendwann auch gemerkt. Dann haben sie aufgegeben und sich in ihr Schicksal ergeben. Sie kannten sich womöglich.«
Thomsen wartete noch einige Augenblicke, bis Bender seine Runde beendet hatte.
»Interessant« murmelte der, als er zu dem Schriftzug kam. »Das Sterben hat begonnen. Was für ein Sterben? Das Wort ist ungewöhnlich, warum benutzt er es?«
Dann rollte er noch ein Stückchen weiter an die Wand und stemmte sich in seinem Rollstuhl etwas hoch, bis er mit der düsteren Ankündigung fast auf Augenhöhe war.
»Womit hat er das geschrieben?«, fragte er Thomsen. Dessen Antwort kam prompt: »Mit Asche.«
Jakob drehte sich überrascht zum Gerichtsmediziner.
»Mit Asche?«
Thomsen nickte.
»Ja, es ist eindeutig Asche. Vermischt mit Wasser und einem Bindemittel, damit es an der Wand hält, aber ihr erkennt die einzelnen Partikel – hier und hier.«
Er deutete auf einen der Buchstaben und jetzt konnte auch Jakob die kleinen Punkte und die poröse Textur erkennen.
»Was für eine Art Asche?«, fragte Mila. »Ich meine, ist es …«
Thomsen schüttelte den Kopf.
»Falls du wissen willst, ob es die Asche eines Menschen ist – nein, ich glaube nicht.«
Max Bender betrachtete seinen Kollegen spöttisch.
»Soweit ich weiß, hinterlässt die Verbrennung eines Menschen keine DNA-Spuren, oder habe ich da etwas verpasst, Thomsen?«
Thomsen antwortete mit einem alarmierend genervten Unterton: »Schön, dass du dich im Internet weiterbildest, Bender. Nein, tut sie tatsächlich nicht. Aber unsere Knochen enthalten viel Kalk, weshalb die Asche eines Menschen sehr hell ist. Diese hier ist dunkler. Wir haben es also womöglich mit simpler Asche aus einem Kamin zu tun, wobei es sehr viel feine Asche braucht, um damit zu schreiben.«
»Also kein kleiner Kachelofen«, bemerkte Jakob, bevor er Bender ansah.
»Was sind Ihre ersten Gedanken?«
Der Profiler rollte durch den Raum, sein Atem war trotz der etwas weniger frostigen Temperaturen als helle Wolke sichtbar.
»Die Schrift … Er wollte, dass seine Opfer sie sehen.«
»Stellt euch das vor«, murmelte Mila, »sie hängen dort und lesen das. Es ist eine zusätzliche Grausamkeit, weil sie wissen, dass sie auf jeden Fall sterben werden.«
»Das Sterben hat begonnen«, murmelte Bender und betrachtete die Schrift, die für ihn interessanter zu sein schien als die beiden tiefgefrorenen Körper.
»In erster Linie galt diese Botschaft aber vermutlich nicht den beiden Opfern.«
»Sondern?«
Die Frage kam von Thomsen, was dazu führte, dass Bender sich ein Augenrollen nicht verkneifen konnte.
»Sie galt uns. Die Botschaft ist an jene gerichtet, die die Leichen finden und die mit den Ermittlungen beginnen werden, und das sind nun mal wir, nicht wahr, Herr Krogh? Wer auch immer hierfür verantwortlich ist, hinterlässt uns die Botschaft, dass das Sterben begonnen hat. Diese Kältekammer wurde akribisch vorbereitet und die Tat von langer Hand geplant – ich fürchte, das, was folgen wird, ist schon in vollem Gange. Hier hat jemand seinen ersten Zug gespielt, so würde ich es mal vorsichtig formulieren.«
»Ein Spiel?«, fragte Mila. Aber Bender schüttelte den Kopf.
»Ich würde es anders bezeichnen. Vielleicht … als eine Herausforderung.«
Es entstand eine nachdenkliche Pause. Schließlich deutete der Gerichtsmediziner auf die beiden Opfer.
»An den Handgelenken kann ich durch die Eisschicht hindurch leichte Verletzungen erkennen«, setzte Thomsen seinen Bericht fort. »Vermutlich selbst zugefügt beim Versuch, sich zu befreien. Aber in einer solchen Situation hat man keine Chance, die Beine waren ebenfalls zusammengebunden. Sie hatten keine Möglichkeit zu entkommen.«
»Und sind hier einfach erfroren«, murmelte Mila.
Jakob blickte sich im Raum um, betrachtete die Kühlgeräte an der Wand und den Hocker, der womöglich dazu benutzt worden war, das Paar an der Decke aufzuhängen. Der Hocker, auf dem vor einigen Stunden auch Mila gestanden hatte. Der Gerichtsmediziner folgte Jakobs Blick hinauf zu dem Haken.
»Es ist mühsam, einen Körper dort hochzuwuchten, geschweige denn zwei. Ich habe einige Zeit gebraucht, um zu verstehen, wie unser Täter es gemacht hat. Und dabei hat das hier geholfen.«
Thomsen zog ein Nylonseil aus einer Plastiktüte. Es war gerade so dick wie ein kleiner Finger, wirkte jedoch sehr belastbar.
»Das lag in einer Ecke. Er muss es über den Haken geworfen haben, um die Körper daran hochzuziehen. Ich wette, dass ich einen Abrieb von dem Seil am Tragegurt finde, den er ihnen angelegt hat. Er hat sie hochgezogen und an einer Verlängerung des Gurtes am Haken festgemacht. Dieses Seil hat er dann wieder gelöst und abgelegt.«
»Warum hat er es nicht mitgenommen?«, fragte Jakob. »Hier im Raum ist sonst nichts, er hat alles mitgenommen, keine Spuren hinterlassen. Nur das Seil.«
Er und die anderen sahen zu Bender, der nachdenklich die beiden Leichen betrachtete. Als er die erwartungsvollen Blicke bemerkte, zuckte er grimmig mit den Schultern.
»Was schaut ihr mich an? Ich habe keine Ahnung, es kann viele Gründe dafür geben und etwas Konkretes kann ich dazu wirklich nicht sagen. So einfach ist es nämlich nicht, tut mir leid. Für den Moment kann ich nur sagen, dass das hier eine verdammte Inszenierung ist. Von langer Hand geplant, minutiös durchgeführt und kaltblütig beendet. Und es wird euch nicht überraschen, wenn ich sage, dass wir uns bald an einem ähnlichen Ort wiedersehen werden.«
»In einer Kältekammer?«, fragte Mila überrascht, aber Bender schüttelte den Kopf.
»Ich weiß nicht warum, aber ich glaube es nicht. Es geht hier um Inszenierung, und die ist auf viele Arten denkbar. Nein, ich glaube, wir haben es mit jemandem zu tun, der diese beiden Menschen nicht nur umbringen wollte, er wollte auch eine Botschaft senden: Seht her, so weit kann ich gehen und noch viel weiter. Das ist das, was ich aus der Situation hier unten herauslese.«
Bender wartete kurz, dann rollte er in Richtung Ausgang und drehte sich zu ihnen um.
»Unser Mann hat sie nicht geknebelt, oder?«
Thomsen schüttelte den Kopf.
»Dann waren sie anfangs vermutlich betäubt oder zumindest außer Gefecht gesetzt. Er hat sie hier aufgehängt, hat alles hergerichtet und ist dann womöglich gegangen, in aller Ruhe. Er hat die Tür zugezogen und sie ihrem Schicksal überlassen.«
»Vielleicht hat er gewartet, bis sie wieder zu sich gekommen sind?«, fragte sich Mila. »Er wollte sie vielleicht schreien hören, wollte, dass sie betteln. Geht es nicht meistens darum? Die Macht, die er hat über das Leben und den Tod – er hätte es auskosten können, es hinauszögern?«
Bender schüttelte den Kopf, während er sich umblickte.
»Nein, das glaube ich nicht. Dafür ist es hier auch schlicht zu kalt, es ist kein Ort, um jemandem beim Erfrieren zuzusehen.«
Der Gerichtsmediziner nickte.
»Bei den Temperaturen hatten sie vielleicht eine Stunde … maximal zwei.«
»Und das Ganze ist ja eher unspektakulär, der Tod an sich, meine ich«, fuhr Bender fort. »Kein Blut, ihr Schreien hat niemand gehört, der Kampf ums Überleben dauerte nicht lang angesichts der Kälte – nein, hier gab es wenig zu sehen, und deshalb glaube ich auch, dass unser Mann einfach gegangen ist.«
Er sah Jakob an.
»Es lässt mich an einen Lagerarbeiter denken, im Kühlbereich eines fleischverarbeitenden Betriebs: Die Ware wird gebracht, aufgehängt, fertig. Keine Emotionen, eine einfache Abfolge.«
»Er hat sie vielleicht nicht mal als Menschen betrachtet«, überlegte Mila. »Sondern tatsächlich eher als Ware. Zwei Fleischstücke, die zum Kühlen aufgehängt werden.«
»Und dann werden die nächsten geholt?«, fragte Jakob in die Runde.
Für einen kurzen Moment sagte keiner etwas. Jakob wollte sich das gar nicht ausmalen: zwei verzweifelte, sterbende Menschen, gefesselt und der Kälte ausgeliefert. Und das Letzte, was sie gesehen und gehört hatten, war ein Schatten, der sich entfernte, ohne sich noch mal umzusehen. Der die Tür schloss, sie verriegelte und dessen Schritte sich langsam entfernten.
Und dann war es still geworden um sie herum. Für immer.
»In der Anzeige ist von einer ersten Trauerfeier die Rede«, sagte Mila. Bender nickte und fuhr sich angestrengt über die Stirn.
»Ja, er hat nicht geschrieben: die Trauerfeier, sondern: die erste. Das ist ein großer Unterschied.«
»Wie interpretieren Sie das?«, wollte Jakob wissen.
Bender rieb sich jetzt die Hände, er zitterte sichtlich.
»Es bedeutet zum einen natürlich, dass es womöglich eine zweite geben wird – mindestens. Wir haben es mit jemandem zu tun, der weiteres Sterben ankündigt. Und gleichzeitig – aber das ist nur ein erster Gedanke – könnte es bedeuten, dass das Sterben begrenzt ist. Es stehen nicht unendlich viele Trauerfeiern bevor, sondern eine bestimmte Anzahl. Denn jedes Trauern endet einmal. Das ist sicher noch keine sattelfeste These. Aber das Ganze wirkt auf mich wie ein Plan, den der Täter bis zum Ende perfekt durchdacht hat. Und vielleicht ist das ja ein kleiner Trost: dass es ein Ende geben wird.«
»Aber wann?«, fragte Jakob. »Gibt es drei Trauerfeiern? Vier? Fünfzehn?«
Bender lächelte schmal.
»Das herauszufinden, lieber Kollege Krogh, ist unsere Aufgabe. Oder besser gesagt: Ihre. Und jetzt sollten wir hochgehen. Unsere Fragen haben wir hier unten gestellt. Die Antworten darauf finden wir nur dort oben.«
4
Stefan Häusler war warm.
Die Sonne schien durch die großen Fenster, und obwohl die Kellner des Cafés die Rollos zur Hälfte heruntergezogen hatten und große Ventilatoren an der Decke surrten, war es stickig.
Er nahm einen Schluck Wasser, ohne Kohlensäure, und trank das Glas schließlich in einem Zug leer. Nervös spielte er mit seinen Fingern, die Hände mal auf der Tischplatte, mal im Schoß.
Und dann sah er sie.





























