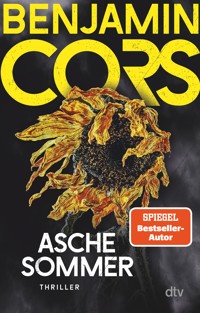Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nicolas Guerlain ermittelt
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie mit Benjamin Cors die dunkle Seite der Normandie In Vieux-Port regiert die Angst: Die Bewohner des Ortes fürchten einen alten Fluch, der ihnen den Tod in den Fluten der Seine voraussagt. Als es ein erstes Opfer gibt, bittet der Bürgermeister Nicolas Guerlain um Hilfe – aber der lehnt ab. Bis wieder eine Leiche auftaucht: Der Pfarrer ist qualvoll in einer Wanne voller Flusswasser ertrunken. Nicolas reist in die Normandie und streift rastlos durch die stillen Gassen von Vieux-Port. Doch der Personenschützer tappt lange im Dunkeln, bis es endlich ein heiße Spur zu geben scheint. Eine fieberhafte Jagd beginnt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Nicolas ist krank vor Sorge. Julie steht im Zentrum eines aufsehenerregenden Strafprozesses. Bei einem Polizeieinsatz in der Banlieue hat sie vor Jahren eine junge Frau erschossen. In Notwehr, beteuert sie. Aber ihr Wort steht gegen das ihres Kollegen. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich. Verzweifelt kämpft Nicolas darum, Julies Unschuld zu beweisen. Da spricht ihn ein Fremder auf der Straße an und bittet ihn um Hilfe. Eindringlich erzählt der Mann von Fluch und Heimsuchung, von einem Dorf in Angst im Hinterland der Normandie. Aber Nicolas lehnt ab. Selbst wenn er wollte: Wie, um Himmels willen, könnte er ein ganzes Dorf beschützen? Erst als der Tod den kleinen Ort am Seine-Ufer befällt wie eine ansteckende Krankheit, macht Nicolas sich auf die Reise … »Eine spannende und komplexe Geschichte, die zudem die Schönheit der Normandie und die Besonderheit der Bewohner mit einfängt. Gute Unterhaltung ist hier garantiert.« www.der-kultur-blog.de
Von Benjamin Cors sind bei dtv außerdem erschienen:
Küstenstrich
Gezeitenspiel
Schattenland
Flammenmeer
Benjamin Cors
Leuchtfeuer
Ein Normandie-Krimi
Well I stepped into an avalanche,
it covered up my soul.
Leonard Cohen
Sandown, Isle of Wight
Südengland
Ihr Name war Ayleen und sie war die letzte Überlebende. Ihm war immer klar gewesen, dass er sie auswählen würde, von Anfang an. Seit er beschlossen hatte, dass es nun genug war. Nicht Henriette oder Samira. Auch nicht Violet, obwohl sie am kräftigsten war und sich bei der Witterung dort draußen womöglich am besten schlagen würde. Nein, ihm war nie eine andere als Ayleen in den Sinn gekommen.
Sie oder keine.
Vielleicht, weil sie verlässlich war und weil ihr gutmütiger Blick ihn immer schon berührt hatte. Weil er ihre eisgraue Farbe so sehr liebte und das schillernde Grün an ihrem Hals und weil sie nie zurückgewichen war, wie die anderen, wenn er seine Hand nach ihr ausgestreckt hatte.
Und nun war es entschieden und Ayleen war bereit. Sie musste es auch sein, er brauchte sie mehr denn je. Es war eine furchtbare Nacht und sie würde anders enden, als er gehofft hatte.
Sanft streichelte er über ihr Gefieder, liebkoste mit seinen zitternden Fingern ihren Hals und ihre Brust, umfasste sie behutsam, er spürte ihr kleines Herz schlagen. Ihre Flügel schlugen kurz aus, als draußen der Wind durch die kahlen Bäume fuhr.
Es war stürmisch, Ayleen würde all ihre Kraft brauchen.
»Du schaffst das schon«, flüsterte der alte Mann in der Dunkelheit des Taubenschlages. »Du musst es einfach schaffen.«
Und fast schien es ihm, als würde die Taube nicken, als würde Ayleen ihm ein Zeichen geben, dass er sich keine Sorgen zu machen brauchte.
Alles würde sich richten.
Henriette und Samira und Violet und die anderen sieben Tauben lagen tot auf dem Boden.
Er hatte ihnen kurzerhand den Hals umgedreht, weil er nicht wusste, was er sonst hätte tun sollen, wohin er sie hätte geben können in dieser Nacht. Mit seinen Händen, in denen die Gicht seit Jahren arbeitete, hatte er ihnen ein paar Brotkrumen hingehalten, und als die Vögel zufrieden gurrten, da hatte er ihnen nacheinander den Hals umgedreht.
Einfach so.
Es war viel leichter gewesen, als er gedacht hatte. Noch nicht mal ein kleinstes Knacken war zu hören gewesen, als ihre Knochen und Muskelstränge nachgaben, und er hatte gedacht, dass das ein schöner Tod sein musste; beim Essen sterben, wenn man es am wenigsten erwartet.
Der Gedanke war ihm Trost gewesen, und zum ersten Mal in dieser Nacht hatte er kurz gelächelt. Und beschlossen, dass es nun wirklich gut war.
Es gab nur noch ihn. Und Ayleen, die sich zu freuen schien, dass er ihr einen kleinen Käfig hinhielt, in den sie mit leisem Gurren hineinschlüpfte. Sie war die Letzte und sie würde dieser Nacht doch noch einen Sinn geben. Sie würde aus dem Ende einen Anfang machen.
»Alles wird gut, Ayleen«, sagte der alte Mann mit gebrochener Stimme und richtete sich auf, den Käfig fest in der Hand. Sein Rücken schmerzte, der Taubenschlag war nicht besonders groß, er hatte die vergangene Stunde in gebückter Haltung verbracht.
»Verdammtes Alter«, fluchte er leise und knipste die kleine Lampe aus, die neben der Tür des Bretterverschlages angebracht war. Er blinzelte, seine Augen suchten im Halbdunkel nach einem Anhaltspunkt. Der hintere Teil des Gartens lag im Schatten der Rotbuchen, die hier im Süden des Landes in vielen Gärten standen. Eine einzelne Schneeflocke trudelte vor ihm durch die eisige Luft, weitere folgten, lautlos, als Vorboten eines Winters, der zu früh über die Insel kam. In der Ferne hörte er die Brandung, die Wellen schoben sich gegen die Klippen, wie sie es schon immer getan hatten.
»Komm schon, Ayleen«, sagte er und blickte den Vogel in seinem Käfig an. »Ich weiß, es ist kalt und ungemütlich heute Abend, aber du darfst nach Hause. Was hältst du davon?«
Die Taube tippelte hin und her, sie reckte erwartungsvoll den Hals, wie immer, wenn sie fliegen durfte. Ihr Heimatschlag war nicht hier, in jenem Teil seines Gartens, wo die Schatten der Bäume kaum Licht hinließen. Sondern fern von hier, dort, wo sich jemand anderes um Ayleen kümmerte.
Jemand, dem der alte Mann vertraute wie kaum einem anderen Menschen.
Und dem er gleichzeitig misstraute wie kaum einem anderen Menschen.
»Ist das möglich, Ayleen?«, murmelte er, als er an den Menschen dachte, zu dem sie fliegen sollte. »Vertrauen und Misstrauen zu gleichen Teilen?«
Die Taube blieb stumm und blickte ihn an, als wartete sie auf das, was er als Nächstes sagen würde.
»Gut und böse«, sagte er und sein Atem blieb in der kalten Luft hängen. »Freude und Angst, geht das zusammen, deiner Meinung nach? Ich meine, kannst du dir vorstellen, jemand zu gleichen Teilen zu lieben und zu hassen, ihn gar zu verabscheuen?«
Der alte Mann machte einige Schritte über den gefrorenen Rasen und stieg über die verfaulten Äpfel eines längst aufgegebenen Obstbaumes.
»Das Leben ist seltsam, Ayleen«, fuhr er fort, als würde er mit sich selbst reden. »Der Tod natürlich auch. Aber das ist dann nicht mehr so wichtig, was meinst du?«
Mit dem Käfig durchschritt er einen kleinen Kräutergarten, den keiner mehr nutzte, seit sich die Krankheit leise und hinterhältig in ihr Leben geschlichen hatte. Er dachte an seine Frau, die reglos in ihrem Schlafzimmer lag, weil diese Nacht ihr den letzten Atemzug genommen hatte, mit kalter, unnachgiebiger Hand. Und er hatte dabei zugesehen und geweint und an eine Taube gedacht und an das, was nun kommen würde.
Als er die kleine Hintertür des Bauernhauses erreichte, stellte der alte Mann den Käfig mit Ayleen auf einen Gartentisch und zündete eine Kerze an, die er in ein Windlicht stellte. Dann setzte er sich auf einen Stuhl und blickte forschend in die Dunkelheit, als würden sich die Schatten der Vergangenheit und Zukunft darin verbergen.
Im schwachen Schein der Kerze betrachtete er seine knochige Hand, seinen glänzenden Ehering.
Wie bereits so oft im Laufe dieser Nacht.
Ayleen gurrte, als wollte sie ihm Mut zusprechen. »Du hast recht, Ayleen. Aber gib mir noch eine Minute, ja?«
Der Blick des alten Mannes wanderte durch den Garten, die Hecke entlang, bis zur Grundstücksgrenze. Dahinter wohnten die Ashburys, Tom und Helen, aber ihr Haus war weit genug entfernt. Über ihm fuhr der Wind durch das reetgedeckte Dach, seit Jahren hatte ihm seine Versicherung dazu geraten, das Dach zu erneuern und endlich mit ordentlichen Ziegeln decken zu lassen.
Aber er und seine Frau hatten dieses Haus auch aufgrund eben dieses Reetdaches so sehr geliebt, sie hatten dem Makler damals schon an der Haustür zugesagt, ohne es von innen gesehen zu haben. Weil sie gewusst hatten, hier würden sie wieder glücklich sein.
Ayleens Gurren holte ihn zurück in den dunklen Garten, der alte Mann fuhr sich müde durchs Gesicht.
»Also gut.«
Langsam stand er auf.
»Ich bin gleich wieder da, Ayleen. Einmal noch gehe ich rein, dann müssen wir wirklich los.«
Auch drinnen brannte kein Licht, nur eine Kerze, die seine Frau angezündet hatte und von der er genau wusste, wann sie abgebrannt sein würde.
Ihm blieb nicht viel Zeit.
Langsam tastete er sich durch einen kleinen Flur, er spürte die Kälte, die durch das Gemäuer kroch, spürte den Winter, der nach den Menschen griff, nach den Lebenden und den Toten. Als er die große Diele erreichte, bemerkte er den beißenden Geruch, aber er störte ihn nicht mehr. Er musste kein Licht anmachen, hier im Haus hätte er sich mit geschlossenen Augen zurechtgefunden. Mit den Fingern strich er über den großen Tisch, über die Stühle und über eine Kommode, auf der ein Bild aus besseren Zeiten stand.
Durch das Fenster in der Eingangstür sah er die Umrisse der Bäume, windzerzaust und schwankend, sah, wie der Schnee nun immer dichter fiel.
Und Licht. Er blinzelte, aber es war tatsächlich da. Ein schwaches Glimmen, die erste Ahnung eines neuen Tages. Die Eingangstür ging nach Osten, dorthin, wo der Tag erwachte.
Aber das war nun bedeutungslos. Er trat über die Schwelle des Schlafzimmers, wo der Geruch am stärksten war und die Nacht am dunkelsten. Vorsichtig, als könnte er sie stören, machte er ein paar Schritte hin zu ihrem Bett. Eine Diele knarzte, so wie sie es immer getan hatte, schon als sie eingezogen waren. Seine Frau hatte immer gehört, wenn er frühmorgens aufgestanden war, um nach den Tauben zu sehen. Sie hatte etwas gemurmelt und sich dann wieder umgedreht. Und er war hinaus in den neuen Tag geschlichen.
Vorsichtig setzte er sich auf die Bettkante und atmete tief durch. Er hörte das Gebälk über sich knarzen, durch die dünnen Fensterscheiben drang der Wind.
Sie war wunderschön, immer noch. Gezeichnet, ja, aber nicht verblasst. Ihr langes Haar war zu einem dicken Zopf geflochten, so wie sie es gewollt hatte. Er hatte sie geschminkt, ihr Haar gebürstet und dabei geweint.
Sie hatte gelächelt.
»Sag es ihm nicht«, hatte sie gebeten. Und das waren ihre letzten Worte gewesen. Und er hatte gewusst, dass er anders entscheiden würde.
Er hatte sie nie betrogen, sie nie angelogen, ein Leben lang. Aber nun, wo sie tot war, würde er sie hintergehen. Für jemanden, dem er so sehr vertraute. Für jemanden, dem er so sehr misstraute.
Er konnte nicht anders.
Er zog die Nachttischschublade auf und nahm einen Zettel und einen Stift heraus. Und im Schein der einzigen Kerze im Haus begann er zu schreiben. Es waren nur wenige Sätze, aber ihm war bewusst, welches Unheil sie anrichten würden.
Trotzdem schrieb er sie, und als er fertig war, rollte er den Zettel zusammen und band ein Gummiband darum.
Er war so weit.
»Es tut mir leid«, flüsterte er und setzte sich zu seiner Frau. Sie hatte die Hände wie im Gebet verschränkt, ihr Gesicht war friedvoll. Die Krankheit hatte ihr jahrelang zugesetzt, aber nun, da sie gesiegt hatte, hatte sie seiner Frau ein friedliches Ende gegönnt. Er beugte sich über sie, und als er sie auf die Stirn küsste, rannen seine Tränen über ihr Gesicht. Liebevoll strich er ihr eine Haarsträhne zur Seite und zog die Bettdecke ein bisschen höher. Sie sollte nicht frieren.
Sein Blick fiel auf die Kerze, die fast abgebrannt war, und mit einem Ruck zwang er sich aufzustehen und aus dem Zimmer zu gehen, ohne sich umzublicken.
Die Nacht ging zu Ende, ein neuer Tag stand vor der Tür. Und Ayleen würde der Sonne entgegenfliegen.
Entschlossen, den Weg zu Ende zu gehen, den er eingeschlagen hatte, trat er aus dem Haus. Er wunderte sich, dass seine Finger zitterten, als er den Käfig öffnete und behutsam den kleinen Zettel an Ayleens Fußring befestigte. Offenbar war er doch aufgeregter, als er sich eingestehen wollte. Die Taube gurrte und pickte vorsichtig nach seiner Hand, diese Berührungen gaben ihm Kraft. In seinem Rücken ging die Sonne auf, immer mehr Licht drang in den Garten, auf dem Reetdach glitzerte der Schnee. Die Schatten zogen sich zurück.
»So, geschafft.« Seine Stimme klang jetzt fest, und während er den Rücken durchstreckte, lächelte er für einen kurzen Augenblick.
»Ich wünschte, ich könnte mit dir kommen.« Mit einem Seufzen strich er der Taube über das Gefieder.
»Na, komm«, sagte er schließlich, schloss den Käfig und hob ihn vom Tisch herunter. Mit den Fingern seiner linken Hand streifte er das Mauerwerk, als er das Haus umrundete und nach vorne Richtung Straße lief. Wo in der Dämmerung das Meer wartete, dort, wo das Land endete und der Ärmelkanal begann.
Als der alte Mann das Gartentor öffnete und hinaus auf die Straße trat, sog er die kalte Luft ein. Kurz setzte er den Käfig ab, um seine Jacke zuzuziehen.
»Du musst schnell fliegen, Ayleen. Dann wird dir auch warm, flieg nur schnell genug.«
Niemand war zu sehen, das Dorf lag noch im Tiefschlaf. Der Milchmann würde erst in einer halben Stunde seine Runde machen, die alte Dorothy etwas später ihren alten Cockerspaniel ausführen. Die Straße lag ruhig da, die wenigen Laternen brannten noch, ihr Lichtschein spiegelte sich auf dem feuchten Asphalt, der nach und nach von Schnee bedeckt wurde. Er blickte hinüber zu der Hecke, an der ein schmaler Pfad entlangführte.
»Nun denn.«
Mit festem Schritt folgte er dem Pfad, der nach etwa hundert Metern nach rechts abbog und in die Felder führte. Er ließ die Siedlung Yaverland hinter sich und lief parallel zur Küste, leicht bergan. Die Herbstsonne schickte sich an, der Insel und der Küste einen schüchternen Besuch abzustatten. In seiner Hand schaukelte der Käfig, Ayleen schien zu ahnen, dass ihr Ausflug nun bald begann. Er hatte sie noch nie von den Felsen von Culver Down aufgelassen, sondern stets von seinem Taubenschlag aus. Und wenn er sie Wochen später drüben auf der anderen Seite des Kanals wieder abgeholt hatte, dann hatte sie geduldig auf ihn gewartet und ihm Brotkrumen aus der Hand gepickt.
Als er kurz darauf eine kleine Anhöhe erreichte, merkte er, dass der Wind nachgelassen hatte und dass kein Schnee mehr fiel. Es war still, für einen Augenblick war nichts außer dem Anbranden der Wellen zu hören.
Und als er sich umdrehte, konnte er das Feuer sehen.
Stumm blickte der alte Mann hinab auf Sandown, auf seine Straße und sein Haus, aus dessen Fenstern hohe Flammen schossen. Er setzte den Käfig auf dem Boden ab und sah zu, wie sein Leben im Feuer aufging. Nichts würde übrig bleiben, so hatten sie es verabredet. Sie war längst fort, ihr Geist war gegangen und alles andere ging nun in Flammen auf. Das Schlafzimmer und die breite Diele, der große Tisch und das Bild auf der Kommode.
Sie hatte die Kerze selbst angezündet, er hatte ein mit Benzin getränktes Tuch um den Stumpf gewickelt und durchtränkte Bettlaken daneben, während sie im flackernden Schein noch einmal ihre größte Bitte ausgesprochen hatte, leise und eindringlich.
»Sag es Mathieu nicht.«
Er würde es ihm nicht sagen. Das würde Ayleen übernehmen.
Die Kerze hatte zuerst die Bettdecke entzündet, dann das Holzgestell, die Dielen und die schweren Vorhänge. Dass es schnell ging, dafür hatte das Benzin gesorgt, das er in rauen Mengen überall im Haus ausgeschüttet hatte. Die Flammen waren die Wände hinaufgekrochen, hatten sich ausgebreitet, die Küche erobert und sich schließlich in das Reetdach gefressen.
Und von da an ging alles sehr schnell. Genau, wie sie es geplant hatten.
Als er drüben am Flughafen Blaulicht sah und Sirenen vernahm, drehte er sich um und nahm den Käfig wieder in die rechte Hand.
»Alles gut, Ayleen«, sagte er, als der Vogel kurz aufflatterte. »Wir haben es gleich geschafft.«
Und während in seinem Rücken eine dunkle Rauchsäule in den fahlen Morgenhimmel aufstieg, schritt er voran, den Hügel hinauf, dorthin, wo er die Taube fliegen lassen konnte.
Die Horseshoe Bay war nur wenige Meter von der Culver Down Battery entfernt, einer kleineren Festung aus dem 2. Weltkrieg, die heute ein Anziehungspunkt für die Touristen auf der Insel war. Noch aber lagen die Felsen und die gesamte Küste verlassen vor ihm. Er blickte auf das Meer hinaus, das ihm in schweren Stunden stets ein Trost gewesen war.
Heute jedoch spürte er beim Anblick der Wellen und des weiten Horizontes nichts mehr. Er hatte seine Gefühle dort gelassen, in den Flammen, die dabei waren, ihr Haus aufzufressen. Daran würde auch die wie immer zu spät anrückende Inselfeuerwehr nichts ändern.
»Geschafft, Ayleen«, murmelte er, als sie den höchsten Punkt der Anhöhe bestiegen hatten. Von hier aus konnte er den Sandhill Holiday Park sehen und das Bembridge Fort. Und die Brandung, die zehn Meter unter ihm gegen die Felsen schlug. Die Kälte kroch ihm in die Glieder und er zitterte.
Langsam öffnete er den Käfig und holte den Vogel heraus. Ayleen wand sich zuerst etwas in seinen Händen, auch sie zitterte, sie war das Fliegen bei einer solchen Kälte nicht gewohnt. Doch dann drehte sie ihr Köpfchen rasch nach rechts, in Richtung ihres Heimatschlags, wohin der alte Mann sie nun fliegen lassen würde. Mit einer Botschaft, die er nicht hätte schreiben sollen.
Und die ihm doch so wichtig war.
Behutsam strich er über das eisgraue Gefieder, beruhigte das Tier mit den Händen.
»Du darfst nach Hause«, murmelte er. »Flieg einfach geradeaus, lass dich nicht ablenken von Wind und Schnee. Immer nur geradeaus. Du kennst den Weg.«
Die Rauchsäule hinter ihnen wurde dichter, das Reetdach musste bereits lichterloh brennen. Eine Schneeflocke setzte sich auf seine Hand, er betrachtete sie, als sie rasch dahinschmolz.
Und dann, als er die Tränen spürte, die über seine Wange liefen, als er aufschluchzte, weil er den letzten Willen seiner Frau tatsächlich ignorieren würde, da öffnete er seine Hände und ließ den Vogel frei.
Und Ayleen, die letzte Überlebende, schwang sich hinauf in die kalte Luft und der Wind über dem Wasser griff nach ihr, schleuderte sie hinauf und brachte sie schwankend auf Kurs.
Und der alte Mann beschloss, dass auch er nun aufbrechen musste. Er hatte genug gehadert, genug gezögert, der Lauf der Dinge ließ sich nicht mehr aufhalten.
Er schloss die Augen und saß noch einmal auf seinem alten Stuhl hinten im Garten, seine Frau stand hinter ihm und flüsterte ihm ins Ohr, während er die Tauben fütterte.
Die Sonne wärmte seinen Rücken.
»Es ist schön mit dir«, sagte sie.
»Es ist gut mit uns«, sagte er.
Und mit diesem Bild im Kopf trat er an den Rand der Klippe. Weiter vorne flog Ayleen eine letzte Schleife über der Küste, bevor sie nach Osten abbog.
»Adieu, kleine Taube«, murmelte er.
Langsam ließ er sich nach vorne fallen, ohne Furcht und ohne Gram. Denn was auch immer Ayleens Ankunft auslösen würde, ihn betraf es nicht mehr. Er spürte die Schwerkraft, die nach ihm griff, den Wind in seinem Gesicht, der seine Tränen trocknete.
»Bis gleich«, dachte er und es war ein schöner Gedanke.
Das Letzte, was er sah, waren die ersten Strahlen der Morgensonne, die über das Wasser tanzten, als wollte der neue Tag ihn überreden, doch noch ein bisschen zu bleiben.
Aber er wollte nicht.
Er wollte nur noch, dass diese kleine Taube ihren Weg fand.
Nach Hause.
In die Normandie.
Teil eins
TAUBE
Kapitel 1
Paris
Zwei Wochen später
Nicolas Guerlain beobachtete die Frau seit zehn Minuten. Irgendetwas war an ihr, das sein Interesse weckte. Sie trug einen dunklen, knielangen Faltenrock über grauen Strumpfhosen und an den Hacken abgewetzte Schuhe. Ihr graues Haar war in einem Dutt zusammengefasst und unter den Ärmeln ihrer Strickjacke schaute das Weiß einer Spitzenbluse hervor.
Ihren Blick hatte sie nicht vom Marmorboden gelöst, seit sie sich ihm gegenüber auf die andere Seite des weitläufigen Vorraumes gesetzt hatte. Reglos lagen ihre Hände in ihrem Schoß.
Durch die bodentiefen Fenster in Nicolas’ Rücken fiel das gleißende Licht eines überraschend hellen Tages in den Raum, er konnte die Geräusche von draußen, von der Place Dauphine hören. Nicolas fiel ein Lied ein, das Tito, sein alter Nachbar, so sehr mochte und das er nur zu gerne morgens um fünf auf seinem Balkon zum Besten gab, unbeeindruckt von den Flüchen der Nachbarn und den lautstarken Protesten herumstreunender Kater.
Es war fünf Uhr, Paris erwachte. Und er dachte an jenen Kronprinzen der Place Dauphine, den Jacques Dutronc besang.
Ein neuer Tag begann, das Spiel des Lebens ging weiter.
Er schätzte die Frau auf Mitte sechzig, aber ihr graues Haar mochte ihn täuschen. Obwohl er sich für gewöhnlich selten täuschte, jedenfalls nicht bei Menschen, die er flüchtig traf und die sein Interesse weckten, die er im Auge behielt, absichtlich oder unbewusst. Weil Beobachten sein Job war, vermutlich sogar mehr als das.
Nicolas blickte auf seine Uhr.
Vor einer halben Stunde hatte sein Team ihn auf dem Rückweg vom Flughafen hier abgesetzt. Sie waren mit François Faure, dem gerade neu gewählten Staatspräsidenten, in London gewesen, bei den Verhandlungen über die Neuordnungen der Wirtschaftsbeziehungen im Rahmen des Brexit-Abkommens. Es waren lange Nächte gewesen, vor verschlossenen Türen und neben leergeräumten Büffets.
Irgendwann hatte Faure beschlossen, ein Zeichen zu setzen, indem er abreiste, und ausnahmsweise war ihm Nicolas dafür dankbar gewesen.
So war er doch noch pünktlich zurück gewesen, hier an der Place Dauphine, auf der Île de la Cité, im Herzen von Paris. Den Termin seiner Vernehmung zu verschieben, hätte Konsequenzen gehabt – und das nicht nur für ihn, sondern für die Person, die dort hinter der geschlossenen, hohen Eichentür auf der Anklagebank saß.
Und die ihn mehr brauchte als je zuvor.
»Entschuldigung, darf ich mich zu Ihnen setzen?«
Nicolas schreckte auf. Tief in Gedanken, hatte er nicht mitbekommen, wie die Frau sich von ihrem Platz erhoben und zu ihm getreten war. Jetzt stand sie vor ihm und lächelte schüchtern. In der rechten Hand hielt sie ihre braune Handtasche, in der linken Armbeuge hing ihr Wintermantel.
Nicolas sah, dass ihr Lippenstift an den Mundwinkeln leicht verwischt, dass ihr Blick zwar freundlich, aber müde war. »Natürlich, setzen Sie sich doch«, antwortete er schließlich und rutschte in der Bank zur Seite.
»Ich wollte mir gerade ein Glas Wasser holen. Darf ich Ihnen eines mitbringen?«
»Sehr gerne«, sagte die Frau mit ihrer leisen Stimme und Nicolas stand auf und ging hinüber zu einem Beistelltisch mit Wasser und Kaffee, der offenbar für Wartende vorgesehen war. Sie lächelte ihm freundlich zu, als er sich wieder zu ihr setzte und ihr eines der beiden Gläser reichte. Hinter seinen Augen tobte Müdigkeit, er spürte, wie sie jeden Winkel seines Kopfes einzunehmen drohte.
Dringend müsste er mal wieder durchschlafen, allein, es gelang ihm nicht.
»Kennen wir uns von irgendwoher? Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor.«
»Nein, wir kennen uns nicht.«
»Seltsam. Ihr Gesicht … es ist, als hätte ich es schon einmal gesehen.«
Unverhohlen musterte sie ihn. »Einen schönen Anzug tragen Sie. Ich mag Männer in dunklen Anzügen, sie sehen so … glaubhaft aus.«
Nicolas schmunzelte.
»Ich versichere Ihnen, Madame, die am wenigsten glaubhaften Männer sind immer jene in besonders guten, dunklen Anzügen.«
Sie nippte an ihrem Glas, während sie beide zu der schweren Eichentür hinüberblickten. Außer ihnen war niemand in dem Wartesaal, der die gesamte Front des Hauptgebäudes einnahm.
»Sie würden sich also nicht als glaubhaft bezeichnen, Monsieur?«, fragte die Frau ihn schließlich leise und Nicolas hob überrascht eine Augenbraue.
Er überlegte kurz.
»Das hängt wohl davon ab, was Sie unter glaubhaft verstehen wollen«, sagte er schließlich.
Die Frau drehte sich zu ihm und lächelte.
»Für mich steckt das Wort ›glauben‹ darin«, sagte sie.
»Für mich das Wort ›Haft‹«, antwortete Nicolas.
Sie hob ihr Wasserglas.
»Womit wir hier genau richtig wären.« Sie deutete hinüber zu der Tür.
»Ein Jammer, dass ich zu spät gekommen bin. Jetzt muss ich warten, bis einer der Besucher hinausgeht. Ich hoffe, das ist bald der Fall. Dieser Prozess ist spannend, finden Sie nicht?«
Nicolas blickte hinauf zur Decke. Das sogenannte Vestibule du Harlay war mit Stuck und goldenen Kronleuchtern versehen, an den Wänden prangten die Gemälde vergangener Epochen und durch die Fensterfront fiel das Licht auf die brokatbesetzten Vorhänge.
Dies war das Pariser Geschworenengericht.
Es urteilte über Straftaten, für die mindestens eine mehrjährige Haftstrafe zu erwarten war.
Und genau deshalb war er hier.
»Gehen Sie auch so gerne zu öffentlichen Gerichtsprozessen?«, fragte ihn die alte Dame. »Ich meine, das Sammeln der Indizien, die Beweisführung, die Plädoyers: Ich fand das schon immer aufregend. Und dieser Prozess hier ist … geheimnisvoll … Finden Sie nicht?«
Nicolas nahm einen Schluck Wasser und blickte sie an.
»Nun, ehrlich gesagt …«, setzte er an, aber die alte Dame unterbrach ihn bereits wieder.
»Glauben Sie, sie war es?«
»Wie bitte?«
»Na, kommen Sie! Die junge Frau dort drinnen! Sie sieht so unschuldig aus. Und so … verzweifelt.«
Das ist sie auch, dachte Nicolas bei sich.
»Aber glauben Sie mir, genau die haben es faustdick hinter den Ohren. Diese Unschuldsengel sind oft die wahren Schuldigen. Ich habe schon viele Gerichtsprozesse als Besucherin erlebt und diese Frau hat es auf jeden Fall getan. Ohne Zweifel.«
Ihre Stimme hatte sich gewandelt, sie klang mit einem Mal hart und kalt.
Nicolas straffte die Schultern, er holte tief Luft und wollte gerade zu einer emotionalen Gegenrede ansetzen, als die Eichentür auf der anderen Seite des Saals geöffnet wurde und zwei Besucher leise die Cour d’Assises verließen.
»Kommen Sie, das ist unsere Chance!«, flüsterte die Frau und raffte ihre Sachen zusammen. »So erleben wir doch noch das Spannendste! Heute soll nämlich der Lebensgefährte aussagen, das will ich nicht verpassen. Nun kommen Sie schon!«
Hastig durchquerte sie den Wartesaal und wandte sich an der Tür noch einmal nach ihm um.
»Kommen Sie endlich!«, zischte sie und winkte.
Im selben Augenblick wurde sie zur Seite geschoben, ein Saaldiener trat hinaus und machte Nicolas ein Zeichen.
»Monsieur, bitte. Die Vorsitzende ruft Sie jetzt in den Zeugenstand.«
Nicolas strich die Hose seines Anzugs glatt, stellte sein Glas ab und schritt durch den Vorraum hinüber zum Eingang des Gerichtssaales.
Die Frau blickte ihm verdutzt entgegen.
Bevor er den Saal betrat, beugte er sich ganz dicht zu ihr und lächelte sie freundlich an.
»Glauben Sie mir, Madame. Unschuldsengel sind vor allem eines: unschuldig.«
Hinter ihnen schloss sich die schwere Tür und der Saaldiener wies der älteren Dame einen der frei gewordenen Plätze in den Besucherreihen zu. Nicolas hingegen ordnete den Knoten seiner Krawatte, holte tief Luft und schritt den Gang hinab, an dessen Ende ein unscheinbarer Holztisch stand, mit einem Stuhl, auf dem an den vergangenen Prozesstagen Polizisten, Ballistiker und auch ein entscheidender Zeuge Platz genommen hatten.
Ein Zeuge, der falsch ausgesagt hatte, da war sich Nicolas sicher.
Der Prozess hatte von Anfang an das Interesse der Medien erregt.
Macht, Liebe, Intrigen.
Und den Tod gab es gratis dazu.
Vor allem aber hatte dieser Prozess etwas, das die Öffentlichkeit mehr liebte als alles andere: eine bildhübsche Tatverdächtige, einen Engel mit schwarzen Schwingen.
So hatte ein Boulevardblatt sie getauft.
Nicolas machte noch drei Schritte.
Dann stand er, zum ersten Mal seit dem Prozessbeginn, neben ihr. Er hatte der Verhandlung bisher nicht beiwohnen dürfen, da er als Zeuge geladen war.
Nun aber stand er hier.
So nah bei ihr.
Langsam atmete er aus und wandte ihr den Kopf zu. Seit seinem Eintreffen in dem großen Gerichtssaal hatte er jeden Blickkontakt mit ihr gemieden, er hatte sich diesen Moment aufheben wollen.
Ich bin da, sollte sein Blick sagen. Ich hole dich hier raus.
Er wusste nur immer noch nicht, wie.
»Bitte nehmen Sie Platz, Monsieur Guerlain.«
Julie lächelte ihn an.
Sie saß auf ihrem Platz hinter ihrem Verteidiger, den Rücken durchgestreckt, das Haar zurückgebunden. Sie trug eine dunkelblaue Hose und eine dazu passende Bluse und für einen Moment stellte er sich vor, dass sie nur eine weitere Besucherin in diesem Prozess war. Ihr Blick war stolz, statt Verzweiflung lag für einen Augenblick Kraft darin und Stärke.
Er wusste, dass sie auch andere Zeiten hatte, andere Verfassungen.
Jetzt aber sagte ihr Blick: Ich bin da. Ich komm hier raus. Für dich.
»Monsieur Guerlain, bitte.«
Der Ton der Vorsitzenden war von jener Nüchternheit, die die Rechtsprechung in aller Welt auszeichnete. Es ging um Fakten, nicht um ein Lächeln. Und sei es noch so wichtig.
Nicolas nickte Julie zu, lächelte kurz, zog den Stuhl heran und setzte sich in den Zeugenstand. Die Richterin besprach sich nochmals mit ihren beiden Beisitzern, die links und rechts von ihr saßen. Neben ihnen saßen die insgesamt sechs Geschworenen, drei zu jeder Seite, Männer und Frauen, ausgelost aus den Pariser Wählerlisten der zurückliegenden Wahlen. Sie blickten ihn neugierig an, eine der Frauen nickte ihm freundlich zu.
»Würden Sie uns bitte Ihren vollständigen Namen und Ihren Beruf nennen?«, fragte ihn die Vorsitzende schließlich. Nicolas schaltete sein Mikro an.
»Nicolas Guerlain, geboren in Deauville, Frankreich. Beruf: Personenschützer, derzeitige Zuständigkeit: Élysée-Palast.«
Er sah, wie einer der Beisitzer eine Augenbraue hob, und er hörte das Tuscheln in den Reihen der Besucher.
Die Vorsitzende blickte ihm in die Augen.
»Ihr Zuständigkeitsbereich beim Staatspräsidenten war auch der Grund für das mehrmalige Verschieben Ihres Erscheinens in meinem Zeugenstand.«
»Ich bitte dies zu entschuldigen, verehrte Vorsitzende. Ich hoffe, dass Ihnen alle Unterlagen zugegangen sind.«
»Das sind sie, Monsieur Guerlain. Erfreut war ich trotzdem nicht über die Verzögerung. Auch wenn die Sicherheit des Präsidenten von größter Bedeutung ist – die Rolle der Justiz ist es auch, meinen Sie nicht?«
»Selbstverständlich.«
Für einen Moment schwieg die Vorsitzende, machte sich einige Notizen, bevor sie wieder den Kopf hob und Nicolas anblickte.
»Ich werde Sie zunächst über Ihre Rechte und Pflichten als Zeuge aufklären, Monsieur Guerlain. Anschließend werde ich Ihnen einige Fragen zu Ihrer Beziehung mit der hier anwesenden Angeklagten stellen.«
Nicolas hätte sich gerne zu Julie umgedreht, aber sie saß etwas versetzt hinter ihm und er wollte gegenüber der Vorsitzenden Richterin nicht unhöflich erscheinen. Aus den Augenwinkeln nahm er Julies Verteidiger wahr, die eleganten Holzpaneele an den Wänden, das Spiel der Schatten, als einer der schweren Vorhänge sich leicht bewegte. Die Fenster waren gekippt, das Geräusch des dichten Verkehrs drang gedämpft zu ihnen in den Saal.
Geduldig ließ er die Formalitäten über sich ergehen und antwortete ohne Umschweife auf die Fragen zu seiner Person.
»Wie ist Ihr Verhältnis zu der Angeklagten, Monsieur Guerlain?«
»Wir leben seit langer Zeit in einer Beziehung.«
»Wohnten Sie zusammen, bevor die Tatverdächtige in Untersuchungshaft kam?«
Nicolas zögerte kurz.
»Ja«, sagte er schließlich.
»Warum zögern Sie?«, fragte ihn die Vorsitzende mit einem kalten Lächeln.
Nicolas spürte plötzlich, wie sein Handy in der Jacketttasche vibrierte.
Verdammt, dachte er. Er hätte es ausschalten sollen.
Er räusperte sich.
»Verehrte Vorsitzende, dem Gericht ist, glaube ich, bekannt, dass die Tatverdächtige … dass Julie Malraux … in den vergangenen vier Jahren verschwunden war. Das ändert für mich aber nichts an der Tatsache, dass wir gemeinsam eine Wohnung hatten. Die Adresse ist …«
Die Vorsitzende winkte ab.
»Ihre Adresse haben wir gerade aufgenommen. Ich danke Ihnen, Monsieur Guerlain.«
Sein Handy vibrierte jetzt ohne Unterlass, es irritierte ihn. Nicolas überlegte, ob er es ausschalten sollte, er wollte aber die Nerven der Richterin nicht noch weiter strapazieren.
Einer der Beisitzer schob eine Akte zu ihr herüber.
»Monsieur Guerlain, Sie sind in den Zeugenstand gerufen worden, um einige Angaben zu Ihrem Verhältnis mit der hier anwesenden Tatverdächtigen zu machen. Aber auch, um uns Ihre Sicht der Dinge darzulegen, Ihre Erinnerungen an die Zeit unmittelbar nach der Straftat. Folgen Sie mir so weit?«
»Das tue ich, Madame Vorsitzende.«
»Gut.«
Als sie in der Akte blätterte, griff er schnell in sein Jackett und schaltete sein Handy aus.
»Der hier anwesenden Julie Malraux, Lebensgefährtin des in den Zeugenstand gerufenen Nicolas Guerlain, wird vorgeworfen, bei einem Polizeieinsatz vor vier Jahren vorsätzlich eine junge Frau erschossen zu haben. Ist Ihnen dieser Vorwurf bekannt, Monsieur Guerlain?«
Nicolas nickte.
»Bitte antworten Sie, für das Protokoll.«
»Der Vorwurf ist mir bekannt. Dennoch ist er falsch.«
»Das war nicht meine Frage.«
Genervt hob sie den Blick, als das laute Hupen eines Wagens zu ihnen in den Saal drang.
»Saaldiener, könnten Sie bitte die Fenster schließen.«
Das Hupen hörte nicht auf, jemand musste seinen Wagen direkt vor dem Gebäude auf die Place Dauphine gestellt haben und dieser jemand war nun dabei, rhythmisch auf die Hupe zu drücken. Erst als alle Fenster geschlossen waren, nahm das Geräusch ab.
Die Richterin blätterte wieder in einer Akte.
»Die Angeklagte hat am besagten Datum an einer Razzia im Drogenmilieu nördlich der Gare du Nord teilgenommen. Es war ihr erster Einsatz im Außendienst. Bei dieser Razzia hat sie die junge Drogenabhängige Clementine Marcellin erschossen. Julie Malraux hat ausgesagt, in Notwehr gehandelt zu haben, weil sie mit einem Messer angegriffen wurde. Anwesend war neben der Angeklagten und Clementine Marcellin nur ein weiterer Polizist. Rémy Foire, er wurde ihr für diesen Einsatz als Partner zugeteilt. Seine Aussage haben wir bereits gehört. Sie besagt, die hier angeklagte Julie Malraux habe ohne Vorwarnung und ohne Not auf die unbewaffnete Clementine Marcellin geschossen.«
Nicolas blickte zu Julie, die jedoch keine Regung zeigte. Die Vorsitzende fuhr mit ihren Ausführungen fort.
»Monsieur Foire gibt an, die Situation sei unter Kontrolle gewesen, und vermutet, die Angeklagte habe schlicht die Nerven verloren. Am Tatort ist kein Messer aufgefunden worden. Laut ballistischem Bericht und gerichtsmedizinischem Gutachten war der erste Schuss tödlich und traf direkt ins Herz. Monsieur Guerlain, war Ihnen damals bekannt, dass Ihre Lebensgefährtin an dieser Razzia teilnehmen würde?«
»Nein«, sagte Nicolas und schluckte schwer. Er ahnte, dass Julie in diesem Augenblick den Blick senkte.
»Warum nicht?«, fragte ihn die Vorsitzende.
Nicolas sah sie an.
»Wir haben oft über ihren Wunsch gesprochen, an Außeneinsätzen teilzunehmen. Ich hielt sie für … noch nicht bereit. Sie war Fallanalystin bei der Pariser Polizei, sie wusste nicht, was draußen …«
Die Richterin lächelte kurz und unterbrach ihn.
»Sind Sie sehr … fürsorglich, Monsieur Guerlain? Womöglich etwas zu fürsorglich?«
»Das kann ich nicht beurteilen, Madame Vorsitzende.«
Wieder blätterte sie in der Akte, aber ihr Blick über die Ränder ihrer Brille war auf ihn gerichtet.
»Monsieur Guerlain, hat sich die Angeklagte Ihnen gegenüber zum Tatgeschehen geäußert?«
»Julie hat die Frau in Notwehr erschossen, so hat sie es mir gesagt. Und ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln.«
»Sie hat es Ihnen aber erst jetzt, nach mehr als vier Jahren, gesagt.«
»Das macht für mich keinen Unterschied. Ich denke, Sie sollten vielmehr beachten, warum ausgerechnet dieser Mann, Foire, ihr als Partner zugewiesen wurde. Julie wurde womöglich Opfer einer …«
»Sie haben als Zeuge keine Vermutungen anzustellen, Monsieur Guerlain. Erklären Sie dem Gericht bitte nicht, wie es seine Arbeit zu tun hat.«
Es vergingen weitere zähe Minuten mit weiteren zähen Fragen, auf die er nicht immer eine zufriedenstellende Antwort geben konnte. Weder für das Gericht noch für ihn. Er war damals nicht dabei gewesen, er konnte nur Julies Charakter beschreiben, ihre Vorsicht, er zeichnete das Bild einer besonnenen und reflektierten Frau, die seit so vielen Jahren an seiner Seite gelebt hatte und die er besser kannte als jeder andere.
Foire beschrieb sie völlig anders.
Julie, die die Nerven verlor. Die eine junge Frau anbrüllte, sie erst schubste und dann mit der Waffe bedrohte.
Das Hupen draußen vor dem Palais de Justice hatte aufgehört.
Ab und an blickte Nicolas zu Julie hinüber, sah das Flackern in ihrem Blick.
Die Haft bekam ihr nicht. Ebenso wenig wie ihm.
»Monsieur Guerlain, Sie sind aus dem Zeugenstand entlassen. Sie dürfen den weiteren Verlauf des Prozesses nun hier im Saal als Zuschauer verfolgen.«
Julies Verteidiger und auch der Vertreter der Anklage hatten nur wenige Fragen an ihn gehabt.
Er konnte nichts beitragen, keine wirkliche Entlastung anbieten. Und das machte ihn wahnsinnig.
»Ich schlage eine kurze Verhandlungspause vor, der Prozess geht in 15 Minuten weiter«, sagte die Vorsitzende Richterin.
Kurz darauf sah sich Nicolas im Vorraum nach der älteren Dame um, mit der er sich unterhalten hatte – und begriff schlagartig, dass ihn etwas anderes erwartete als die Fortsetzung ihres Gesprächs.
Der Grund dafür stand wenige Meter von ihm entfernt in der Mitte des Raumes, umringt von drei Sicherheitsbeamten des Gerichtsgebäudes, auf die er wild gestikulierend einredete. Jetzt wedelte er mit seinem Ausweis vor ihrer Nase herum, was die Männer aber nicht aus der Ruhe zu bringen schien.
Nicolas musste unweigerlich lächeln, als er die Stimme des Mannes vernahm, der mit Sonnenbrille, Bluejeans und dunkler Lederjacke wie der Prototyp eines Zivilpolizisten aussah.
Und wie jemand, der soeben noch die Hupe seines Wagens malträtiert hatte, draußen auf der Place Dauphine.
»Nationale Sicherheit, wissen Sie, was das ist, ja? Es geht um den Staatspräsidenten, es geht um Frankreich, also lassen Sie mich durch! He, Nicolas! Sag diesen Pinguinen, wer ich bin, dass ich für den Staatspräsidenten arbeite, für den GPS … SPR … also jedenfalls für die nationale Sicherheit!«
Aus den Augenwinkeln sah Nicolas, wie weitere Saaldiener sich dem Mann näherten, Frauen und Männer waren stehen geblieben und beobachteten die seltsame Szene.
Um Schlimmeres zu verhindern, durchquerte Nicolas mit schnellen Schritten den Vorraum und blieb vor dem Mann stehen, der nun seine Sonnenbrille abgenommen hatte und finster auf die Sicherheitsleute blickte.
»Salut, Roussel«, sagte Nicolas.
Luc Roussel, Leiter des Commissariat von Deauville, nickte ihm zu. Er war der Mann, mit dem Nicolas in den vergangenen Monaten durch so manche Hölle gegangen war. An den Stränden der Normandie hatten sie Schlimmes erlebt und noch Schlimmeres verhindert, und mittlerweile verband sie eine echte, wenn auch von ständigen Frotzeleien begleitete Freundschaft.
Und es war Roussel, der ihm Mut gemacht hatte, im Sommer, als Julie ihm erneut entrissen worden war.
Jetzt stand er hier, im Palais de Justice, fernab von seiner Dienststelle in Deauville. Und offensichtlich hatte er es eilig.
»Salut, Bodyguard. Ich dachte schon, ich muss mit dem Wagen hier reinfahren, um dich da rauszuholen. Wir müssen reden.«
Nicolas wusste, dass etwas Wichtiges passiert sein musste, sonst wäre Roussel nicht hier und heute aufgetaucht.
»Ist okay, wir gehen raus«, sagte Nicolas zu einem der Saaldiener. Begleitet von vielen misstrauischen Blicken traten sie kurz darauf hinaus ins Sonnenlicht.
»Es heißt übrigens GSPR, Roussel«, sagte Nicolas zu Roussel. »Die Sicherheitsgruppe des Präsidenten kürzt sich GSPR ab. Groupe de sécurité de la présidence de la République. Aber das muss so ein Provinzbulle wie du natürlich nicht wissen.«
»Halt die Klappe, Nicolas«, sagte Roussel. »Folg mir einfach. Den Rest erkläre ich dir unterwegs.«
Sie stürmten die Stufen des Palais de Justice hinunter und erreichten Roussels Wagen, der tatsächlich gänzlich ordnungswidrig direkt vor der breiten Steintreppe geparkt war.
Roussel startete den Motor und schoss los, ohne Rücksicht auf den Verkehr.
»Also, was gibt es?«, fragte Nicolas, während er sich anschnallte. »Ich meine, endlich kann ich dem Prozess beiwohnen, meine Aussage ist gemacht und ausgerechnet jetzt …«
»Er ist zurück in der Stadt«, erwiderte Roussel. Und das alleine reichte, um Nicolas’ Erstaunen über das plötzliche Erscheinen Roussels sofort in Luft aufzulösen.
Der Leiter des Commissariat von Deauville sah müde aus, offenbar war er ohne Pause aus der Normandie nach Paris gefahren, auf direktem Wege zum Palais de Justice.
»Du meinst den Dealer?«, fragte Nicolas leise und Roussel nickte.
»Genau den meine ich, diesen dreckigen kleinen Stricher. Und jetzt schnappen wir ihn uns und dann holen wir deine Julie da raus. Halt dich fest, wir müssen uns beeilen.«
Der Palais de Justice verschwand im Rückspiegel, während Roussel den Wagen beschleunigte.
Sie hatten noch zwei Prozesstage.
Ihnen blieb nicht viel Zeit.
Kapitel 2
Paris
Keine zehn Minuten später lenkte Roussel seinen grauen Citroën in eine Parklücke am Rande des breiten Boulevard de Magenta, knurrte etwas, das Nicolas als »Kaffee holen« interpretierte, sprang raus und knallte die Fahrertür hinter sich zu. Nicolas blickte in den Rückspiegel und fuhr sich mit der linken Hand durchs Gesicht. Die Müdigkeit hatte Schatten unter seine Augen gemalt, seine Wangen waren eingefallen. Er atmete laut aus und lehnte sich in seinem Sitz zurück, während er aus dem Fenster hinaus auf die Straße blickte.
Er sah Männer und Frauen, die an Ramschläden vorbeiströmten, der Dampf einer Wäscherei hing in der kalten Luft. Ein Straßenköter kläffte ohne sichtbaren Grund, der Verkäufer eines Backwarenladens goss einen Eimer Schmutzwasser auf das Trottoir. Weiter vorne hielt mit stotterndem Motor ein in die Jahre gekommener Linienbus an einer Haltestelle, Menschen stiegen aus, andere ein, darüber ein Kondensstreifen, als weiße Narbe auf grauem Grund. Der Asphalt erzitterte, als durch die Unterwelt eine Metro rauschte.
Dies hier war der Nordosten von Paris und doch schien es eine fremde Stadt zu sein. Sken City nannte man das Viertel. Und Nicolas, der in seinem Job als Personenschützer eher an die aufgeräumten Boulevards rund um die Place de la Concorde gewöhnt war, dachte, dass er hier in Sken City eigentlich ganz gut aufgehoben war.
Es war der Ort der Verzweifelten, die Heimat der Untoten. Leben und Tod teilten sich diese Straßen.
Das Leben zeigte sich hier, wo die Rue Ambroise Paré vom Boulevard abging, im Kläffen eines Hundes, in dem Geruch von Abgasen oder im frühen Schnee, der nach und nach die Pappkartons der Obdachlosen zudeckte.
Roussel kam zurück, umständlich stieg er in den Wagen und schlug die Fahrertür zu.
»Scheißkälte«, fluchte er, »es ist doch Herbst, verdammt. In Deauville ist es genauso kalt.«
Als er die beiden Becher auf das Armaturenbrett stellte, fluchte er lautstark, weil etwas Kaffee auf seine Hose getropft war.
»Leck mich doch! Können die ihre beschissenen Pappbecher nicht wenigstens ordentlich abdichten?«
»Ich hätte den Kaffee holen können«, bemerkte Nicolas. »Du musst dich immer noch schonen, Roussel, das habe ich Sandrine versprochen und …«
»Halt die Klappe, Bodyguard.«
Nicolas hob beschwichtigend die Hände und blickte durch die Windschutzscheibe. Vor ihnen überquerte ein Blinder die Straße, niemand bot ihm Hilfe an. Eine alt wirkende Frau von Anfang zwanzig führte zwei Pudel über einen Zebrastreifen, sie kaute Kaugummi, einer der Hunde setzte beiläufig einen Haufen auf die Straße, es schien die Frau nicht zu stören, sie tippte eine Nachricht in ein rosafarbenes Handy, ihre langen Fingernägel waren abgebrochen.
Roussel knurrte neben ihm.
»Wenn ganz Paris ein Körper ist, sind diese Straßen hier die Hämorrhoiden.«
Nicolas musste lachen.
»Ich finde es gar nicht so übel. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt.«
Roussel nippte an seinem Kaffee und verzog das Gesicht.
»Drei Dienstjahre als Bulle in diesen Straßen und du würdest dir wünschen, du wärst ein kackender Pudel. Ich habe es irgendwann gehasst.«
»Und jetzt bist du in der Normandie Leiter des Commissariat von Deauville und hasst auch das.«
»Nur, wenn du zu Besuch kommst. Ansonsten ist es eigentlich ganz in Ordnung.«
Der Tod hatte diesem Viertel seinen Namen gegeben und er war es, der in diesem Augenblick auf der anderen Straßenseite in Form eines kleinen Päckchens den Besitzer wechselte. Ein Päckchen, das, hastig umschlossen von einer zittrigen Hand, in einer Jackentasche verschwand. Der Tod hatte in diesem Viertel einen Ruf, den er nicht zu verlieren bereit war. Sken City war das Zuhause der Untoten, der Vampire, die an den Adern der Stadt nagten und die sich nicht vertreiben ließen.
Wer hier starb, starb langsam.
Skenan war ein Morphium, verschreibungspflichtig, gegen starke Schmerzen. Und gleichzeitig weckte es die dunkelsten Triebe, ein Verlangen, das alles mit sich riss. Skenan war viermal billiger als Heroin, mit ein paar Tropfen Wasser vermischt, führte es den Abhängigen innerhalb kürzester Zeit in die Glückseligkeit.
Skenan war der Grund, warum sie hier waren, Roussel und Nicolas. Weil mit Skenan alles begonnen hatte, vor vier Jahren, in einem Abbruchhaus, nur wenige Straßen entfernt, an einem verregneten Abend in Sken City. Bei einer Razzia, von der Julie Nicolas nichts erzählt hatte, weil sie um seine Sorge wusste und sich davon befreien wollte.
Bei der Razzia war alles schiefgegangen.
Und nun saß Julie in Untersuchungshaft und wartete auf ein Urteil für eine Tat, die sie nicht bestritt. Sie bestritt nur den Vorsatz.
Immer noch gab es keine Antwort auf die Frage, die Nicolas am meisten umtrieb: Warum hatte Julie sich nicht an ihn gewandt, an ihren Freund, ihren Liebsten, an ihn?
Immer wieder hatte er ihr diese Frage gestellt, bei seinen Besuchen in der Untersuchungshaft, bei ihren wöchentlichen Telefonaten, wenn er sie um 18 Uhr in der Telefonkabine im Besucherraum erreichen konnte.
Julie war ihm ausgewichen, hatte sich weggeduckt. Und er fand keinen Schlaf mehr.
Nicolas blickte die Rue Ambroise hinunter, die vom dicht befahrenen Boulevard wegführte, vorbei am »Bistrot Magenta« bis hinüber zu den Gleisen, die von der Gare du Nord in die Vororte im Norden führten, in die Banlieues von Paris.
»Dafür, dass das hier das härteste Drogenviertel der Stadt ist, lässt sich die Polizei aber selten blicken«, bemerkte er und deutete auf den Dealer, der zufrieden an einer Mauer lehnte und offen nach neuer Kundschaft Ausschau hielt.
»Ich meine, der hier ist doch ganz offensichtlich hauptberuflich im Drogenhandel tätig«, fuhr er fort. »Aber er scheint sich keine Sorgen zu machen, dass gleich eine Streife um die Ecke biegt.«
Roussel schlürfte hörbar unzufrieden an seinem Becher.
»Der weiß, dass keine kommen wird«, grunzte er missmutig.
Nicolas blickte ihn verwundert an.
»Was soll das heißen?«
»Das soll heißen, Bodyguard, dass es Orte gibt, an denen die Regeln, die du kennst, nicht gelten. Und Sken City ist so ein Ort, ich dachte, das hättest du mittlerweile begriffen. Damals, als ich noch hier im Einsatz war, gab es nur eine Methode: reinfahren, aufmischen, rausfahren, einbuchten. Heute lassen wir die Jungs einfach ihr Ding machen. Kaum zu glauben, aber wahr. Und weißt du, was das Beste daran ist?«
Nicolas schüttelte den Kopf.
»Dass es funktioniert. Sken City ist immer noch ein schlimmer Ort, der schlimmste vielleicht in ganz Paris. Aber er ist jetzt sauberer. Und besser ausgeleuchtet. Schau, dahinten, siehst du das?«
Nicolas blickte die Straße hinunter, in die Richtung, die Roussel ihm wies.
»Oben an der Wand, über dem Schaufenster.«
Jetzt sah es auch Nicolas.
»Eine Kamera«, murmelte er und drehte sich dann überrascht zu Roussel. »Heißt das, sie filmen hier alles? Und die harten Jungs wissen das und es ist ihnen egal?«
»Völlig«, antwortete Roussel. »Es ist so was wie ein gigantischer Deal und er hält nicht nur die Geschäfte auf den Straßen von Sken City am Laufen, sondern vor allem der Stadtverwaltung die gröbsten Probleme vom Hals.«
»Was ist denn bitte schön ein noch größeres Problem als Drogendeals auf offener Straße?«
Roussel nahm einen Schluck Kaffee und lächelte bitter. »Tote Junkies auf offener Straße, Nicolas. Und eine neue Aidswelle. Das wäre verheerend für das Image von Paris. Also haben sie vor einigen Jahren radikal den Kurs geändert und in Sken City einen Feldversuch gestartet.«
»Und wie sieht der aus?«
Roussel deutete auf den Dealer, der an der Wand lehnte und die junge Frau angrinste, die mit ihren beiden Pudeln auf ihn zukam. Die nächste Kundin, die nächste Einnahmequelle.
»Es ist ganz einfach. Die Stadt hat gewissermaßen den Drogenhandel in Sken City inoffiziell legalisiert. Oder sagen wir, man akzeptiert die Situation. Gleichzeitig will man die Anzahl der Aidstoten und der Hepatitis-Fälle senken. Indem man die Junkies davon abhält, sich Spritzen zu teilen oder verunreinigtes Besteck zu benutzen. Um die Ansteckung und Ausbreitung zu minimieren. Pass auf, gleich siehst du, was ich meine.«
Nicolas beobachtete, wie die Frau mit den beiden Hunden hastig ein kleines Röhrchen einpackte, was sie eben an der Straßenecke gekauft hatte. Ohne Umschweife überquerte sie die einspurige Straße und näherte sich dem Eingang eines Krankenhauses.
»Das Hôpital Lariboisière ist der Mittelpunkt von allem«, erklärte Roussel. »Hier kriegen sie alles, was sie brauchen.«
Nicolas sah, wie die Frau, die im Gehen auf ihr Handy starrte, an einen Kasten trat, der an der Wand hing, und einen münzgroßen Jeton herausnahm. Einige Meter weiter steckte sie ihn in den Schlitz eines Automaten, den Nicolas von weitem für einen Getränkeautomaten gehalten hatte. Die Frau lächelte, als etwas in das Ausgabefach fiel, nahm es heraus und steckte es in ihre Tasche. Dann zerrte sie ihre Hunde weiter.
»Et voilà«, bemerkte Roussel. »Eine saubere Spritze, sterilisierte Tücher, hygienisch einwandfreies Wasser. Alles für den Schuss, den sie sich gleich setzen wird.«
»Wahnsinn«, murmelte Nicolas und Roussel klopfte ihm auf die Schulter.
»Willkommen im echten Leben, Bodyguard. Ich weiß, deine Welt sind die Staatsempfänge und Business-Class-Flüge mit dem neuen Präsidenten. Apropos, wie ist er denn so, immer noch derselbe Frauenheld?«
Nicolas zuckte mit den Schultern. François Faure war weit weg, Nicolas hatte hier und jetzt andere Sorgen.
Ein Kleindealer, der seit der Razzia damals untergetaucht war, war zurück in der Stadt. Und wenn es stimmte, was Roussels Quellen ihm vor einigen Wochen zugetragen hatten, dann war ebendieser Mann in ebenjener Nacht, in der Julie eine junge Frau erschossen hatte, ebenfalls vor Ort gewesen. Jojos Name war in keiner Vernehmung gefallen. Rémy Foire hatte ihn nicht erwähnt und auch Julie erinnerte sich nicht an ihn. Jojo aber hatte auf der Straße geprahlt, den Einsatz aus nächster Nähe beobachtet zu haben – er habe sich unter einer Plane versteckt, unbemerkt von allen. Nur er kenne die Wahrheit, hatte er herumerzählt.
Wenn das stimmte, konnte er bezeugen, dass Julie in Notwehr von ihrer Schusswaffe Gebrauch gemacht hatte. Und dass sie zu Unrecht vor Gericht stand.
Es war eine dünne Spur. Aber es war die einzige, die sie hatten.
Die Frau mit dem rosafarbenen Handy war hinter einer Stahltür verschwunden, ihre Hunde hatte sie draußen angebunden.
»Dort ist die sogenannte salle de shoot«, erklärte Roussel. »Sie wurde extra für die Abhängigen eingerichtet, die sich dort ungestört ihr Skenan spritzen.«
Nicolas blickte auf Uhr und gähnte. »Und seit wann läuft das hier so?«, fragte er Roussel.
»Seit fast vier Jahren. Seit bei den großen Razzien hier im Viertel alles drunter und drüber ging, seit …« Abrupt brach Roussel ab und blickte Nicolas an. Der nickte langsam und sie schwiegen beide für einen Moment.
»… seit es damals bei einer dieser Razzien eine Tote gab«, ergänzte Nicolas schließlich den Satz und blickte über den Boulevard hinweg in Richtung Sken City, wo Kameras an den Hausfassaden hingen und Süchtige sich nicht mehr die Spritzen teilten, aber immer noch die Aussicht auf ein verschwendetes Leben.
Roussel fuhr sich müde durchs Gesicht.
»Hör zu, Nicolas, wir wissen immer noch nicht, was damals wirklich in dem Abbruchhaus passiert ist. Und ob es stimmt, dass Julie …«
Aber Nicolas hörte ihm nicht mehr zu.
Weil ihm plötzlich heiß wurde und kalt zugleich. Der Moment, den sie nicht verspielen durften, war tatsächlich gekommen.
»Ich verstehe, dass das alles nicht einfach ist, für dich und für …«
Nicolas hob eine Hand und machte ihm ein Zeichen, still zu sein. Roussel, der eben noch einen Schluck Kaffee nehmen wollte, setzte den Pappbecher wieder ab und blickte zur anderen Straßenseite.
»Dort drüben«, sagte Nicolas und deutete auf den Eingang des »Bistrot Magenta«, durch dessen Glasfront er bereits vor wenigen Sekunden den Umriss eines Mannes erkannt hatte, der in diesem Augenblick aus der Tür trat und dabei den Kragen seiner hellblauen Sportjacke hochstellte. Er zündete sich eine Zigarette an und blickte sich um.
»Scheiße, das ist er wirklich«, murmelte Roussel.
»Ja, das ist er«, erwiderte Nicolas und wollte gerade die Autotür öffnen, als Roussel ihm eine Hand auf die Schulter legte. Er spürte sie kaum. Nicolas spürte überhaupt sehr wenig in diesem Augenblick. Da war nur diese fieberhafte Ungeduld, sie kribbelte in seinen Beinen und in seiner linken Hand, die immer noch die Tür öffnen wollte, als wollte sie einen Jagdhund von der Leine lassen.
»Langsam, Cowboy«, sagte Roussel eindringlich und umfasste Nicolas’ Schulter etwas fester. »Ich sage dir, wenn du jetzt einfach da rübergehst, dann ist er weg, noch bevor du die andere Straßenseite erreicht hast. Diese Jungs riechen uns zehn Meilen gegen den Wind. Da kannst du auch gleich im Häschenkostüm rüberhoppeln und ihn fragen, ob er eine Möhre für dich hat!«
Nicolas entspannte sich nur unwesentlich und beschloss, zumindest kurzfristig auf Roussel zu hören.
»Wir haben nur diese Chance«, murmelte er. »Nur diese eine, lange kann ich nicht warten. Wir haben schon zu lange nach ihm gesucht.«
Als Roussels Handy plötzlich klingelte, zuckte Nicolas zusammen.
Ich bin wirklich nervös, dachte er. Das hier darf nicht schiefgehen.
Roussel holte umständlich sein Handy aus der Jackentasche und blickte auf das Display. Unwirsch schüttelte er den Kopf.
»Was will der denn jetzt?«, knurrte er. »Der ist doch sonst um diese Zeit im Café oder beim Bäcker …«
Auf der anderen Straßenseite stand der Mann in der hellblauen Sportjacke, rauchte unruhig eine Zigarette und blickte sich nach allen Seiten um. Der Dealer trug ausgewaschene Jeans und weiße, speckige Turnschuhe, seine Bewegungen waren fahrig, sein Blick gehetzt. Er kratzte sich am Unterarm und schlug die Arme um sich, um die Kälte zu vertreiben.
Nicolas beobachtete jede seine Bewegungen, er kannte die Gesichtszüge des Mannes auswendig, die Narben, die geschwungene Nase, das strähnige Haar. Nicolas trug dieses Gesicht auf einem Foto seit einigen Wochen mit sich herum. »Du wirst mir nicht entkommen«, murmelte er, während neben ihm Roussel den Anruf entgegennahm.
»Was ist los, Alphonse?«, zischte Roussel unwirsch in den Hörer, den er mit der linken Hand abdeckte, als könnte der Mann auf der anderen Straßenseite ihn sonst hören. Die Stimme in der Leitung klang aufgeregt, in der Normandie schien der Tag nicht sonderlich ruhig zu beginnen.
Alphonse, der diensthabende Beamte am Empfang des kleinen Commissariat in der Rue Désiré le Hoc in Deauville, schnaufte ins Telefon. Roussel stellte sich vor, wie er mit der linken Hand versuchte, die Überreste eine fettigen Croissants von seiner Diensthose zu wischen.
»Salut, Chef«, stammelte Alphonse nervös. »Entschuldigung, Sie hatten ja gesagt, wir sollen nicht anrufen, weil Sie … ach, verdammt, warum geht das nicht ab … also, jedenfalls …«
Roussel rollte mit den Augen und blickte zu den Geschäften, wo in der Auslage eines Schmuckladens billige Uhren lagen. Er hasste billige Uhren.
»Alphonse, komm zur Sache! Oder gib mir Sandrine oder Yves! Oder irgendjemand anderen, wenn du nicht Bericht erstatten kannst, weil dir ein Croissant das Hirn verklebt!«
»Pardon, Chef, natürlich. Es ist übrigens eine Schnecke, also eine Rosinenschnecke, die haben nämlich drüben im Café jetzt auch …«
»Alphonse!«
»Ja, jedenfalls, Sandrine meinte, ich muss Sie dringend anrufen. Wegen des Mannes, meinte sie, weil …«
Ich werde ihn feuern, dachte Roussel. Ich werde den dicken Alphonse feuern, sobald ich wieder in der Normandie bin.
»Welcher Mann, Alphonse? Und bitte, beeil dich.«
»Natürlich«, stammelte Alphonse, der die schlechte Laune seines Chefs bemerkt hatte. »Also, sie sagte, ich soll Sie schnell anrufen, weil der Mann tot ist und weil hier … also, alle sind aufgebracht und natürlich vor allem der arme Hugo, der hat ihn schließlich …«
Roussel seufzte innerlich. Er hatte keine Wahl, er musste zum Äußersten greifen.
»Alphonse, hör mir zu«, unterbrach er mit bemüht sanfter Stimme seinen immer noch stammelnden Beamten, »ich zahle dir eine Woche lang jeden Morgen zwei Croissants und drei dieser neuen Rosinenschnecken, wenn du mir in drei kurzen Sätzen erklärst, was passiert ist.«
Er konnte die Ruhe förmlich spüren, die sich in Alphonse ausbreitete. Alles wurde zurechtgerückt, seine Gedanken ordneten sich, die Lage wurde klar und darstellbar.
»Im Hafenbecken treibt ein Toter, nackt, er wurde offenbar von der Flut hineingeschwemmt. Entdeckt hat ihn Hugo, der Besitzer der kleinen Fähre, beziehungsweise sein Hund Jalabert. Sandrine ist schon vor Ort.«
»Scheiße«, fluchte Roussel und blickte auf seine Uhr, die teurer war als die Hälfte der Auslage des Schmuckgeschäftes. Er liebte teure Uhren.
Er musste dringend zurück in die Normandie. Sie mussten die Angelegenheit hier in Sken City schnell zu Ende bringen.
»Hör zu, Alphonse, ihr müsst die Kollegen in Caen informieren, außerdem muss der Hafen abgesperrt werden, kein Schiff fährt raus. Die, die reinkommen, müsst ihr sofort überprüfen, findet heraus, ob auf einem der Kähne ein Besatzungsmitglied fehlt. Und jemand muss sich mit der Hafenmeisterei in Verbindung setzen und ihr braucht eine Strömungskarte und ihr müsst ….«
»Das habe ich alles schon erledigt, Chef«, sagte Alphonse mit stolzem Ton. »Alles schon geregelt, wir haben alles im Griff.«
Es war plötzlich still im Innern des Wagens. Roussel hielt immer noch den Pappbecher in seiner Hand, wie in der Bewegung eingefroren.
»Also, Chef, das klingt prima … jedenfalls … die haben auch diese kleinen Brioches im Café gegenüber, die sollen köstlich sein, vielleicht könnten wir variieren … also zum Beispiel dienstags ein Croissant und eine Brioche und mittwochs vielleicht … Chef, Sie sagen ja nichts … nein, mittwochs habe ich Frühdienst, da haben sie die Pain aux chocolats, ich könnte Ihnen eine Liste …«
Alphonse’ Stimme verschwand abrupt, als Roussel die Verbindung unterbrach und mit offenem Mund hinüber in die Rue Ambroise Paré blickte.
Er begriff nicht, was er dort sah, und das lag nicht an dem Mann in der hellblauen Sportjacke, der panisch den Bürgersteig entlangrannte, Passanten anrempelte und fast kopfüber in die Gosse stürzte, bevor er sich gerade noch fing und weiterhastete, den Blick aus weit aufgerissenen Augen über die Schulter gerichtet, als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her.
Nein, das, was Roussel in diesem Augenblick einfach nicht verstehen wollte, war die Tatsache, dass der Teufel dem Mann ähnelte, der eigentlich neben ihm am Steuer sitzen sollte.
Er sah wie Nicolas rannte, als würde ein ganzes Leben davon abhängen, ob er den Mann in der hellblauen Sportjacke erwischte oder nicht. Zwei Leben, dachte Roussel. Es hingen zwei Leben davon ab.
Und das war sein letzter geordneter Gedanke, bevor er das Fenster runterkurbelte und seinen halb vollen Pappbecher auf den Bürgersteig schleuderte, wo sich die braune Flüssigkeit mit den Ausscheidungen einer Pariser Taube mischte.
»Ich hasse diesen Ort!«, brüllte er, wuchtete sich auf den Fahrersitz und schoss nur drei Sekunden später mit quietschenden Reifen aus der Parklücke. Wild hupend riss er das Steuer herum und zog brutal an der Handbremse. Der Wagen schleuderte mitten auf der Fahrbahn herum, Roussel drückte das Gaspedal durch und schoss gerade so durch eine schmale Lücke im Verkehr, quer über den Boulevard und hinein in die Rue Ambroise Paré.
Mitten hinein in den zuckenden Leib von Sken City.
Kapitel 3
Paris
Es lagen fünfzig Meter zwischen ihm und dem Mann, die Rue Ambroise Paré war nicht sonderlich lang, weiter vorne konnte Nicolas bereits die Züge hören, die die Gare du Nord verließen, Richtung Lille und Brüssel.
»Aus dem Weg, Monsieur!«, schrie er einen alten Mann an, der vor ihm die Straße überquert hatte und der sich jetzt, mit einer Zeitung unter dem Arm, auf eine Bank am Straßenrand setzen wollte. Im Vorbeirennen rempelte er eine junge Frau an, er wollte sich entschuldigen, aber er musste weiter, seine Schulter brannte. Mit einem Satz hechtete er an dem alten Mann vorbei, der ihn erstaunt anschaute.
Nicolas kam hart auf dem Asphalt auf, als er über einen umgekippten Mülleimer sprang. Für eine Verfolgungsjagd durch Sken City war er alles andere als passend gekleidet, und nun rannte er im dunklen Anzug und mit feinen Lederschuhen durch die Rue Ambroise Paré und der Mann vor ihm trug Turnschuhe und hatte darüber hinaus auch noch Heimvorteil.
Nicolas war leise aus dem Wagen gestiegen, als Roussel durch das Telefonat abgelenkt war. Er war über den Zebrastreifen gegangen, hatte versucht, in der Menge unsichtbar zu werden und sich dem Mann unbemerkt zu nähern.
Es war ihm fast gelungen.
Dann hatte der andere sich plötzlich hektisch umgeblickt, es war das nervöse Misstrauen der Junkies, und als ihre Blicke sich trafen, über die Köpfe der Menge hinweg, da hatte Nicolas bemerkt, dass der Mann in Panik war.
Nicht seinetwegen, womöglich war es nur fehlendem Stoff oder fehlendem Geld oder beidem geschuldet. Ein Junkie, der nicht mehr in den Knast wollte, kannte nur eine Richtung, wenn die Angst sich meldete.
Weg, so schnell wie möglich.