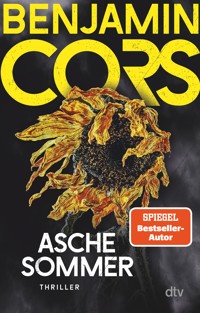Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nicolas Guerlain ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine einsame Insel. Eine mysteriöse Todesliste. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Windumtost und abgelegen vor der rauen Küste der Normandie: Chausey, einst ein Versteck für Schmuggler und Piraten, ist Schauplatz einer rätselhaften Mordserie. Sie beginnt mit dem Fund einer Flaschenpost, die die Wellen an den Strand spülen. Der Inhalt: Eine Liste mit fünf Namen. Der Mann, der die Flaschenpost entdeckt, steht auch darauf - und stirbt qualvoll bei der Rückfahrt zum Festland. Nicolas Guerlain, Personenschützer der französischen Regierung, versucht verzweifelt, die anderen Personen auf der Liste ausfindig zu machen und gerät dabei in tödliche Gefahr: Denn er selbst steht ebenfalls auf der Liste des Mörders. Es wird der persönlichste und schwierigste Fall für den toughen Franzosen. Und das ausgerechnet, während die Beziehung zu seiner großen Liebe Julie zu zerbrechen droht.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Vor der rauen Küste der Normandie findet sich die geheimnisumwobene Inselgruppe Chausey. Einsam und windumtost wird sie zum Schauplatz einer rätselhaften Mordserie. Alles beginnt mit dem Fund einer Flaschenpost, die von den Wellen an den Strand gespült wird. Der Inhalt: eine Liste mit fünf Namen. Der Mann, der die Flaschenpost findet, steht auch darauf – und stirbt auf der Rückfahrt zum Festland eines qualvollen Todes. Nicolas Guerlain, Personenschützer der französischen Regierung, versucht verzweifelt, die anderen Personen auf der Liste ausfindig zu machen, und gerät dabei in tödliche Gefahr: Denn auch er selbst steht auf der Todesliste. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt …
Von Benjamin Cors sind bei dtv außerdem erschienen:
Strandgut
Küstenstrich
Gezeitenspiel
Leuchtfeuer
Schattenland
Flammenmeer
Benjamin Cors
Sturmwand
Ein Normandie-Krimi
Der Tod klopft nicht an die Tür.
Er tritt sie ein, glaub mir, ich war dabei.
Jedes Mal.
Erster Monolog
Ich habe mir die folgenden Worte gut überlegt.
Ich habe sie abgewogen, Tausende Male, weil ich sicher sein wollte, dass sie genug Gewicht haben. In alle Einzelteile habe ich sie zerlegt, sie betrachtet, sie gewälzt, in meinem Kopf. Geschliffen habe ich sie, gefeilt und glatt gerieben, ich habe sie abgeklopft, mein Ohr an ihren Klang gewöhnt und meine Stimme an ihre Aussprache.
Vier Wörter. Das muss reichen.
Nicht für den Anfang. Aber für das Ende.
Ich kann mich an das Lächeln erinnern, das der Spiegel mir zeigte, als ich sie zum ersten Mal sagte und hörte, diese vier Wörter. Ich lächle nicht oft, wirklich nicht, aber diesmal konnte ich nicht anders.
Sie fühlten sich sofort richtig an, gut. Sie wärmten mich, drängten sich nicht auf, nahmen sich nicht zu ernst und entfalteten doch ihre Wirkung.
Ein Gruß zum Abschied.
Das sollte es sein.
Und nun bist du es also, dem sie zufliegen, dir sollen sie gelten, dir flüstere ich sie ins Ohr. Sie werden beginnen, dich zu zerstören, ganz langsam, aber unaufhaltbar.
Komm also her und höre, was ich sage.
Denn ich habe mir die folgenden Worte gut überlegt.
Herzlich willkommen auf Chausey.
Beherrscht von den Gezeiten, gefangen inmitten des Wassers, das uns umschließt, wie das Schicksal seine Beute.
Wir riechen das Meer, hören die Möwen und die Kormorane und das Rauschen in unseren Köpfen, ich spüre das Flattern deines Herzens, du hörst meine Stimme, ich nehme deine Hand, du zerrst daran. Schließ die Augen so fest du kannst, lass dich von diesem Ort verzaubern, von der Stille um uns herum. Und weine ruhig, während ich dir das Blut von der Stirn wische. Du hättest dich nicht wehren sollen, es hat ja keinen Sinn. Wir sind ganz allein hier.
Du. Ich.
Und er.
Es ist dein erster Besuch auf dieser Insel und zugleich dein letzter. Wir beide wissen das und es macht uns zu Verbündeten. Der Wind zerrt an dir und die kalte Luft lässt dich zittern. Oder ist es etwa die Angst? Ich sehe es in deinem Blick, der nach Halt und Hoffnung sucht.
Aber, so leid es mir tut: Hier ist nichts, rein gar nichts, außer Wasser, Felsen, Schlick zwischen den Steinen, dornigen Sträuchern. Falls du einen Silberstreif am Horizont suchst, suchst du vergeblich.
Komm näher, hab keine Scheu! Fürchte dich nicht, es gibt keinen Grund dazu, zumindest jetzt noch nicht. Später wirst du dich ganz deiner Angst hingeben können, aber jetzt sollten wir den Moment genießen, er gehört nur uns!
Ich werde dir sagen, wer ich bin.
Wer ich wirklich bin.
Tut sie weh? Die Schlinge, meine ich. Ist sie dir zu fest? Reibt sie auf deiner Haut?
Folge mir einfach. Wir gehen diesen Pfad entlang, ich nehme dich an die Hand, damit du nicht ausrutschst. Wir sollten uns beeilen, wir haben keine Zeit zu verlieren, nicht eine Sekunde! Nicht hier, an diesem gottverdammten Ort, der mir alles genommen hat. Ich weiß, du hast Schmerzen, du bist erschöpft. Aber das ganze Schreien, der Rotz, der aus deiner Nase läuft, um Himmels willen, wofür soll das gut sein? Hier hört dich keiner, und wenn du so weitermachst, dann verpasst du alles.
Und glaub mir, das willst du nicht.
Jetzt nicht schwach werden, mein Gott, kann das denn so schwer sein … und du sollst nicht heulen! Ich habe schließlich auch nicht geheult. Geschrien habe ich, das ja, hinauf zu den Sternen. Ich habe geschrien, so laut, bis das Firmament geplatzt ist!
Aber jetzt musst du still sein. Sei ganz ruhig, der Tod ist nicht das Ende. Was für ein lächerlicher Gedanke. Wenn alles verrinnt, der Sand durch die Uhr läuft, die Zeit, das Leben sich dem Ende neigt, dann muss man hartnäckig sein. Nicht aufgeben. Warum gebt ihr nur alle so schnell auf?
Als wäre der Tod das Ende, so etwas Lächerliches! Das ist so schwachsinnig, dass es stinkt wie der abgeschnittene Kopf einer Makrele, der in der Sonne liegt, im Rinnstein, das Blut ist geronnen, er liegt dort seit einer Woche, die Fliegen sind dran, die Maden sind drin, er stinkt, dieser Fischkopf, aber keiner erbarmt sich seiner, sie lassen ihn dort liegen, und als die Augen, die ja längst zerfressen sind, als diese Augen sich plötzlich öffnen, da kriegt es keiner mit.
Und genau das ist das Problem!
Das Problem ist, dass keiner hinsieht, wenn der Tod etwas ausspuckt, es dem Leben zurückgibt. Etwas wie mich. Ich wurde ausgespuckt, der Tod wollte mich nicht.
Aber andere, die wollte er, und ich habe sie ihm gegeben, ich habe sie ihm geben müssen.
Erlaubst du, dass ich mich deshalb kurz verbeuge? Vor dem Leben, vor dem Tod, mit einem spöttischen Lächeln, weil Spott mir so gut steht.
Sieh dich ruhig um, während du mit der Schlinge kämpfst, und mit deinen Tränen. Du sagtest, du warst noch nie hier, das ist wirklich schade. Denn Chausey muss man immer zweimal sehen, bei Ebbe und bei Flut. Das wird dir nicht vergönnt sein, aber wir sollten nicht jammern, man kann nicht alles haben, nicht wahr?
Chausey.
Eiland im Meer. Insel im Wind. Archipel unter Wasser. Ein magischer Ort. Woran du das erkennst? Zum Beispiel daran, dass es ganz und gar wahr ist und eben kein Zufall: Chausey hat genauso viele Inseln wie das Jahr Tage. Unglaublich, oder?
365 Felsen, Inseln, Eilande, Brocken, nenn sie, wie du willst. Ich nenne sie: die Welt der Gezeiten. Magisch. Mystisch. Angsteinflößend.
Du willst wissen, warum wir hier sind? Warum so ungeduldig? Ungeduld ist eure größte Schwäche. Doch keine Sorge, du wirst bald alles erfahren. Viel mehr, als du je wissen wolltest.
Die Sonne ist untergegangen und das Wasser steigt, siehst du es? Die Gezeiten wissen, wie sie dieses Eiland erobern müssen: nicht im Sturm, nicht drängend und fordernd, vielmehr sachte, behutsam. In einer Stunde wird die Ebbe wieder von dieser Welt Besitz ergreifen, sie wird an den Steinen, an den Muscheln zerren. Diese eine Stunde aber haben wir noch.
Das wird reichen.
Jetzt aber ein bisschen schneller, wir haben getrödelt, hinein ins Wasser, das jetzt bereits knietief ist und weiter ansteigt. Unter unseren Füßen fliehen die Krabben, in stummem Protest. Eine Sandbank, ein Felsen. Hinter jedem Felsen auf Chausey steckt eine Geschichte, das darfst du niemals vergessen. Steinerne Gesichter, Fratzen, kleine Elefanten, ja, auch das.
Immer mehr Steine, scharfkantig, unser Blick geht aufs offene Meer, hinauf jetzt, hier ist es noch trocken. Alles geschieht in diesem Augenblick, nichts dürfen wir verpassen. Aber jetzt still!
Setz dich hierhin, hinter diesen Felsen, er schützt dich vor dem Wind. Sieh es mir nach, wenn ich jetzt nur noch flüstere, ich komme ganz dicht an dich heran, diese Worte gehören nur dir, keinem anderen! Hörst du mein Herz, spürst du es schlagen? Hier, leg deine Hand auf meine Brust. Du musst schon aufhören zu schluchzen, du hörst es sonst nicht! Ruh dich kurz aus, atme ein. Es ist jetzt so weit. Ich habe ein Geschenk für dich.
Ich bin der Mann, der dir die Augen öffnet.
Nimm meine Hand. Dreh dich um, ich führe dich. Siehst du das Wasser steigen? Siehst du die Möwen tanzen? Sie tanzen für dich, sie heißen dich willkommen auf Chausey, die Wellen, der Wind, die Möwen, der Tod und das Leben.
Hier hinter dem Felsen liegt es, das Geschenk, ich habe es gut verpackt. Du wirst dich freuen. So ist es gut, nicht stolpern, der Strick führt dich, er gibt dir Halt auf deinen letzten Metern.
Jetzt sind wir da.
Ein Kreis aus Steinen, mitten im feuchten Sand. Sie nennen ihn Cromlech de l’Oeillet, keiner weiß, warum er hier ist. Seit grauer Vorzeit gibt es ihn schon, und nun ist er mein Geschenk an dich.
Ich weiß, das überwältigt dich, ich sehe es in deinen Augen, aber warum weinst du nur?
Natürlich. Es muss die Freude sein.
Die Wiedersehensfreude.
Zerr nicht so an deinem Strick, er wird dich noch umbringen! Und das wäre nun wahrlich schade.
Komm, wir gehen näher heran, lass uns dein Geschenk betrachten, während du keuchst und nach einem Ausweg suchst, während du auf das blickst, was du nicht sehen willst. Aber du musst hinsehen, du kannst den Blick nicht abwenden von der Gestalt, die dort liegt. Inmitten dieses Kreises aus jahrhundertealtem Gestein. Das Wasser steigt, die Flut kommt und mit ihr die Erkenntnis, dass am Ende eben alles stirbt.
So einfach ist das.
Gefällt dir mein Geschenk? Genieße es, bald gehört es ganz dir. Genieß die Vorfreude, so wie ich sie seit Jahren spüre. Sieh nur, wie er dich anschaut, immer noch so stark, noch längst nicht gebrochen. Arme Kreatur.
Darf ich deine Haare zurückstreichen, dich küssen, während du zusiehst, wie dieser Mann stirbt?
Er wird dich verlassen, viel zu früh. Aber du brauchst ihn nicht mehr, glaub mir. Sieh ihn dir doch an, wie erbärmlich er da liegt, dem Tode geweiht, weil das Wasser steigt und er nicht mehr rufen kann, weil seine Stimme fort ist, aufgerieben vom Flehen um Hilfe.
Schau ihn dir an, deinen Helden. Deinen Krieger. Deinen Nicolas.
Wer ich bin, willst du wissen?
Ich bin der Mann, der dir die Geschichte seines Todes erzählt.
Von Anfang an.
Kapitel 1
Chausey, Normandie
Wenige Tage zuvor
Hallo, Dumbo.«
Sie legte ihre Hand auf die graue Haut des Elefanten, fuhr über die Furchen und Falten seines massigen Körpers, streichelte sanft über seinen Rücken. Dann umschloss sie den Kopf des Tieres mit beiden Armen und legte ihre Wange an sein rechtes Ohr.
»Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, nicht wahr?«, flüsterte sie. Der Elefant regte sich nicht, stoisch ertrug er die Liebkosungen, seine alten Gliedmaßen dem ewigen Wind ausgesetzt.
»Es war ein gutes Jahr, weißt du?«, sagte die Frau und sah ihm fest in die Augen. »Na ja, kein herausragendes, wir wollen mal nicht übertreiben. Aber ein wirklich gutes, doch, das kann man wohl so sagen, mein lieber kleiner Dumbo.«
Die Frau war etwa Mitte sechzig, sie trug ein leuchtend rotes Kopftuch. Ihre Füße steckten in gelben Gummistiefeln und gegen den Wind und die Kälte am Meer hatte sie sich eine dicke Segeljacke übergezogen.
Sie und der Elefant kannten sich seit vielen Jahren. Genau genommen seit mehr als drei Jahrzehnten, seit sie zum ersten Mal hierhergekommen war, zusammen mit Rémy, der nun etwas weiter unten am Strand stand, genüsslich seine Pfeife stopfte und dabei zufrieden auf das Meer hinausblickte.
Immer wieder fuhren ihre Hände über den Rücken des Tieres, ihre Finger glitten über kleinste Erhebungen, tätschelten die Flanke, sanft berührte sie die Ohren und die dunkle Stelle zwischen den Augen. Sie lehnte sich an das Tier, schloss die Augen und spürte den Wind in ihrem Gesicht, die schwache Wintersonne auf ihrer Haut.
Sie seufzte.
»Den Kindern geht es gut, Dumbo. Jeanne hat ihren zweiten Sohn bekommen, er heißt Max, ein kurzer Name, ich hätte ja einen längeren bevorzugt. Aber er ist ein ganz süßer Fratz. Du wirst ihn bestimmt bald kennenlernen.
Benoît hat eine neue Stelle bekommen, in seiner Firma. Ich weiß immer noch nicht genau, was ein Prokurist macht, aber offenbar verdient er genug, um seiner Familie ein Ferienhaus bei La Rochelle kaufen zu können. Es ist ein schönes Haus, größer als unseres! Dabei ist es nur für die Ferien, ich meine, sie sind kaum da, kannst du dir das vorstellen? Aber ich will mich nicht beschweren, es ist schön dort mit den Kleinen. Wobei, so klein sind sie längst nicht mehr. Seine Älteste, Aurore, hat ihren ersten Freund. Kann man das glauben? Das Leben fliegt nur so dahin. Nur du, Dumbo, du bist immer hier, veränderst dich nicht im Geringsten. Das mag ich so an dir.«
Sie blickte dem Elefanten in die steinernen Augen, fest und entschlossen, so wie jedes Jahr zum Abschluss ihres kleinen Besuchs.
»Wünsch mir ein gutes nächstes Jahr, Dumbo, ja? Ein gesundes, für mich und Rémy. Die Rente bekommt ihm übrigens gut, wer hätte das gedacht?«
»Audile, wollen wir weiter? Der Wind frischt auf!«
Sie lächelte das Tier an und legte ein letztes Mal wehmütig ihren Kopf an seine Stirn.
»Au revoir. Wir sehen uns in einem Jahr. Mach mir keinen Unfug bis dahin. Und ich mache auch keinen. Na ja, vielleicht ein bisschen. Wir wollen ans Nordkap, Rémy und ich, kannst du dir das vorstellen? Im Wohnmobil, die Toissonts, unsere Nachbarn, die haben das gemacht, und es muss wirklich …«
»Audile, mir wird langsam wirklich kalt!«
Sie rollte mit den Augen, lächelte und tätschelte zum Abschied die Wange des Elefanten.
»Also wirklich, oder? Harte Kerle gibt es auch immer weniger. Aber man kann nicht alles haben, nicht wahr, Dumbo? Rémy jammert heute ein bisschen, er hat sich den Magen verdorben. Na ja, das geht auch vorbei. Au revoir, kleiner Elefant.«
Vorsichtig löste sie sich von dem Tier, ihre Füße suchten nach sicherem Tritt. Mit einiger Mühe stützte sie sich auf einem der scharfkantigen Felsen auf, ging in die Hocke und rutschte ein Stück auf dem kalten Stein hinab. Als sie kurz hochschaute, sah sie, dass der Himmel noch immer von jenem Blau war, wie es nur im Winter und am Wasser möglich war. Sie lächelte bei dem Gedanken an einen warmen Tee an Bord der Fähre und klopfte sich den Sand von der Hose, als sie die beiden großen Felsen, die die Form eines kleinen Elefanten hatten, hinabgeklettert war.
Als sie schließlich auf dem Strand stand, wo sie ihre Umhängetasche auf einem kleinen Stein abgestellt hatte, sog sie die frische Luft ein und spürte das Salz in ihrer Nase. Sie sah Rémy, der drüben am Wasser stand, ihr zuwinkte und dabei an seiner Pfeife zog.
Ja, es war ein gutes Jahr gewesen, zweifelsohne. Endlich keine Dienstreisen mehr, keine einsamen Abende in ihrem Haus, Abschiede am Morgen, Begrüßungen am übernächsten Abend, Telefonate, Mails, Kurznachrichten. Sie hatten zu viel verpasst, dessen waren sie sich beide bewusst geworden, und nun stand sie hier, so wie immer gegen Ende eines Jahres, und sie freute sich auf alles, was nun kommen würde.
Die Zeit mit ihrem Mann. Das Nordkap. Die Enkelkinder. Den Herbst ihres gemeinsamen Lebens.
»Na gut, Spätherbst«, murmelte sie, griff nach ihrer Tasche und drehte sich ein letztes Mal um.
Der Elefant von Chausey war in jedem Reiseführer zu finden. Eine Felsformation, von Wind und Wellen im Laufe der Jahrhunderte geformt, ein uraltes Geschöpf der Gezeiten. Den Rüssel noch oben gestreckt, die Spitze leicht eingerollt, die großen Ohren flach angelegt.
Dumbo, so hatte sie ihn für sich getauft, als sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte, vor mittlerweile mehr als dreißig Jahren.
Sie liebte diesen Ort, die Grande-Grève, im Nordwesten der Hauptinsel, den Blick hinaus auf das Meer, hinüber zu den vorgelagerten Felsen: La Gentaie, Le Vieux, La Meule. Das Geräusch der Möwen, die über den Austernbänken kreisten, die kleinen Fischerboote, die bei Ebbe in den Buchten lagen.
Sie sah den Rauch aus Rémys Pfeife, seine Mütze, die leicht schief auf seinem Kopf saß, sie lächelte, weil jetzt, hier, in diesem Moment, alles gut war.
»Das wird ein gutes Jahr«, sagte sie leise vor sich hin.
Als sie ein Knacken hinter sich hörte, drehte sie sich überrascht um.
La Grande-Grève war der größte Strand der Insel, da er aber etwas abseits der Pfade lag und ein gutes Stück entfernt von den Häusern, dem Hotel und dem Restaurant am südlichen Ende der Hauptinsel, waren sie meist allein, wenn sie ihren Spaziergang machten.
»Unser Fazit-Spaziergang«, so hatte Rémy ihren jährlichen Ausflug nach Chausey mal getauft, und sie fand, dass es eine gute Bezeichnung war.
Wie war das Jahr? Wie wird das neue? Was hat dich gestört? Was wünsche ich mir?
Sie besprachen ihre Gedanken, ihre Sorgen und Pläne. Offen und ehrlich, so gut das eben ging in einer Ehe, die schon so viele Jahre Bestand hatte. Gute Jahre, alles in allem.
Und immer kletterte sie die Felsen hinauf, zu ihrem Elefanten. Aber jetzt knackte es hinter ihr, und Audile hatte das Gefühl, beobachtet zu werden. Sie sah hinüber zu Rémy, aber der schaute aufs Wasser hinaus und suchte dort, jenseits des Horizonts, nach den gleichen Antworten wie sie bei ihrem Elefanten.
Plötzlich fiel ein Schatten neben ihr auf den Sand, und ohne Vorwarnung kam ein Mann hinter einem der Felsen hervor, nur wenige Meter von ihr entfernt.
Sie erschrak sich so sehr, dass sie kurz aufschrie und ihre Tasche festhielt. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Rémy herumwirbelte und in ihre Richtung blickte.
»Würden Sie bitte einen Schritt zur Seite gehen?«
Perplex sah sie den Mann an, der jetzt wenige Meter vor ihr stand und ihr zu ihrer Überraschung den Rücken zuwandte. Er war groß und spindeldürr.
»Bitte, würden Sie einen Schritt zur Seite machen? Es ist ohnehin schon schwer genug, sich alles zu merken. Es wäre wirklich ärgerlich, wenn ich wieder von vorne anfangen müsste.«
Sie war so überrumpelt, dass sie tat, was er verlangte.
»14. Aha. Und hier noch einer. 15. Das macht mit denen dahinten … Moment … 37.«
Der Mann ging mit langsamen Schritten auf sie zu, allerdings rückwärts und mit nach vorne gebeugtem Kopf. Sein Blick wanderte über den Sand, er murmelte immer wieder Zahlen, während ein schweres Fernglas, das an seinem Hals baumelte, ihn immer weiter nach unten zu ziehen drohte. Auf seinem Kopf saß ein khakifarbener Hut mit breiter Krempe, der seltsamerweise im Nacken verlängert war, als solle er seinen Besitzer möglichst gut gegen die Sonne schützen.
Ein Tropenhut, dachte sie. Der Mann trug tatsächlich einen Tropenhut.
»37 also … 37. Das dachte ich mir, ich muss mir das, wo habe ich nur …«
Sie sah, wie er etwas suchte, in den Taschen seiner viel zu großen Weste, in seiner Hose, und wie er schließlich hinter seinem linken Ohr einen abgekauten Bleistift hervorholte. Als er schließlich, schnaufend und schwer atmend, neben ihr zum Stehen kam, sah sie, dass er Sommersprossen im Gesicht hatte und dass unter seinem seltsamen Hut rote Haare abstanden.
Er war schätzungsweise Mitte dreißig. Er musterte sie kurz.
»37 plus 26?«
»63«, antwortete sie wie aus der Pistole geschossen, Kopfrechnen war schon immer ihre Stärke gewesen.
Er nickte zufrieden. »Dachte ich mir.« Dann blickte er wieder zu Boden.
»Was machen Sie da?«, fragte sie ihn verdutzt, während sie Rémy ein Zeichen gab, dass alles in Ordnung war.
Doch der Mann machte eine fuchtelnde Handbewegung.
»Pssst! Kein Wort.«
»Was … was meinen Sie?«, fragte sie ihn verwundert und betrachtete mit wachsender Belustigung die seltsame Gestalt, die wie aus dem Nichts aufgetaucht war, rückwärtsging und mit ihrem Tropenhut so wenig nach Chausey passte wie … ein Elefant.
Der Mann hob jetzt den Kopf und zeigte nach oben. Sie tat es ihm gleich und sah einen Vogel, der krächzend über ihnen am Himmel kreiste.
»Eine Möwe«, stellte sie fest.
Er seufzte.
»Wenn das eine Möwe wäre, wäre ich nicht hier. Das ist eine Brandseeschwalbe. Sie ist selten und eigentlich nistet sie vermehrt an Steilküsten, aber ich dachte mir gleich, dass ich hier etwas ganz Besonderes vorfinden würde. Diese Insel ist magisch, wussten Sie das? Ein einziger Ort der Magie!«
Sie nickte und lächelte ihn an.
»Das finde ich auch. Entschuldigung, wenn ich die …«
»Brandseeschwalbe.«
»Genau, wenn ich Ihre Brandseeschwalbe für eine Möwe gehalten habe.«
Er sah sie an. Dann streckte er ihr seine Hand entgegen.
»Ich bin Olivier.«
Sie zögerte kurz, dann gab sie ihm die Hand.
»Audile. Was machen Sie da eigentlich? Ich meine, Sie gehen rückwärts …«
»Strandläufer«, unterbrach er sie.
»Wie bitte?«
»Ich zähle Strandläufer. Das ist mein Job hier. Also seit gestern. Ich bin gestern hier angekommen.«
Langsam begriff sie.
»Sie sind Ornithologe?«
Lächelnd neigte er den Kopf.
»Derzeit bin ich wohl Vogelzähler. Ich wohne dort hinten in dem Haus in den Dünen.« Mit einem dürren Finger zeigte er in Richtung der Hügel.
»Und wie viele haben Sie bereits gezählt?«, fragte sie ihn belustigt.
»64.«
»Waren es nicht 63?«
»Richtig«, sagte er sichtlich genervt. »63. Ich folge ihren Spuren im Sand und seltsamerweise sind sie für mich besser zu erkennen, wenn ich rückwärtsgehe.«
»Ich verstehe.«
»Das bezweifle ich.«
»Wie meinen Sie das, ich …«
»Audile, komm mal! Das musst du sehen!«
Rémys Ruf drang durch die kalte Luft zu ihnen herüber und als wäre es ein Signal zum Aufbruch gewesen, reichte ihr der Vogelschützer die Hand und verbeugte sich.
»Es hat mich gefreut«, sagte er. »Und danke für das Rechnen. Damit habe ich es nicht so.«
»Dann wird es aber keine einfache Aufgabe«, sagte sie.
»Audile!«
Der Mann legte den Kopf schief und sah sie ernst an.
»Das ganze Leben ist keine einfache Aufgabe, meine liebe Audile. Gehen Sie zu Ihrem Mann, er ruft Sie.«
Verdutzt sah sie ihm hinterher, als er rückwärtsgehend zwischen den Felsen verschwand.
»Meine liebe Audile … was fällt dir ein, du Grünschnabel?«, murmelte sie und drehte sich schließlich zum Wasser, vor dem ihr Mann stand und aufgeregt winkte.
»Was hast du?«, rief sie, während sie durch den Sand zu ihm stapfte. Sie nahm sich vor, die seltsame Gestalt von eben schnellstmöglich zu vergessen.
»Wer war das?«, fragte Rémy, als sie bei ihm ankam. Er hustete kurz und hielt sich mit gequältem Blick den Bauch.
»Ach, ein komischer Kauz, nicht der Rede wert. Was hast du? Und was macht dein Magen?«
»Der rebelliert, mir ist speiübel, seitdem wir auf die Insel gekommen sind. Aber das geht bestimmt vorbei, ich trinke an Bord einfach noch einen Schnaps, der wird mir helfen. Es müssen die Muscheln im Restaurant gewesen sein.«
Audile sah sich um.
Dies war Rémys Stelle, hier stand er Jahr für Jahr, blickte hinaus aufs Meer, zum Horizont und zu den zerklüfteten Felsen, er sah den Wellen hinterher, er ließ das Wasser auf sich zurollen, lauschte der leichten Brandung und den Geräuschen der Vögel.
Sie wusste, dass er dabei oft an seine Krebserkrankung dachte. Die gekommen und gegangen war, die sie gemeinsam besiegt hatten, vor zehn Jahren.
Wie war das Jahr, wie wird es werden?
Wovor haben wir Angst?
Was wünschen wir uns?
Sie nahm seine Hand und küsste ihn.
»Deinen Magen kriegen wir wieder hin, auch wenn du tatsächlich ein wenig blass aussiehst. Hast du schon eine Antwort darauf bekommen, was das nächste Jahr für uns bereithalten wird? Bekomme ich endlich einen feurigen Liebhaber? Und du eine Modelleisenbahn?«
»Werd nicht frech!«, drohte er scherzhaft und zeigte auf eine Stelle im Wasser, keine zehn Meter von ihnen entfernt. Dorthin, wo eine Flasche sachte auf den Wellen tanzte. In ihrem Innern konnte Audile ein Stück Papier sehen.
»Eine Flaschenpost!«, rief sie entzückt und reichte Rémy ihre Tasche. »Die Insel hat uns einen Brief geschrieben. Der Name meines feurigen Liebhabers steht drauf, ich bin mir ganz sicher!«
Vorsichtig schritt sie durch das flache Wasser und freute sich, dass sich die Entscheidung für die Gummistiefel gelohnt hatte.
Die Flasche war noch einige Meter entfernt, sie konnte jetzt sehen, dass das Papier zusammengerollt war. Sie spürte eine kindliche Vorfreude auf ihre Entdeckung und überlegte, was dort wohl stehen würde.
Vielleicht die Geburtstagswünsche eines kleinen Jungen. Eine Liebesbotschaft, ins Meer geworfen von einem Teenagerpaar von den Felsen von Granville, wo die jungen Leute abends saßen, hinter sich den Leuchtturm und vor sich die endlose Weite des Meeres.
Und Chausey, vom Festland aus gerade noch am Horizont erkennbar.
Es war eine Weinflasche, wenn auch jegliches Etikett fehlte. Sie griff danach, zog sie aus dem kalten Wasser und war nach einigen entschlossenen Schritten zurück bei ihrem Mann.
»Und?«, fragte er.
»Na, nun warte doch ab, ich kann nicht hellsehen! Komm, wir setzen uns dahinten auf den Felsen.«
Der Korken saß tief im Hals der Flasche, und sie hatten einige Mühe, ihn herauszuziehen. Kurzerhand nahm Audile ihn in den Mund und zog ihn mit den Zähnen heraus.
Neugierig blickten sie beide in die Flasche und auf die Papierrolle.
»Was glaubst du, was draufsteht?«, fragte Rémy leise.
»Vielleicht ist es eine Schatzkarte!«, flüsterte sie zurück.
»Ein ausgefüllter Lottoschein mit sechs Richtigen.«
»Eine Nachzahlung vom Finanzamt.«
»Die Telefonnummer von Brigitte Bardot.«
Sie lachte und drehte die Flasche um, schüttelte sie leicht und ließ die kleine Papierrolle herausrutschen.
»Das wird ein gutes neues Jahr, wenn das alte so spannend endet«, sagte sie und küsste ihn.
Und im Nachhinein würde sie denken, dass sie niemals falscher gelegen hatte, als in diesem Moment.
»Nun mach es nicht so spannend«, sagte sie, als Rémy langsam das Papier aufrollte.
Sie sah, wie er kurz die Stirn runzelte und seine Augen sich erstaunt weiteten. Wie er das Papier vollständig ausrollte. Und dann sah sie die Angst in seinem Blick.
»Rémy, würdest du mir bitte sagen, was draufsteht? Du weißt, ich kann sehr ungeduldig sein, und …«
»Ich verstehe das nicht«, sagte er leise, hustete kurz und schüttelte den Kopf. »Das ist … das muss …«
»Rémy, würdest du mir jetzt bitte …«
Sie hatte mit einem Mal das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren.
»Das kann nicht …«, sagte er und als sie es nicht mehr aushielt, riss sie ihm das Papier aus der Hand.
»Nun, zeig schon, was steht …«
Dann wurde sie still.
Rémy war aufgestanden und schaute sich um, drehte sich im Kreis, suchte etwas, während er sich erneut stöhnend den Bauch hielt.
Aber sie waren allein am Strand der Grande-Grève, der Hauptinsel von Chausey, dieser einsamen Inselwelt am äußersten Rande der Normandie.
Nur sie beide und eine Flaschenpost.
»Was soll das bedeuten …«, murmelte Audile und bekam eine Gänsehaut. Der Wind war abgeflaut, die Sonne beschien den Felsen, auf dem sie saßen.
In einer Stunde würden sie die Fähre zurück nehmen, so wie jedes Jahr. Zurück in ihr Leben, mit den Kindern, den Enkelkindern, mit dem Nordkap und dem Ferienhaus bei La Rochelle.
Rémy Marchand.
In dunklen Lettern stand am oberen Rande des Papiers der Name jenes Mannes, der neben ihr am Strand von Chausey saß, so wie er es seit so vielen Jahren tat. Sie griff nach seiner Hand, als fürchtete sie, dass er fortgezogen werden könnte, von einer unheilvollen Kraft, die von dieser Flaschenpost ausging. Von dieser Botschaft, von der sie nicht wusste, was sie zu bedeuten hatte.
Rémys Hand war kalt, er fror, genau wie sie.
»Da hat sich jemand einen dummen Scherz erlaubt«, murmelte sie und merkte dabei, wie ihre Stimme von der Stille um sie herum fast verschluckt wurde. Dann rollte sie das Papier ganz auf und blickte erstaunt auf vier weitere Namen.
Allesamt Männer, die Namen sagten ihr nichts.
»Kennst du davon jemanden?«, fragte sie und hielt Rémy das Papier hin.
Er nickte kurz und deutete auf den Namen, der direkt unter seinem eigenen stand.
»Er hier, das ist … das ist seltsam. Ein ehemaliger Geschäftspartner, du hast ihn mal bei einem Essen kennengelernt, glaube ich. Mein Gott, mir ist wirklich schlecht.«
Audile sah sich um, stand auf, ging ein paar Schritte den Strand entlang, um eine bessere Sicht zu haben. Sie drehte sich nach allen Seiten, sucht die Büsche, den Pfad, die umliegenden Felsen mit ihrem Blick ab.
Doch sie waren allein. Auch Olivier, der seltsame Vogelkundler, war nicht mehr zu sehen.
»Mir ist kalt, lass uns zur Fähre gehen«, sagte sie schließlich und Rémy nickte ihr zu.
Noch einmal betrachtete sie das Papier in ihrer Hand. Es war gutes Papier, dicker als ein normales Blatt, sie vermutete, dass es teures Briefpapier war. Die fünf Namen waren mit schwarzer Tinte geschrieben, in schwungvollen Lettern.
Einige Minuten später war der Strand leer. Zurück blieben nur einige wenige Fußspuren im Sand. Die Fähre nach Granville fuhr in einer knappen Stunde zurück und Chausey würde noch ruhiger werden. Und dann würde die Flut zurückkommen und die letzten Spuren im Sand auslöschen, als hätte es sie nie gegeben.
Nur ein grauer Felsen würde sich absetzen vom blassen Himmel, weil er hoch genug stand, um hier, im Nordwesten der Hauptinsel, nicht in der Flut zu versinken. Eine Gesteinsformation, die sie »Den Elefanten« nannten: die Ohren angelegt, den Rüssel eingerollt, den Blick aufs Meer gerichtet.
Kapitel 2
Théâtre des Champs-Élysées, Paris
Am Abend
Nicolas Guerlain nahm seine Hand vom Polster des leeren Sessels neben ihm und blickte sich um. Applaus erklang, schwoll an, schwebte zur Decke, während der Dirigent auf der Bühne seine Schultern straffte und den Taktstock hob. Die erste Geige nickte unmerklich, am schwarz glänzenden Flügel in der Mitte der Bühne schloss ein junger Pianist kurz die Augen, seine schmalen Hände lagen auf den Tasten. Es war sein Abend, sein großer Auftritt.
Nicolas hörte, wie jemand durch die Reihen kam, in letzter Sekunde. Knie wurden angezogen, Hüften verdreht, um Platz zu machen. Eine ältere Dame zischte verärgert.
Julie erreichte den Platz neben ihm und setzte sich. Sie sah müde aus, Nicolas wollte nach ihrer Hand greifen, zögerte aber, bis es schließlich zu spät war. Noch oft würde er sich fragen, warum er es nicht getan hatte: Sie mehr berühren, sie trösten, ihr zeigen, dass er für sie da war. Aber dann würde es zu spät sein und die Dinge würden ihren Lauf genommen haben.
Die Musiker setzten ihre Instrumente an, eine gespannte Stille lag über dem Raum. Nicolas stellte sich vor, wie Julie sich doch noch schnell zu ihm hinüberbeugte und ihm einen Kuss gab.
»Ich habe doch gesagt, ich bin gleich wieder da.«
Aber sie blieb stumm, wie so oft in diesen Tagen, die ihm bleischwer vorkamen. Der Taktstock senkte sich, die ersten Töne erklangen, und als Nicolas zur Seite blickte, da sah er, dass Julie weinte, still und leise, nur für sich.
Und er hatte das Gefühl, nichts dagegen tun zu können.
Dabei war dies ihr Tag, ihr gemeinsamer Abend. Er hätte unbeschwert sein sollen, voller guter Erinnerungen, während sie dem Konzert lauschten. Einander berührend, sein Daumen, der sanft über den Ärmel ihres Abendkleides strich, verstohlene Blicke, Gedanken an früher, der erste Kuss in den Kabinen von Deauville, ein junges Leben, gemeinsam begonnen, gemeinsam beschlossen, niemals getrennt.
So sollte es sein.
Eine Nacht, in der sie sich in die Arme nehmen würden, wenn die letzte Note verklungen war, und danach gemeinsam durch die Lichter der Stadt schlendern.
So sollte es sein.
Aber so war es nicht.
Weil ein ungebetener Gast sich stattdessen zu ihnen gesellt hatte, aufdringlich und penetrant, und nicht bereit, ihnen je wieder von der Seite zu weichen.
Rachmaninoff, Klavierkonzert in c-Moll.
Ehrfurcht hatte sich im Théâtre des Champs-Élysées breitgemacht, die Violinen schickten Klanggemälde durch den Raum, sinnlich und hingebungsvoll. Nicolas jedoch hörte nur das leise Schluchzen neben sich. Er drehte sich zu Julie und nahm sie schließlich doch in den Arm. Sie legte den Kopf an seine Schulter, und er wusste, dass sie nach Halt suchte, nach Kraft, doch zugleich wusste er, dass er ihr nichts davon geben konnte.
Fast fünf Jahre waren mittlerweile vergangen, seitdem die Frau an seiner Seite, seine Jugendliebe und engste Vertraute, in genau diesem Konzertsaal gesagt hatte: »Ich bin gleich wieder da.«
Dann war sie verschwunden, spurlos, und er hatte sie gesucht und war daran fast zerbrochen. Er hatte sie gesucht wie ein Phantom, hatte seinen Job als Personenschützer der französischen Regierung darüber fast verloren, hatte den heutigen Staatspräsidenten vor den Augen der Öffentlichkeit niedergeschlagen, aus Versehen, weil er geglaubt hatte, Julie gesehen zu haben. Er hatte sich seinem Vater gestellt, dem übermächtigen Geist aus seiner Vergangenheit. Er hatte lose Enden eingesammelt, sie zu einem festen Tau zusammengebunden, er hatte Julie nie aufgeben wollen.
Und dann, als die Hoffnung geschwunden war, als jedes Licht erloschen schien, da war sie plötzlich wieder da gewesen, blass und mit schwarz gefärbten Haaren, zurück von einem Auftrag, den ausgerechnet sein eigener Vater als Chef des Inlandsgeheimdienstes ihr aufgebürdet hatte. Dann eine kurze Nacht im Hotel, ein Anschlag, den sie in letzter Sekunde gemeinsam vereitelt hatten.
Und doch war es auch dann nicht vorbei gewesen, es war alles nur noch schlimmer geworden. Erneut wurde Julie ihm entrissen, eingesperrt für eine Tat, die sie nicht begangen hatte. Und wieder hatte Nicolas den Spaten in die Hand genommen, hatte den Acker umgegraben, hatte den steinharten Boden mit seinen Händen aufgerissen, bis seine Fingerkuppen bluteten. Und Julie kam frei und das Leben funkelte, für einen ganz kurzen, aber sehr entschlossenen Moment. Eine Liebe unter den Sternen von Paris. Endlich wieder vereint, kaum zu fassen.
Nur wenige Tage war es her, da hatte sich vor Julies Augen eine alte Frau erschossen, auf den Holzbohlen am Strand von Deauville. Sie hatte Julie ein Abschiedsgeschenk hinterlassen, die letzten Worte einer gebrochenen Mutter im Angesicht des Todes.
»Es ist Ihre Schuld. Das alles.«
Es waren diese Worte, von denen Nicolas sofort wusste, dass sie zu viel waren für Julie. Ein letztes Gewicht auf dem Weg in die Tiefe. Ein Windstoß, der eine Kerze erstickte, die ohnehin fast bis auf den Stumpf niedergebrannt war.
Und jetzt saßen sie hier, an ihrem gemeinsamen freien Tag. Ein Abend im Konzert, eine Reise zurück in die Zeit, eine Erinnerung an bessere Tage. Nicolas nahm Julies Hand.
»Ich bin da«, flüsterte er.
»Ich weiß. Es ist nur …«
»Es wird vorbeigehen. Du wirst sehen, es wird vorbeigehen.«
Doch das klamme Gefühl in seinem Inneren blieb, die vertraute Wärme wollte sich nicht einstellen. »Wir machen dir morgen einen Termin«, sagte er leise. »Du musst mit jemandem reden.«
Sie nickte und er wusste, dass sie nicht reden wollte. Sie wollte schweigen, grübeln, und er musste das verhindern, aus Angst vor dem, was dabei herauskommen könnte.
Der Tag hatte eine erste schlechte Wendung genommen, als Nicolas’ Teamleiter, Gilles Jacombe, ihm verkündet hatte, dass er seinen freien Abend nun doch in Begleitung des Staatspräsidenten würde verbringen müssen.
»Das ist nicht dein Ernst, Gilles!«, hatte Nicolas leise in sein Mikro gesprochen, während er gegen Mittag den Eingang eines Nobelhotels an der Place Vendôme gesichert hatte, aus dem François Faure gleich nach einem Essen mit dem Britischen Botschafter kommen würde.
»Tut mir leid. Kurzfristige Änderung.«
»Ich brauche diesen Abend, Gilles«, hatte er geantwortet. Gilles war nicht nur sein Teamleiter, er war auch sein Mentor. Gewissermaßen hatte er ihn entdeckt, er war es gewesen, der Nicolas’ Talent erkannt und gefördert hatte.
Er hatte es bis in das innerste Sicherheitsteam des französischen Staatspräsidenten geschafft, ein normalerweise geschlossener Kreis für die talentiertesten Personenschützer des Landes.
Und selbst unter ihnen war Nicolas einer der Besten.
»Ich weiß«, hatte Gilles gesagt und ihn schnell beruhigt. »Carole, Bertrand und ich kriegen das hin, wir werden ein weiteres Team dazubekommen. Es ist eine spontane Änderung im Terminplan.«
»Faure steht doch gar nicht auf klassische Musik. Er hält Rachmaninoff vermutlich für einen teuren Wodka.«
»Aber seine Frau … die versteht etwas davon. Und sie will ihn spontan ins Konzert entführen.«
Nicolas hatte gelächelt, weil er um die Sympathie seines Teamleiters für Hélène Faure wusste. Sie war eine einsame, in sich gekehrte Person, die in Gilles Jacombe, dem Sicherheitschef ihres Mannes, immer einen klugen Gesprächspartner gefunden hatte und dem sie sich im Lauf der Jahre, die sie jetzt schon gemeinsam an François Faures Seite verbrachten, immer mehr anvertraut hatte.
Faure war ein strahlender, das Leben heftig umarmender Staatspräsident. Ein Mann, der seine Wirkung auf Menschen kannte und der mehr als jeder andere wusste, welche Türen die Macht ihm öffnete. Mehr als einmal hatten sie ihn aus einer fremden Wohnung oder einem spontan gebuchten Hotelzimmer abgeholt.
Und deutlich mehr als einmal hatte seine Frau diese Tatsache mit einem großen Glas Weißwein hinuntergeschluckt. Der Schatten, in den sie sich immer mehr zurückzog, bot ihr Schutz, dennoch waren ihr die Spuren eines Lebens an der Seite dieses Mannes deutlich anzusehen.
»Abfahrt in fünf Minuten. Zurück in den Élysée-Palast und dann hast du frei, Nicolas. Lass dich nicht von uns stören, genießt den Abend. Die beiden werden oben in der Loge sitzen, ihr werdet uns nicht bemerken.«
Eine Stunde später hatte Nicolas sich aufgemacht, hatte Julie abgeholt, sie waren essen gegangen, in einem kleinen Restaurant im Marais, hatten geredet, sie hatten gelächelt, geschwiegen, geflüstert, hatten Klippen umschifft und Blicke ausgetauscht, die voller Hoffnung waren. Und sie hatten beide gewusst, dass das Leben es ihnen so einfach nicht machen würde.
Ganz im Gegenteil.
Rachmaninoff. Klavierkonzert in c-Moll.
Es war eines von Julies Lieblingsstücken, jedoch klang die Musik für Nicolas plötzlich seltsam gedämpft. Am Klavier saß eines jener vielgepriesenen Talente aus Fernost, Nicolas sah die Finger über weiße Tasten fliegen, er sah den Blick der Violinen, fest auf das Notenblatt geheftet, sah den Taktstock des Dirigenten in der Luft, schloss die Augen und wünschte sich, dass alles stillstünde.
»Ich bin da«, flüsterte er und spürte, wie die Musik in den Hintergrund trat, weil etwas anderes in seinem Innern an die Oberfläche drängte. Etwas wie … eine Vorahnung.
Langsam hob Nicolas den Kopf und warf einen Blick nach hinten. Im zweiten Rang des in Gold und Rot gehaltenen Konzertsaales waren einige Logen untergebracht. Er hatte beim Betreten des Saales sofort gewusst, in welcher Loge der Staatspräsident mit seiner Frau saß, aus einem ebenso trivialen wie ärgerlichen Grund. François Faure hatte nicht nur wenig übrig für die Schönheit klassischer Musik, sondern auch kein Gespür für angemessenes Verhalten in einem solchen Konzertsaal.
»Hier ist es viel zu warm. Kaum auszuhalten.«
Wie oft hatten sie diese Worte gehört, bei Empfängen und Konzerten, in Theatern und festlichen Sälen in ganz Europa. Und wie oft hatte Faure einfach beschlossen, sein Jackett auszuziehen und es über einen Stuhl oder einen Sessel zu legen. Oder eben über die Balustrade einer Loge in einem eleganten Konzertsaal in der Avenue Montaigne.
Nicolas erahnte den Schatten eines Mannes im hinteren Teil der Loge, vermutlich Gilles, sein Teamleiter. Er vermutete, dass Bertrand unmittelbar vor der Tür im Gang stehen würde und Carole Adams einige Meter weiter, um jede Person, die an den Logen vorbeiging, vorab zu überprüfen und gegebenenfalls eine kurze Warnung weiterzugeben.
»Entspann dich«, sagte er leise zu sich selbst. Er hatte heute Abend frei, neben ihm saß Julie, er spürte ihre Wärme.
Aber die Musik blieb gedämpft, die Empfindung ging nicht fort. Nicolas wurde unruhig, ohne zu wissen, warum.
»Alles okay?«, flüsterte Julie neben ihm und legt ihm eine Hand auf den Arm.
»Ja«, sagte er und dachte dabei genau das Gegenteil.
Weil irgendetwas nicht stimmte.
Die Geigen vereinten sich zu einem traurigen und doch triumphalen Klangbild, die Finger des jungen Mannes am Flügel flogen über die Klaviatur, Nicolas konnte ein Lächeln auf den Lippen des Dirigenten sehen. Es war ein schweres Stück, ein kompositorisches Meisterwerk, und in einer der Logen saß der Staatspräsident.
Dramatik, Spannung. Das erste Stück endete in einem ersten, frühen Finale, die Musik füllte den Saal ganz aus. Nicolas spürte förmlich den Wunsch des Publikums, bereits jetzt in tosenden Applaus auszubrechen.
Der Pianist atmete kurz durch, fuhr sich durch sein Haar, nickte knapp in Richtung des Dirigenten, legte seine Hände zurück auf die Klaviatur und wartete.
Nicolas drehte sich um. Er wusste nicht, warum. Das Gefühl, beobachtet zu werden, eine Bewegung im Augenwinkel, ein heller Fleck in der Dunkelheit.
Nicolas sah die junge Frau wenige Reihen schräg hinter sich, er konnte ihr Gesicht erkennen, hinter den Köpfen einiger anderer Konzertbesucher. Weil es heller, weil es hübscher war als die anderen.
Und weil sie ihn anlächelte.
Er erkannte sie sofort.
Marie.
»Warum schließt sich der Vorhang?«, flüsterte Julie neben ihm, aber Nicolas antwortete nicht, obwohl er sich ebenfalls wunderte, warum nach dem ersten Stück der rote Stoff zugezogen wurde.
Erstauntes Murmeln erhob sich im Saal.
Marie.
Sein Puls stieg an, Nicolas spürte die aufkommende Unruhe im Saal.
Der Vorhang schloss sich normalerweise nicht nach einem ersten Stück, einem ersten Teil, einem ersten Satz. Das wussten hier alle.
Heute passierte aber genau das.
Und Marie lächelte ihn an. Es war eine Warnung, das wusste Nicolas sofort.
»Au revoir, Bodyguard.«
»Das würde mich wundern. Aber gut: Au revoir, Marie.«
Dann war sie verschwunden, abgetaucht im kalten Hafenbecken von Le Havre, in das Nicolas sie wenige Momente zuvor hineingerissen hatte. Nachdem sie wiederum versucht hatte, splitterfasernackt auf den Präsidenten zuzurennen.
»Sexiste!« Das hatte in blutroten Lettern auf ihrer Brust gestanden.
Nicolas hatte sie in letzter Sekunde aufgehalten. Und sie dann laufen lassen, abtauchen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, aus einem Gefühl heraus, Mitleid vielleicht, Sympathie, er hatte nicht darüber nachgedacht, er hatte einfach gehandelt und sie entkommen lassen.
Es war nicht lange her.
Und nun war Marie hier, im Théâtre des Champs-Élysées, in einem Saal mit dem Staatspräsidenten, den sie so sehr verachtete. Nicolas sah ihre Sommersprossen, ihr schulterlanges Haar, das sie offen trug, und ihr schlichtes, aber elegantes rotes Kleid.
Sie sah umwerfend aus.
Sie deutete in Richtung des Vorhangs und Nicolas begriff.
Marie war nicht zufällig hier.
Und sie war nicht allein.
»Was soll das?«, flüsterte Julie erneut neben ihm und lenkte seinen Blick auf den Vorhang, der sich mittlerweile ganz geschlossen hatte. Ein Wellenmeer aus rotem Stoff, auf dem in diesem Augenblick eine Projektion des Bildes des Staatspräsidenten erschien. Nicolas’ Blick flog durch den Saal, aber es war zu dunkel, die Menschen um sich herum nahm er nur als Schemen wahr.
Applaus erklang. Höflich, zurückhaltend, ohne Euphorie.
»Das wird ihm gefallen«, murmelte Julie und Nicolas sah wieder nach vorne.
Wir sind glücklich, den Staatspräsidenten heute Abend hier begrüßen zu dürfen.
Die Worte waren oberhalb des Bildes auf dem roten Stoff erschienen. Nicolas sah den Lichtstrahl eines Beamers, der aus dem hinteren Teil des Saales nach vorne schien.
»Das war nicht geplant«, sagte er nur knapp und rutschte unruhig auf seinem Stuhl nach vorne.
»Na ja, solche Überraschungen liebt er doch«, sagte Julie und blickte hinauf zu der Loge, in der François Faure mit seiner Frau saß.
»Aber es war nicht geplant«, wiederholte Nicolas. Seine Nervosität steigerte sich sekündlich, er konnte sein Unbehagen förmlich greifen.
Hier stimmte etwas nicht.
Oben in seiner Loge tat François Faure das, was alle Staatsmänner in einem solchen Augenblick taten, weil sie es gewohnt waren: den Applaus, die Aufmerksamkeit und das Gefühl, wichtig zu sein, zu genießen.
Er stand auf und winkte.
Faure trat in der Loge nach vorne, kam aus dem Schatten des überhängenden Balkons hervor, stützte seine linke Hand auf der Balustrade ab, während er mit der rechten winkte.
»Oh mein Gott, er liebt das wirklich«, sagte Julie und der verächtlichen Ton in ihrer Stimme war kaum zu überhören.
Ein breites Grinsen, leuchtende Augen: Es war sein Moment.
Der Moment, in dem er dankbar war, dass seine Frau ihn hierhergeschleppt hatte, dass sie ihn gezwungen hatte, sich dieses anstrengende Werk anzuhören. Der Moment, in dem der Abend sich doch noch zu lohnen begann.
Nicolas drehte den Kopf und blickte Marie an, die schöne, geheimnisvolle Marie.
Auch sie applaudierte. Und sah dann Nicolas an, mit einem spöttischen Lächeln. Ihr Mund öffnete sich, ihre Lippen formten ein Wort.
Ein einziges, Nicolas erkannte es sofort.
Assez.
Genug.
Der Schriftzug auf dem Vorhang verschwand, und genau dieses Wort erschien. Und mit ihm ein Fadenkreuz, projiziert auf das Bild des lächelnden Staatspräsidenten darunter. Und Nicolas begriff, worum es hierbei wirklich ging: Es war kein Aufruf, kein Zeichen des Protestes, keine Warnung. Es war ein Schlachtruf.
»Was soll das?«, fragte Julie neben ihm, aber da war Nicolas schon aufgesprungen.
Er wusste genau, was es bedeutete.
Dies war eine Falle und François Faure war mitten hineingetappt, weil er genau das getan hatte, was eitle Menschen taten, wenn ihnen Anerkennung zuteilwurde. Sie traten aus dem schützenden Schatten, weil sie die Blicke spüren und den Applaus genießen wollten.
»Exit!«
Nicolas’ Schrei durchschnitt den Saal, laut, hart, rücksichtslos. Aber er wusste, dass es zu spät war. Das Ziel war ins Licht getreten.
Und Marie lächelte noch immer.
Jemand schrie, François Faure hatte seine Hand gesenkt, blickte irritiert auf den Vorhang, hinter dem das Getuschel der Musiker zu hören war.
Eine halbe Sekunde, mehr blieb ihm nicht.
Nicolas’ Ruf hallte noch nach, als die Geschosse François Faure trafen.
Die Wucht riss den Staatspräsidenten von den Füßen, schleuderte ihn nach hinten, seine Schulter prallte gegen einen Stuhl, für einen Moment war sein Körper verdreht, sein Blick spiegelte die Erkenntnis, getroffen worden zu sein.
Nicolas sah das Blut auf der Balustrade und auf der darauf abgelegten Jacke.
Er drehte sich um, sein Blick suchte die Reihen ab, glitt hinauf zur Decke, er suchte den Schützen, konnte ihn aber im schummrigen Licht nicht ausmachen. Er griff nach Julies Hand, es ging nur um sie, er musste sie beschützen, gleich würde die Hölle losbrechen im Théâtre des Champs-Élysées. Nicolas wirbelte herum, suchte nach einem roten Kleid, nach Sommersprossen und einem Lächeln, das ihn bereits im kalten Wasser von Le Havre gelähmt hatte.
Aber Marie war fort.
Kapitel 3
Théâtre des Champs-Élysées, Paris
Als wäre er unter meterhohem Eis eingeschlossen, kroch die Kälte Nicolas in den Nacken, sie ließ ihn erstarren, kurz nur, aber doch schien es ihm ewig zu dauern. Schreie waren zu hören, einige Besucher waren aufgesprungen, deuteten hinauf zu der Loge, in der François Faure eben noch gestanden hatte. Panik griff um sich, sie verwandelte das Publikum in eine rücksichtlose Horde, die innerhalb weniger Augenblicke nur noch eines wollte: raus!
Und oben lag der Staatspräsident, schwer verwundet, mindestens.
»Das darf nicht sein«, murmelte Nicolas. Aber so war es.
Er sah die Umrisse einiger Männer in der Loge, er meinte die Stimmen seiner Kollegen zu hören, die zwar schnell reagiert hatten, aber dennoch nicht schnell genug. Sie hatten schlicht keine Chance gehabt.
Um ihn herum brach endgültig das Chaos aus, Menschen kletterten über die Sitze, rempelten sich gegenseitig an, schubsten sich zu Boden. Jeder kämpfte für sich selbst.
»Ein Anschlag!«
»Der Präsident ist tot!«
Rufe knallten wie Peitschenhiebe durch die Luft, Besucher sprangen auf, wollten fort, Menschen stolperten über andere, jemand stieß Julie an der Schulter, sie stürzte zu Boden. Nicolas griff nach ihr, zog sie wieder hoch und sah die Angst in ihren Augen.
»Du musst hier raus, sofort«, sagte er und zog sie mit sich durch die Reihen.
Aus dem Eis wurde Feuer, es brannte, lichterloh. Die Lichter des Saales waren angegangen, die Kronleuchter beschienen die Szenerie, im grellen Licht war das Chaos jetzt allgegenwärtig. Eine hysterisch schreiende Frau saß in der ersten Reihe, sie deutete nach oben, ein Mann wollte sie mit sich ziehen, es gelang ihm nicht. Menschen duckten sich hinter ihren Sesseln, andere waren bereits durch die Türen ins Foyer geflohen. Eine ältere Dame stand hinter einem Pfeiler, sie zitterte, um sie herum schrien Besucher, alle wollten fort. Und alle hatten Angst.
Nicolas griff sich instinktiv ans Ohr, aber da war nichts. Kein Ohrstöpsel, auch kein Mikro am Ärmel. Es war sein freier Abend, ausgerechnet.
»Hier lang!«, schrie er und zog Julie über eine der Sitzreihen nach vorne, wo sich eine kleine Lücke in der Masse aufgetan hatte. Er schirmte sie mit seinem Körper ab, sein Blick suchte nach einem roten Kleid.
Es waren nur noch wenige Meter bis zur Einlasstür, dahinter begannen die weit verzweigten Gänge des Foyers.
»Wir sind gleich draußen!«
Julie hatte sich mittlerweile gefangen, ihren ersten Schock überwunden.
»Ist er tot?«, fragte sie ihn, während sie einer Frau aufhalfen, die vor ihnen gestolpert war. Von hinten drückten weitere Besucher in Richtung Ausgang.
»Ich weiß es nicht! Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen erst hier raus. Du musst hier raus!«
Nicolas spürte die kalte Luft, die durch die geöffnete Tür drang. Gleich waren sie im Foyer, gleich draußen, wo er Julie in Sicherheit wusste.
Der Schütze musste in einer der gegenüberliegenden Logen gestanden haben. Nicolas rief sich den Moment in Erinnerung, in dem François Faure getroffen worden war.
Mitten in die Brust, drei Treffer, gleichzeitig.
»Es sind mehrere«, murmelte Nicolas, während er Julie abschirmte, dann schaute er zurück in den Konzertsaal, hinauf zu den Logen. Bertrand, sein Freund und Teamkollege, stand mit gezogener Waffe an der Balustrade und sicherte die Loge nach vorne ab. Sollte es weitere Schüsse geben, er würde sie abfangen.
Das war sein Job.
Und meiner, dachte Nicolas bei sich.
Schließlich schafften sie es aus dem Konzertsaal. Flackernd blaues Licht zuckte von draußen über Boden und Wände, die Sirenen der Krankenwagen kamen näher, das Geräusch eines Transporters, der auf der Avenue Montaigne scharf abbremste, war zu hören. Türen wurden zugeschlagen, ein Hund bellte.
»Julie!«
Er bremste in vollem Lauf ab und hielt sie am Arm fest, gerade, als sie nach draußen eilen wollte.
»Wir sind draußen, komm …«, sagte sie und sah ihn eindringlich an.
Dann verstand sie.
»Du kommst nicht mit.«
»Nimm die Hände hoch, wenn du rausgehst«, sagte Nicolas. »Gleich kommen hier die Spezialkräfte reingestürmt, die haben keine Zeit zu überlegen, ob du Freund oder Feind bist. Nimm die Hände hoch, renne nicht und setz dich irgendwohin. Jemand wird sich um dich kümmern.«
Sie hatte eine Schramme auf der Stirn, sie war beim Fallen gegen die Lehne eines Sessels geprallt.
»Lass mich nicht allein, Nicolas. Nicht jetzt.« Ihre Stimme klang flehend, er konnte sehen, wie hinter ihren Augen ein Sturm tobte.
Eine weitere Ausnahmesituation, eine weitere Lage, die sie nicht allein bewältigen konnte. Und doch hatte er keine Wahl, sosehr es ihn schmerzte.
»Hör mir zu, ich muss …«
»Nicolas, bitte. Ich … ich schaffe das nicht, ich …«
»Doch, Julie, du schaffst das!« Er nahm ihren Kopf in beide Hände. »Du musst nur da rausgehen, lass dir eine Decke geben. Sie werden dich befragen, du wirst einen heißen Tee bekommen und …«
»Ich will keinen Tee! Ich will, dass du mit rausgehst, dort drinnen sind Verrückte, sie haben den Präsidenten erschossen! Ich will nicht, dass du …«
Es war sein Job und es würde immer sein Job sein.
Er zog seinen Dienstausweis aus der Innentasche und hielt ihn in die Luft. Dann blickte er Julie kurz an, zog sie an sich und hielt ihre rechte Hand. Er beugte sich zu ihr hinab. Ihre Haut war warm, ihr Herz schlug schnell in ihrer Brust.
Nicolas lächelte.
»Ich bin gleich wieder da«, flüsterte er. Dann gab er ihr einen Kuss.
»Ich gehöre zum Personenschutz des Präsidenten!«, rief er den Männern zu, die in diesem Augenblick durch die Türen ins Foyer stürmten, ihre Schnellfeuerwaffen im Anschlag, mit dunklen Masken und Sturmhauben ausgerüstet. Rote Laserpunkte flogen durch den Raum, Befehle wurden gegeben.
»Hinlegen! Alle hinlegen!«
Julie klammerte sich an ihn und Nicolas schob sie entschlossen nach unten.
»Es tut mir leid«, flüsterte er und drückte sie auf den Boden.
»Ich gehöre zum Präsidenten!«, sagte er erneut laut und hielt einem der Männer seinen Ausweis hin.
»Nicolas!«
Es war die Stimme von Carole Adams, die zu ihm drang. Seine Teamkollegin stand mit gezogener Waffe im Gang, der zu den Logen hinaufführte.
Nicolas hastete zu ihr.
»Carole, wie geht es Faure?«
»Foyer sauber«, sprach sie in ihr Mikro und brüllte in Richtung der Spezialkräfte, die gerade in den Konzertsaal stürmten.
»Wir brauchen eine Absicherung! Der Präsident kommt in zehn Sekunden hier runter!«
»Verstanden!«
»Absicherung!«
»Der Wagen steht bereit!«
Carole sah ihn jetzt an.
»Es war Farbe.«
Nicolas runzelte die Stirn. Er brauchte drei Sekunden, um die Information zu verarbeiten.
»Sie haben ihn mit Farbbeuteln beschossen. Er hat starke Schmerzen, dort, wo ihn die Geschosse getroffen haben. Aber sonst geht es ihm gut. Seiner Frau auch.«
»Gott sei Dank.«
»Aber er ist außer sich vor Wut. Kurz davor, jemanden hinzurichten.«
»Kann ich mir denken«, sagte Nicolas. Und Faure würde nicht irgendjemanden hinrichten. Sondern diejenigen, die für seine Sicherheit zuständig waren. Und die ihn zum Gespött gemacht hatten, zum Opfer einer Farbbeutel-Attacke mitten in Paris. Er würde sein Team zur Verantwortung ziehen, und das zu Recht.
»Der Präsident kommt!«
»Sichern!«
Nicolas warf einen Blick in den Konzertsaal. Ein Sanitäter kümmerte sich um eine ältere Dame, mehrere Spezialkräfte durchsuchten mit gezogenen Waffen die hinteren Reihen.
Carole Adams sah ihn an.
»Schöne Scheiße, nicht wahr?«
Nicolas nickte, er hörte Rufe im Gang, durch den offenbar gleich sein Team mit dem Präsidenten kommen würde.
Und dann sah er es.
Nicolas machte einen Schritt Richtung Konzertsaal, blinzelte kurz, weil die Kronleuchter nun hell strahlten. Nein, er hatte sich nicht geirrt.
Auf der anderen Seite des Saales, vor einer angelehnten Kassettentür, lag ein abgerissenes Stück Stoff. Es war blutrot.
»Sichern«, sprach Carole Adams in ihr Mikro. »Nicolas, übernimm du die …«
Aber da war Nicolas bereits losgerannt. Er stürmte durch den Saal, überall waren jetzt Mitglieder des Sondereinsatzkommandos, ihre Waffen im Anschlag. Sich immer wieder gegenseitig absichernd kamen sie zwischen den Reihen hindurch, in denen vor wenigen Minuten noch ein unbekümmertes Publikum gesessen hatte. Auf dem Vorhang prangte noch immer das Foto des Staatspräsidenten, schwächer jetzt, weil der helle Schein der Kronleuchter das Licht des Projektors überstrahlte. Einige Spezialkräfte gingen hinter den Vorhang, von beiden Seiten. Keiner von ihnen wusste, ob noch einer der Attentäter im Raum war, ob er sich in einer der oberen Logen verbarg. Aber sie hatten keine Wahl, sie mussten so schnell wie möglich das Gebäude sichern und alle Besucher evakuieren.
»Sicherung abwarten!«, blaffte ihn einer der Spezialkräfte unter seiner dunklen Maske an, als Nicolas mit schnellen Schritten an ihm vorbeilief.
»Ich gehöre zum Präsidenten«, rief er laut und rannte weiter in Richtung der Seitentür, vor der er das rote Stück Stoff entdeckt hatte. Der Mann versuchte ihn aufzuhalten, aber es war zu spät. Mit einem großen Satz übersprang Nicolas eine Sitzreihe und schlitterte über das glatte Parkett Richtung Tür. Ohne den Stoff, den er jetzt in die Hand nahm, hätte er Maries Spur sofort verloren.
Am Saum des Stoffes war ein Klettverschluss befestigt, und Nicolas verstand sofort. Es war der untere Teil eines eleganten roten Abendkleides, der sich mit einem kräftigen Ruck abziehen ließ.
Während er die Tür vorsichtig mit der Schulter öffnete, griff er nach seiner Waffe … die er nicht dabeihatte, weil sie in einer abgeschlossenen Schublade seines Nachttischs in seiner Wohnung lag.
»Scheiße!«, fluchte er und überlegte, ob er unbewaffnet die Verfolgung aufnehmen sollte. Dann drehte er sich noch mal um und sah, dass oben in der Loge des Präsidenten sein Kollege und Freund Bertrand immer noch den Rückzug absicherte.
»Bertrand!«
Nicolas’ Ruf hallte durch den Konzertsaal. Bertrand sah überrascht zu ihm hinab und verstand Nicolas’ Geste sofort.
Dafür waren sie ein Team.
Der bullige Personenschützer zog seine zweite Dienstwaffe, die er im Gegensatz zu den anderen Teammitgliedern immer bei sich trug, und warf sie in hohem Bogen hinab in den Saal.
Mit einem dumpfen Geräusch landete sie wenige Meter von Nicolas entfernt. Als er die Glock 22 an sich nahm, die schwer in seiner Hand lag, blickte er ein letztes Mal in den Konzertsaal zurück, in dem jetzt Dutzende von Spezialkräften standen. Er dachte an Julie, die vermutlich schon draußen auf der Straße war und fror und sich fragte, warum er sie alleingelassen hatte.
»Später«, sagte er zu sich selbst, stieß die kleine Seitentür auf und rannte hinaus in einen Gang, der in einem weiten Bogen um den Konzertsaal herumführte.
»Sauber!«
»Gesichert!«
Die Rufe der Beamten hallten von den Wänden wider.
Wo bist du hin, Marie?
Nicolas dachte kurz an das Meeting vor einigen Tagen im Élysée-Palast. An die Warnungen vor einer neuen Gruppierung, Aktivisten, die Chaos stiften und den Präsidenten bloßstellen wollten. Und Marie gehörte dazu, diese junge Frau, die er in Le Havre vor einer Verhaftung bewahrt hatte, weil sie ein Zeichen hatte setzen wollte, indem sie versucht hatte, den Präsidenten in der Öffentlichkeit nackt anzuspringen. Eine idealistische Studentin, das war sie für ihn gewesen, der dumme Streich einer jungen Frau, und deshalb hatte er sie laufen lassen.
Du hast dich ganz schön geirrt, dachte er bei sich. Und wenn jemand herausbekam, dass er Marie kannte und er die Chance hatte verstreichen lassen, sie festnehmen zu lassen, dann würde er nicht mehr lange für den Schutz des Präsidenten verantwortlich sein.
Nicolas durchquerte ein kleines Foyer, in dem niemand war, weil alle in Richtung des Ausgangs geflohen waren. Ein weiterer Gang führte in das Innere des Gebäudes, er rannte zu einer Tür, die jedoch abgeschlossen war.
Eine Sackgasse.
Schnell drehte er sich um, hetzte zurück ins Foyer und sah schließlich, wohin er musste: nach oben.
Hinter einem Tresen führte eine kleine Treppe in die oberen Etagen. Sie war offensichtlich nicht für die Besucher, sondern für das Personal gedacht.
Fast hätte er sie übersehen.
Mit gezogener Waffe umrundete Nicolas den Tresen, auf dem Broschüren lagen und Faltblätter zu den Aufführungen im Théâtre des Champs-Élysées. Daneben glänzten ein Paar silberne Damenschuhe im Schein der Kronleuchter und Nicolas konnte sehen, dass einer der Verschlüsse herausgerissen war. Marie hatte sich nicht die Zeit genommen, ihre Schuhe fein säuberlich auszuziehen. Sie musste weg, und dafür brauchte sie keine hochhackigen Schuhe.
Nicolas stand auf der untersten Stufe der Treppe und horchte. Es war still.
Dann fiel eine Tür ins Schloss, sehr weit oben.
Er rannte sofort los.
Drei Stufen auf einmal nehmend hastete er durch das schmale Treppenhaus, das sich in enger Kreisform seitlich des Konzertsaals hinaufwand. Unter sich hörte er jetzt wieder die Stimmen und Rufe des Sondereinsatzkommandos, das dicht hinter ihm jeden Raum des Gebäudes absuchte. Nicolas fluchte, weil er keine Möglichkeit hatte, mit den Kollegen in Kontakt zu treten. Er war von jeglicher Information abgeschnitten. Er war auf sich allein gestellt und er musste sich beeilen, wenn er Marie erwischen wollte.
Fünfter Stock. Es war der letzte.
Das Treppenhaus endete vor einer Metalltür. Vorsichtig drückte er die Klinke hinunter.
Kalte Luft strömte zu ihm herein, der Wind wirbelte feinste Schneeflocken durch die Luft.
»Auch das noch«, fluchte er und stieß die Tür weit auf.