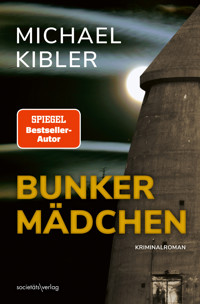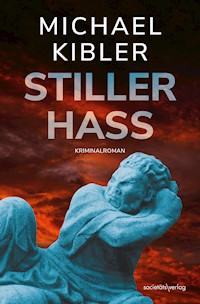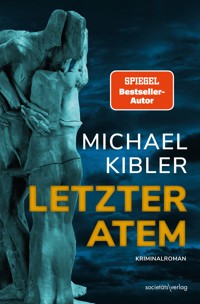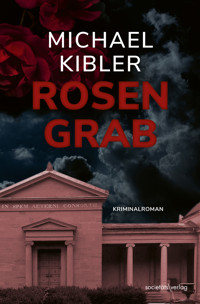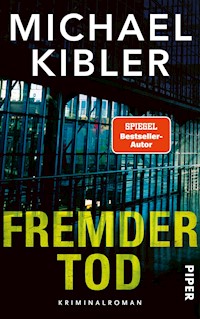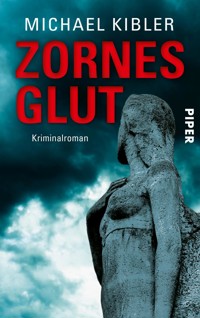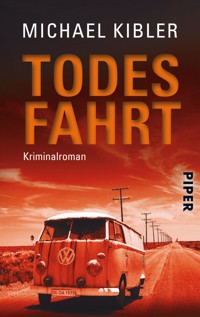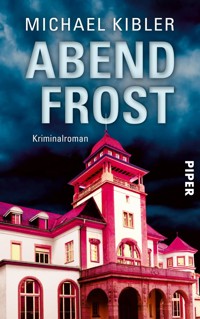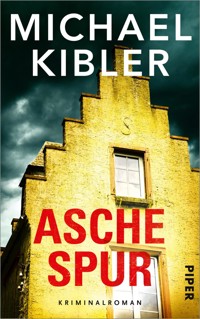
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein versteckter Tresor, eine verschollene Erbin, ein Verbrechen mit Vergangenheit – der 13. Fall für Steffen Horndeich und die Darmstädter Kripo! Seit er vor zwei Jahren den Polizeidienst quittiert hat, arbeitet Steffen Horndeich als privater Ermittler. Dabei gerät er an einen Fall, der bald auch seine früheren Kollegen interessiert. Nach einem Brand wird in einem Haus ein versteckter Tresor gefunden. Darin: private Dokumente der Hausbesitzerin Maria Jimenez, die sich jedoch vor acht Jahren nach Spanien abgesetzt haben soll. Warum hat Maria die Dokumente nicht mitgenommen? Zusammen mit Leah Gabriely folgt Horndeich den Spuren der Frau und stößt auf weitere Ungereimtheiten. Ist die wohlhabende Maria einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Nach »Abendfrost« und »Zornesglut« folgt nun ein neuer packender Krimi der beliebten Darmstadtkrimi-Reihe von SPIEGEL-Bestsellerautor Michael Kibler! »Spannend, routiniert und mörderisch.« hr hessenschau
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Aschespur« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Für Erdmann und seine Erdfrau
Originalausgabe
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion : Christine Neumann
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: checker/stock.adobe.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht und dafür keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Mittwoch, 9. Juni
Rocio I
(immer noch …)Mittwoch, 9. Juni
Rocio II
Donnerstag, 10. Juni
Rocio III
Freitag, 11. Juni
Rocio IV
Samstag, 12. Juni
Rocio V
Sonntag, 13. Juni
Montag, 14. Juni
Rocio VI
Dienstag, 15. Juni
Mittwoch, 16. Juni
Rocio VII
Donnerstag, 17. Juni
Rocio VIII
Freitag, 18. Juni
Rocio IX
(immer noch …)Freitag, 18. Juni
Samstag, 19. Juni
Sonntag, 20. Juni
Rocio X
Montag, 21. Juni
Dienstag, 22. Juni
Rocio XI
(immer noch …)Dienstag, 22. Juni
Mittwoch, 23. Juni
Donnerstag, 24. Juni
Epilog
Nachwort und Dank
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Mittwoch, 9. Juni
Was, um alles in der Welt, hatte dieser alte, schäbige Schuhkarton auf dem edlen Marmor der Küchentheke zu suchen?
Diese Frage stellte sich Steffen Horndeich seit nunmehr zwei Minuten.
Vor ihm stand eine dampfende Tasse Espresso. Ihm gegenüber eine weitere, allerdings derzeit herrenlose. Denn der Eigner des zweiten Espressos und Herr des Hauses versuchte gerade, telefonisch eine größere Katastrophe für seine Firma abzuwenden.
Frank Schröder leitete eine Malermeister-Firma – obwohl dieser Begriff nicht mehr angemessen war. In den vergangenen 20 Jahren hatte der Mann daraus einen Betrieb für die komplette Innenausstattung von Wohnhäusern und auch für jene von Gewerbeimmobilien geformt.
Den heutigen Vormittag hatte sich Frank Schröder freigenommen. Denn er wollte Steffen Horndeich um Rat bitten. Der sollte für ihn ein Konzept erarbeiten, wie Schröder das Einfamilienhaus, in dem er mit seiner Familie wohnte, sicherer machen könne. Einige Einbrüche in der Nachbarschaft im Darmstädter Komponistenviertel während der vergangenen Wochen hatten ihn zu diesem Schritt bewogen.
Kaum hatte Schröder die Espressi zubereitet, hatte sein Handy geklingelt. Er hatte auf das Display gesehen, die Augenbraue hochgezogen, dann die Schultern, und verkündet: »Sorry, da muss ich rangehen.«
Im Erdgeschoss des Hauses breitete sich eine großzügige Wohnküche in Richtung Flur aus – dorthin war Schröder verschwunden. Vom Flur aus führte eine Treppe in das Souterrain. Hier befand sich das Homeoffice von Frank Schröder, ähnlich wie bei Steffen Horndeich. Dessen Haus lag keine fünf Gehminuten von Schröders Domizil entfernt. Auch er hatte sein komplettes Souterrain seinem Geschäft gewidmet: zwei großzügige Räume, in denen sich die Detektei »Steffen Horndeich. Private Ermittlungen« befand.
Horndeich hörte Schröders Stimme trotz einer geschlossenen Tür und eines ganzen Stockwerks Abstand. Der Mann war außer sich und brüllte ins Telefon. Das wird sicher noch ein Weilchen dauern, dachte Horndeich. Und wenn er etwas in den vergangenen zwei Jahren gelernt hatte, dann, dass er eine solche Zeit des unverschuldeten Leerlaufs gnadenlos abrechnete.
Die Wohnküche war nach Horndeichs Geschmack eingerichtet: luftig, weit, sodass auch der massive Esstisch den Raum nicht erdrückte. Sofagarnitur und Couchtisch kamen, ebenso wie die Sessel, eher leichtfüßig daher. Ein paar Kunstdrucke zierten die Wände, eine jedoch war fast nahtlos bedeckt mit Familienfotos. Auf einem der Bilder war sogar Horndeichs Tochter Stefanie dabei, denn die ging mit Schröders Tochter Ilona in dieselbe Klasse.
Küche, Wohnbereich, Essbereich – alles war ausnehmend stilvoll eingerichtet. Nur diese Schuhschachtel auf der Küchentheke passte so überhaupt nicht ins Bild. Sie wirkte, als habe sie bereits ein beschwerliches Leben hinter sich. Sie hatte etwas aufopfernd aufbewahrt, bis ihre Seitenwände ausgebeult waren und die Ecken abgerundet, bis die Seitenflächen Knitterfalten aufwiesen und der Deckel an einer Kante leicht eingerissen war. Patina überzog die Pappe. Und die auf der Querseite aufgedruckten High Heels in einem faden Grau, das einmal silbern gewesen sein mochte, wirkten auf diesem Untergrund völlig deplatziert.
Horndeich schlürfte am Espresso. Erstens konnte er ihn jetzt noch genießen, bevor er kalt wurde. Zum anderen, und das war ein nicht zu unterschätzender Effekt, beschäftigte er seine Finger. Denn die musste er nachdrücklich im Zaum halten. Sie drängten in Richtung Schachtel, wollten den Deckel anheben, wollten ihr ihr süßes Geheimnis entreißen. Nur ganz kurz. Nur einen halben Zentimeter, nur mal eben reinlinsen.
Neugier war eine Berufskrankheit. Bis vor zwei Jahren hatte Steffen Horndeich bei der Mordkommission in Darmstadt gearbeitet – und er war gut gewesen in seinem Job. Zunächst gemeinsam mit seiner Kollegin Margot Hesgart, später dann mit ihrer Nachfolgerin Leah Gabriely, hatte er dafür gesorgt, dass die bösen Jungs und Mädels hinter Gittern landeten. Zweimal hatte er sich in dieser Zeit eine Kugel eingefangen. Beide Male hatte nur wenig gefehlt, um seine Frau Sandra zur Witwe und seine Kinder Stefanie, Alexander und die kleine Antje zu Halbwaisen zu machen. Danach hatte er beschlossen, sich einen Job in ruhigeren Gefilden zu suchen. Seine frühere Kollegin Margot hatte sich vor wenigen Jahren selbstständig gemacht, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Nick. Die beiden betrieben seither eine Beratungsfirma für Sicherheitstechnik. Margot hatte Horndeich darauf angesprochen, dass einige ihrer Kunden auch nach Privatermittlern fragten. Und so hatte Horndeich den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt.
Die Espressotasse war leer, doch aus dem Souterrain tönte immer noch Schröders Stimme. Der Mann blaffte unablässig. Es handelte sich bei dem Telefonat eher um einen Monolog als um einen Dialog mit dem Ziel einer konstruktiven Problemlösung …
Horndeich sah sich abermals um. Schaute aus dem Fenster. Hätte es in dem Raum ein Bücherregal gegeben oder eines mit CDs, wäre er jetzt aufgestanden und hätte die literarischen und musikalischen Schätze begutachtet. Aber außer einem großen Flachbildschirm und ein paar Hi-Fi-Komponenten gab es nichts zu bestaunen. Horndeich hatte sein Smartphone nicht mitgenommen. Und so war ihm – langweilig. Ein Zustand, den er kaum kannte und den er, wenn er denn einmal eintrat, nicht mochte. Und der der Zurückhaltung in Sachen Schuhkarton nicht eben förderlich war.
Schröders Stimme klang immer noch aus der Unterwelt, und so warf Horndeich einen schnellen, kurzen Blick unter den Deckel. Der Karton war prall gefüllt mit Kontoauszügen der Sparkasse Darmstadt. Ab und an ragte ein kleines Pappkärtchen heraus, auf dem eine Jahreszahl vermerkt war. Es waren elf an der Zahl, beschriftet von 2003 bis 2013. Horndeichs rechter Zeigefinger konnte nicht umhin, eines der Kärtchen zu sich heranzuziehen und den Namen des Kontoinhabers auf dem dahinterliegenden Auszug zu lesen. Es war eine Kontoinhaberin: Maria Jimenez.
Horndeich bemerkte, dass er nichts mehr hörte. Er zog die Hand aus dem Schuhkarton und platzierte den Deckel wieder in der ursprünglichen Position.
Horndeich überlegte: Jimenez – den Namen hatte er schon einmal gelesen oder gehört. Er erinnerte sich, dass es zu der Zeit gewesen sein musste, als er noch gemeinsam mit Margot bei der Darmstädter Polizei gearbeitet hatte. Jimenez – da klingelte ein Glöckchen, aber nur ganz leise und aus weiter Ferne.
Eine Stimme riss ihn aus seinen Gedanken: »Entschuldigen Sie, Herr Horndeich, es ist so schwer, heute gutes Fachpersonal zu bekommen.« Schröder sah auf seine Armbanduhr, eine Smartwatch.
Horndeich hatte sich nie dazu durchringen können, dem flachen digitalen Quälgeist in der Innentasche des Jacketts noch einen weiteren am Armgelenk hinzuzufügen. Sein linkes Handgelenk zierte eine Omega Speedmaster, die ihm seine Frau vor Jahren geschenkt hatte und die er fast so sehr liebte wie die ihn Beschenkende.
»Gehen wir durchs Haus. In 30 Minuten kommt der Vermieter, dann kann ich mit ihm gleich besprechen, was ich hier installieren möchte. Also, lassen Sie mich an Ihrem Fachwissen teilhaben.«
Horndeich schätzte eine effiziente Arbeitsweise durchaus. Aber wie ein Reitpferd mit Sporen durchs Haus getrieben zu werden und innerhalb von Minuten ein fundiertes Konzept zu entwickeln oder zumindest solide Ratschläge zu geben, das war eher nicht sein Ding. Aber: Der Kunde war König.
Und so führte Schröder ihn im Schnelldurchlauf durch das Souterrain mit zwei Keller- und zwei Büroräumen, dann durch das Erdgeschoss, dessen Wohnküche er ja schon kannte, aber die beiden weiteren Zimmer noch nicht. Das eine war Abstellkammer und Bügelraum, das andere Lese- und Gästezimmer. Hier fanden sich die zuvor vermissten Regale voller Bücher. Zudem befand sich gleich neben der Eingangstür noch ein Gäste-WC mit Dusche. Das Stockwerk darüber lag bereits unterm Dach. Die beiden Kinderzimmer, das Schlafzimmer und auch das sehr großzügige Badezimmer waren in der Raumhöhe zum Teil durch die Dachschrägen begrenzt.
»Und?«, wollte Frank Schröder bereits an dieser Stelle ein Fazit kredenzt bekommen.
»Ich muss mir noch die Außenbereiche ansehen«, antwortete Horndeich.
Schröder führte ihn einmal um das Haus herum, durch die Garage und wieder zur Haustür.
»Wollen Sie das Gartenhäuschen auch besonders sichern?«
Schröder verneinte. »Da ist nur Gerümpel drin. Wer das klaut, ist selbst dran schuld. Ich habe nicht mal ein Schloss davor, damit potenzielle Diebe nicht die Tür aufbrechen müssen«.
Nun war es Horndeich, der auf die Uhr sah. Keine 15 Minuten hatten sie für den Rundgang benötigt. Aber die gröbsten Schwachstellen hatte er auf den ersten Blick erkannt. Schließlich hatte er solche Beratungen auch im Auftrag von Margots Firma mehrfach durchgeführt, nachdem er selbst ein paar Fortbildungen auf dem Gebiet absolviert hatte.
Als sie das Haus betraten, steuerte Schröder direkt auf die Küchentheke zu. »Auch noch einen Espresso?«, wollte er wissen, als er seinen, der inzwischen kalt sein musste, in die Spüle kippte.
Horndeich lehnte dankend ab.
Schröder ließ die Espressomaschine brummen, dann setzte er sich an die Theke, schlug sein Tablet auf, tippte mit einem Stift ein paarmal auf dem Glas herum und sagte: »Ich höre.«
Und Horndeich ratterte seine Vorschläge herunter. Sowohl die Fenster als auch die Haustür, die Terrassentür und ebenso der Durchgang zur Garage sollten künftig besser über Mehrfachverriegelungen verfügen. Desgleichen die Fenster. Die Gitter über den Souterrainfenstern waren nicht gesichert. Eine Kamera statt eines Türspions in der Haustür würde zudem auch den Kindern ermöglichen, zu sehen, wer vor der Tür stand. Horndeich schwadronierte kurz über den Vorteil von Pilzkopfzapfen gegenüber Rollzapfen, erörterte noch den Nutzen von Alarmanlagen, einer Außenbeleuchtung, die durch Bewegungssensoren ausgelöst würde, und von Kameras im Außenbereich.
Schröder schrieb mit, und soweit Horndeich das erkennen konnte, gliederte er all das, was Horndeich ihm mitteilte, gleich in Überschriften und Stichworte mit Punkten davor. Dann rekapitulierte Schröder seine Liste und wollte von Horndeich wissen, wie teuer die einzelnen Maßnahmen werden würden.
»Das hängt natürlich auch von der Qualität der Bauteile ab. Hier sollten Sie unbedingt auf Gütesiegel achten, etwa auf das der ›vds‹ oder auf die gute alte DIN.«
Schröder blickte auf, sah Horndeich unverständig an und sagte: »Welchen Sinn macht es, wenn ich Geld in die Sicherheit meines Hauses investieren will und dann billigen Mist kaufe, den ein Nachwuchskrimineller in wenigen Minuten kleinkriegt?«
Das wäre eigentlich Horndeichs Satz gewesen, denn meist musste er den Menschen erst mal klarmachen, dass »Geiz ist geil« bei Sicherheitstechnik diese letztlich völlig überflüssig machte.
Also nannte Horndeich ihm Posten für Posten die entsprechenden Summen.
Schröders »Perfekt!« und die Türglocke erklangen im selben Moment.
Rocio I
Mein Name ist Rocío García. Und ich bin eine zufriedene Frau.
Ich darf mich nicht beklagen.
Und ich beklage mich auch nicht. Jetzt, da alles zu Ende geht. Es wird mir wohl nicht vergönnt sein, meinen 60. Geburtstag zu feiern. Der Krebs ist nicht mehr heilbar.
Soll ich weinen?
Nein, ich glaube nicht. Felipe ist ja auch schon von mir gegangen. Dieselbe Krankheit. Bei ihm ging es zum Schluss ganz schnell. Ich hoffe, dass, wenn mein Ende naht, ich ebenfalls nicht lange auf dasselbe warten muss.
Manchmal habe ich Schmerzen. Nicht oft. Und wenn, dann sind da diese Tabletten, die meine Tochter mir besorgt hat.
Nein, ich habe mein Leben gelebt.
Ich hatte einen zärtlichen und gütigen Mann. Einen, mit dem mich nicht nur gegenseitige Liebe verbunden hat, sondern auch die gemeinsame Liebe zur Musik, zum Wandern, zur Literatur.
Wir haben eine bezaubernde Tochter, und sogar eine Enkelin ist mir noch geschenkt worden. Wenn ich nicht mehr bin, lebe ich in meiner Tochter und der Kleinen ein Stück weiter. Was will man mehr?
Meine Enkelin ist jetzt drei Jahre alt, und sie erinnert mich ein wenig daran, wie ich in diesem Alter gewesen bin.
Mit 19 habe ich Felipe García kennengelernt, mit 21 habe ich ihn geheiratet. Er war Architekt – damals natürlich nicht, da hatte er noch studiert –, und er hat sein Leben der Sagrada Família gewidmet. Jener fantastischen Kirche des Genies Antoni Gaudí in meiner Stadt, an der seit über 100 Jahren gebaut wird und die immer noch nicht vollendet ist. Nun werde auch ich nicht mehr erleben, dass sie fertiggestellt wird.
Ja, ich bin mein Leben lang in die Kirche gegangen. Nicht jeden Sonntag, aber doch regelmäßig. Als Kind hatte ich noch ganz naiv an den guten Vater Gott und seinen Sohn Jesus geglaubt. In meiner Vorstellung sah Gott meinem Großvater sehr ähnlich: ein großer, breitschultriger Mann mit einem imposanten Rauschebart.
Mit den Tiefschlägen im Leben veränderte sich der Glaube.
Wer weiß, ob es das Jüngste Gericht gibt? Wie dem auch sei, ich habe die – wahrscheinlich ebenfalls sehr naive – Vorstellung, dass ich in wenigen Wochen meinen Felipe wiedersehen werde. In irgendeiner besseren Welt.
Als unsere Tochter größer geworden war, haben Felipe und ich im selben Architekturbüro gearbeitet. Meine Ausbildung zur Sekretärin hatte ich zum Glück abgeschlossen. Und als unser Kind langsam flügge wurde, rückten wir beide durch die gemeinsame Arbeit noch näher zusammen. Und es war für uns beide gut. Diese wundervolle, so seltsame Kirche, sie wurde unser gemeinsamer Ort.
Auch wir hatten unsere Krisen. Natürlich. Nur war Felipe kein Mann, der laut wurde oder gar die Hand erhob. Die roten Lämpchen blinkten bei mir immer dann, wenn er plötzlich ganz leise sprach. Und seine Sätze keine Kommas mehr hatten, sondern nur noch Punkte.
Sehr früh haben wir unsere Rituale entwickelt, um Krisen nicht zur Bedrohung werden zu lassen. Wenn es Dinge zu klären gab, sind wir immer wandern gegangen in die angrenzenden Berge des Montserrats. Wenn man beim Reden gleichzeitig Höhenmeter überwinden und atmen muss, reduzieren sich Wutausbrüche auf das Nötigste. Für uns beide hat es funktioniert – und mit unserer Tochter hat es ebenfalls geklappt. Gab es Familienstreitigkeiten zu klären, die gleichermaßen sie betrafen, wanderten wir zu dritt. Wir starteten oft wütend und enttäuscht. Aber wir kamen immer weniger erbost und weniger niedergeschlagen als Familie zurück. Stets mit ein paar Kompromissen im Gepäck, die jeder von uns zuzugestehen bereit war.
Felipe und mich hatte von Anfang an auch der Humor verbunden. Wir konnten über vieles lachen, auch über uns selbst. Das hat einigen Streits die Schärfe genommen. Unsere Tochter ist in diesem Bereich ganz nach uns geraten. Und so hat es unterm Strich für uns alle funktioniert.
Der Arzt hat gesagt, ich habe vielleicht noch ein halbes Jahr. Das kann heißen: nur noch drei Monate. Das kann heißen: ein Dreivierteljahr. Dass es bedeutet, dass ich den Herbst in einem Jahr auf keinen Fall mehr erleben werde, hat er so nicht gesagt. Aber wir sind gut genug in Mathe.
Ich liebe meine Enkelin.
Ich liebe sie sehr.
Seit ich sie zum ersten Mal in den Armen gehalten habe.
Jedes Baby hat seinen ganz eigenen, unverwechselbaren Geruch. Ich bin keine Biologin, aber ich bin ziemlich sicher, dass dieser Duft in der Mutter etwas auslöst, was den Muttertrieb weckt und verstärkt.
Als ich meine Enkelin zum ersten Mal im Arm gehabt habe, nahm ich diesen Geruch an ihr wahr. Ich musste weinen und habe mich kaum mehr beruhigen können.
Meine Tochter hatte mir das Baby abgenommen, voller Unverständnis, ja, geängstigt. Was mit mir los sei, fragte sie.
Ich konnte es ihr nicht sagen, da ich es selbst nicht wusste.
Da ich es damals nicht gewusst habe …
Ich liebe meine Enkelin, doch ich habe sie als Baby nur dieses eine Mal auf dem Arm gehabt.
Es hat gedauert, bis ich mir selbst erklären konnte, warum ich sie in meinen Armen hasste, obwohl ich sie doch so liebte.
Es war der Geruch.
(immer noch …)Mittwoch, 9. Juni
Ja, das war eine nette Hütte, vor der sie gerade standen und darauf warteten, dass der Eigner die Haustür öffnen würde. Jana Welzers Blick glitt über den Außenputz bis zum Dachfirst. Alles befand sich in bestem Zustand.
Die Tür öffnete sich, im Rahmen stand ein attraktiver Mittvierziger, sonnengebräunte Haut, durchtrainierter Körper. Die Geheimratsecken und die Grautöne im Haar fielen nicht auf, da der Mann einen Bundeswehrhaarschnitt bevorzugte. Jana hatte diesen Herrn noch nie gesehen, sie kannte nur seinen Namen: Frank Schröder. Der sah sie irritiert an.
Janas Begleiter, Alfredo Jimenez, stellte Jana vor: »Herr Schröder, das ist Jana Welzer, die neue Abwesenheitspflegerin. Frau Welzer, das ist Herr Schröder, der Mieter dieses Hauses.«
»Schön, Sie kennenzulernen«, sagte Schröder und reichte Jana die Hand. Der Händedruck passte zum Mann: kantig. Er grüßte auch Jimenez, dann bat er sie ins Haus. Vom Flur aus steuerte der Hausherr direkt in die Wohnküche und dort an einen an beiden Seiten offenen Tresen mit Marmorplatte. Nobel, dachte Jana. Am Tresen saß ein Mann auf einem Barhocker. Er erhob sich. »Jana?«
Gegen das helle Außenlicht hatte sie ihn zunächst nur als Schatten wahrgenommen. »Horndeich?« Was machte der denn hier?
»Ah, Sie kennen sich bereits! Das ist ja wunderbar. Einen Espresso, die Dame, der Herr?«, fragte der Hausherr.
Jimenez bejahte.
Jana schüttelte den Kopf. Horndeich war Privatdetektiv. Oder privater Ermittler, wie die korrekte Bezeichnung eigentlich lautete. Ihre eigene Profession nannte sich Nachlasspflegerin. Sie regelte den Nachlass von Verstorbenen, bei denen es auf den ersten Blick keine erbberechtigten Hinterbliebenen gab. Auch für diese Menschen musste das Ende ihres Lebens abgewickelt werden: Eventuelles Vermögen wurde gesichert, Versicherungen wurden gekündigt, Hausrate aufgelöst – natürlich stets unter der Aufsicht des Amtsgerichts in Form ihrer Person.
Immer wieder kam es vor, dass reichlich Hab und Gut vorhanden war, aber auf den ersten und auch auf den zweiten Blick keine Erben zu finden waren. Das war der Moment, in dem Jana auf private Ermittler zurückgriff. Fanden diese Erben, bekamen sie eine Provision. Fanden sie niemanden, arbeiteten sie umsonst. Auch sonst gab es immer wieder Rechercheaufträge, die sie allein nicht bewältigen konnte – dann nutzte sie ebenfalls die Dienste von privaten Ermittlern.
Eine gemeinsame Bekannte hatte Jana den Namen des privaten Ermittlers Steffen Horndeich gesteckt. Seitdem hatte sie ihn immer wieder mal mit ihren Rechercheaufträgen versorgt. Der Mann war gut, und sie war froh, dass sie zusammenarbeiteten. »Was machst du hier?«, fragte sie ihn.
»Schröders Tochter und meine besuchen dieselbe Klasse. Und ich habe Herrn Schröder gerade beraten, wie er sein Haus besser gegen Einbruch schützen kann.«
Startschuss für Schröder, wieder zu übernehmen: »Und Herr Horndeich hat mir gute Tipps gegeben! Da müssen wir gleich drüber sprechen, denn ich würde gern einiges davon umsetzen. Und da Herr Lopez ja leider von uns gegangen ist – « Schröder beendete den Satz nicht, dafür tat dies Jana in Gedanken: … muss ich halt mit Ihnen vorliebnehmen. Die Durchtrainierten sind oft auch die Machos, fiel Jana noch ein.
Das Ableben von Diego Lopez war der Grund dafür, dass Jana heute hier war. Der Mann, mit dem sie das Haus betreten hatte, Alfredo Jimenez, war der Bruder von Maria Jimenez. Der gehörte dieses Anwesen. Aber sie war seit acht Jahren verschwunden. Da der Bruder Alfredo Jimenez fast an der polnischen Grenze in Mecklenburg-Vorpommern lebte und von dort aus den Besitz der Schwester nicht verwalten konnte oder wollte, hatte er über das Amtsgericht einen Abwesenheitspfleger bestellen lassen. Das fiel in Janas Kompetenz, denn ein Abwesenheitspfleger war quasi ein Nachlasspfleger für Menschen, die verschwunden, also nur eventuell tot waren. Aber auch bei solch verschwundenen Menschen musste deren Besitz verwaltet werden, von den Konten bis zu den Immobilien. Ein bisschen makaber fand Jana das schon, doch selbstverständlich nahm sie auch solche Aufträge an. Diego Lopez, ein Cousin von Alfredo und Maria Jimenez, war vom Amtsgericht seinerzeit als Marias Abwesenheitspfleger bestellt worden. Vor drei Wochen war er jedoch plötzlich verstorben. Herzinfarkt. Das Amtsgericht Darmstadt hatte ihr nun diesen Fall übertragen. Deshalb war Jana jetzt quasi die Vermieterin von Frank Schröder.
Frank Schröder hatte für Alfredo den Espresso zubereitet, vor ihm abgestellt und dann zeitgleich verkündet: »Lassen Sie uns doch bitte durchs Haus gehen, damit Sie, Frau – wie war der Name doch gleich?«
Alfredo Jimenez sprang helfend ein: »Welzer.«
»… Frau Welzer, das Haus kennenlernen.«
Das war Jana nur recht. Sie hatte in ihrem Büro bereits die Unterlagen ihres Vorgängers Diego Lopez in Regale sortiert, sich gestern auch die Dokumente zu dieser Immobilie genau angeschaut, dennoch wollte sie den Bau ebenfalls in Augenschein nehmen. Und je eher sie wieder in ihrem Büro saß, desto lieber war es ihr.
Jana hatte den Eindruck, dass Horndeich gerade dazu ansetzte, sich zu verabschieden, doch Schröder sagte nur: »Herr Horndeich, vielleicht gehen Sie einfach noch einmal mit.« Es klang mehr wie ein Befehl denn wie eine Bitte. Lopez kam nicht einmal mehr dazu, den Espresso zu trinken, da das Quartett schon zur Besichtigung aufbrach.
Das Haus war nicht nur von außen in einem guten Zustand. Die letzte Renovierung lag sicher nicht mehr als zwei Jahre zurück. Das passte, denn Schröder und seine Familie wohnten seit genau zwei Jahren hier.
Die Tapeten lösten sich in keiner Ecke, auch um die Bilderrahmen herum sah Jana keine Schatten. Ebenso wenig zeigten sich irgendwo in den Wänden sichtbare Risse. Das Gebäude war 1980 gebaut worden. Ein kleines Haus von vielleicht 90 Quadratmetern Grundfläche.
Im Schlafzimmer hielt Schröder inne und zeigte auf das Nachtschränkchen, das neben der rechten Bettseite stand. »Da ist uns vor ein paar Wochen ein Missgeschick passiert – ich weiß nicht, ob Herr Lopez Ihnen davon berichtet hat?«, wandte sich Schröder an Alfredo Jimenez.
Der schüttelte nur den Kopf.
»Ist ja auch schon alles wieder behoben. Die Kinder haben getobt, der Kleine hat die Große geschubst, und die ist gegen den Nachttisch geflogen. Hatte zwei dicke blaue Flecke auf dem Rücken.« Schröder sah Horndeich an: »Vielleicht hat Ilona das ja Stefanie erzählt.«
Auch Horndeich schüttelte nur den Kopf.
»Na ja, Sie wissen ja, das hier ist ein Haus in Fertigbauweise, also mit vielen Holzbalken und dazwischen Rigipsplatten und Dämmung. Das Nachtschränkchen ist umgekippt und hat die dahinterliegende Gipsplatte zerschmettert. Dahinter ist ja ein Hohlraum wegen der Dachschräge. Wir haben gleich die Handwerker geholt und das richten lassen. Das Seltsame aber war: Hinter dieser Platte haben wir einen Schuhkarton gefunden.«
Hatte Horndeich gerade eine Augenbraue hochgezogen, fragte sich Jana.
»Einen Schuhkarton?«, echote Jimenez.
»Ja«, lachte Schröder auf. »Ein alter, vergilbter Schuhkarton. Ich hab mir erlaubt, kurz reinzuschauen. Da waren irgendwelche Kontoauszüge drin. Ich hab den Deckel wieder draufgemacht. Ich gebe ihn Ihnen nachher mit«, wandte sich Schröder an Jimenez.
»So einfach läuft das nicht«, warf Jana ein. Schröder wie auch Jimenez hatten Fragezeichen in den Augen, als ihr Blick den von Jana traf.
War sich Jana nicht ganz sicher gewesen, ob Horndeich wenige Sekunden zuvor tatsächlich die Augenbraue bewegt hatte, so war das Grinsen in seinem Gesicht nun ohne jeden Zweifel zu identifizieren.
Nach der Führung durch das Haus setzte Schröder die Begutachtung des Grundstücks fort. Durch die überschaubare Grundfläche des Hauses wirkten die 500 Quadratmeter des Gartens umso weitläufiger.
Zwar war neben dem Haus noch eine Garage angebaut und im hinteren Teil ein Schuppen errichtet worden, aber der Rest des Grundstücks bestand aus gepflegtem Rasen und hohen Hecken, die ein wenig von Gefängnismauern aus Naturgrün hatten. Aber das bot natürlich auch die Möglichkeit, sich einmal textilfrei zu sonnen. Vielleicht hatte Maria Jimenez, als sie noch hier gewohnt hatte, davon Gebrauch gemacht.
»Meine Kinder lieben den Garten«, sagte Schröder mit einem Lächeln im Gesicht. »Deshalb sind sie auch stinksauer, dass es am Wochenende mal wieder zur Oma nach Hamburg geht. Da schlafen wir dann alle zu viert in einem Raum. Und ins Grüne bringt uns da nur unser Auto.«
»Ja, das kenne ich. Meine Kids haben mir auch schon mehrfach gesagt, dass sie froh sind, so ganz im Grünen zu wohnen«, stimmte Alfredo Jimenez dem Mieter zu.
Schröder grinste Jimenez an: »Freitag hin, Montag zurück – das sollte auszuhalten sein. Da müssen sie einfach durch.«
Nachdem die kleine Gruppe wieder die Wohnküche erreicht hatte, schritt Schröder stante pede auf den Karton zu. Er hob ihn an und ging in Richtung Alfredo: »Hier ist der Karton für Sie. Mit den Kontoauszügen Ihrer Schwester.«
Er trug die Pappkiste in einer Hand, die andere lag oben auf dem Deckel. Es wirkte, als ob er einen Schrein mit heiligen Knochen übergeben wollte.
Jana war schnell genug. Sie preschte in den Laufweg und streckte Schröder die Hände entgegen. »Ich werde sie mit bestem Wissen und Gewissen treuhänderisch verwalten«, sagte sie. »Denn als Abwesenheitspflegerin denke ich, dass ich dies zu den anderen eingelagerten Gegenständen von Maria Jimenez packen sollte, nachdem ich es sauber archiviert habe.«
Sowohl Frank Schröder als auch Alfredo Jimenez wirkten ein wenig irritiert, aber keiner wagte es, sich ihr in den Weg zu stellen. Sie nahm Schröder die Kiste ab. Zu oft hatte Jana es erlebt, dass Erben unlautere Wege gingen und sich noch ein paar Euro mehr sichern wollten, als ihnen zustand. Und je öfter sie das erlebt hatte, desto öfter war sie entschieden eingeschritten. Es gab schließlich ein ganz klar geregeltes Erbrecht. Und da hatte niemand die Ermächtigung, sich persönlich zu bereichern. Auch nicht an Kontoauszügen.
Horndeich verabschiedete sich von ihnen.
Schröder brachte ihn zur Tür, kam dann zurück: »Könnten wir gerade durchsprechen, welche Sicherheitsmaßnahmen ich im Haus ergreifen möchte?«
Es war nicht das erste Gespräch, das Jana mit dem Mieter einer von ihr verwalteten Wohnung führte. Und sie hatte leider auch die Erfahrung gemacht, dass sie als Verwalterin oft nicht so ernst genommen wurde wie ein Vermieter. Was sich meist darin zeigte, dass viele glaubten, sie über den Tisch ziehen zu können. Da waren sie bei ihr allerdings an der falschen Adresse. Selbstverständlich würde eine Investition in Sicherheitstechnik den Wert dieser Immobilie steigern. Aber allein Schröders Tonfall ließ erahnen, dass es harte Verhandlungen werden würden.
Horndeich saß in seinem Büro. Er schrieb eine Rechnung an Frank Schröder für die Beratungsleistung dieses Tages. Er war davon ausgegangen, dass sie sich einen halben Tag lang das Haus in allen Ecken anschauen würden, aber Frank Schröder hatte sich ja als ein Typ der Marke »Express-Manager« entpuppt. Sollte ihm recht sein. Der Mann war ihm ohnehin nicht sympathisch. Was jedoch keinen Einfluss darauf hatte, dass ihre Töchter sich gut verstanden.
Horndeich hatte ein wenig in sein Geschäft investiert, in Rechner-Equipment, in einen rasend schnellen Internetzugang. Das war von Vorteil, wenn man Videos nicht nur herunterladen, sondern auch hochladen musste. Da machte es dann schon einen Unterschied, ob man für den Upload eines Films zehn Minuten oder 90 Minuten brauchte.
Neben der Beratung von Frank Schröder hatte Horndeich natürlich noch weitere Klienten zu versorgen.
»Kommst du zum Abendessen, Papa?«, wollte sein Sohn Alexander von ihm wissen. »Mama hat alles fertig gemacht!«, erzählte der Sechsjährige nicht ohne Stolz, als ob er derjenige gewesen wäre, der nicht nur die Nachricht überbrachte, sondern selbst für die Mahlzeit gesorgt hätte.
Alexander besuchte inzwischen die erste Klasse. Und wie seine große Schwester Stefanie, die jetzt am Ende ihres vierten Schuljahrs war, war Alexander unglaublich wissbegierig, neugierig, und er erkannte Zusammenhänge genauso schnell wie seine große Schwester. Was dieser nicht immer gefiel.
Aber Alexander hatte noch eine weitere Gabe: Er war sehr musikalisch. Vor zwei Jahren hatte er zum ersten Mal an einem Klavier gesessen, hatte eine Gitarre in der Hand gehabt und nach der Begegnung mit diesen Instrumenten Tränen in den Augen, weil seine Finger noch zu klein waren. Horndeichs Frau Sandra hatte eine Kindergeige für ihn besorgt – und Alexander war ein Wunderkind, auch wenn niemand in der Familie dieses Wort benutzte.
Seine Tochter Stefanie hatte jedoch sofort begriffen, dass der jüngere Bruder hier auf einem Feld aktiv war, auf dem sie bislang keine Glanzleistungen hatte zeigen können. Horndeich hätte es nicht für nötig befunden, dass Stefanie, die in der Schule kaum eine Zwei schrieb, weil alles nur Einsen waren, auch noch ein Instrument lernte. Aber die junge Dame bestand darauf. Cello. Ebenfalls ein Musikinstrument mit Saiten, aber eines, das größer war als das von Alexander. Seine Frau spielte Orgel. Oder Keyboard, wie man das heute nannte. Und tatsächlich wurde in ihrer Familie Hausmusik praktiziert – ein Wort, das Horndeich ebenfalls auf dem Scherbenhaufen der Geschichte verortet hätte. Stefanie wollte auch das Notenlesen lernen, nachdem es Alexander irgendwie zugeflogen zu sein schien.
Unterm Strich: Seine Frau, seine Tochter und sein Sohn musizierten gemeinsam. Kammermusik, wie es in gehobenen Kreisen hieß. Er, Horndeich, musste das nicht verstehen. Er spielte leidlich Akkordeon – hatte er jedenfalls gespielt. Aber das gute Stück lag unterm Dach. Da lag es gut. Alles hatte seine Zeit. Er ließ lieber musizieren. Vor zwei Abenden hatte sein Familientrio ein paar der methodischen Sonaten von Telemann gespielt. Nicht alle, aber die achte, die er so sehr mochte.
»Papa! Abendessen!«
Minuten später saßen sie am gemeinsamen Esstisch. Sandra hatte es sich nicht nehmen lassen, noch einen Salat zuzubereiten. Und Horndeich war immer wieder erstaunt, dass seine zwei Ältesten darauf bestanden. Natürlich mochten die Kids auch Schokolade und Kekse, aber abends musste ein Salat auf dem Tisch stehen.
Sie hatten als Familie ein Ritual entwickelt: Bei jedem Abendessen erzählten sie sich, was an diesem Tag besonders schön gewesen war. Natürlich, es gab auch Tage, die man einfach nur abhaken konnte. Und so hatte jeder das Recht, nichts zu sagen. Aber für die negativen Erfahrungen war am Abendesstisch kein Platz. Nur für die guten.
Antje, inzwischen knapp eineinhalb Jahre alt, saß in ihrem Hochstuhl und klopfte mit ihrem Löffel auf dem Tisch herum. Sandra eröffnete ungerührt die Runde: »Und? Was war heute schön?«
Wie immer schaltete sich Stefanie sofort ein: »Ich war heute Gassi mit Ilona.« Sie unterbrach sich selbst, giggelnd: »Also mit Bello. Ilona war nicht an der Leine. Und Bello hat die ganze Zeit auf uns gehört. Und auch nicht auf dem Bürgersteig gekackt. Das macht er sonst immer gern.« Eine weitere Regel war, dass die positiven Schilderungen nicht kommentiert wurden …
»Ich habe heute ganz viel Musik gemacht. Und das meiste hat geklappt.« Alexander. Er war ein besserer Musiker als Wortjongleur.
Horndeich sah seine Frau an. Ihr Part. Irgendwie war es eine unausgesprochene Vereinbarung, dass sie vor ihm das Positive des Tages benannte.
»Wir sind heute einem bösen Mann auf die Schliche gekommen. Er hat auf seinem Computer Spuren hinterlassen, mit denen wir beweisen können, dass er ein böser Mann ist. Und dass er Schlechtes getan hat. Und dass ein Gericht ihn ins Gefängnis schicken kann.«
Sie hatten auch vereinbart, dass niemand klatschen würde. Denn sie wollten nicht, dass irgendeine positive Erfahrung mehr wert war als eine andere.
Nun richteten sich alle Augen auf ihn. »Und du, Papa?«, fragte Stefanie.
Tja, was war das Positivste des Tages? Es war verpönt, und dennoch brachte Horndeich es immer wieder: »Das Schönste an diesem Tag ist, dass ich mit euch allen hier zusammen zu Abend essen kann.«
Stefanie rollte die Augen, Alexander übte sich im Augenrollen, Antje krähte, und seine Frau warf ihm eine Kusshand zu. Na also! War das Fazit des Tages doch nicht wirklich schlecht.
Horndeich hatte sich gerade eine Schüssel Salat aufgetan, als das Handy, wenn auch leise, davon zeugte, dass irgendjemand genau in diesem Moment Horndeich sprechen wollte.
Sie hatten in der Familie eine Vereinbarung, an die er sich eisern hielt: Wenn das Handy beim Essen klingelte, dann drückte man ohne nachzuschauen auf den Button »Ich kann gerade nicht sprechen«. Ihm war es wichtig. Sandra war es wichtig. Ihre Kinder sollten von Beginn an lernen, dass ein Anruf von außen kein Grund war, die Zusammenkunft der Familie zu stören.
Horndeich wusste, dass er in wenigen Minuten zurückrufen würde.
Die Besprechung mit Schröder hatte sich genauso entwickelt, wie Jana es befürchtet hatte. So schnell er beim Gang durchs Haus die Peitsche geschwungen hatte, so genüsslich zelebrierte er das Feilschen um jeden Euro der Eigenbeteiligung für die sicherheitstechnische Ertüchtigung des Wohnhauses.
Schröder war sicher davon ausgegangen, dass diese Verhandlungen wesentlich weniger Zeit in Anspruch nehmen würden als die Hausbesichtigung. Aber Jana hatte den Auftrag, das Vermögen von Maria Jimenez so zu verwalten, dass es nicht schrumpfte. Und Schröder verfügte ebenfalls über eine nicht unerhebliche Habschaft, wie Jana annahm.
Zwei Stunden später hatten Jana und Schröder sich geeinigt. Jana hatte sich daraufhin in ihrer Wohnung im Lucasweg 13 schnell etwas zu essen zubereitet, war dann über die Mathildenhöhe in Richtung ihres Büros gegangen, den schäbigen Pappkarton voller Auszüge unterm Arm. Ihr Büro befand sich im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Klinkerbaus aus den Fünfzigerjahren in der Pützerstraße. Seinerzeit war das sogenannte Ernst-Neufert-Haus wegweisend in der Architektur gewesen.
Janas Geschäftsräume erstreckten sich über rund sechzig Quadratmeter und bestanden aus einem großen Raum mit zwei Schreibtischen und einem Besprechungstisch, dann ihrem eigenen, kleinen Büroraum, einer Küche, einer Toilette und einem größeren Archivraum.
Sie stellte den Schuhkarton auf dem Besprechungstisch ab. Und betrat das Archiv. Vier Regalbretter waren bereits mit Unterlagen von Maria Jimenez belegt.
Ihr Bruder Alfredo Jimenez war am Samstag vor fünf Tagen nach Darmstadt gekommen. Er hatte sich mit seiner Frau in einem Hotel einquartiert. Ihr Wohnsitz lag in Mecklenburg-Vorpommern, nahe der polnischen Grenze in Pasewalk. Jimenez besaß eine eigene Landwirtschaft und hatte Jana bereits zuvor am Telefon wortreich erklärt, dass er von dort aus nicht auch noch die Güter seiner Schwester verwalten wollte und konnte. Nachdem diese verschwunden war und auch die Polizei in der darauffolgenden Zeit keinen Hinweis auf ihren Verbleib hatte entdecken können, aber ebenso wenig Hinweise auf ein Gewaltverbrechen hatte, hatte er sich an das Amtsgericht gewandt. Seine Schwester besaß drei Immobilien, zwei davon waren vermietet. In einem der Häuser hatte es einen Kurzschluss gegeben. Elektriker hatten bestellt werden müssen. Und Alfredo hatte keine Lust gehabt, das aus seiner eigenen Kasse zu bezahlen. Und auf Konten der Schwester hatte er keinen Zugriff. Also hatte er sich an das Amtsgericht gewandt, die dann einen Abwesenheitspfleger bestellten. Alfredo hatte seinen Cousin Diego Lopez vorgeschlagen, da dieser bei einer Hausverwaltung arbeitete und sich daher im Metier auskannte. Und er wohnte auch noch in Darmstadt. Daher hatte er das Mandat erhalten.
Nachdem Diego Lopez drei Wochen zuvor plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben war, wollte Jimenez das Mandat auf jeden Fall von einer anderen Person weiterführen lassen. Das Amtsgericht hatte sie, Jana Welzer, dazu bestimmt. Und Alfredo Jimenez sowie auch Diego Lopez’ Witwe Barbara hatten sich Jana gegenüber von Anfang an sehr kooperativ gezeigt.
Sie rechnete es Alfredo hoch an, dass er nach Darmstadt gekommen war, um sie dabei zu unterstützen, die Übergabe der Abwesenheitspflege von seinem verstorbenen Cousin auf sie reibungslos durchführen zu können. Alfredo war gemeinsam mit Jana zur Witwe gefahren, hatte sie einander bekannt gemacht, hatte all die Unterlagen, die Diego in seinem heimischen Büro aufbewahrt hatte, im eigenen Wagen zu Janas Geschäftsräumen transportiert.
Jana holte aus dem Archivraum zwei leere Ordner und trug sie zum Besprechungstisch. In diese Ordner würde sie die Kontoauszüge aus dem Schuhkarton umsiedeln. Während sie die einzelnen Auszüge in die Ordner sortierte, überflog sie bereits das monetäre Tagebuch. Aber sie konnte nichts Ungewöhnliches erkennen. Keine außergewöhnlichen Einnahmen, keine exorbitanten Ausgaben. Alles im Rahmen.
Jana hatte auch alle anderen Ordner bereits überflogen. Und sie war ebenfalls auf Unterlagen zu diesem Konto bei der Sparkasse gestoßen. Aber in den Heftern befanden sich eben nicht die Originalauszüge, sondern DIN-A4-Ausdrucke, die die Bank angefertigt hatte. Indem Diego Lopez die Dokumentation aller Geldbewegungen von Maria Jimenez bei dem Geldinstitut angefordert hatte, hatte der Cousin aus der Sicht eines Abwesenheitspflegers alles richtig gemacht. Das sprach für ihn.
Während Jana die Kontoauszüge in den Ordnern abheftete, war ihr die Frage mit dem Schuhkarton nicht aus dem Kopf gegangen. Welchen Sinn macht es, solche Unterlagen hinter einer Rigipswand quasi einzumauern? Hätte Maria Jimenez die Auszüge loswerden wollen, wäre Verbrennen sicher die sinnvollere Lösung gewesen. Oder auch ein simples Entsorgen in der Mülltonne. Deren Inhalt wurde schließlich im Müllheizkraftwerk bei über 850 Grad Celsius final vernichtet. Oder war Maria Jimenez schlichtweg nur ein Missgeschick passiert? Hatte der blöde Schuhkarton einfach auf der falschen Seite der Demarkationslinie gestanden, als sie eine der Rigipsplatten ausgetauscht hatte? Aber wie sollte er dorthin gekommen sein? Wahrscheinlicher war hingegen, dass irgendjemand ihn dort bewusst abgestellt hatte.
All diese Gedanken kreisten in Ihrem Kopfkarussell, während sie die etwas eintönige Arbeit verrichtete. Es war bereits nach 19:00 Uhr, als ihr einfiel, dass noch niemand nach der Post geschaut hatte. Was daran lag, dass ihre Kollegin Irina sich drei Tage freigenommen hatte. Sie arbeitete halbtags in Janas Büro, kümmerte sich um die komplette Buchhaltung, nein, eigentlich um die gesamte Büroorganisation – inklusive des Leerens des Postkastens.
Jana stand auf, ging zur innen liegenden Seite des Briefkastens, schloss das Türchen auf. Tatsächlich war der Briefträger heute fleißig gewesen: zwei Rechnungen, drei Werbepostsendungen und ein Brief.
Der Brief war jedoch nicht an sie adressiert, sondern an Diego Lopez in der Darmstraße in Darmstadt. Zunächst hatte Jana keine Ahnung, wie dieser Brief in ihrem Briefkasten gelandet war. Sie nahm das Kuvert unter die Lupe. Es schien nicht geöffnet worden zu sein. Die Adresse war auf ein Etikett aufgedruckt. Ein Absender war nicht vermerkt. Die Briefmarke war eine aktuelle, 80 Cent wert, mit dem Motiv »50 Jahre Sendung mit der Maus«. Jana musste das Kuvert direkt unter die Schreibtischlampe halten, um den Stempel lesen zu können: »Briefzentrum Köln«. Er war am vorigen Tag abgestempelt worden.
Die erste Erklärung, die ihr einfiel, war, dass Barbara Lopez, die Witwe, diesen Brief in ihren Briefkasten geworfen hatte. Das würde sich schnell klären lassen. Sie griff zu ihrem Handy, aber noch während sie das Gerät entsperrte, fiel ihr ein, dass sie die Telefonnummer noch nicht unter ihren Kontakten abgespeichert hatte. Jana mochte es nicht, wenn die Adressdatenbank im eigenen Mobiltelefon mehr Einträge aufwies als die Anzahl der Abgeordneten im Deutschen Bundestag: Das waren inzwischen über 700. Und so übertrug sie Kontaktdaten von Personen für ihre Tätigkeit als Nachlass- und Abwesenheitspfleger immer erst dann auf ihre Geräte, wenn sie sie wirklich benötigte.
Sie klickte sich durch die Ordner in ihrem Rechner, bis sie bei Maria Jimenez landete. Dort hatte sie eine Worddatei mit Adressen angelegt. Tatsächlich befand sich da auch schon die Handynummer von Barbara Lopez. Sie übertrug sie auf ihr Gerät, dann wählte sie den Anschluss.
»Lopez, ja bitte?«, vernahm Jana die helle Stimme der Witwe von Diego Lopez.
»Guten Abend, Frau Lopez. Hier spricht Jana Welzer. Die Abwesenheitspflegerin, die das Mandat Ihres Mannes übernommen hat.«
»Ja, ich weiß, wer Sie sind. Und Sie rufen sicher wegen des Briefes an.«
Na also! Das hatte sich schon geklärt. »Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie ihn bei mir eingeworfen haben?«
»Ja. Er lag heute in meinem Briefkasten. Und ich bin spazieren gegangen und habe die Runde an Ihrem Haus entlang gemacht. Da habe ich ihn einfach eingeworfen. Ich weiß ja nicht, wie dringend das immer ist.«
»Sie haben ihn gar nicht geöffnet?« Das war eigentlich eine überflüssige Frage, denn der Brief war fest verschlossen. Wäre er tatsächlich geöffnet worden, hätte Barbara Lopez dies derart unsichtbar nur mit Stasimethoden erreichen können. Wovon Jana nicht ausging.
»Nein. Ich habe niemals einen an meinen Mann adressierten Brief geöffnet.«
»Und wieso haben Sie ihn mir vorbeigebracht? Es kann doch auch ein privater Brief sein.«
Barbara Lopez zögerte nur kurz, dann sagte sie: »Mein Mann hat immer nur Post bekommen, wenn es um die Sachen seiner Cousine ging. Die wenigen privaten Briefe, die uns erreichten, waren außerdem immer mit der Hand beschriftet. Machen Sie ihn einfach auf. Wenn es tatsächlich ein privater Brief ist, geben Sie ihn mir einfach zurück.«
»Haben Sie denn eine Ahnung davon, wer ihn geschickt hat? Ich habe nur sehen können, dass er in Köln abgestempelt worden ist.«
»Nein. Ich habe mich nie um die Geschäfte meines Mannes gekümmert.« Sie pausierte kurz, dann fuhr sie fort: »Was soll ich mit künftigen Briefen machen, die mich erreichen?«
Jana überlegte kurz. Sie ging nicht davon aus, dass noch viele Briefe an den Abwesenheitspfleger Diego Lopez geschickt würden. Der erste Schritt, als sie die Abwesenheitspflegschaft übernommen hatte, war gewesen, dass Irina die Ordner ausschließlich nach relevanten Ansprechpartnern durchsucht hatte. Irina hatte diese danach per Mail oder Telefonat vom Wechsel der Abwesenheitspflegschaft für Maria Jimenez informiert. Jana machte sich eine mentale Notiz, Irina zu fragen, ob sie irgendjemanden in Köln kontaktiert hatte.
Zu Barbara Lopez sagte sie: »Ich glaube nicht, dass Sie noch viele Briefe für Ihren Mann erhalten werden. Zumindest keine, die seine Verwaltung der Dinge von seiner Cousine angehen. Ich habe bereits alle notwendigen Stellen informiert. Sollte tatsächlich noch Post bei Ihnen landen, können Sie die Briefe gern öffnen und nachschauen, ob sie für mich relevant sind. Oder Sie sammeln sie, und ich komme sie einfach abholen. Sie müssen auf jeden Fall nicht für jeden einzelnen Brief bei mir vorbeikommen. Aber haben Sie herzlichen Dank, dass Sie mir diesen Brief gebracht haben.«
Die beiden Frauen verabschiedeten sich voneinander. Und Jana widmete sich der seltsamen Post. Wenn ein Brief keinen Absender trug, machte das Jana stets misstrauisch. Es gab einfach keinen Grund, einen Empfänger nicht wissen zu lassen, wer der Verfasser des Briefes war. Zumindest gab es keinen lauteren Grund. Jana entnahm ihrer Schreibtischschublade einen Brieföffner und schlitzte das Kuvert an der oberen Seite auf. Dann legte sie den Umschlag auf die Schreibtischunterlage, stand auf, verließ ihr Büro, ging ans andere Ende der Räume in den Toilettenraum. In einem Schrank bewahrte sie nicht nur Putzutensilien auf, sondern auch eine Box mit Einweghandschuhen.
Während sie zurück in ihr Büro ging, fummelte sie den Handschuh über ihre Hand. Sie hasste diese Art von Fingerkleidung, die nicht sanft über die Haut glitt, wie es jede Art von Kleidung eigentlich tun sollte. Sie setzte sich wieder auf ihren Bürostuhl, dann fingerte sie ein Blatt Papier aus dem Briefumschlag. Sie entfaltete den Bogen im DIN-A4-Format und las den Text. Die Länge des Briefinhalts hätte jedem Post auf Twitter alle Ehre gemacht: Er bestand aus einem einzigen Satz mit insgesamt sieben Worten und 38 Zeichen inklusive Satzzeichen, wie Jana fast automatisch berechnete. »Maria Jimenez ist nicht mehr am Leben.« Ausgedruckt mit einem Laserdrucker, keine Unterschrift.
Seltsam.
Irritierend.
Der Schuhkarton voll mit Kontoauszügen hinter einer Wand in einem Haus, das war schon seltsam genug. Aber jetzt auch noch solch ein anonymer Brief, adressiert an den verstorbenen Abwesenheitspfleger? Wer immer diesen Brief gesendet hatte, er hatte offenbar noch nichts von Diego Lopez’ Tod mitbekommen. Was sollte dieser Brief? Ein Brief ohne jeden Hinweis darauf, wie der Absender zu dieser Einschätzung gekommen war. Und wieso anonym?
Wahrscheinlich handelte es sich einfach um einen blöden Scherz.
Einen blöden Scherz aus Köln?
Sie seufzte.
Sie könnte diesen Brief zerknüllen und in den Papierkorb werfen.
Dann die Abwesenheitspflege für Maria Jimenez einfach weiter professionell handhaben.
Den Schuhkarton Schuhkarton sein lassen.
Den Brief Brief sein lassen.
Ja, das könnte sie machen …
Horndeich saß in seinem Wagen und fuhr auf der B 38 durch den Odenwald. Nach wie vor tat sein auberginefarbener Mazda Xedos 9 treu seinen Dienst und kutschierte ihn seidenweich durch die Gegend.
Nach dem Abendessen hatte Horndeich mit seinen beiden älteren Kindern den Tisch ab- und die Spülmaschine eingeräumt. Die Aufgabenverteilung war ganz klar geregelt: Wer das Essen zubereitete, musste nicht abräumen und abwaschen. Was bislang in der Praxis hieß: Sandra kochte, er, Stefanie und inzwischen auch Alexander kümmerten sich um Küchen- und Geschirrreinigung. Seine Frau mochte das Kochen, Horndeichs Ding war es eher nicht. Stefanie hatte ein paarmal versucht, der Mutter nachzueifern, aber, Horndeich schmunzelte bei dem Gedanken in sich hinein, sie war mit ihren neun Jahren definitiv eine bessere Cellospielerin als Köchin.
Es war Margot Hesgart gewesen, die ihn während des Essens versucht hatte zu erreichen. Als er das Gespräch nicht angenommen hatte, hatte sie ihm eine Whatsapp-Nachricht geschickt: »Hätte kurzfristig einen Auftrag für dich. Interessiert? Dann müsste ich dich heute Abend aber noch briefen. Der Kunde ist ein bisschen eigen. Gruß, Margot.«
Seine ehemalige Kollegin bei der Mordkommission in Darmstadt lebte inzwischen in Lichtenberg im Odenwald, rund 30 km von Darmstadt entfernt. Er erreichte das Haus, in dem sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Nick wohnte. Ein Teil beherbergte die Geschäftsräume, der andere Teil das private Domizil.
Margot öffnete die Tür zu ihren Privaträumen, nachdem sie Horndeich begrüßt hatte. »Ist ja schön, dass es geklappt hat. Wie geht’s dir?«
Horndeich nickte nur, entledigte sich seiner Jacke, die sie sofort an der Garderobe platzierte.
Wenig später saßen sie in Margots Wohnzimmer. Horndeich mochte das lederne Sofa, auf dem er saß. Auch wenn er es für seine eigenen Räume als zu wuchtig empfunden hätte. Zumal Margot zwei davon im Neunzig-Grad-Winkel aufgestellt hatte. Sie saß auf dem zweiten Kanapee.
»Wo ist Nick?«, erkundigte er sich.
Margot griente. »Ist mit seinen Jungs unterwegs. Männerabend. Ich bin ja froh, dass er hier über die Jahre richtig Anschluss gefunden hat. Magst du was trinken?«
Horndeich nickte. Zwei Minuten später stand vor ihm ein Glas Hefeweizen, alkoholfrei, mit zwei halben Zitronenscheiben. Margot wusste, dass er bei solchen Außentemperaturen gern Hefe mit Südfrucht trank, obwohl dort keine Zitrone hineingehörte. Sie selbst hatte sich ein Glas Rotwein eingeschenkt. »Es ist gut, dass wir heute noch mal miteinander sprechen. Denn ich habe auch eine Frage an dich. Aber lass uns erst mal das Geschäftliche klären«, sagte Horndeich.
»Na, da machst du mich aber neugierig. Aber gut, erst das Business: Nick und ich betreuen schon seit einem halben Jahr eine Firma in Hirschhorn.«
Horndeich runzelte kurz die Stirn, überlegte und ordnete den Ort ein: am Neckar gelegen, rund 80 km von Darmstadt entfernt und der südlichste Zipfel ihres Bundeslands Hessen.
»Sie heißen Zinker und sind so Verbindungsteilespezialisten für die Autoindustrie. Schrauben, Nieten und noch anderes Spezialzeug, das ich nicht wirklich durchschaue. Vor einem Dreivierteljahr sind sie Opfer eines Hackerangriffs geworden. Dabei wurde klar, dass den Cyberkriminellen irgendjemand innerhalb der Firma geholfen haben muss. Und zwar jemand, der von außen in die Firma eingebrochen ist. Da kamen wir dann ins Spiel und haben für das gesamte Unternehmen ein neues Sicherheitskonzept erstellt. Feller hat uns dabei sehr geholfen.«
Horndeich kannte Richard Feller. Er hatte als Kommissar über Jahre mit dem IT-Experten zusammengearbeitet. Man sagte Feller nach, dass er eine Festplatte nur in seine Hand legen müsse, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Das war natürlich übertrieben, aber Horndeich kannte keinen Menschen, der besser in der Lage gewesen wäre, irgendwelchen digitalen Datenträgern ihre Mysterien zu entlocken.
Horndeich unterbrach sie. »Wie geht es ihm eigentlich?« Er korrigierte sich selbst: »Wie geht es ihnen?« Sofort wollte er sich wieder korrigieren: Nur weil Richard Feller seit nunmehr zwei Jahren mit der Kommissarin Leah Gabriely liiert war, konnte man sie dennoch als zwei getrennte Persönlichkeiten wahrnehmen, oder? Er fragte sich kurz, ob die Leute, wenn sie sich nach seinem Wohlbefinden erkundigten, auch immer ihn und Sandra vermengten.
Margot bekam von dem kleinen gedanklichen Exkurs nichts mit und antwortete: »Ihm geht es gut. Er genießt die Freiberuflichkeit. Mit der Rente im Rücken klappt das ganz gut. Und deshalb geht es den beiden zusammen wohl auch ganz gut, denn Leah im Kommissariat und Richard Däumchen drehend zu Hause – das würde ganz bestimmt nicht gut laufen.«
Margot machte eine kurze Pause, dann sprach sie weiter: »Nachdem Nick und Richard und ich das Gelände und auch die Computer-Infrastruktur gesichert hatten, rief der Geschäftsführer heute an und fragte mich, ob ich nicht vielleicht jemanden kennen würde, der für ihn verdächtige Mitarbeiter überwachen könne. Alles im Rahmen des Legalen, aber er wolle verhindern, dass er noch mal Opfer solch eines Coups wie jenem von vor neun Monaten würde. Er hatte begriffen, dass ein Privatdetektiv deutlich billiger ist als ein Angriff auf seine Firma. Der Geschäftsführer Norbert Zinker – Firmenchef in der vierten Generation – ist nicht ganz einfach zu nehmen. Freundlich formuliert: alte Schule. Nicht ganz so wohlwollend: cholerischer Macho. Wenn das was für dich wäre, müsstest du morgen Nachmittag bereits dorthin fahren, und ich würde dich jetzt in die wichtigsten Dinge einweihen.«
Horndeich musste nicht lange überlegen. Denn er hatte sehr schnell herausgefunden, dass der geringste Teil der Arbeit eines Privatermittlers jener war, untreuen Ehepartnern nachzustellen. Das waren die Fälle, die im Fernsehen Furore machten: der Privatdetektiv, der das außereheliche Verhältnis dokumentierte. Ja, hatte er auch schon zweimal gemacht. Aber das Problem bei diesen Fällen war: Der vermeintlich betrogene Ehepartner betrat sein Büro, wollte Gewissheit, schickte den Detektiv los. Der lag zwei Tage auf der Lauer, dokumentierte die Untreue der Gattin oder des Gatten, druckte die Bilder aus, übergab sie, stellte eine Rechnung – und der Auftraggeber ward nie mehr gesehen. Mit der Bestätigung des Fehlverhaltens war das Geschäftsverhältnis zwischen Klient und ihm beendet. Das war sicher befriedigend für den Mandanten. Aber was daraus definitiv nicht folgte, war ein Folgeauftrag. Denn zumeist waren die Menschen nur einmal miteinander verheiratet.
Geschäftskunden hingegen sicherten das eigene Einkommen nachhaltiger. Am besten mit Rahmenverträgen. Den Unternehmen war daran gelegen, herauszufinden, ob der vom Orthopäden für kaum gehfähig beurteilte Mitarbeiter nicht doch jeden Tag zwei Stunden seine Runden mit dem Hund drehte. Und ob Krankgemeldete nicht die Motorradtour mit den Freunden machten. Oder ob sich der leitende Angestellte nicht mit seinem Kollegen von der konkurrierenden Firma heimlich im Nachtklub traf. Deshalb kam Horndeichs Antwort, ohne zu zögern: »Klar, danke! Habe ein bisschen Luft im Moment und mache das gern. Und mit cholerischen Machos kann ich umgehen.«
In den folgenden zwei Stunden lernte Horndeich alles über die Firma inklusive Sicherheitskonzept und Firmenhistorie. Während dieser Zeit war Margot auch auf Wasser als begleitendes Getränk umgestiegen. Zum Schluss drückte sie Horndeich einen USB-Stick in die Hand: »Da ist all das drauf, was ich dir eben gezeigt habe. Und du weißt: vertraulich.«
Horndeich nahm den Stick und ließ ihn in der Hosentasche verschwinden.
»So, mein Guter, jetzt will ich aber wissen, worüber du mit mir sprechen möchtest.« Der Satz wurde begleitet durch das Geräusch des Weines, den sie nun doch wieder in ihr Glas schenkte.
»Erinnerst du dich noch an den Namen Maria Jimenez?«
Margot antwortete zunächst nicht. Andere hätten es als »zappeln lassen« empfunden, aber sowohl Horndeich als auch Margot wussten, dass die Verankerung im Gehirn immer stärker war, wenn man sich selbst an etwas erinnerte, als wenn man es einfach mitgeteilt bekam. »Unsere Abteilung? Mord?«
Horndeich erwiderte nichts. Sie sollte von selbst darauf kommen.
Nach ein paar Sekunden sagte seine ehemalige Kollegin: »Nein, kein Mordfall. Keine Zeugin. Aber der Name sagt mir was. Ich meine, klingt spanisch. Mit solch einem Namen hatten wir es nicht jeden Tag zu tun. Wann?«
»Vor acht Jahren.«
Margot nippte an ihrem Glas, schaute an die Decke, legte die Stirn in Falten und sagte dann: »Maria Jimenez ist 2013 verschwunden.«
»Ja. Ganz genau.«
»Und was hast du damit zu tun? Ich meine, das war ja nicht mal unser Fall. Vermisstenanzeigen laufen ja nicht über die Mordkommission.«
Horndeich berichtete kurz vom Rundgang durch das Haus, das Maria Jimenez gehört hatte. Also genau genommen noch gehörte. Und dass eine Abwesenheitspflegerin sich um die Immobilie kümmerte.
»Und warum fragst du mich jetzt nach dieser Maria Jimenez?«, wollte Margot wissen.
Horndeich berichtete auch über den Schuhkarton voller Kontoauszüge hinter einer Rigipswand.
»Verstehe ich das richtig? Frau Jimenez hatte einen Schuhkarton mit Kontoauszügen von ihrem eigenen Konto hinter einer Gipswand …« Sie macht eine Pause. »Mir fällt kein richtiges Verb ein – versteckt? Oder – eingemauert? Oder war sie einfach nur ein bisschen verpeilt?«
»Genau das lässt mir keine Ruhe«, sagte Horndeich. »Wie kann man so zerstreut sein, dass man nicht merkt, dass der Schuhkarton mit den Kontoauszügen genau auf dem Platz steht, vor dem ich jetzt eine Wand anbringe. Das kann kein Versehen sein. Aber gleichzeitig ist es so sinnlos. Hast du noch mal irgendetwas über Maria Jimenez gehört?« Horndeich wusste selbst, dass diese Frage eigentlich ziemlich dusselig war. Er hatte den Polizeidienst vor zwei Jahren quittiert, Margot jedoch bereits vor sieben Jahren, also nur ein Jahr nach dem Verschwinden von Maria Jimenez.
Es folgte die Antwort, die er erwartet hatte: »Nein. Wieso? Willst du da jetzt nachbohren?«
»Will ich nicht«, antwortete Horndeich und wusste in diesem Moment bereits, dass er damit nicht nur Margot, sondern auch sich selbst anschwindelte. Auf der anderen Seite war er nicht mehr bei der Polizei. Und ein Schuhkarton hinter einer Wand war zwar seltsam, aber nun auch kein Hinweis auf irgendein Verbrechen. Dennoch fragte er: »Da müsste es doch noch eine Akte geben, oder?«
Margot zuckte mit den Schultern. »Klar. Er gibt sicher noch eine Akte. Aber, mal ganz nüchtern: Ein Schuhkarton hinter einer Rigipswand ist zwar seltsam, aber nun auch kein Hinweis auf irgendein Verbrechen.«
Horndeich zuckte ein klein wenig zusammen, als Margot den Satz, den er kaum eine Sekunde vorher gedacht hatte, fast wörtlich aussprach.
Ja. Sie waren schon ein verdammt gutes Team gewesen.
Und genau genommen waren sie es ja heute immer noch.
Rocio II
Ich war ein glückliches Kind.
Ich war von meinen Eltern gewollt. Sie hatten sich über mich gefreut, als ich vor nun mehr als 58 Jahren zur Welt gekommen war.
Ich war das erste Kind und sollte das einzige bleiben. Ich war Mamas Liebling. Und ich war Papas Liebling. Er hat es mir immer hoch angerechnet, dass ich zwei Tage vor dem Großen Preis von Spanien das Licht der Welt erblickte. So konnte er mit seinen Freunden das letzte Formel-1-Rennen live sehen, das auf der Rennstrecke neben unserer Heimatstadt ausgetragen worden war. Wie oft hatte er mir erzählt, dass er es persönlich miterlebte, als Alberto Ascari das Rennen auf seinem Lancia gewann. Noch vor Fango auf Mercedes. Ich hatte Papas Formel-1-Leidenschaft nie geteilt, mich aber immer darüber gefreut, wenn er mich in den Arm genommen und geknuddelt hatte, während er die Geschichte erzählte – als hätte ich damals irgendeinen Einfluss auf das Geschehen gehabt.
Meine Zeitrechnung als Kind bemaß sich nach den Wochenenden. Die verbrachten wir bei meinen Großeltern. Sie besaßen ein großes Haus in San Juan de Vilasar, damals 60 Busminuten von unserer Wohnung in der Stadt entfernt. Meine Eltern und ich hatten in dem Gebäude zwei Zimmer ganz für uns allein. Und das Haus lag keine zehn Minuten vom Strand entfernt. Damals noch mit Platz ohne Ende, bevor die Touristen das Land in den darauffolgenden Jahren Stück für Stück kaperten.
Ich war ein Strandkind.
Ich liebte den Sand, das Meer, die Wellen, die Wogen.
Unvergleichlich.
Unbezahlbar.
Ich war das kleine Mädchen, das Sandburgen baute.
Ich war das kleine Mädchen, dem alle applaudierten, wenn es Sandburgen gebaut hatte.
Ich war das kleine Mädchen, das Muscheln sammelte.
Ich war das kleine Mädchen, dem alle applaudierten, wenn es Muscheln gesammelt hatte.
Ich war die Prinzessin.
Nein, eigentlich war ich Königin. Wenn nicht sogar die Kaiserin in jenem Gebäude, das für meine Großeltern ein Haus war, für mich jedoch ein Palast.
Wenn wir nicht am Strand waren, spielte ich im Garten. Hinter den fünf Olivenbäumen war mein Versteck. Mein Papa hatte dort einen kleinen Unterstand für mich gebaut. Und mir ein altes Nachtschränkchen überlassen. Und Opa hat mir den Kinderstuhl aus Holz gezimmert. Als ich sieben war, passte ich kaum mehr hinein. Zu Weihnachten bekam ich den gleichen Stuhl, nur einfach an meine Körpergröße angepasst. Auf dem nun zu klein gewordenen Thron durfte meine Lieblingspuppe Platz nehmen, wenn wir beide »hinter die Oliven« gingen, wie ich mein Refugium nannte.
Im Nachtschränkchen waren die wichtigen Dinge versteckt: ein Taschentuch meines Großvaters, mit filigraner Seidenstickerei, das meine Großmutter ihm geschenkt hatte. Nein, sie war nicht begeistert, dass er es so bereitwillig an mich weitergegeben hatte – aber so richtig böse sein konnte sie ihm auch nicht, denn schließlich war sie es, die mir, ganz entgegen der Anweisung meiner Mutter, stets Zuckerplätzchen zusteckte.
Ebenfalls versteckt hatte ich dort drei Exemplare der Zeitschrift ¡Hola!. Mit vielen tollen Bildern drin. Von Königen und Königinnen, Schauspielern und Schauspielerinnen. Für meine Großmutter war es einfach nur eine Illustrierte, für mich ein Schatz. Besonders die Ausgabe vom November 1962 – mit einer deutschen Schauspielerin auf der Titelseite: Christine Kaufmann. In Farbe! Und ich wusste, wenn ich mal groß wäre, wollte ich genauso wie sie aussehen. Woran man sich auf seine alten Tage noch erinnert …
Meine Mutter konnte gut kochen. Meine Großmutter hingegen hätte in jedem Sterne-Restaurant als Köchin anfangen können. Gerade an den Wochenenden und auch in den Ferien, die ich oft allein bei meinen Großeltern verbrachte, war der Garten das Zentrum – wenn schon nicht der ganzen Stadt, so doch der nahen und auch der ein wenig weiter entfernten Nachbarschaft.
Ende der Leseprobe