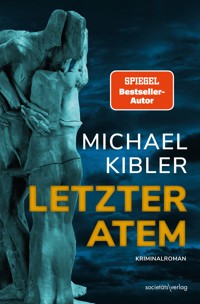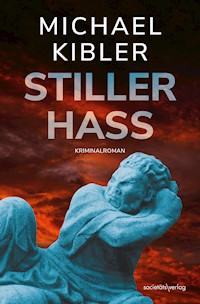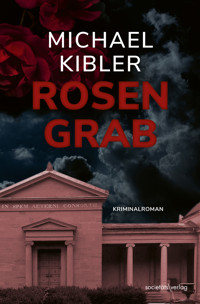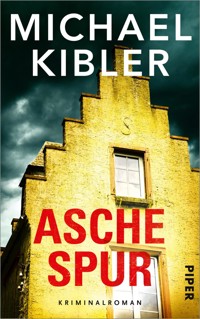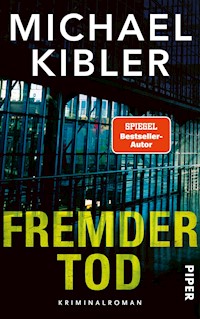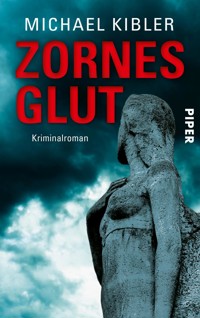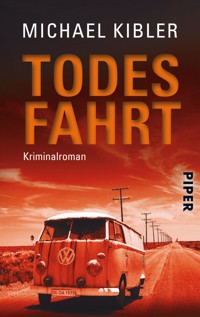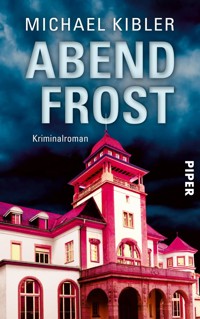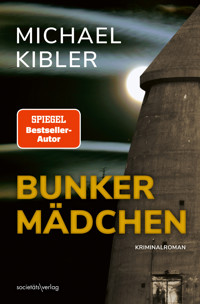
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Societäts-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vor 40 Jahren wurde die 24-jährige Charlotte Fries neben einem Weltkriegsbunker auf einem ehemaligen Eisenbahngelände in Darmstadt ermordet aufgefunden. Fünf Menschen hausten damals illegal in demBunker – doch weder die möglichen Zeugen noch der Mörder selbst wurden je aufgespürt. Der Cold Case fällt in der Gegenwart zufällig Privatdetektiv Steffen Horndeich in den Schoß, der gemeinsam mit seiner Partnerin Jana Welzer zu graben beginnt. Schnell werden sie in einen Strudel von Ereignissen gezogen, die den damaligen Mord in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen. Können Horndeich und Jana nach vier Jahrzehnten die Identität des Mörders doch noch aufdecken?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Michael Kibler
Bunkermädchen
Kriminalroman
Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag
© 2025 Frankfurter Societäts-Medien GmbH
Hedderichstraße 49 • 60594 Frankfurt am Main
Der Verlag behält sich das Text- and Data-Mining nach § 44b UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zustimmung des Verlages untersagt ist.
Satz: Julia Desch, Societäts-Verlag
Umschlaggestaltung: Julia Desch, Societäts-Verlag
Umschlagabbildung: Bunker: Armin Kübelbeck Hintergrund: Björn Lauer
Printausgabe ISBN 978-3-95542-533-3
E-Book ISBN 978-3-95542-534-0
Besuchen Sie uns im Internet:
www.societaets-verlag.de
Für die Hüterin der Dackel
Charlottes Tagebuch, Juli 1982
Abitur!
Endlich das Abi!
Mit 15 Punkten in Geschichte!
Wir sind ins Roma gegangen, im Lucasweg. Eine schöne Tradition, dort die Dinge zu feiern, die es zu feiern gilt.
Meine Eltern haben eingeladen, Oma und Opa waren auch dabei. Das sind so Momente, in denen ich traurig bin, dass Oma und Opa von Papas Seite schon so früh gestorben sind.
Opa hat eine Rede gehalten. Dass er stolz auf mich sei. Dass ich das Abitur mit so einer guten Note bestanden habe. Dass er seit Jahren den Austausch mit mir schätzt, die Perspektive der Jugend – in meinem Fall der reflektierten Jugend. Deren Argumente teile er nicht immer, aber er höre sie gerne und denke danach darüber nach.
Diese Anleitung zum eigenständigen Denken und Argumentieren, das sei es, was er an der heutigen Schulausbildung so schätze. Zu seiner Zeit seien dies keine Tugenden gewesen, sondern eher ein charakterlicher Makel. Und was er ebenso schätze: dass junge Frauen heute die Möglichkeit hätten, ihre Intelligenz in die Gesellschaft einzubringen.
Er hat die Rede frei gehalten, aber mir danach eine handschriftliche Version übergeben. Ja, manchmal bin ich nah am Wasser gebaut. Das habe ich dann mit Oma gemeinsam. Es ist so schön, wenn ich sehe, dass die beiden immer noch Händchen halten.
»Und du willst jetzt Geschichte studieren?«, wollte Opa von mir wissen.
»Klar«, habe ich geantwortet.
Das will ich ja auch. Aber ich möchte erst eine Ausbildung machen. Etwas Handfestes, womit ich immer einen Job bekommen werde. Geschichte studieren, wer weiß, ob mich das jemals ernähren wird. Vor allem nicht auf Lehramt, sondern Magister, weil ich dann interessantere Nebenfächer wählen kann. Und eines weiß ich ganz sicher: Ich will niemals finanziell von einem Mann abhängig sein. Weshalb ich jetzt auch anfange, die Ausbildung als Krankenschwester zu machen.
Und das habe ich Opa auch so gesagt.
Oma hat gelächelt, Opa zärtlich den Unterarm gestreichelt, mich angeschaut und dann gesagt: »Ich bin damit nicht schlecht gefahren, finanziell von deinem Opa abhängig zu sein.«
»Du hast ja auch Opa geheiratet«, habe ich gesagt. »Und, wenn ich das so sagen darf, da hast du ganz schön Schwein gehabt.«
Oma hat mir zugezwinkert und Opa einen Kuss auf die Wange gegeben. Danach haben wir gegessen. Ich hatte wieder Lasagne mit Huhn, lecker wie immer. Mein Opa hat wie stets sein Omelett gegessen – schwerere Kost mag sein Magen ja nicht mehr. Jeder von uns hat danach noch einen Kaffee getrunken, nur Oma ihren obligatorischen Eierlikör. Ich werde nie verstehen, was sie an diesem Zeug findet.
Danach hat Papa noch ein paar Worte gesagt. Ohne Skript. Wie stolz er und meine Mutter auf mich seien. Dann hat er gesagt, dass ich ja nicht nur ein super Abi hingelegt habe, sondern auch eine tolle Fotografin sei.
Ich hatte keine Ahnung, worauf er jetzt hinauswollte.
Ja, ich fotografierte gern.
Und ich fand es super, dass Papa mir bereits mit dreizehn beigebracht hatte, in seiner Dunkelkammer im Keller Filme zu entwickeln, Bilder abzuziehen.
Mein Papa – und das wurde mir erst viel später klar – hat da nie eine Rechnung aufgemacht. Er hat nie gesagt, ich solle weniger fotografieren. Nein. Es waren immer Filme da, es standen auch immer die nötigen Chemikalien zur Entwicklung im Regal, und es gab auch immer genügend Fotopapier.
Dann griff er unter den Tisch. Ich hatte mich vorher schon gewundert, dass er eine Tasche dabeihatte. Dann stellte er ein in Geschenkpapier verpacktes Päckchen auf den Tisch. Ich hab’s gleich geöffnet. Eine Spiegelreflexkamera.
Und nicht irgendeine Spiegelreflexkamera, sondern eine Canon A1. Das Beste im semiprofessionellen Bereich. Die Kamera, bei der ich mich nicht mehr zwischen Blendenautomat oder Zeitautomat entscheiden musste. Als ich das Geschenkpapier entfernt hatte, musste ich weinen.
Es war mein Opa in seiner trockenen Art, der sagte: »Du brauchst nicht aufhören zu heulen, ich lege noch einen drauf.«
Und er übergab mir das passende Blitzgerät, ein Speedlite 199A – mit einer Leitzahl von 30.
Und legte noch ein Bündel von zehn Ilford 36er-Schwarzweißfilmen dazu.
Sowohl mein Papa als auch mein Opa fotografieren ebenfalls gern – aber nur noch selten in Schwarzweiß. Aber beide akzeptierten, dass meine Liebe der Schwarzweiß-Fotografie galt. Und die Regale der Dunkelkammer wurden durch Heinzelmännchen noch immer mit allen nötigen Utensilien bestückt.
Etwas, was ich an beiden sehr, sehr mochte: Sie akzeptierten meine Meinung. Die von einer jungen Frau, die gerade einmal volljährig war.
Samstag, 3. Mai
Prost«, sagte Margot Hesgart und hob das Weinglas.
Steffen Horndeich tat es ihr nach und sie stießen an. Nicht zum ersten Mal in dieser Nacht. Im Kamin prasselte das Feuer, Margot hatte vor einer Viertelstunde nochmals drei Scheite nachgelegt. Auf dem Couchtisch standen zehn weitere leere Gläser. Privatdetektiv Steffen Horndeich, einstmals Mordermittler der Darmstädter Polizei, und seine ehemalige Kollegin waren die letzten Übriggebliebenen der kleinen Feier in Margots Haus in Lichtenberg. Bis vor elf Jahren hatten die beiden gemeinsam Mörder gejagt, bevor Margot den Dienst bei der Polizei quittiert hatte. Horndeich hatte es ihr fünf Jahre später nachgetan.
»Vor genau zwei Wochen war Hitlers Geburtstag«, sagte sie.
Horndeich runzelte die Stirn. »Wie bitte?«
»Ja. Am 20. April. Wäre dann 136 Jahre alt geworden.«
»Wie kommst du denn jetzt darauf? Und wieso weißt du so was?«
Horndeich sah auf seine Uhr. Eine Omega Speedmaster. Das Modell zeigte Viertel nach zwei. Doch Horndeich war nicht müde. Kurz nach Mitternacht waren die letzten Gäste gegangen, zehn Minuten später hatte sich Margots Mann Nick ebenfalls in Richtung Schlafzimmer verabschiedet. Horndeichs Frau Sandra war mit anderen Gästen ins dreißig Kilometer entfernte Darmstadt gefahren, um den Babysitter abzulösen. Seitdem saßen Margot und Horndeich auf der Couch vor dem Kamin. Es kam Horndeich vor, dass er seine ehemalige Kollegin und, ja, eigentlich wirklich eine Freundin, viel zu selten sah. Und so genoss er diese vertraute Stunde sehr.
Um 19 Uhr hatte die kleine Veranstaltung begonnen. Margot und ihr Mann hatten das achtjährige Bestehen des gemeinsamen Unternehmens »Hesgart & Peckhard« gefeiert – ein kleines Beratungsunternehmen für Sicherheitstechnik. Er hatte über den Abend verteilt ein paar Gläser Wein getrunken, würde auch nicht mehr nach Hause fahren. In ihrem Haus in Lichtenberg im Odenwald hatten Margot und Nick zwei Gästezimmer eingerichtet.
»Ich muss gerade an Charlotte Fries denken.«
»Wer ist Charlotte Fries? Und was hat sie mit Hitlers Geburtstag zu tun?« Horndeich merkte, dass der Wein bei Margot ein paar mentale Spuren hinterlassen hatte. Er selbst hielt sich bereits seit zwei Stunden am selben Glas Wein fest – er musste ja noch nach Hause fahren.
»Charlotte Fries war auch auf der Viktoriaschule. Wir waren damals zusammen in der Theater-AG. Und sie hatte auch am 20. April Geburtstag. Allerdings 74 Jahre danach. Und unser Geschichtslehrer – der auch die AG geleitet hat – der hatte zu den Geburtstagen der Schüler immer ein geschichtliches Ereignis parat. Charlotte hat damals angefangen zu heulen, als er ihr sagte, dass sie sich den Geburtstag ausgerechnet mit Hitler teilte. Seitdem hat er das nicht mehr gemacht. Ich hab ihr dann noch zugeflüstert, dass Joan Miró, also der spanische Maler, auch an dem Tag geboren wurde. Hat sie aber nicht wirklich getröstet. Kannte Miró wahrscheinlich nicht …«
Horndeich dachte kurz nach.
Er erinnerte sich an keinen einzigen Geburtstag ehemaliger Mitschüler. Lag vielleicht auch daran, dass er die Schulzeit eher verdrängte. Klar, an Louis erinnerte er sich, auch an Peter. Aber deren Geburtstage? Er hatte keine Ahnung. »Und? Habt ihr noch Kontakt?«
Margots Blick wirkte für einen kurzen Moment fast wütend. Dann sagte sie: »Das geht schlecht. Charlotte lebt nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Dir sagt der Name nichts?«
Horndeich schüttelte den Kopf.
»Na ja, bis vor einer Woche hab ich auch Ewigkeiten nicht mehr an sie gedacht. Genau genommen nicht mehr, seit ich von der Polizei weg bin. Da hatte ich mir ihren Fall noch mal angeschaut.«
»Ihren Fall?« Horndeich kramte in seinem Gedächtnis. Aber nein, bei dem Namen klingelte zunächst kein Glöckchen.
»Sie ist 1985 umgebracht worden. Drei Jahre nach ihrem Abi. Fünf nach meinem.«
Zu dieser Zeit hatte Horndeich noch gar nicht in Darmstadt gewohnt. »Und was hat letzte Woche die Erinnerung hervorgeholt?«
»Mein Abi-Treffen. 45 Jahre. Wenn ich mich bis dahin noch nicht alt gefühlt hatte – seit diesem Abend hat sich das definitiv geändert. Aber lassen wir das Thema. Warst du mal auf irgendeinem Klassentreffen?«
Horndeich hatte in seinem Leben an keinem einzigen teilgenommen. Er wusste nicht einmal, ob irgendjemand ein solches für einen Jahrgang, den er besucht hatte, je organisiert hatte. Vor drei Jahren hatte seine Frau Sandra einmal ein Klassentreffen besucht – und daraufhin dann einen Stalker am Hals gehabt, der sie später auch noch erpresst hatte. Nein, auf das Thema Klassentreffen war Horndeich wahrlich nicht gut zu sprechen.
Margot deutete Horndeichs Schweigen offenbar zutreffend als Nein und sprach weiter: »Thorsten war auch da.«
Horndeich hatte keine Ahnung, wer Thorsten war. Aber offensichtlich hatte der irgendetwas mit der toten Charlotte zu tun.
»Er hat tatsächlich einen aus dem Bunker gekannt.«
Margot war in ihren Gedanken ziemlich weit abgedriftet. Horndeich hatte keine Chance mehr, ihr zu folgen. »Thorsten? Bunker? Margot, wovon sprichst du?«
Margot sah ihn an. »Sorry. Magst du die Geschichte hören?«
»Klar, schieß los.«
»Charlotte und ich waren noch bis kurz vor meinem Abi 1980 in der Theater-AG. Obwohl sie zwei Jahre jünger war, haben wir uns gut verstanden. Und im Januar 1985 war sie ermordet worden. Erdrosselt. Ging damals durch die hessischen Medien. Sie lag neben einem der Bunker auf der Knell. Du weißt, das damalige Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn.«
Horndeich kramte in seinem Gedächtnis. Klar, in Darmstadt, westlich der Frankfurter Straße. Ein Gelände so groß wie zwölf Fußballfelder des Böllenfalltor-Stadions. Das Einzige, was von dem ehemaligen Bahn-Werk noch übrig war, waren die beiden Bunker und der Wasserturm. Direkt neben dem Wasserturm hatte das Hightech-Unternehmen ISRA Vision seine neue Firmenzentrale gebaut. Horndeich war unbegreiflich, wieso das Gebäude so nah an den Turm gebaut worden war. Betrachtete man es positiv, konnte man unterstellen, dass das Gebäude den Turm vor Wetterunbill von Westen her beschützen wolle. Doch Horndeich kam es eher so vor, als rücke der Koloss aus Stahl und Beton dem Turm einfach nur auf die Pelle. Außerdem hatte die Entega, der Energieversorger der Region, auf dem Gelände einen Standort.
Früher war auf dem Grundstück ein Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn angesiedelt. Waggons waren hier repariert worden, vom Radsatz bis zum Dach. Horndeich hatte sogar ein Luftbild im Kopf. Ein Darmstädter Autorenduo hatte vor wenigen Jahren ein Buch über die verschwundenen Orte Darmstadts veröffentlicht. Darin war die »Knell«, wie die Darmstädter das Gelände nannten, auch aufgeführt gewesen. Inklusive der beiden Bunker. Es handelte sich um zwei Hochbunker der Bauart Winkel. Auf Horndeich wirkten sie immer wie überdimensionierte Gartenzwerge aus Beton, die man vergessen hatte, bunt anzustreichen. 42 Gleise hatte das Werk gehabt. Komisch, wie man sich an solche Nebensächlichkeiten erinnern konnte.
»Man hat den Mord damals nicht aufklären können. Als ich dann bei der Mordkommission war – das war, bevor du dazu gestoßen bist –, da habe ich mir den Fall noch mal zur Brust genommen. Das war im Jahr 2000. Erst da habe ich dann auch die Tatortfotos gesehen. Es war das erste Mal, dass ich daran gezweifelt habe, ob ich den richtigen Beruf ergriffen habe. Es gab noch ein paar Asservate, unter anderem ihr Halstuch. Habe das alles untersuchen lassen. Und am Halstuch hat man tatsächlich die DNA vom Täter gefunden. Gab aber keinen Treffer in der Datenbank.«
Margot hielt inne. Jetzt, da sie davon berichtete, erinnerte sich Horndeich vage, von diesem Fall auch schon einmal gehört zu haben. »Und was hat das alles mit dem Bunker und diesem Thorsten zu tun?«
»Es waren zwei Bunker, also, es sind zwei. Sie standen damals ganz am Rand des Werks. Umgeben von Brombeerbüschen. Diesseits und jenseits des Werkszauns. Aber zwischen den Sträuchern war ein Trampelpfad zum Bunkereingang. Auf beiden Seiten der Zäune gezimmerte Holztreppchen. An der Tür des Bunkers ein Vorhängeschloss. Als die damaligen Kollegen es geöffnet hatten, staunten sie nicht schlecht: Im Bunker fanden sich fünf Schlafplätze, offensichtlich von Obdachlosen. Inklusive weiterer Utensilien wie etwa einem kleinen 2-Platten-Herd. Aber natürlich war keiner von den Bewohnern anwesend. Und es hat sich danach auch niemand bei der Polizei gemeldet.«
Wieder hielt Margot inne, wieder musste Horndeich den Erzählfluss manuell in Gang bringen: »Thorsten?«
Margot lächelte Horndeich an, hob nochmals das Glas, nahm einen weiteren Schluck und sagte dann: »Die Akte Charlotte Fries war sehr dünn. Keine Zeugen und der Tatort ohne echte Spuren. Eine Winternacht, in der es nur geschifft hatte. Und im Umfeld der Toten überhaupt keine Ermittlungsansätze. Keine bekannten Ex-Freunde, keine verschmähten Liebhaber – da war so überhaupt nichts gewesen. Und dann sprach mich Thorsten vergangene Woche auf dem Klassentreffen an. Ob denn der Mord an Charlotte jemals geklärt worden sei. Er hatte mit Charlotte Abi gemacht.«
»Moment – du sagtest, Charlotte habe 82 Abi gemacht. Wieso ist Thorsten dann auf eurem 80er-Abitreffen mit dabei?«
»Thorsten war ein Pechvogel. Am Tag, als er die zweite Abiprüfung geschrieben hatte, da ist er abends mit seinem Fünfziger-Motorrad vor dem Böllenfalltor aus der Kurve geflogen. Er lag sechs Monate im Krankenhaus, auch der Kopf hatte etwas abgekriegt. Er musste quasi wieder lernen zu laufen und vor allem war der linke Arm zunächst gelähmt. Nach dem Krankenhaus folgte ein weiteres halbes Jahr Reha. Dann ging er wieder zur Schule. Er hat wirklich sehr hart trainiert und man hat ihm nicht mehr angesehen, dass ihn der Unfall fast das Leben gekostet hätte. Er machte die Dreizehnte noch mal und legte ein ziemlich gutes Abi hin. Er war dann in Charlottes Jahrgang. Aber er war eben auch in unserem gewesen. Deshalb haben wir ihn zu jedem unserer Treffen alle fünf Jahre eingeladen. Diesmal ist er tatsächlich gekommen. Kam extra aus den USA.
Und seine Frage, ob der Mord jemals aufgeklärt worden war, die konnte ich nur verneinen. Dann fragte er mich, ob die Polizei denn jemals mit den Leuten aus dem Bunker gesprochen habe. Wie denn, habe ich zurückgefragt. Denn weder die Kollegen 1985 noch ich im Jahr 2000 hatten jemals herausgefunden, wer da übernachtet hat. Ein Kollege von mir ist auch 2002 nochmal an den Fall ran – war kurz, bevor du zu uns kamst. Aber der hat auch nichts Neues mehr herausgefunden.«
Horndeichs Blick wanderte in Richtung der Flammen im Kamin. Eigentlich müsste er Sandra vorschlagen, ob sie ihr Häuschen nicht auch durch einen solchen Gemütlichkeitsspender bereichern sollten. Es war Anfang Mai, und die Temperaturen hatten es sich seit zwei Tagen noch einmal knapp über dem Gefrierpunkt eingerichtet. Also offensichtlich ähnliche Temperaturen wie auch in der Nacht des Mordes an Charlotte Fries.
»Ich fragte Thorsten, ob er mehr wisse als ich. Und er sagte, einer der Leute, die in diesem Bunker genächtigt hätten, den hätte er flüchtig gekannt. Ich habe ihn gefragt, warum er das nie der Polizei erzählt habe. Und er hat geantwortet, dass er ihn kurz nach dem Mord nur noch einmal gesehen habe – und dann sei er in die USA gegangen, um zu studieren. Er hat gesagt, das sei ihm damals das Wichtigste gewesen. Er sei zu der Zeit auf einem ziemlichen Egotrip gewesen – nach seinem Unfall auch irgendwie verständlich.«
Auch Margot schien nun vom Kaminfeuer hypnotisiert zu werden. Horndeich fragte nach einer halben Minute: »Und jetzt? Hat dir dieser Thorsten den Namen des Kerls verraten?«
»Ja, hat er.«
»Und? Wirst du jetzt ermitteln?«
Margot lachte auf. »Horndeich, ich bin nicht mehr bei der Polizei. Du übrigens auch nicht.«
Horndeich nippte an seinem Glas. Langsam gingen die Flammen im Kamin zur Glut über. So saßen sie denn auf der Couch. Die ehemaligen Kollegen. Die Freunde.
»Und, wie hieß er?«
»Wer?«
»Der Mann aus dem Bunker.«
»Weiß ich nicht mehr – ich glaub, der Name ist im Wein ertrunken … Thorsten ist dann auch gleich gegangen. Mir ist es auch erst gerade eben wieder eingefallen.«
Sie nahm noch einen Schluck Wein, stellte das leere Glas auf dem Tisch ab.
»Horndeich, ich geh schlafen. Ich bin müde. Wir müssen morgen noch packen. Am Montag hebt der Flieger ab.«
»Wieder in Nicks alte Heimat?« Margots Mann stammte aus Indiana in den USA.
»Ja. Nick will seine Mutter besuchen. Auch wenn es natürlich nicht klar ist, ob sie ihn erkennt.« Sie zuckte mit den Schultern.
Horndeich nickte nur. Schlafen schien eine gute Idee zu sein. Er verabschiedete sich bereits von seiner ehemaligen Kollegin. Sie würde morgen ausschlafen können. Er wollte auf jeden Fall zum Frühstück wieder bei seiner Familie sein.
Montag, 5. Mai
Jana Welzer hatte frische Croissants gekauft und auch schon zwei Kaffee zubereitet. Es war Montagmorgen, 9:58 Uhr. Zu Wochenbeginn trafen Horndeich und sie sich stets um 10 Uhr. Seit knapp einem Jahr residierten sie nun gemeinsam in diesen wunderbaren Räumen. Direkt am Rande der Mathildenhöhe hatten sie den ersten Stock und das Dachgeschoss des Jugendstilhauses »Haus Deiters« gemietet. Der altehrwürdige Bau war 1901 errichtet worden, zur ersten Jugendstilausstellung des damaligen Großherzogs Ernst Ludwig.
Es war ein wundervolles Gebäude mit wundervoller Aussicht. Jana genoss es jedes Mal, wenn sie aus dem Fenster schaute. Schon allein deswegen fanden die Montagstreffen im Turmzimmer statt, am sechseckigen Tisch. Viel zu groß für sie beide, doch an zwei Wänden hingen jeweils zwei sehr nützliche Surface Hubs – große Flachbildschirme mit Tablet-Funktionen.
Etwas länger als das Mietverhältnis existierte die Partnerschaft mit Steffen Horndeich. Jana war nicht immer Privatdetektivin gewesen. Sie hatte BWL studiert, war in die internationale Spedition ihres Vaters eingestiegen. Das hatte sich im Nachhinein als keine gute Idee herausgestellt. Jahrelang hatte sie daraufhin für das Technische Hilfswerk gearbeitet, auch in leitenden Positionen. Vor wenigen Jahren hatte sie umgesattelt auf Nachlasspflegerin und Insolvenzverwalterin. Da hatte sie dann Horndeich kennengelernt. Zunächst hatte er für sie ein paar Recherchen durchgeführt, und vor einem Jahr hatten sie beschlossen, künftig in einer gemeinsamen Detektei als Partner zu arbeiten. Bislang hatte Jana das nie bereut.
Eine Minute später betrat Horndeich das Büro. »Wow! Kaffee! Perfekt!«
»Und dazu noch Croissants«, griente Jana.
»Womit habe ich das verdient?«
»Einfach so«, sagte sie. Meinte es aber nicht so. Es war jetzt mehr als ein Jahr her, dass ihr Lebensgefährte Ben verstorben war. Urplötzlich an einem Herzanfall. Die Zeit danach hatte Jana viel Kraft gekostet, um langsam wieder ins normale Leben zurückzufinden. Und Horndeich hatte sie dabei stets unterstützt. Hatte nie gemeckert, wenn sie plötzlich einmal ausfiel oder vielleicht nicht ganz so schnell und brillant dachte wie gewöhnlich, abgelenkt war oder aus heiterem Himmel Tränen flossen. Daran hatte sie besonders letzte Nacht gedacht und daher kurzfristig beschlossen, etwas früher da zu sein, den Kaffee zuzubereiten, Croissants mitzubringen.
»Hat Katharina ihn drangekriegt?«
Ganz Horndeich. Kaum hatte er das Büro betreten, schaltete er auf Business-Modus.
»Ja«, antwortete Jana.
Ihr Job im Geschäft der privaten Ermittler war natürlich ab und an geprägt von spektakulären Ermittlungen. Die Brot-und-Butter-Jobs waren jedoch meist viel banaler. Sie hatten zwei Rahmenverträge mit Unternehmen. Da ging es oft um Mitarbeiter, die in mehr oder minder sträfliche Aktivitäten verstrickt waren. So auch Hannes Peters. Der Klassiker: Krankschreibung, ohne krank zu sein. Das muss man ihm jedoch nachweisen. Horndeich und Jana waren sich nicht zu schade, auch über Stunden und Tage zu observieren. Doch gerade am Wochenende war es nützlich, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eben Katharina Hochnagel. Die inzwischen 30-Jährige hatte nach 20 Semestern ihr Philosophiestudium abgebrochen. Und das, was sie die zehn Jahre zuvor gemacht hatte, auf eine professionelle Schiene gesetzt: ›KaHo Recherche-Labor‹ lautete der Name des einen Unternehmens, ›KaHo Business-Service‹ das andere. Sie war die richtige Partnerin, wenn es kleinteilige Dinge zu recherchieren gab, und sie war ebenfalls die richtige Partnerin, wenn in irgendwelchen Projekten Menschen gebraucht wurden, die perfekt Spanisch und Deutsch sprachen. Sie machte auch die eine oder andere Übersetzung, aber als Zweisprachlerin, die es so gar nicht hinter einen Schreibtisch zog, begleitete sie lieber Manager als zuverlässige und diskrete Assistentin auf Zeit in spanischsprachige Länder.
Katharina war zwar nicht Partnerin, aber doch unverzichtbare Assistentin. Sonntagmorgen um fünf hatte sie Hannes Peters erwischt, wie der Mann mit Bandscheibenvorfall den sonstigen Gewohnheiten nicht widerstehen konnte und am Ostermontag sieben Kilometer Jogging absolviert hatte. Perfekt dokumentiert von Katharina Hochnagel.
Sie hatte Jana eine Nachricht geschrieben und die entsprechenden Fotos und Videos auf dem gemeinsamen Server abgelegt. Horndeich hatte sich bereits an den Tisch gesetzt, Jana schaltete den Monitor an und zeigte das Material. Inklusive Dehnungsübungen.
»Perfekt«, kommentierte Horndeich.
Jana würde nachher noch den nötigen Papierkram erledigen, dann wäre dieser Fall vom Tisch. Danach projizierte Jana den gemeinsamen Kalender auf den großen Monitor. Die Eintragungen waren sehr übersichtlich. Erst am morgigen Nachmittag hätten sie eine Sitzung bei der zweiten Firma, für die sie arbeiteten. Immer wieder gab es Fälle, in denen Menschen Ermittlungen von ihnen wünschten, die absolut diskret zu behandeln waren. Menschen mit viel Geld. Einige dieser Aufgabenstellungen hatten sie Katharina zu verdanken. Denn als Assistentin im oberen Management bekam man die eine oder andere Sorge des Klienten mit. Nicht zuletzt arbeitete Katharina hin und wieder auch für eine etablierte Frankfurter Detektei namens »Wantrupp & Wantrupp« – über die ebenfalls ab und an ein Auftrag an »Horndeich & Welzer« abfiel.
»Ist also eher ruhig im Moment«, fasste Horndeich zusammen und fegte mit der Hand die Croissant-Krümel von der Brust.
Konnte Jana nur zustimmen. »Wie war dein Wochenende?«, wollte sie wissen.
Ihr Partner berichtete vom gemeinsamen Familienausflug am Samstag. Steinbrücker Teich, Bootchen fahren, trotz Eiseskälte. Und dann erzählte er vom Treffen bei seiner ehemaligen Kollegin Margot Hesgart, die das achtjährige Bestehen ihrer Firma gefeiert hatte. »Und du so?«, stellte er die Gegenfrage.
Nein, Jana seufzte nicht. Diese Blöße würde sie sich nicht geben. »Ich war tanzen.« Bevor sie mit Ben zusammengekommen war, war sie an Wochenenden oft Salsatanzen gewesen. Um zu tanzen – und danach auch die Nacht nicht allein zu verbringen. An diesem Samstag war sie ebenfalls wieder losgezogen. Die Auswahl an Interessenten für weitere Aktivitäten jenseits der Tanzfläche war groß gewesen. Nur hatte sie keinerlei Interesse verspürt.
»Margot hat mir was erzählt, und irgendwie lässt mir das keine Ruhe«, sagte Horndeich unvermittelt.
»Was denn?«
Horndeich berichtete ihr von dem Mord an Charlotte Fries. »Jahrzehntelang keine Spur, auch bei der DNA kein Treffer, und dann ist da plötzlich jemand, der einen dieser Bewohner des Bunkers kennt.«
»Hast du den Namen?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Moment«, hielt Jana inne. »Charlotte Fries? Januar 1985? Neben dem Bunker auf dem ehemaligen Bahnbetriebswerk?«
»Ja. Wieso? Sagt dir das was?«
»Ja. Und nein. Ich hab es gesehen. Damals bei ›Aktenzeichen XY ungelöst‹. Irgendwann im Jahr 2002. Eine der ersten Sendungen, die Rudi Cerne moderiert hat. Ich war ja auch erst 18. Aber die Sendung ist mir im Kopf geblieben. Wegen dem Bunker. Und der Name auch. Und die haben damals was anders gemacht.«
»Und das wäre?«
»Zuerst hat Cerne sich mit einem Kommissar der Darmstädter Kripo unterhalten. Es gab ja nicht viele Spuren. Aber sie haben die Dinge der Obdachlosen aus dem Bunker gezeigt. Wohl in der Hoffnung, dass irgendjemand da irgendetwas erkennt. Und dann haben sie tatsächlich die Mutter der toten jungen Frau quasi auf die Bühne geholt. Und die hat unter Tränen gesagt, dass sich die Menschen, die in dem Bunker gewohnt hatten, doch bitte melden sollen. Sie seien die wichtigsten Zeugen.«
»Und hat sich dann jemand gemeldet?«
»Keine Ahnung. Ich erinnere mich nur an die Sendung.«
»Die würde ich jetzt gern sehen.«
Jana nickte nur. Sie auch. Ihre Hand glitt über Tastatur und Maus. Zwei Minuten später wusste sie, in welcher Sendung über den Fall berichtet worden war.
»Wikipedia hat eine Liste der Sendungen. Aber das Video ist, zumindest auf den ersten Blick, auf keiner der gängigen Plattformen zu finden.«
Horndeich hob eine Augenbraue.
Jana grinste und sagte: »Ich ruf sie an.«
Gemeint war Katharina. Die Frau für alle Fälle.
»14 Uhr im Schloss«, so lautete die simple Nachricht in der Chat-Gruppe von »Horndeich & Welzer« – zu der neben den Namensgebern nur noch Katharina gehörte. Die hatte offensichtlich Erfolg gehabt. Und auch sie liebte das neue Domizil im Haus Deiters – weshalb sie es immer nur als ›das Schloss‹ bezeichnete.
Horndeich hatte nach dem Treffen den Vormittag dazu genutzt, das Mittagessen zu kochen. Wenn alle Familienmitglieder zu unterschiedlichen Zeiten aßen, tendierte er dazu, einfach einen großen Topf Suppe oder Eintopf zu machen. Problemlos aufzuwärmen und auch dann immer noch lecker.
Seine Frau Sandra würde gegen 13:30 Uhr zu Hause ankommen, die kleine Antje im Gepäck. Die war inzwischen fünf Jahre alt, Kindergartenkind und der Sonnenschein der Familie. Sein Sohn Alexander, zehn Jahre alt, würde nach der Schule ebenfalls direkt nach Hause kommen, ebenso wie Stefanie, seine 13-jährige Tochter, die dieselbe Schule besuchte.
Sandra arbeitete bei der Polizei, als IT-Forensikerin. Halbtags. Zumindest in der Theorie. Derzeit hielten die Mörder die Füße still, Sandra kam also zumeist pünktlich nach Hause. Kurz vor eins vernahm Horndeich, dass jemand das Haus betrat. Dieser Jemand steuerte schnurstracks in Richtung Küche. »Hast du schon fertig gekocht?«, wollte Stefanie wissen.
»Hallo, dir auch einen guten Tag«, sagte der Vater.
Stefanie lächelte schräg, sagte dann: »Riecht lecker! Kann ich mir schon nehmen? Ich hab Hunger.«
Horndeich entnahm einer Schublade zwei Keramikschälchen, eins mit Snoopy versehen, das andere mit dem Konterfei von Charlie Brown. Er füllte beide Schälchen.
Dann setzte er sich zu seiner Tochter an den Küchentisch. Er hatte sich abgewöhnt, zu fragen, wie denn der Tag in der Schule so gewesen sei. Horndeich mochte keine einzeiligen Antworten. Und gerade seine älteste Tochter fing gemeinhin ohnehin zuerst an zu plappern. »Trötet Alexander nachher wieder durchs Haus?«, wollte sie wissen. Wertschätzung klang anders.
»Ja, dein Bruder wird heute ganz bestimmt wieder Klarinette üben.«
Stefanie verzog das Gesicht, Horndeich tätschelte ihr die Schulter, eine Geste, deren Ironie seiner Tochter nicht entging.
Alexander war ein musikalisches Wunderkind. Sehr zur Freude seiner Eltern, sehr zum Missfallen der ältesten Tochter. Denn Alexander nahm die Musik sehr ernst. Sowohl das Musizieren mit dem Cello als auch jenes mit der Klarinette. Letzteres Instrument hatte er erst vor einem Dreivierteljahr zum ersten Mal in den Händen gehalten. Und vor drei Monaten hatte seine Lehrerin kapituliert und gesagt, sie könne dem Zehnjährigen nichts mehr beibringen. Nun hatte er einen Lehrer an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt.
Horndeich und seiner Frau war bewusst, dass ständiges Üben am Tag für jene, die gerade nicht übten, ziemlich nervenzehrend sein konnte. Wie etwa für Stefanie. Antje, das Nesthäkchen, war da viel entspannter. Sie spielte mit ihrer besten Freundin Prinzessin, einerlei, welche akustischen Randbedingungen dabei zu stören vermochten. Nachdem Sandras älteste Tochter und Halbschwester der anderen drei, Liv, vor einem halben Jahr ausgezogen war, hatten sie ihrem Sohn Alexander die Wohnung im Souterrain als Musikzimmer zur Verfügung gestellt. Dort übte er. Und auch Fiona Kreutzer, die Tochter seiner ehemaligen Instrumentenlehrerin, die ebenfalls Klarinette spielte. Sie verbrachten Stunden um Stunden dort unten.
»Papa, kriege ich jetzt die AirPods Pro?«
Ein erneuter Versuch seiner Tochter, aus der Situation einen Vorteil zu schlagen. Kopfhörer, die Geräusche von außen unterdrückten.
»Wieso bist du eigentlich schon da?«, wollte Horndeich wissen. Nach seinem Kenntnisstand hatte seine Tochter am Montag auch die sechste Stunde Unterricht. Also bis ein Uhr.
»Letzte Stunde ist ausgefallen«, erwiderte sie knapp.
Da die Noten seiner Tochter definitiv im grünen Bereich lagen, hakte Horndeich nicht nach, ob das Ausfallen der Stunde dem Willen der Schule oder jenem der Tochter geschuldet war.
Und die hakte sofort nochmals nach: »AirPods Pro?«
»Nein«, antwortete der strenge Papa nur. Denn sie hatten der Tochter inzwischen zugestanden, ihr Zimmer direkt unter das Dach zu verlegen. Selbst bei den Fortissimo-Stellen jeglicher Komposition konnte sie dort vom Üben ihres Bruders nicht gestört werden.
»Papaaa«, insistierte sie.
»Stefanieeeee«, gab er zurück. Der Moment, in dem seine Tochter wusste, dass hier und jetzt an dieser Stelle nichts mehr auszurichten war.
»Schatz, ich muss wieder ins Büro«, sagte Horndeich.
»Kein Problem, Mama kommt ja auch gleich. Ist übrigens richtig lecker, was du da gezaubert hast«, sagte sie.
Horndeich stand auf, ging um den Tisch herum, drückte seiner Tochter einen Kuss aufs Haupt und verließ das Haus.
Horndeich hat es sich zur Angewohnheit gemacht, den Weg zum Büro zu laufen. 15 Minuten. Auch wenn es kalt war, so wie heute. Die Alternative war allerdings nicht die Fahrt mit dem Auto. Parkplätze im Umfeld der Mathildenhöhe waren mehr wert als Goldbarren. Und eine Fahrt mit dem Fahrrad bei Westwind – dann lieber laufen.
Als er das Büro erreichte, waren sowohl Jana als auch Katharina bereits vor Ort. Man traf sich im Turmzimmer. Jana hatte die Temperaturen dank Heizung auf ein heimeliges Niveau angehoben. Dann entdeckte Horndeich auf dem Tisch ein Gerät, das nicht zum eigenen Equipment zählte. »Was ist das denn?«, wollte er wissen.
Katharina lachte ihn an. »Es ist mir nicht nur gelungen, die passende XY-Folge aufzutreiben, sondern auch ein Gerät, das in der Lage ist, alte VHS-Videokassetten abzuspielen. Und ich habe sogar noch einen Adapter aufgetrieben, mit dem man die analogen Signale auf unsere wunderbaren Bildschirme projizieren kann. Nicht selbstverständlich«, sagte sie, aber das war Horndeich auch so klar.
Er konnte nicht anders, er musste fragen: »VHS? Wie bist du denn da dran gekommen?«
Katharina rollte mit den Augen. »Zuerst Internet, dann E-Mail, dann Kleinanzeigen im Netz – und hier bekommst du jetzt das Ganze im Paket.«
Mit dieser Antwort gab sich Horndeich zufrieden.
Drei Minuten später erwachte der Monitor zum Leben. Die typischen weißen Querstreifen einer VHS-Aufnahme leiteten den Filmbeitrag ein. Dann erschien Rudi Cerne auf dem Bildschirm. Er wirkte wie ein fetter Zwerg, denn das Bild war völlig in die Breite gezogen. Katharina tippte auf der Fernbedienung drei Tasten, dann erschien der Filmbeitrag im richtigen Seitenverhältnis.
Horndeich hatte erwartet, dass sie jetzt die Kassette bis zur richtigen Position spulen müssten. Aber der Beitrag begann direkt. »Und auch jetzt bitten wir Sie wieder um Ihre Mithilfe in einem schon etwas älteren Fall«, leitete Rudi Cerne den Beitrag ein. »Auch bei alten Fällen ist die Polizei stets bemüht, doch noch die Täter ausfindig zu machen. So auch hier im Fall von Charlotte Fries.«
Dann begann der Einspieler. Gezeigt wurde eine Schauspielerin, die in die Rolle von Charlotte Fries geschlüpft war. Die junge Frau hatte in Darmstadt gelebt und in Frankfurt Geschichte studiert. Der Film zeigte das Leben von Charlotte, machte aber für das geübte Auge sehr deutlich, dass es kaum Fakten gab, die Auskunft über ihren letzten Tag gaben. Einzig gesichert war, dass sie am Abend des 6. Januar auf das Gelände des Bahnbetriebswerks Darmstadt gegangen war, über Trampelpfade durch Brombeerhecken, über selbstgezimmerte Trittstufen vor und hinter dem Zaun, der keine zwei Meter hoch gewesen war. Dort musste sie auf ihren Mörder getroffen sein. Der Film zeigte, dass Charlotte Fries wohl gestoßen worden war, mit dem Kopf auf einen Stein aufschlug und danach mit dem Halstuch noch stranguliert worden war.
Der Einspieler endete, Rudi Cerne bat einen Kommissar Fritz Lahntaler auf die Bühne, den Horndeich nicht persönlich kannte. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dürfte der wohl auch kurz vor der Pensionierung gestanden haben.
»Herr Lahntaler, obwohl der Mord an Charlotte Fries bereits 17 Jahre zurückliegt, haben Sie dennoch berechtigte Hoffnung, den Fall heute mit der Hilfe unserer Zuschauer lösen zu können. Worauf gründet sich diese Erwartung?«
Horndeich seufzte innerlich. Die positive Bilanz von XY war, um es freundlich zu formulieren, überschaubar. ›Berechtigte Hoffnung‹ hielt er für eine etwas zu hochgegriffene Formulierung. Dennoch fuhr Fritz Lahntaler optimistisch fort – die Sendung lag nun auch schon mehr als 20 Jahre zurück: »Wir haben im angrenzenden Hochbunker einige Gegenstände vorgefunden, die darauf hindeuten, dass hier mindestens fünf Menschen über eine ganze Weile hinweg gehaust haben. Mit diesen Menschen würden wir gern reden. Sie könnten Zeugen sein bei diesem abscheulichen Verbrechen.«
Dann wurden die Gegenstände gezeigt. Ein Schlafsack, Taschen, ein Gaskocher – aber, unterm Strich, Massenware. Cerne verabschiedete sich formvollendet von seinem Gast und sagte dann: »Normalerweise haben hier nur die Ermittler das Wort. Aber heute wollen wir eine Ausnahme machen. Denn Charlotte Fries’ Mutter möchte einen Appell an die Bewohner dieses Bunkers richten.«
Die Dame, die nun zu Rudi Cerne ging, schätzte Horndeich auf ungefähr 60 Jahre. Während sie sprach, rannen Tränen ihre Wangen hinunter. Sie sah direkt in die Kamera: »Wer auch immer in diesem Bunker gelebt hat – ich bitte Sie eindringlich: Wenn Sie etwas gesehen oder gehört haben, melden Sie sich! Nur mit Ihrer Hilfe kann die Polizei endlich herausfinden, wer meine Tochter ermordet hat.« Die letzten Worte hatte das Weinen fast gänzlich verschluckt.
Horndeich schluckte. Und er sah, dass auch Jana und auch Katharina dieser Beitrag nicht unberührt gelassen hatte.
Weiteres Gekrissel auf dem Bildschirm machte klar, dass der Beitrag zu Ende war.
Schweigen waberte im Raum. Weder Jana noch Katharina sagten etwas, auch Horndeich fiel kein passender Kommentar ein.
Schließlich sprach Jana zuerst: »Und du sagst, dieser Klassenkamerad von Margot, er kannte einen der Bewohner dieses Bunkers?«
»Ja. Aber ich kenne den Namen nicht.«
»Aber du kennst den Namen von diesem Klassenkameraden?«
»Thorsten«, sagte Horndeich. Im selben Moment erkennend, dass dies keine große Hilfe war.
In diesem Moment leuchtete Horndeichs Handy auf. Er hatte sein iPhone so eingestellt, dass Nachrichten akustisch nicht angezeigt wurden. Nur Anrufe vibrierten. Er nahm das Gerät auf, entsperrte den Bildschirm.
»Fliegen gleich los. Er kann dir den Namen nennen. Weiß nicht, ob dir das wichtig ist, aber ich wollte es dir auf jeden Fall schicken«, lautete die Nachricht von Margot.
Dann erschien ein Foto auf dem Bildschirm. Es zeigte die Visitenkarte von Thorsten Selbig. Chef einer amerikanischen Firma für Getreidehandel. Der Sitz der Firma war im US-amerikanischen Topeka. Auf der Karte standen auch E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer.
Horndeich hatte gar nicht registriert, dass Katharina ihm über die Schulter geschaut hatte. Aber sie sagte: »Kansas.«
»Die Rufnummer?«
»Auch. Aber vor allem Topeka. Hauptstadt von Kansas.«
Horndeich war immer wieder erstaunt über die Allgemeinbildung von Katharina. Nein, Allgemeinbildung traf es nicht. Eher Bessernasen-Wissen für Fortgeschrittene. »Rufnummer ist Festnetz?«
»Kann man in den USA nicht sagen. Alle Nummern kommen aus demselben Nummernpool. Kansas. 816. Egal ob Festnetz oder mobil.«
»Na, dann probieren wir das doch gleich mal.«
Horndeich wählte die »+1« für die USA, dann die Vorwahl 816, wenn man Katharina glauben durfte, für Kansas, und dann die restliche Ziffernfolge.
»Ist noch ein bisschen früh da«, sagte Katharina.
Horndeich war klar, dass es in den USA immer früher war als in Deutschland. Aber wie viele Stunden Kansas zurücklag, das konnte er beim besten Willen nicht sagen.
»Sieben Stunden«, beantwortete Katharina die nicht gestellte Frage.
»Hello«, meldete sich eine männliche Stimme im Handy. Sie klang ausgeschlafen.
»Guten Tag, spreche ich mit Herrn Selbig?«, fragte Horndeich auf Deutsch.
»Ja«, antwortete die Stimme – nun ebenfalls auf Deutsch.
»Hier spricht Steffen Horndeich. Ich bin ein Freund von Margot Hesgart. Und wie Margot bin auch ich ehemaliger Mordermittler in Darmstadt. Margot sagte mir, Sie hätten zusammen über den Mordfall an Charlotte Fries von 1985 gesprochen.«
»Hallo und guten Tag. Ja, das haben wir. Was kann ich für Sie tun?«
Tja, Horndeich war doch ein wenig überrumpelt davon, dass dieser Thorsten sofort ans Telefon gegangen war. »Herr Selbig …« Bevor er anfing zu stammeln, stellte er das Reden lieber ein.
»Sie sind die Polizei und wollen den Fall jetzt doch noch einmal aufnehmen?«
»Nein, ganz so einfach ist es nicht. Ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten. Ich bitte um zehn Minuten Ihrer Zeit. Ich möchte nach Möglichkeit mehr erfahren über den Mann, den Sie aus dem Bunker kennen.«
»Da haben Sie Glück. Ich fliege morgen zurück in die USA. Habe hier noch Verwandtschaft besucht. Wollen wir uns morgen treffen? Am Flughafen Frankfurt?«
»Ja, selbstverständlich, gern. Wo dort?« In Gedanken überschlug er bereits, wo nochmal überall diese »Meeting-Point«-Schilder hingen.
»Ich schlage vor, im Airport-Club. Mein Flug geht um 12:55 Uhr. Würde es Ihnen um 10:30 Uhr passen?«
Horndeich hatte keine Ahnung, worum es sich beim Airport-Club handelte. Doch er wollte sich jetzt auch nicht die Blöße geben, nachzufragen. Deshalb sagte er kurz und knapp: »Sehr gern.«
»Wunderbar. Dann sehe ich Sie morgen um halb elf.«
Das Gespräch wurde beendet.
Schweigen in der Runde. Beigelegt durch Katharina. »Airport-Club? Wow! Da hat jemand Kohle und zeigt es gern.«
Jana nahm Horndeich die Blöße ab, nachzufragen: »Was zur Hölle ist denn bitte der Airport-Club?«
Katharina übernahm die Rolle des Erklärbärs: »Elitärer Meeting-Point. All die Jungs und Mädels, nein, meistens sind es die Jungs, die zwischen den Kontinenten hin und her jetten und sich trotzdem manchmal persönlich treffen wollen – die haben dort einen Platz.«
»Wenn ich Margot richtig verstanden habe, war Thorsten Selbig seit Jahren nicht mehr in Deutschland«, entgegnete Horndeich.
»Egal. Wenn seine Firma ernste Geschäftsbeziehungen nach Europa hat, dann lohnt sich die Mitgliedschaft auf jeden Fall.«
»Ho ho! Mr. Wichtig fährt zum Flughafen!« Jana grinste breit.
Horndeich graute schon davor. Den richtigen Parkplatz am richtigen Ort in diesem Labyrinth zu finden – Horndeich hasste es.
»Darf ich mich als deine Assistentin andienen?«, wollte Katharina wissen.
Und von Horndeichs Herz fiel ein Stein. »Aber nur, wenn du auch die Chauffeurin machst!«
Katharina grinste. Diabolisch.
»Essen ist fertig!« Sandras Stimme hallte durchs Erdgeschoss und erreichte bestimmt auch noch die Zimmer im ersten Stock.
Für Horndeich, der direkt neben seiner Frau stand, war die Ansage ein wenig zu laut, aber sie würde ihren Zweck erfüllen. Sandra und er hatten den Tisch gedeckt. Frisches Brot lag im Korb, Käse, Wurst und andere Leckereien umringten denselben. Auch eine Schüssel frischen Salats hatte ihren Platz.
Für gewöhnlich waren die Kinder vor 18 Uhr am Essenstisch, doch heute war auch fünf Minuten nach der Zeit niemand vom Nachwuchs in Sichtweite. Das war eher ungewöhnlich.
Zumeist war es Alexander, der mit Fiona die Zeit vergessen konnte, wenn die beiden unten im Souterrain gemeinsam musizierten. Und das taten sie fast jeden Tag, in der Regel eine Stunde, manchmal auch zwei. Offensichtlich schienen die beiden die Zeit vergessen zu haben.
Die Große, Stefanie, hätte eigentlich seit zehn Minuten zu Hause sein sollen. Sie trainierte montags immer Wing Tsun. Eine ehemalige Polizeikollegin hatte vor einem halben Jahr, während der Aktionswoche der Schule, einen Schnupperkurs dieser Selbstverteidigungsart angeboten. Und Stefanie war begeistert gewesen. Horndeich hatte die ehemalige Kollegin danach noch einmal darauf angesprochen. Diese hatte bestätigt, dass Stefanie sich sehr gut angestellt hatte und quasi ein Naturtalent war. Und so trainierte seine Große jetzt zweimal die Woche die chinesische Kampfkunst.
Antjes Ankunft im Esszimmer war zunächst akustisch zu vernehmen. Sie imitierte lautstark das Galopp-Geräusch eines Pferdes. Wenig später ritt sie herein. Das Pferd bestand aus einem Holzstiel mit Pferdekopf. Der trug eine ansehnliche Mähne. Frühere Generationen hätten dieses Spielzeug als Steckenpferd bezeichnet. Beide Begriffe stimmten heute nicht mehr: Das Spielzeug war zum Sportgerät mutiert und das Steckenpferd zum »Hobby Horse«.
Margot Hesgarts Vater, Sebastian Rossberg, hatte Antje das Steckenpferd vor einem halben Jahr geschenkt. Zunächst wusste seine Jüngste damit nicht viel anzufangen. Das änderte sich just am folgenden Tag, an dem ihr ihre große Schwester ein Video auf YouTube vorgespielt hatte, das Mädchen im Wettkampf mit Steckenpferden zeigte. Die Probanden ahmten verschiedene Reitdisziplinen nach, wie Dressur, Springen, Western oder Rennen. Horndeich hatte den Fehler gemacht, laut aufzulachen, als er die ersten 30 Sekunden gesehen hatte. Das hatte ihm einen vernichtenden Blick seiner großen Tochter eingebracht und nur den Bruchteil einer Sekunde später denselben Blick in einer um acht Jahre jüngeren Variante.
Vielleicht hätte er nicht lachen sollen. Vielleicht hatte nur das den Trotz von Antje provoziert. Auf jeden Fall bestand Antje darauf, das auch zu lernen. Und flugs hatte Stefanie auch schon einen Sportverein in Darmstadt ergoogelt, der tatsächlich mit Kindern und Jugendlichen diese Disziplinen trainierte. Seitdem waren Antje und ihre »Flicka«, wie sie das Steckenpferd getauft hatte, unzertrennlich.
»Brrr«, wies Antje das Holzpferd an, stehen zu bleiben. Dann setzte sie sich auf ihren Platz und schob Flicka neben sich auf den Stuhl. Der bisherige zweimalige Versuch der Eltern, das zu unterbinden, hatte in einem Tränenmeer geendet. Und als Stefanie sich ebenfalls lautstark auf Antjes Seite positionierte, war Flicka das einzige Haustier, das es jemals in der Familie Horndeich an einen Esstisch geschafft hatte. Nicht einmal der Familienhund Fidel, ein kleiner, schlauer Chihuahua, wäre jemals in der Lage gewesen, sich auch nur für einen Moment dieses Privileg zu verschaffen.
»Hast du gut gemacht«, lobte Antje ihr Pferd. Horndeich musste sich zur Seite drehen, damit sie nicht sein breites Grinsen sah.
Alexander betrat ebenfalls den Raum, neben sich Fiona. Vor einem Dreivierteljahr hatten sie sich kennengelernt, als Frau Kreutzers Mann mit der gemeinsamen Tochter ebenfalls nach Darmstadt umgesiedelt war. Zu dem Zeitpunkt waren sie gleich groß gewesen, inzwischen überragte Fiona Alexander um ein halbes Haupt.
Für Fiona war ebenfalls ein Platz eingedeckt. Nach dem Abendessen würde das Mädchen nach Hause gehen – vielmehr von Alexander nach Hause begleitet werden, auch wenn dieses andere Zuhause nur 200 Meter entfernt lag. Doch Alexander war bereits mit seinen zehn Jahren gänzlich Gentleman.
»Wo ist Stefanie?« In dem Moment, in dem Sandra die Frage stellte, gaben ihr und Horndeichs Handy parallel einen Ton von sich. Sandras Handy machte »Pling«, Horndeichs Handy vibrierte nur kurz.
Beide sahen synchron auf das Display ihrer Smartphones. »Nicht erschrecken«, lautete die Botschaft, die Stefanie in die Gruppe »Familie« gepostet hatte. Horndeich und Sandra sahen einander fragend an. Sie hörten, wie die Haustür geöffnet wurde. Sekunden später stand Stefanie im Esszimmer. Und der Sinn ihrer Nachricht erschloss sich auf den ersten Blick: Ihr rechtes Auge zierte ein fettes, violettes Veilchen.
»Stefanie!«, gab Sandra von sich.
Horndeich dachte es nur.
»Alles halb so wild«, antwortete die Tochter. »Ich war nicht richtig konzentriert. Ludwig hat mir einen Kettenfauststoß verpasst, als ich ihn würgen wollte. Meine Schuld.«
»Tut es weh?«, stellte Antje die wichtigste Frage. Dabei spiegelte ihr eigenes Antlitz das Maximum an potenziellem Schmerz, den Stefanie wohl gerade ertrug.
»Alles gut.« Stefanie ging auf ihre Schwester zu und umarmte sie kurz. »Ludwig hat von mir auch schon den ein oder anderen blauen Fleck abbekommen. Ich glaube, mein Konto ist noch im positiven Bereich.«
»Aua«, flüsterte Alexander. Er war schon immer ein Kind gewesen, das jegliche Form körperlicher Auseinandersetzung hasste und vermied – weshalb er seine einzig wirklich schlechten Noten in Fußball, Handball und Basketball eingefahren hatte. Und auch Fionas Blick machte deutlich, dass sie derartige Blessuren überhaupt nicht schätzte.
»Oh! Mozzarella! Das beste Heilmittel gegen ein blaues Auge!«
»Willst du das jetzt aufs Auge tun?«
»Quatsch, Küken, ich will es essen. Viel zu lecker, um es sich ins Gesicht zu klatschen.«
Antje giggelte laut. Sie liebte es, wenn ihre ältere Schwester sie ›Küken‹ nannte. Offensichtlich gab ihr das ein Gefühl von Geborgenheit.
Stefanie war als Letzte in den Raum getreten, aber sie war die Erste, die sich den Teller vollgeladen hatte. »Guten Appetit«, gab sie in die Runde.
Charlottes Tagebuch, Juni 1984
Wieder einmal waren wir im Restaurant Roma.
Aber ich war ein bisschen traurig.
Wir hatten als Familie hier immer zusammen gespeist. Doch diesmal war alles anders. Es war das erste Mal ohne Opa. Es gab dennoch etwas zu feiern: Ich hatte meine Ausbildung als Krankenschwester erfolgreich abgeschlossen – und würde bald studieren.
Aber es gab keine Rede von Opa. Und das fehlte mir. Als Kind hatte ich nie verstanden, warum bei Familienfesten meist ältere Männer aufstanden, um fürchterlich langweilige Reden zu halten. Heute wünschte ich mir nichts sehnlicher.
Diesmal war es Papa, der sprach.
Ich sei jetzt Krankenschwester, sagte er, habe meinen Abschluss auch diesmal mit Bravour bestanden. Nach nur zwei Jahren – weil ich mir ja schon fünf Jahre lang vor der Ausbildung regelmäßig die Wochenenden beim Deutschen Roten Kreuz um die Ohren gehauen hatte. Und nun würde ich neue Pfade beschreiten, ab Oktober ein Geschichtsstudium beginnen. Er erzählte Anekdoten, an denen man angeblich schon früher hätte ablesen können, dass ich einmal Geschichte studieren würde. Ich wünschte, ich hätte genauer hingehört. Aber ich dachte nur an Opa, der diesmal nicht sprechen konnte. Als ich Papa danach bat, mir das, was er gesagt hatte, aufzuschreiben, wirkte er völlig verdutzt. Er hatte frei gesprochen. Es gab keinen Text.
Und jetzt werde ich tatsächlich bald in Frankfurt Geschichte studieren.
Papa hatte wieder ein Geschenk auf den Tisch gelegt: ein Zoom-Objektiv. 35–105 Millimeter. Und das bei einer konstanten Lichtstärke von 1:3,5. Damit ich – wenn ich nach einer Weitwinkelaufnahme mal ein schönes Porträt machen wollte – nicht jedes Mal das Objektiv wechseln müsste.
Bei uns in der Familie waren es immer nur die Männer, die Reden hielten, und sie waren es, die die Geschenke überreichten. Doch ich wusste: Die Frauen waren es, die im Hintergrund mitdachten. Oma. Mama. Die mich wirklich kannten. Die wussten, welche Geschenke mich wahrhaft glücklich machen würden. Deshalb bedankte ich mich zuerst bei Mama. Und dann bei Papa.
Ich wusste, Mama hatte sich ernsthaft in die Materie eingearbeitet – sie, die selbst nie eine Kamera in der Hand gehalten hatte. Und es war diesmal sie, die den Zehnerpack Ilford-Filme auf den Tisch legte. Ich weiß, Mama hat es in diesem Moment nicht verstanden, aber ich stand auf, trat neben sie, umarmte sie – und wollte sie einfach nicht mehr loslassen.
Als wir das Restaurant gerade verlassen wollten, nahm mich Oma noch einmal zur Seite. Sie fragte, ob ich ihr helfen würde – für ihren 80. Geburtstag in zwei Monaten. »Klar«, sagte ich, »wobei darf ich helfen?«
Sie meinte, ich habe doch so eine künstlerische Ader. Sie wünsche sich, dass ich Tischkärtchen gestalte – und dass auf jedem Kärtchen ein Foto von ihr als junge Frau gedruckt sei. Selbstverständlich würde sie die Materialien bezahlen.
Ich konnte mich nur wiederholen: »Klar.«
Dann hatte sie noch einen Wunsch: Ich solle an diesem Abend fotografieren. Auch hier wolle sie mir die Filme und Batterien stellen. »Vielleicht kannst du mir danach ein schönes Fotoalbum machen?«, sagte sie.
Sie freue sich so sehr auf diesen Tag. Ich gab ihr einen Kuss auf die Wange und sagte: »Klar, Oma. Du kannst dich auf mich verlassen.«
Dienstag, 6. Mai
Katharina holte Horndeich um halb zehn ab. Sie fuhr mit ihrem Wagen vor, der etwas speziellen Version eines Pkw: Es handelte sich um einen russischen Wolga aus den Siebzigerjahren. Im Gegensatz zu den Standardfahrzeugen mit einem Vierzylindermotor war dieser mit einem V8-Motor ausgerüstet. Seinerzeit die Version, die ausschließlich für den KGB gebaut worden war. Janas Freund Ben hatte eine Vorliebe für Oldtimer aus dem Osten gehabt. Und Jana hatte den Wagen Katharina nach Bens Tod geschenkt. Der V8 blubberte wie ein amerikanischer Straßenkreuzer. Horndeich hatte das Geräusch bereits im Haus vernommen.
Er trat auf die Straße, genau in dem Moment, als Katharina den Motor abstellte. Er öffnete die Beifahrertür und wollte einsteigen. Da vernahm er Katharinas Stimme. Statt eines »Guten Morgen« hörte er die Worte: »So nicht, Herr Horndeich.«
Er ließ den Satz dreimal durch sein Gehirn pendeln, wusste aber auch danach nicht, was Katharina meinte.
»Als Ihre Assistentin kann ich nur sagen, werter Chef: Mit Jeans und ohne Jackett kommen Sie in den Airport Club nicht rein. Dresscode.«
»Und das weißt du woher?«, fragte er und sah ins Wageninnere. Katharina trug tatsächlich ein auberginefarbenes Businesskostüm und war perfekt geschminkt.
»Internet? Webseite? Kein Problem – dafür hast du ja mich. Also: Am besten Anzug. Muss nicht der feinste sein. Aber definitiv eine Fliege.«
»Fliege?«
»War ein Scherz.«
Horndeich schlug die Beifahrertür wieder zu, ein wenig fester als beabsichtigt. Dresscode! Er wollte mit einem ehemaligen Schulkameraden von Margot sprechen und keine Vorstandssitzung besuchen. Während er sich umzog, beruhigte sich sein Gemüt wieder. Letztendlich hatte Katharina ihm einen Gefallen getan.
Wenig später wollte er erneut in den Wolga steigen. Er hatte den Fuß noch nicht in den Fahrgastraum gesetzt, da hörte er: »Echt jetzt?«
»Was ist denn nun schon wieder?«
»Also, wäre ich ein Mann und an deiner Stelle, würde ich das Jackett doch eher ausziehen, bevor ich nachher völlig verknittert aus dem Wagen steige. Und das will ich nicht umsonst gekauft haben«, sagte sie und deutete hinter sich an ihre Kopfstütze. Dort entdeckte Horndeich einen chromfarbenen Jacketthalter.
Er ging um den Wagen herum, öffnete die Fondtür, bugsierte das Jackett über den Bügel, kam wieder zurück zur Beifahrertür. Öffnete sie erneut. Drehte sich einmal um die eigene Achse und fragte: »Darf ich jetzt?«
»Sehr gern.«
Eine Minute später setzte sich der Wolga in Bewegung. Katharina fuhr gemächlich auf der A5 Richtung Norden, ließ sich quasi mit 90 Stundenkilometern vom vorausfahrenden Lastwagen ziehen.
»Nicht schneller?«, wollte Horndeich wissen.
Katharina griente: »Können schon, wollen nicht. Er verbraucht schon bei 90 genügend Sprit.«
Horndeich war froh, auf dem Beifahrersitz zu sitzen, und dieses Hochgefühl verstärkte sich noch, als Katharina die A5 verließ und sich durch die verschiedenen Spuren Richtung Flughafen fädelte. Souverän lenkte sie den Wagen in Richtung Terminal 1 oder dort zielsicher in das Parkhaus mit der Nummer P2. »Du weißt, wo wir hinmüssen?«
»Was für eine Frage. Ich bin deine Assistentin!«
Katharina parkte den Wagen ein und stieg aus. Sie schloss ihn ab, auch auf der Fahrerseite, nachdem auch Horndeich ihn verlassen hatte. »Da lang«, sagte sie, und Horndeich folgte ihr. Katharina rief den Aufzug, beide stiegen ein.
»Hier steht nichts von Airport Club«, monierte Horndeich.
»Richtig. Deshalb hast du ja auch mich, damit du dich nicht verläufst.«
Horndeich erwartete, dass, sobald sich die Aufzugtüren öffneten, sich die Eleganz eines noblen Empfangsraumes vor ihm auftat. Fehlanzeige. Ein dunkler Gang führte sie weiter. Bis zum nächsten Aufzug. Als sich dessen Türen öffneten, konnte Horndeich die erlösende Beschriftung sehen: »Airport Club.«
Die Räumlichkeiten des Airport Clubs strahlten gediegene Eleganz aus. Katharina strebte an die Empfangstheke. »Dr. Steffen Horndeich und seine Assistentin. Wir haben einen Termin mit Herrn Thorsten Selbig.«
»Sehr wohl«, sagte die Dame auf der anderen Seite der Theke. Ebenfalls Kostüm, ebenfalls geschminkt. Ein doppelt so altes Double von Katharina. Horndeich fühlte sich wie in einem Paralleluniversum. Vielleicht hätte Jana den Job übernehmen sollen. Sie war in dieser Art von Universum eindeutig – ›zuhauser‹, das konnte man so nicht sagen, oder?
»Nehmen Sie doch bitte kurz Platz.«
Minuten später trat ein Mann auf Horndeich zu. Er trug Anzug und tatsächlich eine Fliege. Horndeich und Katharina tauschten kurz einen Blick. Horndeich sah, dass sie sich das Lachen sehr verkneifen musste. Unter dem Anzug war der Mann hingegen sehr gut trainiert. Da er mit Margot Abi gemacht hatte, musste er ungefähr in ihrem Alter sein, also die 60 auch gerade übersprungen haben. Das sah man ihm definitiv nicht an, auch wenn der Bürstenhaarschnitt deutlich meliert war.
»Sie müssen Dr. Horndeich sein«, sagte Selbig, sah Horndeich kurz an und ließ den Blick dann zu Katharina wandern. »Und Sie sind?«
»Katharina Hochnagel. Seine Assistentin.«
»Assistentin?«
»Jeder gute Privatdetektiv benötigt eine Assistentin«, konterte Katharina trocken und streckte ihre Hand in seine Richtung. Selbig ergriff sie, schüttelte danach auch Horndeich die Hand.
»Dr. Horndeich? Worin haben Sie promoviert?«
»Menschenkenntnis«, antwortete Horndeich. »Meine Assistentin war offenbar der Meinung, so ein Titel würde ein bisschen Eindruck schinden«, sagte er und warf Katharina kurz einen missbilligenden Blick zu.
Selbig deutete ein Kopfschütteln an, grinste aber verhalten. Er führte seine Gäste durch ein paar Gänge in einen Raum, dessen Türschild ihn als Raum ›Hollywood‹ auswies. Selbig ließ seine Gäste eintreten. Das Kabinett war länglich geschnitten. Vier bequem aussehende Stühle gruppierten sich um einen runden Holztisch.
Formvollendet zog Selbig einen der Stühle zurück, sodass Katharina Platz nehmen konnte. Auch Horndeich ließ sich nieder, daraufhin auch Selbig.
Es klopfte an der Tür. »Herein«, sagte Selbig. Die Tür öffnete sich, ein Ober brachte ein Tablett mit Kaffee, Tee und zwei Flaschen Wasser sowie Gläser und Tassen. Er stellte es auf dem Tisch ab und verschwand genauso geräuschlos, wie er den Raum betreten hatte.
»Also, Herr Horndeich, was genau möchten Sie wissen?«
»Es geht um den Mord an Charlotte Fries. Margot erwähnte, dass Sie auf dem Klassentreffen von einem Mann sprachen, der zur Zeit des Mordes einer derjenigen gewesen war, die im nebenstehenden Bunker ihr Lager aufgeschlagen hatten. Die Polizei hat nie einen der fünf ausfindig machen können. Deshalb ist diese Information so interessant.«
Katharina füllte die Rolle der Assistentin perfekt aus, schenkte Selbig einen Kaffee ein, Horndeich nach einem kurzen Kopfnicken ebenso, sich selbst dann auch.
»Sie sind Privatdetektiv?«
»Ja.«
»Und Sie glauben, Sie werden nach all den Jahren nun den Mörder finden?«
»Herr Selbig, das weiß ich nicht. Aber vielleicht wird die Polizei den Fall wieder aufnehmen, wenn wir diesen Zeugen präsentieren können.«
Selbig hielt kurz inne, sah Katharina an, dann wieder Horndeich. »Es würde mir viel bedeuten«, sagte er nach ein paar Sekunden Pause. »Nach dem Gespräch mit Margot habe ich mir schon Vorwürfe gemacht, damals nicht doch zur Polizei gegangen zu sein. Es gab eine Zeit in meinem Leben, leider nur eine sehr kurze Zeit, in der Charlotte Fries der wichtigste Mensch in meinem Leben war. In der Schule waren wir ein Paar. Leider nur für vier Monate, dann hatte Charlotte beschlossen, dass ich für sie nicht der Mann fürs Leben sei. Aber ihren Mörder würde ich nur zu gern –« Er beendete den Satz nicht.
»Wie heißt der Mann, der damals im Bunker gehaust hat?«
»Timo Richter. Seinen Namen werde ich wohl kaum vergessen.«
»Wie das?«
»Vielleicht muss ich ein wenig ausholen. Charlotte und ich, wir haben 1982 das Abi auf der Viktoriaschule gemacht. Margot hat Ihnen erzählt, weshalb ich auf ihrem Klassentreffen war?«
»Ja«, antwortete Horndeich nur knapp. Auf der Fahrt hierher hatte er auch Katharina in die wenigen ihm bekannten Fakten eingeweiht.
»Ich hatte Bio und Englisch als Leistungskurse«, fuhr Selbig fort. »Nach dem Abi haben wir uns alle aus den Augen verloren. Also, ich habe sie alle aus den Augen verloren. Das lag auch daran, dass ich direkt danach zum Bund gegangen bin. Hab mich für zwei Jahre verpflichtet. Erstens wuchs da ein bisschen mehr Kohle rüber, zum anderen wollte ich mir selbst beweisen, dass ich nach dem Unfall zu 100 Prozent wiederhergestellt war. Ich kam zur Marine nach Kiel – also ein Stückchen weiter von der Heimat entfernt. Danach wollte ich in die USA, um zu studieren.
Weihnachten 82 hatte ich dann Urlaub vom Bund. Bin nach Darmstadt gefahren, zu meinen Eltern. Hatte meine Bundeswehruniform an, als ich über den Luisenplatz lief. 1982, Friedensbewegung, Sie erinnern sich? Der gute Russe. War damals halt die Zeit. Da saßen dann drei Punks auf den Stufen vor dem langen Lui. Als ich an denen vorbeiging, rief mir der eine hinterher: ›Mörder!‹ Ich hatte eine kurze Lunte damals, besonders an dem Tag. Die Züge waren knallvoll gewesen, dazu noch verspätet, es war ein Scheißwetter, ich wollte einfach nur noch nach Hause. Ich hab mich zu dem Typ umgedreht und gesagt: ›Ich verteidige dich und ich verteidige die Demokratie, wenn uns jemand ans Leder will.‹
Seine Argumentation veränderte sich dadurch nicht: Er schrie nochmals ›Mörder!‹ Dann landete seine Faust auf meinem Auge. Hatte ich gar nicht mit gerechnet, sonst hätte ich mich natürlich geschützt. So gab es nur den Reflex: Ich schlug zweimal zurück, und er lag auf dem Boden. Keine Ahnung, woher die ganze Meute kam, aber binnen Sekunden waren wir umringt von Menschen. Eine Minute später war die Polizei da. Die Beamten nahmen uns beide mit aufs Revier im Schloss. Da erfuhr ich auch seinen Namen: Timo Richter. Wir mussten unsere Personalien angeben, dann haben sie uns wieder laufen lassen.«
»Das war aber lange vor der Ermordung von Charlotte.«
»Ja. Das war der Tag, an dem ich Timo Richter zum ersten Mal gesehen habe. Ich hab von der Polizei nichts mehr gehört. Ich weiß nicht einmal, ob die da noch irgendetwas unternommen haben. Ich bin dann nach dem Bund in die USA und habe in Wisconsin Lebensmitteltechnologie studiert. Der Bruder meines Vaters hat dort gewohnt, das hat mir den Einstieg erleichtert. Und dann kam ich Weihnachten 84 nach Deutschland. Heiligabend bei meinen Eltern und dann drei weitere Wochen alte Heimatluft schnuppern. Hab dann noch zwei Freunde aus der Schulzeit besucht. Und ab dem achten Januar war der Mord an Charlotte Stadtgespräch. Ich war wie versteinert.
Zehn Tage später war dann ihre Beerdigung. Einen Tag, bevor mein Flieger mich wieder zurückbringen sollte. Ich war dort. Viele waren dort. Viele Menschen in meinem Alter. Wahrscheinlich Kommilitonen. Auch zwei ehemalige Mitschüler habe ich erkannt. Mit denen hatte ich aber nicht viel zu tun gehabt.
Ich hab geheult. Und ich war nicht der Einzige. Ich kannte außer den beiden von der Schule niemand – außer einem: Ausgerechnet Timo Richter stand da ebenfalls in der Menge, unübersehbar, immer noch Punk, wenn auch Punk light. Ich habe mich ziemlich im Hintergrund gehalten. Er auch. Auf dem Weg vom Friedhof liefen wir plötzlich nebeneinander. Ich fragte ihn: ›Kennst‹ mich noch?’
›Du bist der Mörder in Uniform‹, hat er gesagt, aber dabei schräg gegrinst, während immer noch Tränen seine Wangen hinunterliefen. ›Sorry, war eine blöde Aktion damals.‹
Hatte ich nicht mitgerechnet, dass er das jemals sagen würde. Wir gingen runter Richtung Roßdörfer Platz, da war damals noch eine gute Pizzeria in der Roßdörfer Straße, das Nido. Hab ihn eingeladen. Und ihn natürlich gefragt, warum er bei der Beerdigung gewesen war und warum er geheult hatte wie ein Schlosshund. Falsche Frage. Er fing sofort wieder an zu flennen.
Ich hatte ja in den Tagen zuvor die Fakten über den Mord gelesen. Wusste also auch, dass Charlotte neben einem dieser Winkelbunker gefunden worden war. Und Richter, der sagte mir, dass er einer der fünf sei, die den Bunker als Unterschlupf für die Nacht genutzt hätten.
›Und Charlotte hat da auch gepennt?‹, habe ich ihn dann gefragt.
Er hat es verneint. Sie wäre aber mit einem der anderen aus dem Bunker liiert gewesen. Den Namen habe ich allerdings nicht mehr auf dem Schirm. Aber Charlotte habe ihren Freund dort eben immer wieder besucht, auch wenn die anderen dabei waren.
›Hast dich verguckt in Charlotte, nicht wahr?‹, war meine nächste Frage.
Die Antwort bestand abermals aus Tränen.
Danach habe ich bezahlt, wir sind gegangen und haben uns nie wieder gesehen. Ich flog am nächsten Tag zurück in die USA – und war seitdem bis vor einer Woche nie mehr in Deutschland gewesen.«
»Und Ihre Eltern?« Katharina stellte die Frage, die Horndeich ebenfalls sofort durch den Kopf gegangen war.