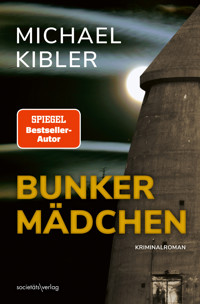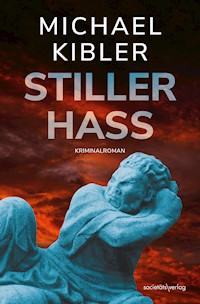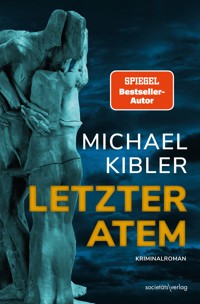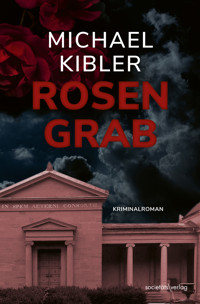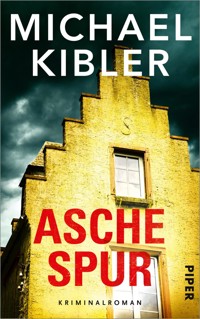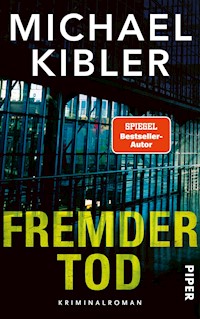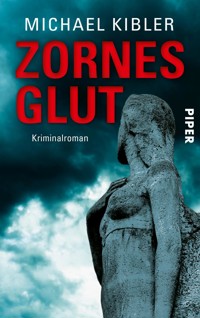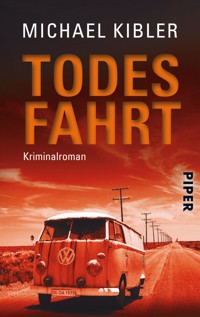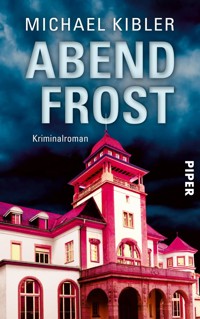Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Societäts-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Als Nachlasspflegerin Jana Welzer das Parkett im neuen Büro ihres Elternhauses verlegen lässt, macht der Handwerker eine grausige Entdeckung: Unterm Holz finden sich Spuren eines großflächigen Blutflecks. Durch die Unterstützung ihres Detektivkollegen Steffen Horndeich stellt sich schnell heraus, dass es sich um menschliches Blut handelt. Und dass die Menge des Blutes auf eine schwere Gewalttat zurückgehen muss. Der Gedanke, das neue Geschäftsdomizil dort einzurichten, wo ein Mensch ermordet wurde, lässt Jana keine Ruhe. Gemeinsam mit Steffen Horndeich versucht sie das blutige Geheimnis zu lüften. Horndeich und Jana rollen die Geschichte des Hauses und seiner Mieter auf. Und stoßen dabei auf Geheimnisse, die vielleicht besser im Verborgenen geblieben wären ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Michael Kibler
Bittere Lüge
Kriminalroman
Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag
© 2023 Frankfurter Societäts-Medien GmbH
Satz/E-Book: Julia Desch, Societäts-Verlag
Umschlaggestaltung: Julia Desch, Societäts-Verlag
Umschlagabbildung: Statue: Michael Kibler; Hintergrund: Björn Lauer
Printausgabe ISBN 978-3-95542-465-7
E-Book ISBN 978-3-95542-466-4
Besuchen Sie uns im Internet:
www.societaets-verlag.de
Für den Panda, den kleinen roten Drachen und manchmal auch den Grüffelo
Rocky I
Und da liegst du dann, in deinen eigenen feuchten Pupsen.
Trotzdem. Noch vor wenigen Monaten wäre ich aufgestanden, aufs Klo gegangen, hätte mich gewaschen und mich umgezogen. Niemand hätte davon irgendetwas mitbekommen. Kennen wir ja alle, die kleinen Entgleisungen des Körpers. Nach Alkohol oder nach zu viel Glutamat. Zumindest bei mir.
Allein, dass ich darüber jetzt nachdenke, ich auch nur einen Gedanken daran verschwende, zeigt, wo ich gestrandet bin. Aber ich war in meinem Leben nie gut darin, mir Selbiges schönzureden. Fäkalien bleiben Fäkalien. »Hast du das?«, frage ich in den Raum.
Ich kann ihn nicht sehen, denn er sitzt am Fenster. Hat eine schöne Aussicht. Muss er mich nicht anschauen. Und ich kann ihn nicht sehen. Das Bett steht falsch. »Ja«, sagt er.
Hat den Laptop auf dem Tisch geparkt, schreibt mit, was ich ihm sage.
Er hasst es.
Das weiß ich.
Aber er macht es. Weil ich ihn bezahle. Und weil er Kohle braucht. Auch das weiß ich. Ich denke, er würde mir am liebsten an die Gurgel gehen. Mir den Hals zudrücken. Warten, bis die Augen aus den Höhlen treten. Bis die Zunge aus dem Mund quillt. Bis ich blau anlaufe.
Aber er wird es nicht tun.
Denn wenn er das tut, geht er leer aus. Habe ich alles geregelt. Kenne die Gesetze. Und weiß, wie man sie umgeht. Nicht legal, aber effektiv.
»Was habe ich zuletzt gesagt?« Die Frage müsste mir peinlich sein. Doch so leicht es ist, die körperliche Kontrolle aufzugeben, so schwer ist es, die Gedanken noch auf Kurs zu halten.
Krebs heißt die Krankheit. Und Krebs ist ein Arschloch. Bis vor zwei Monaten hat er nur meinen Körper ruiniert. Jetzt nagt er am Gehirn wie ein Biber am Holz. Die Frage ist nicht, ob der Baum fällt. Die Frage ist nur, wann.
Und ich hoffe, ich kann meine Geschichte noch fertig erzählen, bevor der Biber sich final mit der Zunge über die Lippen fährt.
Ein Hoch auf die standhaften Bäume.
Freitag, 14. April
Es endete, wie es immer geendet hat. Mit schwarzen Zeugen der Verzweiflung, drapiert über und auch auf den Wangen. Verzweiflung wegen ihm. Ersetze ›ihm‹ durch den Vornamen des aktuellen männlichen Quells der Seelenpein. Jana Welzer hatte den Namen bereits wieder vergessen. Doch sie beobachtete Senta mit einem hohen Maß an physikalischem Interesse. Es war erstaunlich, wie man mit solch einer kleinen Menge an Mascara, beweint und vertupft im Gesicht, ein so großes Desaster anrichten konnte. Die Geometrie entsprach ungefähr einer Luftaufnahme des Mississippideltas.
Senta war auf dem Höhepunkt ihrer Erzählung angelangt. Wie ihr endgültig klar geworden war, dass er nur ein Schwein sei. Wie alle anderen Männer. Oder ›Ers‹, um gerecht zu bleiben.
Zwischen Jana und Senta stand ein Tisch, darauf die Weingläser und etwas zu knabbern. Senta schaute in Richtung Wand, an der einige Ukraine-Flaggen hingen. Janas Blickrichtung ging in den Raum hinein. So konnte Dieter, dem die Weinstube gehörte, Sentas augenblickliche Verfassung nicht erkennen, als er an ihren Tisch trat. »Bei euch alles in Ordnung?«
Senta wandte sich ihm spontan zu und Jana entging nicht, wie Dieters Gesichtszüge für den Bruchteil einer Sekunde völlig entgleisten. Er sagte nichts, sondern wandte sich um und verschwand sofort wieder.
»Sehe ich so schlimm aus?«, stellte Senta die eher rhetorische Frage. Und flüsterte gleich darauf: »Scheiße.« Sie nestelte in ihrer Handtasche nach einem Papiertaschentuch, entfaltete es, hielt es sich ungeschickt vors Gesicht. Mit der anderen Hand griff sie nach der Tasche, stand auf und flüchtete in Richtung Toilettenraum.
Nein, Jana hatte keinerlei derart aufregende Männergeschichten zu berichten, und schon gar nicht in dem rasanten Dreimonatstakt ihrer Freundin Senta. Jana und ihr Ben waren eher ein Paar, als dass sie keines waren, aber eben auch kein richtiges. Sein Lebensmittelpunkt lag in Berlin, der ihre in Darmstadt – und Lufthansa und die Deutsche Bahn verdienten recht gut an den beiden. Sie erinnerte sich der Liedzeilen »Kompliziertes Innenleben«, die die Dichterin Mascha Kaléko vor mehr als 100 Jahren geschrieben hatte, besungen von der Sängerin Dota in der Gegenwart:
»Hinter jedem Abschied steht ein Warten.
Wenn dein Schritt verhallt ist, sehn’ ich mich.
Wenn du kommst, ist jeder Tag ein Garten, aber wenn du fort bist, lieb ich dich.«
War das Leben also damals auch nicht leichter gewesen. Tröstlich wie ein staubtrockener Keks …
All das wäre noch auszuhalten gewesen, wenn sie derzeit nicht auch mit ihrem Job gehadert hätte. Jana Welzer, inzwischen straff auf die 40 zugehend, allerdings nach wie vor mit Stil und Stöckelschuhen, arbeitete als Nachlasspflegerin. Starb ein Mensch und hinterließ keine auf den ersten Blick auffindbare Nachkommen, trat sie an diese Stelle: Sie kümmerte sich darum, dass das Erbe gesichert, der Verstorbene begraben, die Wohnung aufgelöst wurde und Wertgegenstände in einem sicheren Lager landeten. Dafür wurde sie vom Amtsgericht beauftragt. Lukrativer als jene Aufträge war ihr Job als Insolvenzverwalterin. Eine Arbeit, die ihr jedoch immer weniger Freude bereitete, weil sie dort oft eher Psychotherapeutin für zerstrittene Sippen aus Familienunternehmen war, die offenbar nur ein Ziel kannten: die Vernichtung gemeinsam erwirtschafteten Geldes durch zumeist kindische Streitereien, die aber mit Armeen ausgefochten wurden.
Mehr Spaß machten schließlich ihre gelegentlichen Ermittlungen mit Privatdetektiv Steffen Horndeich, der in den vergangenen drei Jahren oftmals Partner bei kriminalistischen Recherchen gewesen war, und der inzwischen einen Status irgendwo zwischen gutem Bekannten und Freund hatte. Aber aufregende Fälle waren dünn gesät.
Senta setzte sich wieder an den Tisch. Das Mississippidelta war der Sahara gewichen: Sie hatte jegliches Make-up aus dem Gesicht entfernt. Stand ihr deutlich besser als die Werbeplattform für teures Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Armani oder natürlich auch Gucci, als die sie ihr Gesicht oftmals missbrauchte.
Dieter trat wieder an den Tisch, sagte nichts, stellte nur zwei Nosing-Gläser mit Whisky ab. Das für Senta beinhaltete ungefähr die dreifache Menge als jenes für Jana.
Wortlos verschwand er wieder.
Dieter wusste, dass Jana einen guten Whisky schätzte, aber nur in kleinen Dosen.
Senta musste auf ihn jedoch so gewirkt haben, als ob sie einen großen Schluck benötigen würde. Jana schnupperte an der güldenen Flüssigkeit: Torfig. Ganz offensichtlich die »Signature Edition Thirteen« der Destille »St. Kilian«, deren flüssiges Gerstengold die Karte des Hochprozentigen zierte. Jana hob das Glas, Senta stieß schweigend mit ihr an. Dass sie nichts mehr sagte, zeigte die nächste Stufe des Dramas: Nachdem zuvor länger als eine Stunde die Beschwerden über Leopold – jetzt erinnerte sie sich doch wieder des Namens – in einem nicht enden wollenden Schwall von Logorrhoe aus ihr herausgebrochen waren, folgte nun der katatonische Zustand. Er würde bis zu den Abschiedsworten anhalten.
Manchmal fragte sich Jana, weshalb sie für ihre Freundin eigentlich die Tröst-Tante gab. Sie mochte Senta, aber Senta war oft auch nur schwer zu ertragen. Sie war eine – Schwätzerin. Was an Abenden wie diesem jedoch gleichermaßen einen Vorteil bot: Man musste selbst nichts zur Unterhaltung beisteuern. Jana hatte beim drittletzten Mann – oder war’s der viertletzte gewesen? – den zaghaften Versuch unternommen, auch ihre eigene Perspektive einzubringen, die sich an einigen Stellen deutlich von jener Sentas unterschied. Woraufhin nicht mehr der Mann, sondern sie, Jana, plötzlich zum Feindbild Nummer eins avanciert war. Aus der Reihe: ›Fehler, die man nur einmal macht‹.
Senta hatte das Glas bereits geleert, nachdem Jana nur einmal genippt hatte.
Die Uhr an Janas Hand vibrierte. Sie sah auf die Apple Watch, die ihr anzeigte, dass Jörn Großeimer sie anrief. Ihr Blick fiel auf die Uhr im Raum. Es war bereits 21:30 Uhr. Weshalb rief er um diese Uhrzeit bei ihr an?
Sie wischte mit dem Finger über das Display der Uhr, bis sie dort lesen konnte ›Ich kann im Moment nicht sprechen‹. Ihr Finger glitt auf den ›Senden‹-Button.
Jörn war ein guter Bekannter von ihr. Sie kannte ihn bereits seit Jahren. Bei ihrer Tätigkeit als Nachlasspflegerin hatte sie oftmals Wohnungen betreten müssen, deren Bewohner schon vor einem längeren Zeitraum die irdische Welt verlassen hatten. Jörn hatte seine Karriere als Kammerjäger angefangen und wurde dementsprechend oft auch in solche Wohnungen beordert. Er hatte aus der Not eine Tugend gemacht und sein Angebot um einen Entrümpelungsservice erweitert. Inzwischen war ein dritter Geschäftszweig hinzugekommen: der Innenausbau einer solchen Wohnung, mit dem man alle Spuren irdischer Verwesungsprozesse nicht nur tilgte, sondern neu verkleidete.
Jana war vor wenigen Monaten in die Souterrainwohnung des Hauses ihrer Eltern eingezogen. Also, präzise formuliert, nicht sie, sondern ihr Büro. Die Büroräume in der Pützerstraße 6 hatte sie aufgegeben, nachdem das Verhältnis zum Vermieter unerträglich geworden war. Janas Mutter war auf die Idee gekommen, dass sie die Wohnung dafür nutzen könne. Zunächst fand Jana die Vorstellung, tagsüber auf Tuchfühlung mit Mama und Papa zu leben, wenig attraktiv. Zumal die Beziehung zu ihrem Vater eine getrübte war. Zwei Dinge hatten die Perspektive verändert: zum einen Janas Pragmatismus gepaart mit der Immobiliensituation in Darmstadt. Und zum anderen hatte sie wahrgenommen, dass ihr Vater nicht mehr gesund war. Sie wusste nicht, worunter er litt, und er war in solchen Dingen zudem nicht eben der Gesprächigste – ganz wie die Tochter. Auch ihre Mutter hatte ihr nichts sagen können. Oder wollen. Aber Jana hatte dieses Gefühl. Bauchgefühl. Da war etwas mit ihrem Vater, und es war nicht gut. Und sie wollte nicht mehr weit entfernt sein. Es waren ihre Eltern. Und sie würden eines Tages eben nicht mehr da sein. Bei allen Differenzen mit ihrem Vater – er war es eben: Ihr Vater. Der Zeit seines Lebens gut zu ihr gewesen war. Der zwar richtig Scheiße gebaut hatte, was sein Verhältnis zu legalen Machenschaften anging, aber ihr gegenüber – alle ihre Freundinnen hatten sie damals um ihren coolen Dad beneidet … Und nein, die Zeit der Flucht war vorbei. Kein Erfurt mehr, kein Berlin. Ihr Platz war hier. Auch wenn sich das nicht immer richtig anfühlte. Aber manchmal. Das musste genügen.
Das Haus lag im Richard-Wagner-Weg, nicht weit entfernt von Steffen Horndeichs Domizil. Als Jugendliche hatte sie in den Räumen sogar ein paar Jahre gewohnt. Der Empfangsraum, der Büroraum, Küche und Archiv sowie Bad waren bereits renoviert und eingerichtet worden. Hier hatte sie ebenfalls auf die Dienste von Jörn Großeimers Unternehmen zurückgegriffen. Nun hatte er sich den Eingangsraum vorgenommen. Sie hatte überlegt, das Parkett neu schleifen und versiegeln zu lassen. Doch dann waren Jörn Großeimer einige lose Parketthölzer aufgefallen und Jana hatte sich entschlossen, das Parkett komplett neu verlegen zu lassen.
Am heutigen Freitag sollte Jörn das alte Parkett herausreißen. Janas Eltern waren zu einem Wochenendtrip aufgebrochen und so störte der Lärm nicht weiter. Eigentlich hätte die gesamte Aktion bereits am frühen Abend abgeschlossen sein sollen. Doch gleich zwei Bohrhammer, die Jörn für diese Arbeit benötigte, hatten sich im Abstand von 15 Minuten verabschiedet. Und es hatte einfach Zeit gebraucht, neue aufzutreiben. Jan und seine Mitarbeiter hatten beschlossen, das Entfernen des alten Bodens dennoch an diesem Freitag zu Ende zu bringen. War ihm jetzt schon wieder eine Maschine kaputtgegangen?
Abermals vibrierte Janas Uhr. Wieder war es Jörn, der anrief. »Sorry, Senta, da muss ich kurz drangehen.« Sie tippte auf das grüne Icon und hob das Handgelenk in Richtung Mund. Noch vor kurzem hätte man bei einer solchen Geste die Besitzerin mit einem Stirnrunzeln angeschaut: Plante sie, in ihre eigene Uhr zu beißen? Doch dieses Meisterwerk der Technik war letztlich nichts anderes als ein vollwertiges Smartphone. Wenn auch das Display kleiner war.
»Was ist?«, wollte Jana wissen. Während sie das sagte, verließ sie den Gastraum und trat ins Freie auf den Bürgersteig vor der Weinstube.
Jörn Großeimers Stimme war gut zu verstehen. »Jana, ich glaube, du solltest mal herkommen.« Zwar entsprach der Klang aus dem winzigen Lautsprecher der Uhr in keiner Weise jenem einer HiFi-Box. Doch dass in der Stimme ihres Bekannten ein Hauch von Sorge mitschwang, konnte Jana deutlich vernehmen.
»Weshalb?«, hakte Jana nach. Zwar war Senta bereits im sprachlosen Zustand angekommen, aber sie konnte und wollte die Freundin noch nicht allein lassen.
»Ich habe hier was gefunden. Und das solltest du dir anschauen. Am besten sofort. Davon hängt auch ab, ob und wie wir hier weitermachen.«
Das klang nicht gut. Das klang nach einem großen Problem. Sie erinnerte sich des Spruches ihres Professors der Betriebswirtschaftslehre, der ihr die wichtigsten Dinge über das Thema Insolvenz beigebracht hatte: »In jedem kleinen Problem steckt ein größeres, das unbedingt herauswill.« Genau nach so einem größeren Problem klangen Jörn Großeimers Worte. Jana seufzte. Wenn es darum ging, ob Jörn mit dem Parkettlegen überhaupt fortfahren würde, dann war offensichtlich wirklich etwas Ernstes geschehen. »Was ist los?«
»Ich habe hier Blut gefunden. Viel Blut.«
Ja, auch Jana hatte sich inzwischen ein E-Bike gegönnt. Nicht, dass sie nicht auch mit einem normalen Fahrrad zurechtgekommen wäre. Aber sie genoss es, den Aktionsradius deutlich erweitert zu haben. Fuhr sie früher 25 Kilometer mit dem Rad, waren es jetzt bis zu 70. Was ihr auch der Sattel erlaubte. Denn der war bei allen Aktionen, die sie mehr als 20 Kilometer durch die Welt führten, das schwächste Glied in der Kette. Jana mochte weder wund noch Aua. Jetzt ärgerte sie sich darüber, an diesem Abend nicht mit dem Elektrofahrrad nach Arheilgen geradelt zu sein. Denn sie saß im HeinerLiner – dem Ruftaxi-Kleinbus Darmstadts. Sie mochte das Konzept: per App den Siebensitzer bestellen. Und sich dann für rund fünf Euro direkt ans Ziel bringen zu lassen. Unmittelbar vor der Weinstube Kilian befand sich einer der zahlreichen Haltepunkte. Ebenso vor dem Haus ihrer Eltern. Also, dem Haus, in dem auch ihr Büro lag. Sie würde die Synapsen in ihrem Gehirn noch dressieren müssen, damit die mit der Adresse primär jene Arbeitsstätte assoziierten.
Als Jana Senta mitgeteilt hatte, dass sie jetzt sofort zu ihrem Büro fahren müsse, hatte Senta es sich nicht nehmen lassen, sie begleiten zu wollen. »Ich muss mein Leben ohnehin neu sortieren. Dann kann ich jetzt damit auch gleich anfangen.«
Dem hatte Jana nur wenig entgegenzusetzen. Und so bestellte sie in der App zwei Plätze im Auto.
Es war immer mal wieder vorgekommen, dass das Ruftaxi während der Fahrt die Route geändert hatte, um noch einen weiteren Fahrgast aufzunehmen. Das lag in der Natur der Sache und war für Jana völlig in Ordnung. Nur an diesem Abend wollte sie so schnell wie möglich ihr Ziel erreichen. Doch kaum hatten sie eine junge Dame in Arheilgen eingesammelt, bog der HeinerLiner in Kranichstein schon wieder von der direkten Route ab, ins Nirvana der Einfamilienhaus-Siedlung. Die Fahrer des Elektro-Benz orientierten sich dabei strikt an dem, was das HeinerLiner-Navi ihnen vorgab. Das Problem dabei: Die App barg ein hohes Potenzial für Verbesserungen. Denn es lotste die Fahrer oft durch winzigste Nebenstraßen, in denen der Chauffeur das Fahrzeug auch mal 50 Meter zurücksetzen musste wegen Gegenverkehr. Wie zum Beispiel in diesem Moment.
Gefühlte zwei Stunden später nahmen zwei Herren im Taxi Platz. Und Jana hoffte, dass es jetzt endlich direkt in den Richard-Wagner-Weg ging. Weit gefehlt. Sie brauchten für die Tour, die sie mit dem E-Bike in 15 Minuten zurückgelegt hätte, fast eine halbe Stunde. Jana war Senta dankbar, dass die Neuausrichtung ihres Lebens nicht beinhaltete, leichtfertig mit alten Traditionen zu brechen: Auch auf der Fahrt behielt sie zum Glück ihr Schweigegelübde der letzten Phase bei.
Vor dem elterlichen Haus standen zwei Fahrzeuge, die Jana wieder ein Lächeln ins Gesicht zauberten. So seriös sich Jörn Großeimers Innenausbau-Firma auch gab – alle Fahrzeuge von Jörn waren knallrot lackiert und ein freches Mardergesicht grinste die Welt von den Seitenflächen an. Relikt aus der Zeit, als Jörn noch ausschließlich als Kammerjäger unterwegs gewesen war. »Großeimer GmbH« lautete der einzige Schriftzug neben dem Marder. Jörn differenzierte im Außenauftritt nicht zwischen den Tätigkeiten als Kammerjäger, Entwickler und Innenausbauspezialist.
»Wie cool ist das denn?«, begeisterte sich auch Senta beim Blick auf die Lackierung der Firmenfahrzeuge. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. Es war der erste Satz, den sie seit dem Einstieg in den HeinerLiner von sich gegeben hatte.
Jörn hatte während seiner Tätigkeit von Anfang an Selbstbewusstsein bewiesen: Einige Kunden hatten darauf bestanden, dass er, als er noch ausschließlich als Kammerjäger tätig war, mit einem neutralen Fahrzeug vor dem Geschäft parkte. Doch Jörn hatte darauf bestanden, mit dem offiziellen Firmenfahrzeug vorzufahren: inklusive Marder und Schriftzug. Einige hatten sich zähneknirschend darauf eingelassen, andere hatten daraufhin die Konkurrenz beauftragt. Um dann ein Jahr später ebenfalls zur ersten Gruppe zu gehören.
Die Souterrainwohnung erreichte man, indem man die Rampe zur ehemaligen Garage hinunterging. Am unteren Ende links befand sich die Eingangstür. Jana musste nicht mal aufschließen, die Tür war geöffnet.
»Ah! Da bist du ja endlich.« Jörn begrüßte Jana mit einer Umarmung. »Und das ist?«, fragte er und schaute in Richtung Senta.
»Ich bin Senta, die beste Freundin von Jana«, sagte diese.
Jana hätte den Status etwas anders definiert. War ›Freundin‹ überhaupt die richtige Bezeichnung? Aber der Begriff ›Bekannte‹ wirkte in der deutschen Sprache steriler als OP-Besteck. ›Eine Freundin‹ – war das treffender? Fühlte sich auch eher an wie ein Dreier im Lotto. Aber, wenn nicht Senta, wer war dann eigentlich ihre besteFreundin? Während ihres Studiums, da hatte sie beste Freundinnen gehabt. Sie waren eine Clique gewesen. Drei unzertrennliche Mädels. Die sich erst dann getrennt hatten, als zwei von ihnen quasi zeitgleich ihre künftigen Lebenspartner getroffen hatten. Jana war keine dieser beiden gewesen.
Dann? Später? Als sie viele Jahre beim Technischen Hilfswerk gearbeitet hatte, zum Schluss sogar hauptamtlich, ja, natürlich hatte sie Freundinnen gehabt. Aber so eine richtig feste beste Freundin, die Seelenverwandte fürs Leben? Nein. Die hatte es nie gegeben.
»… mir erst jetzt vor?«
Jörns Stimme holte sie in die Gegenwart zurück. »Sorry, was hast du gefragt?«
»Wieso du mir deine beste Freundin erst heute vorstellst?«
Jörn war ein attraktiver Mann. Das hatte Jana vor Jahren schon festgestellt. Sein Gesicht war kantig, scharf geschnitten, und sein Blick strahlte immer, umrahmt von Lachfältchen. Aber Jörn war stets tabu gewesen, denn Jörn trug einen Ehering. Ihr Blick fiel auf Jörns rechte Hand. Kein Ring.
Kein Ring?
Sie hatte Jörn das letzte Mal vor drei Monaten getroffen. Da hatte der Ring den Finger noch geziert. Denn Jana erinnerte sich glasklar an den Gedanken, der ihr damals durch den Kopf geschossen war: Der Ring blitzte ohne jeden auch nur kleinsten Kratzer. Und Jana hatte sich gefragt, ob Jörn den Ring vielleicht heimlich polierte, damit er immer schön strahlte.
Strahlen war das Stichwort: Senta strahlte. Beim Anblick von Jörn. Nein, Jana rollte nicht die Augen. Aber sie wusste bereits in diesem Moment, wie der Name des Mannes lautete, der in den kommenden Monaten über Sentas Lippen sprudeln würde. Bis zum unvermeidlichen Finale nach drei Monaten. Natürlich machte Senta immer die Männer dafür verantwortlich. Aber Jana wusste, dass auch Senta selbst einen großen Teil der Verantwortung dafür trug, dass die Beziehungsversuche früh in die Binsen gingen.
Jana war sich sicher, dass Jörn den Ring ausgezogen hatte, weil er sich mit dem Parkett im Eingangsbereich der Wohnung auseinandersetzen musste. Was nichts daran änderte, dass sich die Figurenpositionen auf dem Schachbrett deutlich verändert hatten: Die schwarze Dame stand unverblümt näher beim weißen König als die weiße Dame. Wenn Jana sich und Jörn im gleichen weißen Team verortete.
Was für Gedanken beschäftigten sie? Sie war hierhergekommen, weil Jörn Großeimer Blut entdeckt hatte. »Also, Jörn, wo ist das Blut?« Während sie diese Frage stellte, entging ihr nicht, dass Jörns Blick auf Senta nicht gleich beim Aussprechen der ersten Silbe von ›also‹ in ihre Richtung gewandert war, sondern erst beim Aussprechen des Wörtchens ›Blut‹.
»Das Blut, ja. Das Blut«, stammelte Jörn. Er schien sich gedanklich erst sortieren zu müssen.
So hatte Jana Mr. Käfervernichter noch nie erlebt … Er räusperte sich. Der Moment, in dem er zu alter Form auflief. »Wir hatten ungefähr die Hälfte des Parketts herausgerissen«, sagte er. »Dann wurde es unheimlich.«
Jana fiel auf, dass Jörn offensichtlich allein in der Wohnung war. Eigentlich war er mit drei weiteren Mitarbeitern angerückt. Jörn schien Janas Gedanken lesen zu können. »Die anderen habe ich bereits heimgeschickt. Heute machen wir nichts mehr.«
Ja, es war Jana schon immer ein wenig unheimlich vorgekommen, wie sehr sie und Jörn in manchen Situationen fast exakt gleich getickt hatten, als ob sie dem Takt eines universellen Metronoms folgten. Aber, wie gesagt, Jörn war unantastbar. Jörn war verheiratet. Und wenn Jana Jörns Aussagen richtig interpretierte, was Inhalt, Körperhaltung und Stimmlage anging, dann war er so was von verheiratet. Schon früher hatte sie ein paarmal gedacht, dass die Ehe von Jörn und seiner Frau dem Gebäude des Gasthauses Krone in Darmstadt entsprach: Es war das einzige Haus der Altstadt gewesen, das das Bombardement am 11. September 1944 völlig unbeschadet überstanden hatte.
»Wenn wir weitermachen, dann machen wir morgen weiter«, fuhr Jörn fort.
»Sie haben hier Blut gefunden?«, wollte Senta wissen. Jana hatte ihr nur gesagt, dass sie wegen Problemen auf der Baustelle sofort in ihr Büro zurückfahren müsse. »Wie aufregend!«
Fremdschämen. Senta klang wie die Provinzkandidatin von ›Germany’s Next Topmodel‹ mit der Frage nach der richtigen Mascara für die Wimpern.
»Ich zeige euch das mal«, sagte Jörn. Er griff nach seinem Tablet, klappte die Abdeckung nach hinten, zeigte Jana – und auch der sofort an ihre Seite getretenen Senta – ein Foto. Auf dem Bild war ein einzelner Parkettstab zu sehen. Aber nicht von oben, sondern von der Unterseite. Und die war nicht hell oder grau, wie Jana das erwartet hätte, sondern in ein dunkles Braun getaucht.
»Wir haben das Parkett von vorn nach hinten herausgehebelt. Ist richtig gut angelegt worden. Hat uns zwei Bohrhammer gekostet. Und dann waren da plötzlich die Holzteile, deren Unterseiten braune Flecken aufwiesen.«
»Okay, braune Flecken. Und was ist daran so besonders?«
»Na, das Blut!«, mischte sich nun Senta in die Diskussion ein.
Jana dankte ihr innerlich für den qualifizierten Wortbeitrag.
»Wir haben noch ein paar der Hölzer vom Boden gelöst. Und uns das angeschaut. Und die hatten auch alle diese braune Färbung. Wie auch der Kleber unter dem Holz.«
»Und woher weißt du, dass das Blut ist?«, wollte Jana nun wissen.
Der Moment, in dem Jörn grinste. »Ist halt mein Hobby. Ich habe irgendwann angefangen, mir auch so einen kleinen Koffer zuzulegen wie bei denen von der Spurensicherung. Nicht, dass das für mich wichtig wäre. Aber du glaubst ja nicht, an was für Orten ich bereits nicht nur Fliegen und Kakerlaken entsorgt habe, sondern ganze Wohnungen aufgelöst. Und irgendwann hat es mich interessiert, was all die Flecken waren, die ich in den Behausungen gefunden habe. Deshalb habe ich auch in meinem Koffer eine Spraydose ›LumiScene‹. Also das, was man im Fernsehen immer unter ›Luminol‹ subsumiert. Du sprühst es auf einen Fleck, machst das Licht aus und wenn es dann in wundervollem Blauviolett leuchtet, heißt das: Blut. Und genau das ist bei diesem Fleck passiert.«
»Der Fleck auf diesem Holzstück stammt also von menschlichem Blut?«
»Nein. Er stammt von Blut. Mehr kann LumiScene nicht erkennen.«
»Und warum hast du mich dann angerufen? Und die Pferde scheu gemacht?«
»Weil die Fläche so groß ist. Wir haben hier fast drei Quadratmeter voll von Blut. Auf der Unterseite des Parketts. Das heißt, das Blut muss sich seinen Weg durch die Ritzen nach unten gesucht haben. Und sich dann verbreitet haben. All das lässt sich ganz bestimmt nicht dadurch erklären, dass sich irgendjemand in den Finger geschnitten hat.«
Jörn wischte auf seinem Tablet und zeigte auf eine Fotografie, auf der das Parkett noch vollständig zu sehen gewesen war. Die Mitte des Raumes war von einem roten Ring umrahmt. »Das ist ungefähr der Bereich, in dem wir Parkettstücke gefunden haben, die mit Blut getränkt waren.«
Jana betrachtete die Aufnahme. Und war schockiert. Da muss ein regelrechter Blutsee auf der Unterseite des Parketts zu erkennen gewesen sein. Was war hier geschehen? Jana spürte, wie ihr Magen sich in die Diskussion einmischte. Sie hatte hier vier Jahre lang gelebt. Als Jugendliche. Zwischen 14 und 18 Jahren. Und die ganze Zeit hatte diese Blutlache vielleicht neben ihr existiert? Und sie hatte nichts davon gewusst? Ihr wurde schlecht.
Jana war gut darin, ihre Körperfunktion zu kontrollieren. Sie bekam ein Zittern unter Kontrolle, ein Frieren. Sie hatte auch ihre Gesichtszüge zumeist im Griff. Aber jetzt? Jana würgte. Sie hatte in einer Wohnung gelebt, in der die Blutspuren einer massiven Verletzung – im besten Falle – die ganze Zeit neben ihr geruht hatten?
Das Würgen wurde stärker. Zum Glück hatte sie den Toilettenbereich bereits komplett renovieren lassen. Sie stürzte in Richtung Klo und übergab sich. Mehrfach. Was sie gar nicht gewohnt war. Sich zu übergeben gehörte nicht zum Repertoire ihrer Körperreaktionen. Aber jetzt übernahm die Area postrema des Hirnstamms die Kontrolle.
»Scheiße! Ist alles in Ordnung mit dir?« Sentas Stimme. Das war eigentlich der Drehbuchtext von Jana gegenüber Senta.
»Ja, geht schon.«
Es ging nicht. Noch ein weiterer Schwall ergoss sich in die Toilette. Während Jana darum bemüht war, ihre Haare aus der Kampfzone herauszuhalten, spürte sie, wie Senta die Hand auf ihre Schulter legte. »Zu viel Alkohol?«
Das fragte die Richtige ... Jana erhob sich. Trat vor das Waschbecken und den darüber angebrachten Spiegel. Spülte ihren Mund aus. Richtete Klamotten und Frisur. All das unter dem kritischen Blick von Senta. Und Jana war erstaunt, dass ihr die Anwesenheit der Freundin – okay, nennen wir sie jetzt einmal so – angenehmer war als ihre Abwesenheit.
»Wieder alles gut?«, wollte Senta wissen.
»Ja. Alles gut.« Natürlich war wieder ›alles gut‹ – der Begriff, der es in den vergangenen zehn Jahren geschafft hatte, zur Standardfloskel zu werden. Las man die beiden Worte, hatte man keinen Schimmer davon, wie sie gemeint waren. Es gab zig Variationen der Betonung, die die Bandbreite von ›es geht mir wirklich super‹ bis zu ›ich bin echt ganz unten‹ widerspiegelten.
Jana widmete ihrem Spiegelbild einen letzten, prüfenden Blick, fand, dass sie wieder in die Welt hinaustreten konnte, drehte sich um und verließ den Toilettenraum. Ja, die Höflichkeit gebot, dass sie Senta die Tür aufhielt.
»Was ist denn mit dir passiert?«, wollte auch Jörn sofort wissen.
Jana antwortete nicht. Stattdessen stellte sie die Gegenfrage: »Wie bist du auf die Idee gekommen, dass das hier Blut sein könnte? Hätte ja auch eine Flasche Rotwein sein können, die jemand aufs Parkett geschmissen hat.«
»Ja, natürlich, hätte auch eine Flasche Rotwein sein können. Habe ich natürlich auch zuerst dran gedacht. Habe ich immer wieder mal gesehen, wenn der Inhalt einer solchen Flasche einen Boden ruiniert hat. Aber ich hatte eben auch schon die anderen Fälle.«
»Welche denn?«, wollte Senta sofort wissen.
Jörns Blick wandte sich dann auch wieder ihr zu, als er antwortete: »Na ja, einmal, da hatten wir einen Suizid. Jemand hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten. Die Polizei hatte sich damals gewundert, dass nur so wenig Blut auf dem Boden zu sehen gewesen war. Als wir dann das Laminat rausgerissen hatten, da haben wir gesehen, wo die restlichen drei Liter gelagert gewesen waren. Unter dem Laminat, da hatte sich noch so eine Unterlage aus Stoff befunden. Wahrscheinlich zur Trittschalldämpfung. Die hatte all das Blut aufgenommen. Da habe ich mir dann zum ersten Mal dieses LumiScene gekauft. Die Polizei war mächtig beeindruckt, was ich ihnen dann da präsentiert hatte.«
Jörns Blick war nicht von Senta gewichen. Und Jana kannte Jörn so gar nicht: Als Aufschneider. Als Angeber. Bislang war er ihr immer eher als zurückhaltend aufgefallen.
»Und das war das einzige Mal, dass Sie menschliches Blut gefunden hatten?« Senta, die sich jetzt wie eine Journalistin von RTL II gab bei ihrer ersten Recherche für ein True-Crime-Format. Jörn sprang sofort drauf an: »Nein. Einmal hatten wir einen alten Mann, der im Bad gestürzt zu sein schien. Sein Schädel war eingeschlagen. Sah auf den ersten Blick alles aus wie ein Sturz. Sie hatten die Leiche weggeräumt, dann kamen wir, um sauber zu machen. Denn er hatte fast zwei Monate unbemerkt dort gelegen. Auch da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Und ich hatte in der Umgebung LumiScene versprüht. Und dann sofort mit allen Arbeiten aufgehört. Ich bin ja kein Kriminalexperte. Aber da war so viel Blut, das definitiv nicht mit der Theorie von einem Sturz in Einklang zu bringen war.
Wir sind gegangen, die Spurensicherung ist gekommen. Die Leiche wurde danach noch exhumiert – und tatsächlich wurde klar, dass der Mann umgebracht worden war. Sie haben dann sogar ein halbes Jahr später den Täter gefunden.«
»Wow!«, sagte Senta.
Jana fühlte sich als Statistin in dieser Show. Es war an der Zeit, sich wieder als Managerin zu gebärden. »Also, was genau kannst du mir zu diesem Blutfleck sagen?«
Das war der Moment, in dem sich Jörn endlich auch einmal ihr zuwandte. »Hier ist eine ganze Menge Blut geflossen. Mehrere Liter. Natürlich weiß ich nicht, ob es menschliches Blut ist. Aber wenn es das nicht ist, dann haben sie hier einen Hund gekillt, irgendwelche Hühner als Opfergabe vorbereitet oder das Passa-Lamm geschlachtet. Das ist mehr Blut, als durch ein Versehen geflossen sein könnte.«
»Arbeiten Sie auch mit der Kriminalpolizei zusammen?«, Senta wieder. Die ihr unverhohlenes Interesse an Jörn Großeimer kaum verhehlen konnte.
»Na ja, nicht so direkt. Aber wie gesagt, ich habe den Tatort eines Mordes identifiziert.«
Senta schmolz dahin. Und Jana hatte nur noch einen Impuls: Sie wollte nach Hause in ihre Wohnung.
Rocky II
»Dann erzähl ich dir jetzt von der ersten Tour mit Fischi.«
»Ja.«
Die Stimme aus dem Dunkel. Meine Augen mögen kein Licht mehr. Dabei habe ich gerade die helle Mittagssonne so geliebt. Konturen, klarer, als es jedes Foto darstellen konnte. Alles, was sich gegen den Himmel abzeichnete, war konsequent von ihm abgetrennt. Grenzen. Trennlinien. Was ist vorne? Was ist hinten? Ganz klar. Keine Diskussionen.
Die erste Tour mit Fischi. Hab gekotzt damals. Musste mir der Alte ausgerechnet ihn auf den Beifahrersitz drücken? Bin ja meist allein gefahren. Klar, mit Benno. Aber das war o.k. Und jetzt? Ausgerechnet Fischi? Aber gut. Wenn der Chef meinte, das wäre richtig, na dann.
»Bist du bereit?«, frage ich.
»Ja. Sprich«, antwortet mein Sohn.
Sprich. Wie unterschiedlich man diesen Imperativ interpretieren konnte. Ich wollte erzählen. Wollte berichten. Wollte ihm damit ein Fundament bereiten.
Für ihn bedeutete ›sprich‹ jedoch nur: Fang endlich an, damit ich mittippen kann. Als ob er nach Stunden bezahlt würde. Er hat nichts kapiert. Gar nichts. Und trotzdem beginne ich jetzt zu erzählen.
»Es war dunkel damals …«
Es war dunkel damals.
Nicht gut.
Ich hasste das auf diesen Straßen. Wenn da mal wenigstens rechts ein reflektierender Seitenstreifen war, dann hatte man schon gewonnen. Gab’s hier jetzt allerdings nicht. Vielleicht war die Definition von ›in der Pampa‹ genau die Abwesenheit von irgendwelchen Straßenmarkierungen.
In diesen Momenten schätzte ich meine Heimat, die BRD, schon sehr. Dort gab es auf den Landstraßen nicht nur Seitenstreifen, sondern sogar reflektierende Leitpfosten, wie es auf Beamtendeutsch heißt. »Wie weit ist es noch?«
Da saß dieser Depp neben mir. Und konnte nicht mal seine Klappe halten. Ich wusste genau, wohin ich zu fahren hatte. Wie oft hatte ich diese Tour schon gemacht? Zehnmal? Zwanzigmal? Auf jeden Fall hatte ich keinen Bock auf diesen Frischling neben mir. »Vielleicht 20 Kilometer.«
Schweigen von der rechten Seite. Das Beste, was passieren konnte.
Der Laster war voll. Mercedes-Benz LA 710. Der mit der runden Haube vorne. Hatte auch schon über zehn Jahre auf dem Buckel. Ich mochte das Fahrzeug. Zuverlässig. Und gerade im Osten Europas war der Allradantrieb oftmals sehr hilfreich gewesen. Was wir in Deutschland Straßen nannten, waren im Osten keine Straßen. Manchmal nur Feldwege. Der Laderaum war vollgepackt mit Paletten von polnischem Wodka. Alles legal, alles perfekt. Was Zöllner nicht sahen und auch nicht sehen mussten, war, dass es von der Fahrerkabine zum Laderaum unseres Siebeneinhalb-Tonners noch eine schmale Luke gab. Zu einer doppelten Wand. Ein kleiner Stauraum. Konnte man nicht sehen, wenn man nicht wusste, wonach man suchte. Das war der Ort, wo wir die Dinge versteckten, die wirklich Kohle brachten. Wodka war nett, Kunst war netter. Wodka brachte Geld, Kunst brachte Gelder. Sozusagen. Das deutlich lukrativere Geschäft.
Aber davon hatte der Frischling natürlich keine Ahnung.
Klar, der polnische Wodka war gut. Ich mochte die Flaschen, auf denen ein Bison abgebildet war und ein Gras in der Flasche dümpelte. Die edelste Art, eine Pflanze zu konservieren. Ich würde ein paar Flaschen abzweigen. Aber das, wie gesagt, war nur das halbe Geschäft. Ich musste den kleinen Umweg fahren. Raus nach Mühlenbeck. Abseits der Autobahn. Oder dem, was sie in der DDR Autobahn nannten.
»Kann ich da auch mal pinkeln?« Fischi wieder. Wie ich das hasste, wenn ich mit irgendeinem Typen, der noch grün hinter den Ohren war, auf die Piste geschickt wurde. Aber klar, ich hatte hier nicht das Sagen. Fischi kam von oben. Wurde mir von dort aufgedrückt. Musste ich mit leben. Konnte ich mit leben. Solange der Typ die Klappe hielt. Was er eben jetzt nicht tat. Wobei, nachher konnte das nur schwierig werden. Aber daran konnte ich jetzt auch nichts mehr ändern. Es gab noch keine Handys. Oder einfach nur Telefonzellen. Zumindest nicht entlang der Landstraße. Aber ich hätte den Typ per Telefon wahrscheinlich ohnehin nicht mehr rechtzeitig erreicht. Es hieß improvisieren.
Ich merkte, wie ich müde wurde. Ich saß bereits seit zwölf Stunden hinter dem Steuer. Und Fischi hatte noch nicht einmal einen Führerschein für Lastwagen. Wir kamen aus dem Osten von Polen. Hatten dort fast den ganzen Stauraum mit polnischem Wodka gefüllt. Schmeckte gut, das musste ich zugestehen. Aber bitte, war es den Aufwand wert?
Aber was wusste ich schon. Ich war ja nur der Fahrer. Ich lud die Kisten voll Wodka in den Laster und fuhr sie in den Westen. Mein Chef hatte alle Papiere organisiert, und seit ich in der Firma arbeitete, hatte ich nie Probleme gehabt mit den Papieren. Ein beruhigendes Gefühl. Auch wenn wir jetzt den Abstecher nach Mühlenbeck machten.
Aber nein, ich war nicht nur der Fahrer. Ich wusste auch um die anderen Geschäfte. Die, die nicht in Polen getätigt wurden. Sondern eben im ostdeutschen Nachbarstaat. Was hechelte die DDR nach Devisen! Und genau da konnte das Unternehmen des Chefs Unterstützung anbieten. Sozusagen. Nein, ich kannte mich nicht aus mit Politik. Aber ich kannte mich sehr gut aus in Fragen des Geldes. Je mehr, desto besser. Und wer, wenn nicht ich, kannte sich aus mit den Salden von Konten. Und wir würden da jetzt eine Menge Material abholen, die deutlich mehr Geld einbrachte, als die zehnfache Menge an Wodka, die wir hinten auf dem Laster hatten.
Nein, ich, Rocky, hatte kein Abitur. Ich hatte nicht einmal einen Realschulabschluss. Aber ich hatte einen Hauptschulabschluss, und Mathe war mit Abstand das beste Fach gewesen, das ich absolviert hatte. Weil, Mathe, das hatte mit Geld zu tun. Und das war das Einzige, was mich wirklich interessierte.
Der Schlenker nach Mühlenbeck, das war echt keine große Geschichte.
»Willst du da einen Stopp machen?« Fischi wieder.
»Ja. Wir werden dort einen Stopp machen.«
»Und warum?«
Warum. Das war immer die falsche Frage bei Leuten, die nicht Untergebene befragten, sondern Menschen, die in der Hierarchie deutlich über ihnen standen. Das war nicht Fischis Problem. Das war nicht Fischis Angelegenheit. Fischi hatte einfach nur neben mir zu sitzen und zu lernen. »Wir machen einen Stopp, damit du lernst, was in diesem Geschäft wichtig ist. Und das sind ganz gewiss nicht die Wodkaflaschen.«
»Sind sie nicht?«
Mein Gott, der Typ hatte echt noch was zu büffeln!
Samstag, 15. April
Jana hatte beschissen geschlafen. Viele Träume waren durch Morpheus Nebel marschiert, die alle genau eines gemeinsam hatten: Wellen von Blut waren durch sie hindurch geschwappt.
Es war schon hell draußen.
Jana drehte sich noch einmal auf die andere Seite. Dabei verschob sich die Bettdecke so, dass nun ein Stück Haut in der Nierengegend frei lag und natürlich sofort eine kleine Brise die Stelle kühlte.
Jana knurrte, zerrte die Bettdecke zurecht.
Es war schon schlimm genug, dass sie sich darauf eingelassen hatte, ihr Büro im Haus der Eltern einzurichten. Aber jetzt auch noch das mit dem Blut? War das ein Zeichen? Ein Zeichen dafür, doch einfach an einem anderen Ort nach geeigneten Räumen zu suchen? All die Kohle, die sie jetzt reingesteckt hatte, in den Wind zu schreiben?
Jana brummelte noch einmal und zog sich das Kissen über den Kopf, wobei sie sich mit der Hand versehentlich selbst an den Haaren ziepte.
Jetzt einfach so liegen bleiben.
Sich nicht regen.
Den Tag verstreichen lassen.
Ach was, den Tag – die Woche ... Das Leben!
Ihr Radiowecker sprang an. Relikt aus vergangenen Zeiten, aber immer noch treuer Diener.
Und sie hörte, wie aus dem Lautsprecher eine Frau sang: »Aber ich will nicht, ich will lieber hier liegen, für immer hier liegen, denn liegen ist Frieden! Mein Geschenk an die Welt!«
Jana konnte nicht anders. Sie fing an zu lachen. Dabei entpuppte sich das Kissen über dem Kopf als hinderlich.
Und sie lauschte noch einer Zeile: »Und wenn die Welt heut vor die Hunde geht, und kein Stein mehr auf dem anderen steht, an mir kann es nicht liegen, denn ich bin liegen geblieben.«
Jana prustete los. Danke, Sängerin! Du hast mir den Tag gerettet! Sie griff zum Handy, schaute auf die App ihres Lieblingssenders und stellte fest, dass die Sängerin Elen hieß. Wunderbar. Wieder ein Name, den sie sich merken musste.
Sie schwang die Decke zurück, die Beine über den Bettrand, setzte sich auf. Und wusste nun auch, was sie mit diesem Tag anfangen würde.
Das Frühstück war ihnen heilig.
Samstagmorgen, zehn Uhr.
Die ganze Familie beisammen. Horndeich hatte den Job, den Tisch zu decken. Seine Tochter Stefanie half ihm dabei. Mit ihren fast zwölf Jahren stand sie gerade an der Schwelle zur Pubertät. Horndeich spürte das bereits in einigen Momenten. Aber den Tisch decken mit Papa, das war immer noch okay.
Sein Sohn Alexander, jetzt neun Jahre alt, nutzte die Zeit vor dem Frühstück, um zu musizieren. Derzeit Cello. Also ein Kindercello. Halbe Größe von einem Geigenbauer in Darmstadt. Alexander hatte seine Liebe zu den Kompositionen von Edward Elgar entdeckt. Eben insbesondere zu dessen Tonschöpfungen für Cello. Horndeich hatte dieser Musikgattung in seinem Leben bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Aber das Cellokonzert von Elgar – das hatte was.
Die jüngste Tochter, Antje, sie war jetzt drei Jahre alt. Alt genug, um sich in jede Diskussion einzumischen. Noch nicht alt genug, um sich aktiv am Familienleben zu beteiligen.
Horndeichs Frau Sandra ging samstags um halb zehn Uhr immer zum Bäcker. Horndeich liebte Croissants. Liebte es, sie in den Kaffee zu tunken. Nichts, was seiner Tochter Stefanie gefiel.
Die hatte den Tisch inzwischen gedeckt. Und hatte währenddessen die ganze Zeit mit ihrem Familienhund Fidel kommuniziert. »Sitz«, »Platz«, »Roll dich« – der Hund gehorchte im Wesentlichen ihr. Seine Frau Sandra hatte auch einige Versuche gestartet, Herrin über den Hund zu werden, aber gegenüber ihrer Tochter hatte sie definitiv immer den zweiten Platz eingenommen. ›Roll dich‹ – so sinnlos wie Rabattmarken – aber für ihre Tochter machte der Hund den Affen. Sozusagen. Für seine Frau nicht. War möglich, dass er, wenn er mit einem erwachsenen Menschen kommunizierte, ›Roll dich‹ für würdelos hielt. Das war die beste Interpretation seiner Weigerung. ›Ich gehorche nur Stefanie‹ war die wahrscheinlichere ... Horndeich genoss das Frühstück im Familienkreis. Unter der Woche gingen die Kinder zur Schule oder in die Kita. Seine Frau arbeitete halbtags bei der Polizei im Bereich der IT-Forensik. Er selbst war Privatdetektiv – nun, manchmal hatte er mehr zu tun, manchmal weniger. Unterm Strich passte es. Und es war gut, dass er sich als Freiberufler immer wieder um die Kinder kümmern konnte, wenn bei seiner Frau Land unter war, weil sie für irgendeinen Mordfall Überstunden schieben musste.
»Sind wir eigentlich genug Kinder?«, wollte seine Tochter von ihm wissen, als er gerade die Trauben kleinschnitt, für das Müsli, das seine Tochter und seine Frau so liebten.
»Wie meinst du das?«, wollte Horndeich von seiner Tochter wissen.
»Na, der Thomas, der hat sechs Geschwister«, entgegnete Stefanie.
»Ich glaube, wir haben genug Kinder. Also du hast genug Geschwister«, antwortete der verantwortungsbewusste Vater. Er und seine Frau waren sich einig, dass drei Kinder genug waren. Und sie sorgten aktiv dafür, kein weiteres entstehen zu lassen. Zum Glück gab es da ja seit dem vergangenen Jahrhundert genug funktionierende Möglichkeiten.
»Aber eigentlich hätte ich gern eine Schwester.«
»Du hast eine Schwester«, erwiderte Horndeich.
»Ja, aber ich hätte gerne eine ältere Schwester. Von der ich noch was lernen kann.«
Horndeich grinste. »Na, das wird dann leider kaum möglich sein. Du bist das erste Kind, das deine Mutter und ich …« Verdammt. Scheiß Verbendstellung des Nebensatzes in der deutschen Grammatik. Man sollte sich im Vorfeld klarmachen, wie man einen Satz zu Ende bringt. ›… gezeugt haben‹, wäre jetzt wohl das falsche Ende. Oder? Horndeich wusste nicht, mit welchem Verb er den Satz abschließen sollte. Seine Tochter half ihm: »… gezeugt haben.«
Danke, Sexualkundeunterricht.
»Weiß ich doch«, erwiderte Stefanie. »Ist aber eine schöne Vorstellung. Dann müsste ich nicht allein alles den beiden Kleinen beibringen.«
Horndeich nickte nur. Aus der Perspektive der ältesten Tochter mochte die Aussage richtig sein. Horndeich war sich gar nicht bewusst, dass seine Tochter das Bedürfnis oder auch nur die Notwendigkeit sah, ihren jüngeren Geschwistern irgendetwas weitergeben zu müssen.
Zehn Minuten später saßen sie gemeinsam am Frühstückstisch.
Sandra hatte tatsächlich Croissants für ihn aufgetrieben. Und aß auch selbst eines als Goodie zum Müsli.
Alexander hatte ein Faible für Laugenbrötchen, die Horndeich durchaus auch zu schätzen wusste. Antje aß, was man ihr vorsetzte. Das hatte sie gemeinsam mit Fidel. »Darf ich zum Frühstück Musik machen?«, fragte Alexander.
Horndeich reagierte nicht, ebenso wenig seine Frau. Und auch die beiden anderen Kinder legten kein Veto ein. So zuckte Alexander sein Handy und streamte Elgars Cellokonzert auf die Boxen. Konnte Horndeich mit leben. Er war nur erstaunt, dass seitens Stefanie kein Widerspruch kam. Aber offensichtlich empfand auch sie diese Musik als angenehm.
Die Familie pflegte das Ritual, beim Abendessen zu fragen, was am Tag schön gewesen war. Und es hatte sich ein weiteres Ritual etabliert: Beim Samstagmorgen-Frühstück fragte Sandra ab, was in der Woche besonders schön gewesen war.
Zuerst waren die Kinder an der Reihe, etwas zu erzählen. Dann die Erwachsenen.
Stefanie berichtete, dass sie in der Schule in Sport beim Weitsprung eine gute Marke erzielt habe. Alexander sagte, dass er das Cellokonzert von Elgar inzwischen fast auswendig spielen könne. Antje verstand das Konzept noch nicht und brabbelte irgendetwas.
Dann war die Reihe an den Erwachsenen. Für gewöhnlich war Sandra vor ihm dran. Er machte immer den Abschluss. Gemeinhin sagte er Dinge wie: »Ich freue mich, dass ich eine ganze Woche mit euch gelebt habe, ohne dass irgendetwas Schlimmes passiert ist.« Stefanie und Alexander rollten dann meist mit den Augen, und Sandra griff nach seiner Hand. Aber seine Frau antwortete nicht auf die Frage. »Sandra?«
Sandra sah ihn an.
»Was war für dich das Schönste in der Woche?«, wiederholte Horndeich. Sandra hob den Blick und schaute Horndeich immer noch direkt an. Aber sie sagte nichts.
Nicht nur Horndeich fiel auf, dass irgendetwas nicht stimmte. Auch Stefanie bekundete dies durch ein fragendes: »Mama?«
Da Sandra ihren Gatten ansah, nahm der auch als Erster die Träne wahr, die sich plötzlich ihren Weg über die Wange nach unten suchte. Sandra wischte sie in einer schnellen, aber fahrigen Handbewegung zur Seite. Dann stand sie auf. »Sorry, ich muss mal aufs Klo.«
Sie erhob sich, ging durch den Flur in Richtung Bad.
Alexander war auf die Musik fokussiert, Antje hatte im Löffel das Spielzeug ihres Lebens entdeckt, aber Horndeich und seine Tochter Stefanie sahen einander an. Horndeich versuchte Fröhlichkeit zu verbreiten, tunkte sein Croissant in den Kaffee, sodass ein wenig der Flüssigkeit überschwappte. Keines der Kinder nahm dies auch nur wahr.
Nachdem Sandra nach zwei Minuten noch nicht zurückgekehrt war, erhob sich Horndeich. Auch hier musste er seine ältere Tochter nur anschauen, die eine winzige Bewegung des Nickens machte. »Klar, geh, schau nach Mama.«
Horndeich drückte die Klinke der Badezimmertür nach unten. Die Tür öffnete sich. Sandra hatte sie nicht einmal verschlossen. Was nicht dafür sprach, dass sie wirklich einen Toilettenbesuch geplant hatte. Tatsächlich saß seine Frau ohne heruntergelassene Hose auf dem zugeklappten Deckel der Toilette. Hier ging es definitiv nicht um Ausscheidungsvorgänge, die der Verdauung zuzurechnen gewesen wären. Vielmehr rannen Tränen über ihre Wangen. Jetzt nicht mehr einzeln, sondern wie eine gutorganisierte Parade.
Als er das Bild sah, erstarrte er für eine Sekunde. Er und seine Sandra hatten all die Jahre ihrer Zusammengehörigkeit, zuerst als Paar, dann als Ehepartner, dann als Eltern, auf angenehm harmonische Weise verbracht. Vor einem Jahr jedoch hatte es die erste wirklich erschütternde Krise gegeben. Auf einem Klassentreffen hatte Sandra einen ehemaligen Mitschüler – Horst Horstler – getroffen, der sie erpresst hatte. Denn Sandra hatte einige Jahre, bevor sie Horndeich kennengelernt hatte, bereits eine Tochter zur Welt gebracht. Der Vater war ein gewalttätiges Arschloch gewesen. Und so hatte Sandra in ihrer Verzweiflung die Tochter unmittelbar nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Der ehemalige Mitschüler Horst hatte Sandra in seiner Verliebtheit – wohl eher in seiner Verblendung – über Jahre gestalkt. Und sie erpresst, wenn sie nicht freiwillig ihrem Ehemann Steffen Horndeich sagen würde, dass sie bereits vor der Ehe ein Kind geboren habe, das jetzt irgendwo adoptiert sei, würde dieser Horst es nicht nur dem Gatten erzählen, sondern auch Sandras Kindern.
Sandra hatte über Tage nicht gewusst, wie sie darauf reagieren sollte. Sie hatte mit ihm, Horndeich, ihrem Mann, gestritten, gefochten, Horndeich hatte seine Frau nicht mehr erkannt. Bis sie ihm dann doch alles erzählt hatte. Sie war ihm in diesen paar Tagen fremd gewesen. Ein Zustand, den er kaum ertragen hatte. Es hatte den Anschein gehabt, dass sich Sandras Persönlichkeit verändert hatte. Und ihm hatte es einfach nur Angst gemacht. Nachdem Sandra sich von der Last ihrer Geschichte befreit hatte, hatten sie ihr normales Leben wieder aufnehmen können. Und Horndeich kannte seine Sandra gut. Wusste oft, wie sie in zwei Sekunden reagieren würde. Und dieses Verhalten jetzt, ein einsames Weinen auf dem Klo im Bad – das war wieder eine Situation, die er so noch nie erlebt hatte. Die auf ihn so fremd wirkte. Nein – befremdlich. Weil er sie überhaupt nicht einzuordnen wusste.
»Was ist los?«, wollte er wissen. Und während er das aussprach, hörten sich die drei Worte lahm an. Bleischwer. Eine Floskel mit dem Gewicht eines Ankers.
Und auf Floskeln antwortete Sandra nicht. Auch nicht jetzt, in dieser Situation. Er setzte sich auf den Badewannenrand, einen halben Meter von seiner Frau entfernt. Nicht ganz auf Augenhöhe, aber fast.
Sandra sagte nichts. Doch Tränen rannen ihre Wangen hinab, wie die Modellbahnversion des Rheinfalls.
Er war keiner Überlegung gefolgt. Sondern er folgte einfach nur der Intuition. Horndeich stand auf, reichte seiner Frau die Hand, sie ergriff sie, und er zog sie nach oben, bis sie einander gegenüberstanden. Sandra legte ihren Kopf an seine Schulter und weinte hemmungslos.
Horndeich hatte die Tür zum Bad nicht geschlossen. Deshalb hörte er, wie im Esszimmer ein Stück Geschirr auf den Boden fiel. Das Geräusch illustrierte akustisch zerberstende Keramik. Augenblicklich die Stimme seiner Tochter Stefanie: »Mama!«
Horndeich wusste nicht, ob seine Frau dies überhaupt wahrgenommen hatte. Er hielt sie weiter im Arm, bewegte sich nicht.
Sekunden später stand Stefanie im Türrahmen zum Bad. »Alexander hat seinen Kakao umgeworfen.« Stefanie sah ihre Eltern an. Wie der Papa die Mama im Arm hielt. Wie die Mama weinte.
Mama war gemeinhin die Problemlöserin. Wenn irgendetwas schieflief, dann rief man nach Mama. Einerlei, ob die Toilette verstopft, der Ton im Fernseher nicht zu hören oder eben etwas heruntergefallen war. Mama kannte die Lösung.
Horndeich schaute in Richtung seiner Tochter, die erwiderte seinen Blick. Und es war eine wortlose Kommunikation.
»Stefanie, siehst du nicht, dass hier gerade irgendwas so gar nicht stimmt?«
»Doch. Natürlich sehe ich das.«
»Kannst du Mama in Ruhe lassen? Ich meine, kannst du dieses kleine Problem ohne sie und mich lösen?«
»Ja. Das kann ich.«
Stefanie wandte sich ab und ging wieder zurück in Richtung Esszimmer. Und Horndeich spürte, dass aus seiner Kleinen plötzlich eine Große geworden war.
»Komm Alexander, das kriegen wir gemeinsam hin. Pass auf wegen der Scherben. Unter der Spüle, da sind ein Kehrblech und ein Besen. Ich hol schon mal den Lappen.«
Er hörte diese Worte nur, aber er wusste, dass seine große Stefanie gemeinsam mit dem kleineren Bruder das Problem völlig selbstständig lösen würde.
Kinder alterten nicht in Wochen oder Monaten. Kinder alterten in Momenten, in denen man erkannte, dass sie einen großen Entwicklungsschritt gemacht hatten. Horndeich war sich nicht sicher, ob er glücklich darüber war, dass seine Stefanie die Hürde vom Kind zur Jugendlichen definitiv gewuppt hatte. Im Moment jedoch war er sehr froh darüber.
Sandra hatte aufgehört zu weinen.
Horndeich löste die Umarmung und hielt sie ein wenig auf Abstand. »Was ist denn los mit dir? Was ist passiert?«
Sie antwortete zunächst nicht, sah ihm in die Augen. Das war schon mal gut. »Ich …«, begann sie Sekunden später. Aber es folgte keine weitere Erklärung.
»Achtung! Scherben!«, hörte er seine Tochter rufen. Sollte er nicht vielleicht doch besser ins Esszimmer gehen?
»Sehe ich doch!« Alexanders Stimme. Die beiden hatten das im Griff.
»Jemand hat mich angerufen.« Sandra. Leise. Die Stimme zerbrechlich wie hauchdünnes Porzellan.
»Wer?« Das war die Frage, die er stellte, die aber gleichzeitig nur ein winziges Mosaiksteinchen war, unter all den weiteren Fragen im Kopf. »Warum? Weshalb? Wieso? Worum geht es hier eigentlich?«
Bevor Sandra antworten konnte, klingelte es an der Haustür.
Bis vor einem halben Jahr hatte es noch ein Frühwarnsystem gegeben: Sekunden, bevor die Türklingel auf einen Gast aufmerksam machte, hatte das Kreischen des Gartentürchens Besuch angekündigt. Horndeich hatte versucht, dem lauten Quietschen mit Fett Herr zu werden, aber es war ihm nicht gelungen. So hatten sie beschlossen, ein komplett neues Tor einsetzen zu lassen. Horndeich hätte nicht gedacht, dass er das Kreischen des Türchens einmal vermissen würde.
»Ich mach schon auf«, rief Stefanie. Die Problemlöserin des Tages. Trat ganz in die Fußstapfen ihrer Mama …
Sandra schien sich vorerst gefasst zu haben. »Reden wir später darüber.« Horndeich ließ seine Frau los.
»Wer immer es ist – gib mir bitte zwei Minuten, damit ich mich wieder halbwegs vorzeigbar herrichten kann.«
Horndeich nickte und verließ das Bad. Nicht, ohne die Tür zu schließen.
»Hallo, Jana!«, begrüßte seine Tochter die Dame im Türrahmen.
»Hallo, Stefanie. Störe ich?«
Stefanie antwortete nicht sofort. Wieder ein Zeichen dafür, dass sie in den vergangenen Minuten um Jahre gereift war. Noch gestern hätte sie zu Jana gesagt: »Nein, komm rein.« Nun schien Stefanie zu überlegen, ob es passte, dass Jana in das Haus trat, in dem gerade irgendwie alles auseinanderzufallen drohte.
Aber da war ja nun Horndeich zur Stelle. Konnte seiner Tochter endlich unter die Arme greifen. Er trat neben sie, legte seine Hand auf ihre Schulter – gestern war diese Schulter dem Boden doch auch noch zehn Zentimeter näher gewesen, oder? – und sagte: »Hallo, Jana, was führt dich hierher?« Es war Samstag. Natürlich hatte es während gemeinsamer Ermittlungen immer wieder auch Wochenendarbeit für sie beide gegeben. Aber derzeit arbeiteten sie an keinem gemeinschaftlichen Fall. Und, ja, selbstverständlich hatten sie sich ebenso auf privater Ebene schon getroffen. Immer, wenn ein gemeinsamer Fall erfolgreich abgeschlossen worden war. Dann hatten sie zusammengesessen. Mal bei ihr, mal bei ihm, mal in größerer Runde in einem Restaurant. Mal im kleinen Kreis in seinem Garten. Aber ein spontaner Wochenendbesuch von Jana, ganz allein, das hatte Horndeich noch nicht erlebt.
»Kann ich dich kurz sprechen? Es ist wichtig.«
Auch das war neu. Auf beruflicher Ebene hatten sie diesen Satz oft ausgetauscht. Aber eben nur auf beruflicher Ebene. Jetzt stand Jana vor ihm und ihr Blick war fast flehentlich. Hatte Ben sich von ihr getrennt? Hatte sie sich von Ben getrennt? Ben war Janas Freund. Oder so etwas Ähnliches. Er hatte den Mann schon ein paarmal getroffen, als dieser Jana in Darmstadt besucht hatte. Mit seinem Wolga. Einem aus der Zeit gefallenen russischen PKW, mit einer V8-Maschine, mit Automatik, hoher PS-Zahl und einem noch höheren Benzinverbrauch.
Irgendwie hatten die beiden nie zueinandergefunden. Zumindest nicht final. War das Finale jetzt eingeleitet worden? Wollte Jana mit ihm darüber sprechen? War es ein privater Grund, weshalb sie Horndeich aufsuchte? Eigentlich konnte er sich das nicht vorstellen. Andererseits: Warum sollte sie ihn am Wochenende behelligen? Wenn es nicht dringend war?
Horndeich war sich unsicher, wie er reagieren sollte. Hinter seinem Rücken lag ein völlig verunglücktes gemeinsames Samstagsfrühstück. Vor ihm stand Jana. Sah auch nicht glücklich aus. Und seine Tochter schaute ihn von unten ebenfalls mit fragender Miene an.
Horndeich zögerte. Gleichwohl betrat in diesem Moment Sandra von hinten die Szenerie. »Hallo, Jana, komm doch herein. Kaffee? Ein Croissant?«
»Ja, sehr gern.«
Es war eines der großen Mysterien dieser Welt: Vor 60 Sekunden hatte er seine weinende Frau im Bad stehen lassen. Und nun trat sie neben ihn, und niemand, der es nicht gewusst hätte, wäre darauf gekommen, dass sie geweint hatte. Okay, da bedeckte ein wenig mehr Schminke ihre Haut. Aber nichts deutete darauf hin, dass sich auf Sandras Wangen vor ein paar Minuten noch Tränen ein Wettrennen geliefert hatten.
Sie gingen gemeinsam durch den Flur, in Richtung Esszimmer. Und, tatsächlich, keine weitere Spur legte Zeugnis davon ab, dass hier vor wenigen Minuten eine Kakaotasse Suizid verübt hatte. Okay, vielleicht war es auch Sterbehilfe gewesen. Die Scherben waren beseitigt, der Fleck ebenso. Es gelang Horndeich, seiner Tochter einen aufgereckten Daumen zu zeigen, ohne dass jemand anderes es mitbekam.
Sie zwinkerte ihm zu. Sie setzten sich an den Frühstückstisch, Sandra bereitete für Jana einen Kaffee zu.
»Kann ich dich unter vier Augen sprechen?«, wollte Jana wissen.
Horndeich sah zu Sandra. Und er erkannte, dass es seiner Frau alles andere als unrecht war, wenn er mit seiner Geschäftspartnerin das Terrain verlassen würde.
»Klar, komm mit«, sagte Horndeich.
Sie stiegen über die Treppe im Haus in das Souterrain. Dort hatte Horndeich seine Büroräume eingerichtet. Einen Empfangsraum, der zuvor ein Wohnzimmer gewesen war, und sein Büro, das einmal ein Schlafzimmer gewesen war. Dann gab es noch eine kleine Küche und ein Bad. Die Räume waren nur knapp über zwei Meter hoch. Horndeich genügte es. Und den meisten seiner Klienten ebenfalls. Natürlich konnte man die Räume ebenso von außen erreichen, über den Zugang vom Garten aus.
Horndeich hatte seine Kaffeetasse gefüllt und mitgebracht. Auch Jana trug ihre Tasse mit nach unten. Horndeich steuerte den deutlich gemütlicheren Empfangsraum an, ausgestattet mit zwei Sofas und einem Couchtisch.
Sie ließen sich nieder, dann fragte Horndeich: »Was kann ich für dich tun? Worum geht es?« Letztere Frage hatte er in den vergangenen zehn Minuten schon einmal gestellt. Wenn auch Sandra und nicht Jana …
Jana zögerte. Aber nur kurz. Dann sagte sie: »Ich brauche einen Rat. Oder vielmehr deine Meinung.« Dann Schweigen.
Horndeich füllte es mit einer Frage: »Wozu?«
Jana erzählte. Dass Jörn Großeimer den Empfangsbereich der neuen Büroräume renovieren wollte. Dass er das alte Parkett herausgerissen und dabei festgestellt hatte, dass unter diesem Blutreste zu finden gewesen waren.
»Blutreste?«
»Ja. Ein richtig großer dunkler Fleck, mit sicher drei Metern Durchmesser. Und Jörn hat die Ausrüstung, um zu testen, ob das Blut wirklich Blut ist. Und das ist es. Ohne Zweifel.«
Horndeich zögerte kurz. Dann fragte er: »Okay. Dein Bekannter reißt das Parkett raus und findet auf der Unterseite davon Blut. Was ist jetzt die Frage?«
Jana atmete tief ein. »Die Frage ist, was ich jetzt machen soll. Ignoriere ich das? Lasse ich Jörn all seine Fähigkeiten als Tatortreiniger ausspielen, lasse ich ihn putzen, schrubben, desinfizieren? Dann danach einfach das neue Parkett auf den Boden legen? Meine Möbel wieder draufstellen, vielleicht noch drei Gummibäume, neben dem Schreibtisch, wegen der Atmosphäre? Und alles ist wieder gut?«
Zunächst klang das für Horndeich wie ein vernünftiger Plan. Aber er spürte, dass sich da bei Jana ein gewisser Widerstand abzeichnete. Er versuchte sich in Diplomatie: »Was spricht dagegen?«
Jana antwortete ohne Zögern: »Die Menge des Blutes. Jörn hat gesagt, dass er solche Mengen an Blut schon zweimal an Tatorten gefunden habe. Und es habe sich dabei einmal um Suizid und einmal um ein Tötungsdelikt gehandelt, nicht um irgendeinen Schnitt in den Finger. Dafür war das einfach zu viel Blut gewesen.«
»Aber welche Konsequenzen hat das für dich? Also, hätte das für dich?«
Jana sah Horndeich an. Und ihr Blick war ungefähr so freundlich wie jener des Rumpelstilzchens, als man seinen richtigen Namen nannte. Doch Horndeich war sich keiner Schuld bewusst. »So eine Menge Blut? Und wenn das menschliches Blut ist? Wenn in den Räumen, die jetzt mein Büro sind, jemand umgebracht wurde?« Horndeichs spontane Auffassung war: Kein schöner Gedanke. »Du glaubst wirklich, da ist jemand getötet worden?«
Janas Züge entspannten sich etwas. »Keine Ahnung. Weißt du, ich bin wahrlich nicht die, die an Traumfänger, Globuli und Feng Shui glaubt. Aber es gefällt mir nicht, dass da jemand zu Tode gekommen sein könnte. In den Räumen, in denen ich arbeite.«
»Aber das weißt du doch gar nicht.«
»Ich weiß nicht, ob es überhaupt eine gute Idee war, dort im Souterrain des Hauses meiner Eltern mein Büro einzurichten. Ich habe da mal gewohnt. Und auch meine Eltern. Und auch Ben hat dort mal gewohnt. Okay, ganz kurz. Und jetzt ist es der Ort, wo jemand gestorben ist? Also, wo jemand umgebracht worden ist?«