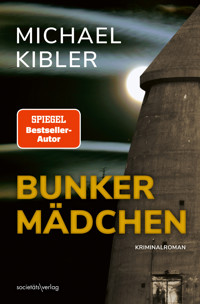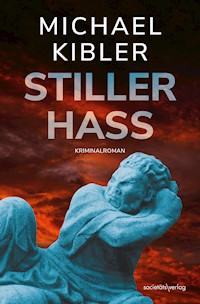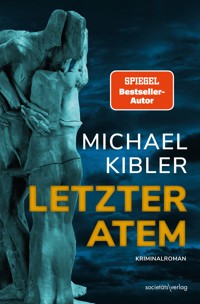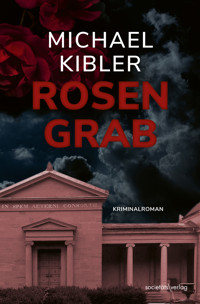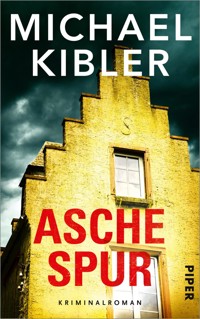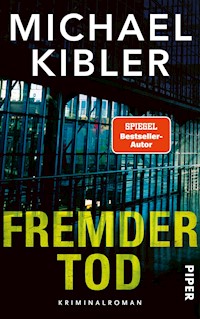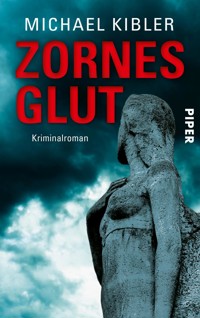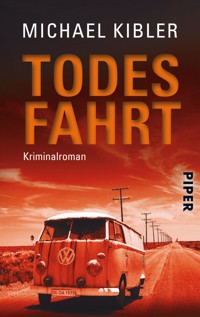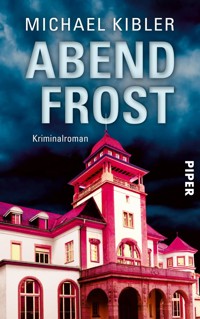Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Societäts-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der vermeintliche Selbsttod einer schwangeren Frau und der bestialische Mord an einem gut situierten Ehepaar stellen das Ermittlerduo Margot Hesgart und Steffen Horndeich von der Mordkommission Darmstadt vor Rätsel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Kibler
Engelsblut
Kriminalroman
Alle Rechte vorbehalten • Societäts-Verlag
© 2023 Frankfurter Societäts-Medien GmbH
Satz/E-Book: Julia Desch, Societäts-Verlag
Umschlaggestaltung: Julia Desch, Societäts-Verlag
Umschlagabbildung: Statue: Michael Kibler; Hintergrund: Wira SHK/Shutterstock.com
Printausgabe ISBN 978-3-95542-469-5
E-Book ISBN 978-3-95542-470-1
Besuchen Sie uns im Internet:
www.societaets-verlag.de
Für Hala
PROLOG
So fühlt es sich also an, wenn man reich ist.
Ich bin jetzt reich.
Sehr reich.
So fühlt es sich also an, wenn man getötet hat.
Ich habe es getan.
Der Wagen fährt toll. Ich bin noch nie so ein Auto gefahren. Ira hat mir ihr Navi gegeben. Sie wollte kein Geld dafür. Sie hat es nicht Blutgeld genannt. Aber ich bin sicher, sie hat es gedacht.
Der Wagen gehört nicht mir, sondern dem Toten.
Ich hoffe, ich habe genügend Vorsprung.
Ich habe gemordet, aber ich habe auch eine Familie. Deshalb versuche ich, nicht zu heulen, mich zusammenzureißen und mich auf die Straße zu konzentrieren.
Es gibt eine Menge Brücken hier. Und vorhin, da war ein Moment, in dem ich gedacht hab: gegen den Pfeiler, rumms – und alles wäre vorbei.
Aber das geht nicht. Schließlich werde ich gebraucht.
Der Schmuck ist unglaublich. Ich werde versuchen, ihn zu Geld zu machen. Ist wahrscheinlich noch mehr wert als das Bargeld. Was für eine Summe! Aber jetzt nicht die Nerven verlieren. Ich darf mir nicht erlauben, den Verstand auszuschalten. Jetzt alles langsam und nach Plan.
Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Weil ich getötet habe?
Oder bin ich ein guter Mensch, weil ich damit ein Leben lebenswert machen werde?
Darüber kann ich nicht richten.
Und wenn ich Glück habe, wird darüber auch kein irdischer Richter richten.
Irgendeine Instanz wird mich irgendwann zur Rechenschaft ziehen.
Aber jetzt ist es ohnehin zu spät.
Etwas rückgängig machen – das kann keiner.
Ich kann nur noch nach vorn schauen.
SONNTAG
Der Weg war nicht weit vom italienischen Restaurant Gargano zu ihrem Häuschen im Harras. Hauptkommissar Steffen Horndeich hatte den Merlot genossen. Zu einer Pizza mit Meeresfrüchten. Und viel Knoblauch. Ob der in Italien wohl auch zu den Früchten des Meeres zählte? Bei der Menge!
Sandra, Horndeichs Frau, hatte sich für Spaghetti Bolognese entschieden. Ohne Knoblauch, schließlich stillte sie noch.
»War ein schöner Abend«, sagte Sandra und kuschelte sich im Gehen an ihren Gatten.
»Hm-mm«, brummte Horndeich wohlig zurück. Es gab Momente, da war das Leben einfach nur gut. Er war jetzt knapp vierzig und rundum zufrieden.
Im Moment passte Dorothee auf die Kleine auf. Sie war die siebzehnjährige Tochter des Mannes von Horndeichs Chefin, Hauptkommissarin Margot Hesgart. Doro, wie sie genannt wurde, machte eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester und durfte Sandras Rechner und Drucker nutzen. Sie musste irgendeine Arbeit für die Berufsschule schreiben und war froh über das noble IT-Equipment im Haus. Im Gegenzug nutzten Horndeich und Sandra ihre Anwesenheit immer mal wieder, um gemeinsam ein paar Stunden außer Haus zu verbringen, um essen zu gehen. Oder auch nur spazieren. Wenn man kleine Kinder hat, lernt man solche gestohlenen Stunden zu schätzen, dachte Horndeich.
Sandra öffnete die Tür.
Che, Doros Hund, kam mit wedelndem Schwanz auf sie zu. Sandra begrüßte den rotbraunen Chihuahua mit einer Extraportion Kraulen.
»Schon da?« Doro kam die Treppe aus dem Dachgeschoss herunter. Derzeit befand sie sich in der postpubertären »Null Bock«-Phase. Was sich in sechs Piercings durch diverse Ohrlöcher und kiloweise schwarzem Eyeliner optisch manifestierte. Sie hatte es auch nicht gerade leicht. Der Papa, Margots Mann Rainer, weilte in Amerika, die leibliche Mutter war tot – und Margot und Doro standen sich irgendwie gegenseitig auf den Füßen, wenn es darum ging, zueinanderzufinden.
»Ja. Und war echt lecker«, sagte Sandra und strahlte Dorothee an. »Bist du weitergekommen mit deiner Arbeit?«
»Ja.«
»Und war unsere Kleine brav?«
»Ja. Sie hat die ganze Zeit geschlafen. Trinken wir noch was zusammen?«
Horndeich irritierte irgendetwas an Doros Verhalten. Aber er hätte nicht sagen können, was genau es war.
»Klar«, sagte Sandra. Sie ging mit Doro nach oben ins Arbeitszimmer und holte Stefanie, die in ihrem Tragekörbchen schlief. Horndeich stellte drei Gläser auf den Tisch. Doro würde sicher auch einen Schluck Wein trinken. Sandra verzichtete wegen der Kleinen noch auf Alkohol.
»Ich fahr am Dienstag nach England. Mit meinem Freund«, eröffnete Doro in einem Tonfall, als berichtete sie über den bevorstehenden Gang zum Schafott.
»Deinem Freund? Habe ich da was verpasst?«, fragte Sandra in betont lockerem Tonfall und nahm einen Schluck Mangosaft. Alkoholfrei bedeutete ja nicht automatisch geschmacklos.
»Egal«, sagte Doro.
»Komischer Name«, meinte Sandra, aber mit dem Kalauer konnte sie auch kein Lächeln ins Gesicht der jungen Frau zaubern.
»Egal«, wiederholte diese. »Könnte Che so lange bei euch bleiben? Und könntet ihr vielleicht ab und an mal meine Blumen gießen?«
Sandra sah zu Horndeich. »Klar, kein Problem. Ich freu mich, wenn Che hier ist.« Der Chihuahua war von Doro gut erzogen worden, das hatte sie wirklich gut hingekriegt und war wohl auch der Grund, dass sie die Sondergenehmigung erhalten hatte, ihn im Wohnheim bei sich zu behalten. Zumal der Hund kaum größer war als ein fetter Hamster.
»Würdest du mich vielleicht auch zum Flughafen bringen?« Doros Stimme war noch leiser geworden.
Wieder sah Sandra zu Horndeich. Wäre das nicht eigentlich Magots Job?, fragte dieser Blick. Aber auf diese Frage hatte auch Horndeich keine Antwort, obwohl er natürlich registriert hatte, dass Doro immer mehr die Nähe zu Sandra gesucht hatte. War nicht einfach für ihn, denn er musste ja mit Margot zusammenarbeiten. Und private Probleme von Kollegen, die in die eigenen vier Wände hineingetragen wurden – lustig war anders.
»Klar. Ich fahre dich.«
»Gut, dann geh ich jetzt mal«, sagte Doro und stand auf. »Kann Che gleich bei euch bleiben?«
»Auch das.« Sandra begleitete Doro zur Tür. »Sag mal, ist alles okay?«
»Ja, alles bestens«, sagte Doro. Sie umarmte Sandra und anschließend auch Horndeich, was diesen etwas befremdete. Das war jedoch noch nichts im Vergleich zu dem Abschied, der dem Hund zuteilwurde. Doro knuddelte das Tier, als ob sie es nie mehr wiedersehen würde.
Als sie ging, warf sie einen wehmütigen Blick zurück. Che klemmte den Schwanz zwischen die Hinterbeine und jaulte leise.
»Was war denn das?«, fragte Horndeich, nachdem sich die Tür hinter Doro geschlossen hatte.
»Keine Ahnung.« Sandra schmiegte sich an ihn. »Noch Lust auf ein paar Minuten Bond?«
Horndeich nickte. Sowohl er als auch Sandra hatten eine Vorliebe für den britischen Agenten. Im Gegensatz zu den meisten James-Bond-Fans diesseits der fünfzig hatte Sandra sogar alle Romane von Ian Fleming gelesen. Sie und Horndeich hatten sich vorgenommen, einmal nacheinander alle Bond-Filme in der Reihenfolge ihrer Entstehung zu schauen. Derzeit lag Der Mann mit dem goldenen Colt im DVD-Player. Roger Moore als der Held. Christopher Lee mit drei Brustwarzen als der Schurke.
James-Bond-Filme hatten einen großen Vorteil: Es war unmöglich, den Faden der Handlung zu verlieren – Sandra konnte die Kleine stillen, Horndeich sorgte für Chips-Nachschub –, und dann ging’s weiter. Selbst ganztägige Unterbrechungen brachten den Agenten nicht aus dem Konzept. Bond war da sehr genügsam.
Sie kuschelten sich aufs Sofa und starteten den Film. Nun, der Colt war nicht golden, und er war kein Colt. Aber bei derlei Kleinigkeiten durfte man nicht so pingelig sein. Dann brauchte man sich auch nicht über fliegende Autos zu wundern. Wie zum Beispiel gerade über den zum Flugzeug umgerüsteten AMC Matador Coupé. Horndeich geriet immer in Verzückung, wenn er die alten Wagen sah. Der AMC hatte wenigstens noch Schwung in der Seitenführung der Karosserie. Und die vier runden Rücklichter waren so groß, wie die Designer von BMW und Fiat es sich nie getraut hatten, sie zu gestalten.
Sandra küsste Horndeichs Hals und arbeitete sich gerade zum Ohr vor. James ließ sich ja zum Glück an jeder Stelle stoppen.
Doch dann klingelte Horndeichs Handy.
Auch Sandra hatte bei der Darmstädter Polizei gearbeitet. Sie wusste, dass ein Anruf nach 22 Uhr im besten Fall Ärger, im schlimmsten Fall Arbeit bedeutete.
Horndeich sah aufs Display. Seine Kollegin Margot Hesgart. Er schaltete das innere Programm auf Job und nahm das Gespräch an. »Ja?«
»Hallo Horndeich. Sorry, dass ich störe. Aber da hat sich eine Frau vor den Zug geworfen. Wir müssen hin.«
»Okay. Wo?«
»Odenwaldbahn Richtung Traisa. Ich beschreib dir den Weg. Du fährst erst mal zur Uni an der Lichtwiese, dann …«
»Margot, ich hab schon ein bisschen Wein intus …«
»Alles klar, ich hol dich ab. Bin in zehn Minuten da.«
Dann hatte sie aufgelegt.
»Du musst los?«
»Ich muss los. James muss warten.«
In diesem Moment erwachte Stefanie und begann zu schreien. Zeit für eine Runde knoblauchfreie Milch.
Der Tatort war weiträumig abgesperrt. Margot und Horndeich standen am Flatterband, das vom Bahnübergang zu ihren Füßen mehr als zweihundertfünfzig Meter bis zur Front des Triebwagens reichte, auf dessen Rückleuchten sie nun blickten. Sie waren nur schwach zu erkennen, denn der gesamte Bahndamm war in gleißend helles Flutlicht gehüllt.
Blaulichter zuckten, vom Notarzt- und Rettungswagen sowie von mehreren Feuerwehrfahrzeugen. Füchse, Damwild und Wildschweine hatten sich angesichts solchen Trubels in ihrem Terrain tunlichst in Sicherheit gebracht.
Der Unfallort lag im Wald zwischen Darmstadt und Traisa.
»Kein schöner Anblick«, sagte ein hagerer Fünfzigjähriger, dessen Uniform ihn als einen Kollegen der Bahnpolizei auswies. »Kresper mein Name.«
Margot stellte sich vor, reichte ihm die Hand, und Horndeich tat es ihr nach. Margot war zehn Jahre älter als ihr Kollege Horndeich.
»Wissen Sie schon genau, was passiert ist?«
»Nur, dass eine junge Frau überfahren worden ist. Der Körper – nun – er ist ziemlich zerstört.«
»Haben Sie schon in Erfahrung gebracht, wer sie ist?«
»Nein. Die Kollegen suchen den Bahndamm ab. Wir haben wohl die meisten Körperteile gefunden. Aber noch keine Handtasche oder so etwas. Kommen Sie, ich bringe Sie zu unserem Notfallmanager, Ferdinand Muttl.« Er hob das Absperrband, Margot und Horndeich bückten sich darunter hindurch.
Kresper eskortierte die beiden entlang des Bahndamms. Ein Kollege der Schutzpolizei, der keine zehn Meter entfernt stand, starrte ins Dickicht. Margot folgte seinem Blick und erkannte den Arm im Gestrüpp, bevor sie das Gesicht abwenden konnte.
»Scheiße«, brummte Horndeich, der offenbar den Blick in die gleiche Richtung gelenkt hatte.
Auch Margot kommentierte: »Derart zerstörte Körper sind mit das Schlimmste. Die kommen gleich nach denen, die zwei Wochen im warmen Wohnzimmer gelegen haben …«
Margot kannte den Bahnübergang im Wald am Kirchweg. Jeden Montag und Donnerstag, so es die Bösewichte der Stadt zuließen, joggte sie mit den Mitstreitern des Lauftreffs durch den Traisaer Wald. Den Lauftreff gab es seit fünfundreißig Jahren. Und was Margot sehr schätzte: Sie trieb Sport mit netten Leuten, ohne dass sie einem Verein beitreten musste. Wie oft war sie wohl in den vergangenen Monaten über diesen Bahnübergang gejoggt?, überlegte sie. Wie oft hatte sie vor dem roten Blinklicht gestanden, wenn sie und ihre Gruppe genau den Weg des Zuges um 18.17 Uhr oder um 18.52 Uhr gekreuzt hatten? Manchmal eine willkommene Unterbrechung, mal eine verfluchte, weil sie den Schnitt verschlechterte. Seit sie sich diesen Minicomputer am Arm gegönnt hatte, war die Zeit des unbeschwerten Waldlaufs passé, wie sie ausgerechnet in diesem unpassenden Moment ernüchtert feststellte.
»Herr Muttl, das sind Margot Hesgart und Steffen Horndeich. Kripo Darmstadt.«
»Hallo«, sagte Muttl nur. Er saß in einem der Mannschaftswagen der Polizei, einen Laptop vor sich auf einem Klapptisch. Er wirkte ein wenig wie ein Bär im Lord-Outfit: Karohemd, helles Cordsakko unter dem Mantel. Und einen gepflegten Schnauzer im rundlichen Gesicht.
Margot kannte den Mann. Sechs Jahre zuvor war er schon mit von der Partie gewesen, als sich ein jugendlicher Lebensmüder von einer Brücke auf die Eisenbahngleise gestürzt hatte. Damals war auch schon das große Programm mit zig Einsatzkräften zum Zuge gekommen, weil der Junge bereits eine Viertelstunde am Nordbahnhof auf der falschen Seite des Geländers gestanden hatte. Muttl war damals schon der Zuständige für »Personenschäden« bei der Bahn gewesen. Der Jugendliche war dann tatsächlich gesprungen. Aber auf das falsche Gleis. So war der Zug, der ihn hätte überrollen sollen, an ihm vorbeigefahren. Zwei gebrochene Beine und später eine Ausbildung bei der Polizei. Gott bewies manchmal schrägen Humor, um seine Schäfchen auf den rechten Weg zu führen. Doch nun verrieten Muttls Stimme und sein Gesichtsausdruck, dass Gott diesmal nicht nach Scherzen gewesen war.
»Können Sie uns kurz die Fakten geben?«, fragte Margot. Horndeich stand wie ein Schatten seiner selbst neben ihr. Ihm schien das Ganze noch viel näher zu gehen als ihr.
»Einen Moment«, sagte Muttl und tippte noch etwas in den Laptop. Dann wandte er sich Margot und Horndeich zu.
»Viel wissen wir noch nicht. Eine junge Frau. Hat sich genau am Bahnübergang auf die Schienen gesetzt. Mehr können wir nicht sagen, denn ihr Zustand ist …« Er beendete den Satz nicht.
»Fremdverschulden möglich? Hat sie jemand vor den Zug gestoßen?«
Muttl zuckte nur mit den Schultern. »Das rauszufinden, ist Ihr Job. Aber ich kann es mir kaum vorstellen. Erstens hat der Lokführer gesagt, sie habe einfach dort gesessen. Zweitens sähe der Körper, wenn sie jemand vor den Zug gestoßen hätte, anders aus. Dann wäre er nicht so zerfetzt worden. Eher zur Seite geschleudert. Hätte auch nicht schön ausgesehen – aber das hier …«
Er sprach nicht weiter.
»Ja, das hier?«
»Ganz einfach. Die dümmste Art, sich überfahren zu lassen, ist, sich längs zwischen die Gleise zu legen. Da passiert Ihnen wenig, wenn Sie nicht die Statur eines Sumoringers haben. Aber es gibt Positionen, bei denen …«, wieder stockte er. »Sie wusste genau, wie sie sich platzieren musste, damit es sie richtig erwischt.«
»Konnten Sie schon feststellen, wer sie ist?«
»Nein. Die Identifikation wird schwierig werden. Rötliches, langes Haar. Kein Übergewicht. Aber schon bei der Körpergröße muss der Arzt puzzeln.«
Margot seufzte innerlich. Auf einmal fühlte sie sich unglaublich müde. Sie war gerade auf dem Weg ins Bett gewesen, als sie um kurz nach 23 Uhr der Anruf erreicht hatte. Und natürlich fragte sie sich, welch schlimmes Schicksal einen Menschen dazu bringen konnte, sich vor einen Zug zu werfen. Oder, wie Muttl es gerade beschrieben hatte, sich auf die Gleise zu setzen und zuzusehen, wie der Zug auf einen zubrauste. Gruselige Vorstellung.
»Können wir mit dem Lokführer sprechen?«, fragte Margot. Sie warf ihrem Kollegen einen Seitenblick zu. »Alles okay, Horndeich?«, flüsterte sie.
Der nickte nur. Sagte aber nichts.
»Der Lokführer sitzt da hinten am Rettungswagen«, sagte Muttl und deutete in die entsprechende Richtung.
»Danke«, erwiderte Margot und verabschiedete sich.
Auf dem Weg zum Rettungswagen murmelte ihr Kollege: »He, brauchst du mich noch? Mir geht es nicht wirklich gut.«
Sie sah den Kollegen an. Im Flutlicht war gut zu erkennen, dass er ziemlich blass um die Nase war. »Nein, schon in Ordnung. Wie kommst du heim?«
»Vielleicht fährt mich einer von den Kollegen der Schupo. Sonst lauf ich bis zum Böllenfalltor und nehm mir ein Taxi.«
Margot überlegte kurz, ob es nicht eine bessere Möglichkeit gab. »Wie wär’s, wenn du dich kurz von den Jungs in Weiß durchchecken lässt, während ich mit dem Lokführer rede?«
Horndeich war von der Idee nicht gerade begeistert: »Ich komm schon klar«, blaffte er.
»He, was ist mit dir los?« Den Tonfall war Margot nicht gewohnt.
»Gar nichts ist los, was soll los sein? Ich geh jetzt. Du kommst hier allein klar. Ich auch«, grunzte er, dann wandte er sich grußlos ab und verschwand im herbstlichen Wald.
Seltsam. So hatte sie ihren Kollegen noch nie erlebt. Vielleicht schlug der drei Monate alte Nachwuchs aufs Gemüt. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht erinnerte sie sich kurz an die Zeit, als ihr Sohn Ben, inzwischen selbst zweifacher Vater, in diesem zarten Alter gewesen war. Dann sah sie das Gesicht ihres Mannes zu der Zeit vor sich. Okay. Und Horndeich war schließlich auch nur ein Mann.
Sie erreichte den Rettungswagen, in dessen offener Seitentür ein Mann saß, eingehüllt in eine Wolldecke, eine Tasse heißen Tee in der Hand.
»Sie sind der Lokführer?«, fragte Margot und ging direkt auf ihn zu.
Der Mann sah auf. Er war vielleicht dreißig Jahre alt, schlank, aber selbst unter Wolldecke und Jacke konnte man erahnen, dass er gut durchtrainiert war. »Ja«, sagte er. Und die roten, geschwollenen Augen zeigten, dass das Ereignis nicht spurlos an ihm vorübergegangen war.
»Hesgart, Kripo Darmstadt. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen?« Sie hasste diese Frage. Natürlich konnte sie Fragen stellen, so viele sie wollte. Nur die Qualität der Antworten war stets ungewiss.
Der Mann nickte. »Ich heiße Reinhard Zumbill.«
»Herr Zumbill, können Sie mir erzählen, was hier passiert ist?«
Zumbill nickte, sagte aber zunächst nichts. Stattdessen trank er einen Schluck Tee. Dabei rollten wieder Tränen über seine Wangen. »Ich bin pünktlich losgefahren. Haltepunkt Lichtwiese. Keiner raus, zwei rein, wie immer, sonntags, der letzte Zug halt.«
Er machte eine Pause.
Eine lange Pause.
»Und dann?«
Zumbill sah sie mit leerem Blick an. »Ich bin an der Station ›Lichtwiese‹ um 22.51 Uhr weggefahren. Hab ganz normal beschleunigt. Hab dann auf Fernlicht geschaltet, während ich einen Schluck Kaffee getrunken hab. Und als ich sie sah, da war alles schon zu spät. Hatte schon über fünfzig Stundenkilometer drauf – kaum Fahrgäste als Ballast, und der Itino beschleunigt wirklich gut.«
»Itino?«
»So heißen die Triebwagen hier.«
Margot war auch schon mit den modernen und schicken Triebwagen gefahren. Die waren deutlich komfortabler als die durchgesessenen Kunstledersitze in den ehemaligen silbernen Nahverkehrszugwagen. Margot erinnerte sich auch noch an die Dampfloks, die bis 1970 auf der Strecke gefahren waren. Als kleines Mädchen hatte sie immer vor Furcht und Vergnügen gekreischt, wenn sie mit ihrem Vater auf der Fußgängerbrücke am Traisaer Hüttchen gestanden hatte und vom Rauch und Dampf der zischenden Loks eingehüllt worden war.
»Scheiße. Hätte ich doch bloß den Kaffee nicht …« Wieder versank Zumbill in Schweigen.
»Und dann?« Margot hatte genug Einfühlungsvermögen, um zu wissen, dass dieser Mann viel Hilfe brauchen würde, um nach diesem Erlebnis wieder einigermaßen ins Leben und in den Job zurückzufinden. Wenn er Pech hatte, nur noch ins Leben. Aber da war auch noch ihr eigenes drängendes Bedürfnis: Sie wollte einfach nur noch ins Bett.
»Dann? Dann sah ich sie. Vorn auf den Gleisen. Hat sich nicht bewegt. Ich hab sofort auf den Schlagtaster für die Notbremsung gehauen. Dann kam ich zum Stehen. Dort …« Er deutete in die Richtung, in der der Zug stand. Rund zweihundert Meter Bremsweg. Zeit genug für Räder, Achsen und Fahrgestell, ihr Todeswerk zu vollstrecken.
»Sie ist also nicht vor den Zug gesprungen?«
»Nein. Sie saß da. Wartete. Ich hau auf den Schalter, schon zu spät, dann der Schlag, dann das Quietschen der Räder. Ich hab direkt die Jungs in Frankfurt angefunkt, hab gesagt, wo ich stehe, kurz hinter dem Bahnübergang Hektometer 10.3. Ich hab irgendwie funktioniert wie im Lehrbuch. ›Sehr verehrte Passagiere, wegen eines technischen Defekts können wir im Moment nicht weiterfahren. Bitte verlassen Sie den Zug nicht. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeit. Ich bitte um Ihr Verständnis.‹ Ich glaube, ich vergesse eher den Text von ›Alle meine Entchen‹ als den hier. Dann bin ich aus dem Zug. Mit Taschenlampe und Notfallkoffer. Hab den Rumpf gesehen. Ohne den Rest dran.«
Zumbill schwieg. Es gab auch nicht mehr viel zu sagen.
»Werd ich wohl nie vergessen, was? Was meinen Sie, Frau Hesgart?«
Sie war sicher nicht die geeignete Person, um auf diese Frage kompetent zu antworten.
Wieder brach Zumbill in Tränen aus.
»Danke, Herr Zumbill, ich denke, das war’s fürs Erste.« Die Zeit, da sie noch gedacht hatte, sie müsse sich um das Leid jedes Opfers persönlich kümmern, die war lange vorbei. Ihr Job war es, die bösen Jungs zu fangen. Wenn es hier überhaupt welche zu fangen gab. Sie wandte sich an einen der Schutzpolizisten. »Wo ist die Leiche?«
Der Beamte drehte sich um und deutete auf den Wagen des Bestattungsunternehmens.
Ein junger Mann saß im Fahrzeug. Die Seitentür stand auf, einen Fuß hatte der Mann auf den Schotter des Waldwegs gestellt. Er rauchte eine Zigarette. Rund um den Dreitagebart war er ziemlich blass.
»Hesgart, Kripo Darmstadt. Sie sind?«
Der Mann stieg aus dem Auto, ein schlaksiger Hüne, der Margot um gut einen Kopf überragte. In der einen Hand hielt er die Zigarette. Die andere reichte er Margot.
»Michael Stein. Mann, Mann, Mann, so was habe ich auch noch nicht gesehen. Ich meine, ist ja mein Job, mit Toten und so – aber das hier …«
»Kann ich die Leiche sehen?«
»Die Leiche – Sie sind gut. Ich kann Ihnen das zeigen, was wir gefunden haben.« Er ging um den Wagen herum.
Im Heck des Leichenwagens war eine Plastikwanne mit Deckel.
»Könnten Sie die Innenbeleuchtung einschalten?« Zwar erhellte das Flutlicht die Szenerie draußen, legte damit aber einen Schatten über das Innere des Wagens. Jetzt kam der beschissenste Teil des Jobs.
Michael Stein zog den Deckel zur Seite, und Margot konnte ins Innere sehen. Sie schaltete um auf Profi-Modus. Obwohl sie sicher war, dass sie diese Bilder noch eine Weile verfolgen würden, egal, in welchem Modus.
Die Tote hatte eine rote Jacke getragen. Margot fühlte in die Innentaschen. Nichts. Alles leer. Kein Portemonnaie. Kein Personalausweis.
Dann fasste sie in die rechte Seitentasche. Dort klimperte etwas. Sie zog einen Schlüsselbund heraus. Zwei Schlüssel, die aussahen wie ein Haustür- und ein Wohnungstürschlüssel. Dann zwei kleinere Schlüssel. Für die Kellertür und den Briefkasten? Am Ring hing noch etwas. Ein Schlüsselanhänger in Form eines Engels mit Smiley-Gesicht, zu zwei Zöpfen gebundenen Haaren und einer Kette mit Herzchenanhänger.
Sie wussten also nicht einmal, wer die Tote war. Sie war nur eine tote Frau, deren Schutzengel sie im Stich gelassen hatte.
Und Muttl hatte recht. Die Identifizierung würde nicht leicht sein. Das Gesicht würde jedenfalls nicht dazu beitragen. Aber vielleicht ein Teil des Zahnbildes.
»Okay, Sie können den Deckel wieder schließen. Danke. Fahren Sie die Leiche bitte zur Rechtsmedizin nach Frankfurt.«
»Machen wir. Wenn wir hier fertig sind.«
Margot verabschiedete sich von Michael Stein, der sich bereits die nächste Zigarette angezündet hatte.
MONTAG
Margot Hesgart hatte höchstens drei Stunden geschlafen. Dabei war es nicht nur der Selbstmord an der Strecke der Odenwaldbahn gewesen, der sie so aufgewühlt hatte. Die Rückkehr in das leere Haus hatte auch dazu beigetragen.
Es hatte zwei Stunden gedauert, bis sie endlich eingeschlafen war. Und dann sicher eine halbe Stunde, bis sie die Töne des Radioweckers dieser Welt hatte zuordnen können.
Duschen, schminken, anziehen – es war schnell gegangen, wie es immer schnell ging. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Um acht Uhr hatte sie mit einem Kaffee hinter ihrem Schreibtisch gesessen. Viele Fälle, viele ältere Fälle.
Hinrich, der Gerichtsmediziner, hatte sich noch nicht zu der Zugleiche geäußert. Natürlich nicht. Er würde ja auch jetzt erst an den Alutisch mit den sterblichen Überresten der Toten treten.
Sie klickte die Ordner des Servers an. Es gab bereits welche, in denen die Kollegen Bilder der Nacht abgelegt hatten. Auf den vom kalten Blitzlicht der Kameras erhellten Fotos wirkten die Überreste gleichzeitig viel schärfer und gleichzeitig irrealer.
Horndeich kam ins Büro.
»Na, wieder fit?«
»Hmmm«, grummelte der Kollege und ging zur Kaffeemaschine. Der erste Gang jeden Morgen.
»Was war los gestern?«
Die Maschine brummte, dann floss der Kaffee in die Tasse.
»Machst du mir auch noch einen?«
»Hmm.« Offenbar hatte auch Horndeichs Wortschatz gelitten.
Er setzte sich auf seinen Platz. »Sorry, das gestern war – es war einfach ein wenig viel.«
»Wieso? Willst du es mir erklären?«
Horndeich zögerte. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein. Im Moment nicht. Vielleicht ein andermal.«
»Gut.« Margot tat einen halben Löffel Zucker in den Kaffee. Gegen die Bitterkeit, wie sie immer zu sagen pflegte. Dann legte sie noch einen Löffel nach. Was ihrem Kollegen nicht entging.
»Kommst du am Dienstag auch zum Flughafen?«, fragte der.
»Zum Flughafen? Haben wir da eine Übung? Oder sollen wir Al Capones Urenkel festnehmen?«
Horndeich schaute seine Chefin verständnislos an. »Nein, ich meine, wenn Doro und ihr Freund abfliegen.«
»Doro? Freund? Abfliegen? Mit wem will sie wie lange wohin fliegen?«
»Äh – ich dachte, du weißt das. Sie fliegt mit ihrem Freund für zwei Wochen nach London. Hat Urlaub genommen. Ich nehme an, sie wollen sich mal die lustigen roten Doppelstockbusse anschauen.«
»Und wieso weißt du davon?«
»Na, weil sie gestern Abend Sandra gefragt hat, ob die sie zum Flughafen fährt. Hat wohl gedacht, dass das sicherer ist. Bei unserem Job weiß man ja nie, ob nicht die ein oder andere Leiche dazwischenkommt.«
»Schon gut, du musst dich nicht entschuldigen.«
»Ich will mich doch gar nicht entschuldigen. Wofür denn auch?«
»Lass gut sein.«
»Wie ist denn Doros Freund? Ich hab ihn noch gar nicht kennengelernt.«
»Na, da haben wir ja was gemeinsam«, sagte Margot. Und schüttete noch einen Löffel Zucker nach.
»Nicht so gut, euer Verhältnis gerade, was?«
Margot nahm einen Schluck. Viel zu süß, dachte sie. »Doch doch, alles bestens. Wenn ich sie anrufe, dauert es keine fünf Minuten, bis sie mich anschreit und auflegt. Um danach gleich wieder anzurufen und mir mitzuteilen, was ich ihrem Vater bitte ausrichten möge. Offenbar ist der ihr gegenüber genauso gesprächig wie …« Margot hielt inne. »Vergiss es. Meine privaten Angelegenheiten gehören nicht hierher.«
Horndeich nickte nur und kramte leicht verlegen auf seinem Schreibtisch herum.
»Wann fliegt sie denn?«, fragte Margot, die ebenfalls angefangen hatte, sinnlos Papiere von rechts nach links und wieder zurück zu räumen.
»Ich weiß es nicht genau. Früher Nachmittag. Ich sag dir noch Bescheid.«
»Wäre nett. Dann komm ich vielleicht als Überraschungsgast.«
Margot stand auf. »Bin gleich wieder da.«
Sie ging in den Toilettenraum. Stellte sich vor den Spiegel. Betrachtete ihr Spiegelbild.
»Erzähl du mir doch mal, was ich falsch mache!«, blaffte sie sich selbst an.
Das Spiegelbild blaffte synchron zurück und schwieg dann – wie sie. Dorothee war zweieinhalb Jahre zuvor in ihr Leben getreten. Ihr Sohn Ben war damals gerade ausgezogen, und sie hatte sich darauf gefreut, mit ihrem Mann Rainer endlich ein wenig entspannte Zweisamkeit genießen zu können. Doch der Göttergatte hatte Doro aus Berlin mitgebracht. Seine uneheliche Tochter, die er selbst erst ein paar Monate vorher persönlich kennengelernt hatte. Doros Mutter hatte sich beim Gardinenaufhängen das Genick gebrochen. War von der Leiter gefallen. Klang blöd, war blöd, aber bei allem Klischee leider ein Fakt. Das hieß für Doro und ihren Hund Che: zu Papa und seiner Frau. Oder ins Heim.
Margot hatte ihrem Einzug zugestimmt. Und zunächst sah es so aus, als ob sie einen guten Draht zu dem Mädchen gefunden hätte. Doro hatte eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester begonnen und war wenig später ins Schwesternwohnheim gezogen. Doch nachdem Rainer vor über einem halben Jahr entschieden hatte, vorerst in den USA zu arbeiten, hatte sich ihr Verhältnis immer weiter verschlechtert. Inzwischen wusste Margot nicht mehr, wie sie noch an Doro herankommen sollte. Sie hatte den Eindruck, egal, was sie sagte oder tat – für die junge Dame trug sie den Stempel »verkalkte Spießerin« auf der Stirn. Als sie Doro das letzte Mal zum Essen eingeladen hatte, war diese nach zehn Minuten aufgestanden und hatte das Restaurant verlassen, weil Margot erst nach dem Essen mit ihr darüber diskutieren wollte, dass in Afrika Menschen an Hunger starben.
»Gar nichts machst du falsch«, versuchte Margot nun, ihr Spiegelbild zu trösten. »Vielleicht ist es einfach nur das große Finale der Pubertät.«
Vielleicht, dachte sie. Hoffte sie. Dabei gönnte sie Doro die Reise. Würde sicher ihren Horizont erweitern. Sie würde am Dienstag auf jeden Fall zum Flughafen fahren. Schon allein, um den Freund kennenzulernen.
»Wird schon wieder«, versprach sie ihrem Spiegelbild.
Das nickte. Und Margot sah die Träne, die sich aus seinem rechten Auge stahl.
Sie wandte sich ab. Das Spiegelbild musste ohne sie weiterheulen.
Warum, verdammt noch mal, hatte sie in letzter Zeit so nah am Wasser gebaut?
Sie tupfte sich übers Gesicht, dann ging sie wieder ins Büro.
»Alles okay?«, fragte Horndeich.
»Jaja, alles paletti.«
»Gut. Denn wir müssen los. Da hat eine Frau zwei Leichen gefunden. Und es sieht nicht nach einem natürlichen Tod aus.«
Margot parkte den Wagen an der angegebenen Adresse. Die Kollegen der Spurensicherung waren bereits eingetroffen. Vor dem Gartenzaun des großen Hauses warteten zwei Kollegen der Schutzpolizei, Polizeikommissar Bernd Süllmeier und eine junge Kollegin, die Margot nicht kannte, deren Namensschild und Uniformabzeichen sie aber als Polizeikommissaranwärterin Unterreuter auswiesen. Daneben stand eine junge Frau ohne Uniform. Wahrscheinlich die Dame, die den Leichenfund gemeldet hatte.
Margot und Horndeich stiegen aus.
Süllmeier grüßte sie: »Moin, Frau Hesgart. Ich sag Ihnen …«, meinte er, dann unterdrückte er ein Aufstoßen. Dann begann er noch mal: »So was habe ich noch nicht gesehen.« Dann schwieg er.
»Guten Morgen«, grüßte Margot zurück. »Was gibt es?«
Während Süllmeier sich entschuldigend abwandte, um weiter gegen seinen rebellierenden Magen zu kämpfen, erstattete Frau Unterreuter tapfer Bericht: »Da drin sind mindestens zwei Tote. Also im ersten Raum. Einbruchspuren an der Terrassentür.«
»Männlich, weiblich? Alter? Hinweise auf die Identität?«
»Wahrscheinlich ein Mann und eine Frau«, meinte die Polizeikommissaranwärterin. »Keine Ahnung, wie alt.«
Gut, die Kollegin kam offenbar gerade von der Polizeischule. Würde noch lernen müssen, Informationen knapp und vor allem präzise weiterzugeben. Margot wandte sich nochmals an Süllmeier, in der Hoffnung, von ihm ein paar genauere Angaben zu erhalten: »Das Alter?«
Statt einer Antwort riss Süllmeier die Augen auf und hechtete in Richtung des Gebüsches neben dem angrenzenden Spielplatz. Dort übergab er sich.
PKA Unterreuter übernahm wieder: »Die liegen da schon eine Weile. Sehen nicht schön aus. Lauter Maden überall.«
Das war das Stichwort für die Dame neben Frau Unterreuter, in Tränen auszubrechen. Horndeich und Margot warfen sich einen Blick zu, dann trat Margot auf die junge Frau zu. Die war gute zwanzig Jahre jünger als sie selbst und trug das schwarze, volle Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Das weiße Kleid mit den roten Blumen, das sie trug, verbreitete eine sonnige Fröhlichkeit und stand damit im deutlichen Gegensatz zum Gemütszustand der Frau. Margot nickte Horndeich zu, und der verstand. Er würde mit der Spusi ins Haus gehen, Margot würde sich unterdessen um die Zeugin kümmern, die inzwischen an ihrer Schulter schluchzte. Zunächst tätschelte Margot ihr nur die Schulter. Nach wenigen Minuten hatte sich die Dame wieder im Griff.
»Wie heißen Sie bitte?«, fragte Margot.
Die Dame wischte sich undamenhaft die Tränen weg. Der Kajalstift zeichnete die Bewegung über der Wange nach. Margot reichte ihr ein Papiertaschentuch.
»Jasmin Selderath. Ich bin mit Regine befreundet. Wir sind Kolleginnen an der Christian-Gude-Schule.«
»Kommen Sie, setzen wir uns doch auf eine der Bänke dort«, schlug Margot vor. Das dreistöckige Haus hatte ein spitz zulaufendes Mansardendach mit holzverschindelten Giebeln. Es umfasste die beiden oberen Stockwerke – schick. Das Haus lag gegenüber der August-Buxbaum-Anlage, einem winzigen Park, der zwischen der Hauptstraße und den Häusern wie ein vergessenes überdimensionales Handtuch wirkte. Die Anlage war gut hundert Jahre alt. So alt, wie Margot sich an diesem Tag fühlte.
Jasmin Selderath und Margot ließen sich auf einer der Parkbänke nieder. Die Beamten zogen bereits Absperrband quer über die Straße. Und obwohl die Straße recht abseits lag, trafen zuverlässig die ersten Gaffer ein. Margot würde nie verstehen, was diese Menschen an herumwuselnden Beamten spannend fanden.
»Sie haben die beiden Toten gefunden?«
Frau Selderath wischte mit der Hand unter der Nase entlang, war sich dessen aber wohl nicht bewusst. Margot versorgte sie mit einem Nachschub an Taschentüchern, indem sie ihr die ganze Packung in die Hand drückte.
»Nein, ja … also …«
»Vielleicht von Anfang an«, half ihr Margot auf die Sprünge. »Regine ist Ihre Freundin und wohnt hier?«
»Ja. Genau. Sie ist die Klassenlehrerin der 3b, ich habe die 3a. Christian-Gude-Schule.«
Margot kannte die Grundschule im Martinsviertel. »Wie heißt Regine mit Nachnamen?«
»Aaner. Regine Aaner. Sie lebt mit … sie lebte …« Weiter kam sie nicht, wurde wieder von einem halbminütigen Weinkrampf geschüttelt. »Sie und ihr Mann Paul wohnen da.« Sie zeigte auf das Haus, das gerade Ziel des sogenannten Ersten Angriffs wurde. Der Plan: Spuren sichern.
»Und warum sind Sie hergekommen?«
»Weil Regine nicht zum Unterricht erschienen ist. Und auch nicht zu erreichen war. Sie wollte über die Herbstferien mit Paul in Urlaub fahren, an die Ostsee. Sie hatten in Warnemünde ein Ferienhaus – Paul liebte die Seeluft, hat Regine immer gesagt.« Das schwache Lächeln auf Jasmin Selderaths Gesicht stand in scharfem Kontrast zu den Spuren des Weinens.
»Sie wollten gleich zu Beginn der Ferien los, und sie wollten gestern zurückkommen. Aber Regine ging nicht ans Telefon, als ich vorhin angerufen habe, und ihr Handy war tot. Nicht mal die Mailbox ging an. Das fand ich seltsam. Ich hab gedacht, dass sie vielleicht Ärger mit ihrem Wagen hatten. Aber Regine hat sich in der Schule überhaupt nicht gemeldet, und das war ganz und gar nicht ihre Art. Dass sie vom Urlaub aus nicht anruft – das war normal. Aber dass sie nicht Bescheid sagt, dass sie nicht oder zu spät in die Schule kommt – da sind bei mir die Alarmglocken angegangen. Ich bin in der Pause hierhergefahren, aber niemand hat aufgemacht. Pauls Wagen stand nicht im Carport. Regines schon. Ich dachte, Paul sei schon zur Arbeit gefahren.«
»Welchen Beruf hat Paul Aaner?«
»Ihm gehört ein Autohaus; er handelt mit alten Autos.«
»Was haben Sie dann gemacht?«
»Dann bin ich um das Haus herumgegangen. Und hab gesehen, dass die Scheibe der Terrassentür eingeschlagen ist. Und mir sind diese Fliegen aufgefallen, die durch das Loch in der Scheibe rein und raus sind. Und der Geruch. Dann hab ich Ihre Kollegen gerufen.«
Sie machte eine Pause. Jetzt kam offenbar der schwierige Teil. »Ich habe vor dem Haus gewartet – und Ihre Kollegen waren nach zehn Minuten da. Ich habe sie hinters Haus begleitet. Herr Süllmeier hat durch das Loch in der Terrassentür gegriffen und die Tür von innen geöffnet. Da schlug uns der Gestank voll entgegen. Ihre beiden Kollegen sind rein und gleich wieder raus. Ich habe es nur aus den Augenwinkeln gesehen – aber da drin waren die beiden. Ich kenne mich ja nicht mit so was aus – aber ich glaube nicht, dass sie überhaupt in Urlaub gewesen sind.«
»Können Sie mir sagen, wann genau Ihre Freunde abreisen wollten?«
»Ja. Sonntag vor zwei Wochen. Wir hatten Freitag noch Schule. Und Regine wollte am Samstag in aller Ruhe packen.«
Margot schaute in ihren Kalender. Musste also der Achte gewesen sein. »Ich habe noch eine Frage. Wir müssen ganz sichergehen, dass die beiden Toten im Haus auch wirklich Regine und Paul Aaner sind. Und das ist am einfachsten über den Zahnarzt herauszufinden – wissen Sie, zu welchem Zahnarzt Ihre Freundin ging? Und vielleicht auch ihr Mann?«
»Wir haben vor Kurzem darüber gesprochen, weil ich meinen Zahnarzt gerade gewechselt habe. Ihrer hat seine Praxis in der Heidelberger Straße, ich glaube, in der Nähe der Kreuzung mit der Bessunger Straße. Ich kann mich an seinen Namen nicht mehr so richtig erinnern. Springer vielleicht.«
»Das finden wir heraus, danke. Hatten Regine oder Paul Aaner Verwandte? Geschwister, Eltern?«
»Nein, nicht dass ich wüsste. Pauls Eltern sind schon seit ein paar Jahren tot, und Regine hat nie über ihre Eltern gesprochen. Ich glaube, das Verhältnis war nicht so gut. Geschwister hatte sie keine. Regine hat mal gesagt, dass Paul noch einen Bruder hat. Andreas oder so. Ich weiß es nicht mehr genau.«
»Herzlichen Dank, Frau Selderath, Sie haben uns sehr geholfen. Wenn Sie mir bitte noch Ihre Adresse geben könnten und auch die Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können.«
Margot notierte die Adresse und eine Mobilfunknummer, dann sagte sie: »Gut, Frau Selderath, dann wird ein Kollege Sie jetzt nach Hause bringen. Wenn wir noch Fragen haben, melden wir uns bei Ihnen.«
»Ich bin mit dem Fahrrad da, danke.«
Frau Selderath verabschiedete sich, und Margot ging auf das Haus zu.
Horndeich war hundemüde, und daran hatte auch der Kaffee im Büro nicht viel geändert. Nachdem seine Tochter nach dem Zwei-Uhr-Häppchen auch noch schreiend auf das um 3.30 Uhr bestanden hatte, ebenso wie auf das um 5.45 Uhr, hatte er das Dudeln des Radioweckers eine Stunde später einfach in seine Träume eingebaut, anstatt aufzuwachen. Er träumte, er wäre in Nashville auf einem Open-Air-Festival. Carrie Underwood sang, sogar Emmylou Harris war dabei. Vielleicht sollte er in Zukunft besser einen Volksmusiksender mit Humf-tataa in seinem Radiowecker einstellen …
Horndeich ging durch das Erdgeschoss des Hauses, in dem die Toten gefunden worden waren. Die Kollegen von der Spurensicherung hatten in dem Zimmer, in dem die Leichen lagen, bereits einen schmalen Gang freigegeben, durch den er sich bewegen durfte. Er trug einen weißen Schutzanzug mit hübschen blauen Überschuhen. Nicht gerade sexy, aber effektiv, wenn es darum ging, keine eigenen Spuren am Tatort zu hinterlassen.
Während Baader, Taschke und ihr Team akribisch alle Kleinigkeiten fotografierten und dann einsammelten, verschaffte sich Horndeich zunächst einen groben Überblick. In eine Wand des Raumes war ein Tresor eingelassen. Das ihn verdeckende Gemälde – eine kitschige Sommerlandschaft – war zur Seite geklappt worden wie ein Fensterladen. Die Tresortür stand offen. Und der Tresor war leer.
Unweit des Tresors lag ein Mann auf dem Boden. Selbst auf die Entfernung von mehreren Metern konnte Horndeich noch die Bewegung der weißen Larven wahrnehmen, die diesen Mann als Heimstatt erwählt hatten. Um den Toten, der auf dem Bauch lag, war eine getrocknete Lache dunkler Flüssigkeit zu sehen. Blut. Dieser Mann war eindeutig nicht an einem Herzanfall gestorben.
In einer Ecke des Raumes, nicht weit von der Terrassentür entfernt, stand eine Sitzgarnitur. Auf einem der beiden Sofas saß eine Frau. Ihr Zustand glich der des Mannes. Dass es sich um eine Frau handelte, schloss er im Wesentlichen aus der Länge des Haars und der Bekleidung. Das Mobilteil eines Festnetz-Telefons lag auf dem Boden.
Hinrich, der Gerichtsmediziner aus Frankfurt, beugte sich gerade über die Tote. Horndeich wunderte sich, denn er hatte Hinrichs Wagen nicht vor dem Haus stehen sehen. Der Mediziner fuhr den gleichen Wagen wie er selbst, einen roten Chrysler Crossfire, den er immer unmittelbar am Absperrband eines Tatorts abstellte. Dort hatte zwar auch diesmal ein Auto mit Frankfurter Kennzeichen gestanden, aber das war ein Toyota Prius gewesen. Martin Hinrich hatte vor gut zwei Jahren sein Leben gänzlich neu sortiert. Bauch weg, mehr Muskeln, eine attraktive Freundin, die offenbar auch etwas im Kopf hatte. Erstaunlich, dass sie es mit diesem Zyniker vor dem Herrn aushielt.
»Und, können Sie schon was sagen?«, fragte er ihn.
Hinrich drehte sich um. Seine Gesichtsfarbe glich eher der weißen Tapete als dem Beigeton des Sofas, und das wollte bei ihm echt was heißen. Für gewöhnlich parierte er die typische erste Ermittlerfrage immer mit einem zynischen Spruch. Daher rechnete Horndeich auch jetzt mit einem »Definitiv tot« oder einer ähnlich geistreichen Bemerkung. Doch der Zustand der Leichen – und besonders der Geruch – schien Hinrich jede Art von Humor ausgetrieben zu haben. »Ich denke, sie ist erstochen worden. Die Fliegen haben sich nicht nur auf das Gesicht gestürzt, um ihre Eier loszuwerden, sondern sich auch hier eingenistet.«
Er deutete auf eine Stelle im Bereich des Bauches. »Da muss eine tiefe Wunde gewesen sein. Wenn auch nur wenig Blut geflossen ist. Höchstwahrscheinlich die einzige Stichwunde.«
»War sie die Todesursache?«
Hinrich erhob sich. »Was weiß ich. Das kann ich euch erst sagen, wenn ich die Tote auf meinem Tisch untersucht habe.«
»Und der Mann?«
»Der hat mehrere Stichwunden. Hier.« Hinrich deutete auf eine Stelle am Rücken. »So, wie das auf den ersten Blick aussieht, hat er die hier eingefangen, als er schon lag. Das käme dann fast einer Hinrichtung gleich. Und hier …«, er zeigte auf eine schwarze Stelle am Handgelenk, »… das dürften Abwehrspuren sein. Aber das kann ich im Moment auch nur annehmen, weil sich die Calliphoridae auf Hände und Unterarm gestürzt haben.«
»Calli-wer?«
»Das, was hier so rumfliegt. Schmeißfliegen.«
Zum wiederholten Mal dankte Horndeich seiner Tochter, dass sie ihn um das Frühstück gebracht hatte. Abgesehen von den ekligen Begleitumständen, schien das Geschehen aber immerhin ziemlich eindeutig. Horndeich zwang sich, die beiden Leichen einmal genau zu betrachten. Beide hatten eine Gemeinsamkeit – sie trugen jeweils einen Ring am rechten Ringfinger. Kein gewöhnliches Modell: Ein Teil aus Weißgold ging in einen Teil aus Gelbgold über. Horndeich kannte diese Art Ring. Als er und Sandra sich Eheringe angeschaut hatten, war ein ähnliches Modell auch in ihre engere Wahl gekommen.
Horndeich sah sich um. Im Wohnzimmerschrank aus lackiertem Kiefernholz stand ein einziges gerahmtes Bild: das Hochzeitsbild. Der Bräutigam stand hinter der Braut, hielt sie mit dem rechten Arm umfasst und hatte die Hand auf ihre gelegt. Und die Ringe schienen genau die zu sein, die die beiden Toten an den Fingern trugen. Das war es dann aber auch schon an Übereinstimmungen zwischen den beiden damals Lebenden und den Toten, wenn man mal von der Haarfarbe der Frau absah.
Margot trat auf Horndeich zu, ebenfalls im modischen Malermeister-Look mit blauen Tatzen. »Und?«, fragte sie den Kollegen, nachdem sie sich kurz umgeschaut hatte.
Horndeich deutete auf den toten Mann. »Es scheinen die Hausbewohner zu sein, Regine und Paul Aaner.« Horndeich deutete auf die Ringe und zeigte Margot das Foto.
Dann sagte er: »Da hat jemand mit dem Messer zugelangt und den Inhalt des Tresors im Auge gehabt. Hat er auch bekommen. Und den Mann trotzdem erstochen. Die Frau auch. Warum die dabei aber so ruhig auf dem Sofa sitzen geblieben ist, das gilt es noch herauszufinden.«
»Die anderen Wertgegenstände sind noch da«, stellte Margot fest und deutete einmal quer durch den Raum: Der Fernseher war sicher zweitausend Euro wert, auch die Lautsprecher schienen edel. Neben dem Sofatisch stand ein Rucksack. Horndeich ging daneben in die Hocke und öffnete ihn. Dann pfiff er leise. »Komplette Fotoausrüstung.«
Ein paar Monate vor der Geburt seiner Tochter hatte sich Horndeich eine Kamera gekauft. Und sich daher mit Qualität, Ausstattung und Preisen vertraut gemacht. Seine Wünsche und seine finanziellen Möglichkeiten hatten sich leider nicht vereinbaren lassen. Und die Canon, die er gerade in der Hand hielt, hatte damals auf seiner Wunschliste ganz oben gestanden. Die beiden Objektive kosteten dann noch mal das Doppelte.
»Keine Ahnung, warum der Dieb das dagelassen hat.«
»Der Dieb bricht also über die Terrassentür ein. Kämpft mit dem Mann. Der öffnet den Tresor. Die Frau sitzt dabei auf dem Sofa?«
Horndeich ging zu dem Tresor hinüber. »Hinrich, sind Sie sicher, dass das an den Händen Abwehrspuren sind?«
Der Mediziner wandte sich aus der Hocke heraus dem Polizisten zu: »Nein. Kann auch sein, dass er versucht hat, den Mixer zu reparieren, während der lief …«
Na, da war er doch wieder, der alte Hinrich.
Horndeich schaute sich das Gemälde an, die Tür des Tresors, dann das Drehrad für die Zahlenkombination. »Da ist kein Blut.«
»Also fand der Kampf statt, nachdem der Tresor geöffnet worden ist. Seltsam«, stellte Margot fest.
»Vielleicht schauen wir uns noch den Rest des Hauses an«, meinte Horndeich.
Die beiden machten sich auf einen Rundgang durch das Gebäude. Sie gingen vom Wohnzimmer in den großzügigen Flur. Dort standen zwei große und zwei kleine Hartschalenkoffer, je ein Set in Rot und eines in Blau. Daneben ein Kosmetikkoffer, ebenfalls in Rot.
»Na, da sind die Geschlechterrollen ja klar definiert«, schmunzelte Horndeich, als er die Koffer öffnete. Sie waren alle akkurat gepackt.
»Sieht wirklich so aus, als ob sie verreisen wollten. Wie die Freundin der Toten gesagt hat.«
»Dazu sind sie nicht mehr gekommen.«
Das Team ging weiter in die Küche. Ebenfalls ein großer Raum von sicher zwanzig Quadratmetern. Teuer, dachte Horndeich. Alle Geräte waren aus Edelstahl. Das Ambiente glich dem einer Restaurantküche. Trotz der Größe der Küche gab es nur einen kleinen erhöhten Seitentisch, an dem zwei Barhocker standen. Gemütlich geht anders, dachte Horndeich.
Die Küche unterstrich den Eindruck, dass das Paar verreisen wollte. Nichts stand herum. Im Kühlschrank befand sich kein Gemüse, nur verpackte Butter und H-Milch, alles mit einem Haltbarkeitsdatum von noch mindestens einer Woche.
Margot und Horndeich gingen in den Keller. Auch hier zeigte sich, dass die Bewohner des Hauses nicht arm gewesen waren. Schon die nagelneue Heizungsanlage zeugte von einer gut gefüllten Portokasse. Wie die Wohnräume wirkte auch der Kellerbereich sorgfältig aufgeräumt. In einem Kellerraum zogen sich Regale an der Wand entlang, in denen akkurat beschriftete Plastikboxen in Reih und Glied standen. Was Horndeich wieder einmal daran erinnerte, was er seiner Sandra versprochen hatte: Endlich mal seinen Bereich des Kellers aufzuräumen und auszumisten. Gut, dass Sandra das hier jetzt nicht sehen konnte – es würde sie sicher nachhaltig an sein Versprechen erinnern. Aber das Ehrenwort stammt noch aus der Zeit vor Stefanies Geburt. Und die oberste Priorität bei allen heimischen Aktivitäten war derzeit eindeutig: irgendwie genügend Schlaf abkriegen.
Im ersten Stock des Hauses fand sich zunächst das Schlafzimmer. Das Bett war gemacht, alles sauber und aufgeräumt. Sie öffneten die Schranktüren, sahen in die Schubfächer der Nachtschränke. Sie waren von dem Dieb offensichtlich nicht durchsucht worden.
Das Bad war großzügig ausgestattet: In der riesigen Badewanne standen zahlreiche Pflanzen. Ein Rand zeigte, dass die Wanne mit Wasser gefüllt gewesen war. Offenbar hatten die beiden niemanden darum bitten wollen, ihre Blumen zu gießen. Hinter dem Bad folgte ein Arbeitszimmer. Es war offenbar das von Regine Aaner, denn an der Wand hingen mehrere Klassenfotos von Grundschülern. Neben den Kindern stand auf den Fotos immer dieselbe Person. Die Lehrerin war nicht groß, von sehr zierlicher Statur. Das brünette, glatte Haar war auf allen Bildern zu einem Pferdeschwanz gebunden.
»Das ist sie wohl. Hübsch«, sagte Horndeich, und sofort schoss ihm das Bild von der Toten auf dem Sofa in den Kopf. Die abgesehen von der Körpergröße keinerlei Ähnlichkeit mit der Frau auf den Fotos aufwies.
Auf dem Schreibtisch mit Glasauflage stand ein Laptop, zugeklappt. Einige Kabel führten, zusammengefasst in einem Kabelbündelschlauch, zu Drucker, Steckdosen und einem externen Festplattenspeicher. Neben dem Tisch standen zwei Rolloschränke. Sie waren geöffnet, und zahlreiche Ordner darin wiesen ebenfalls auf Regine Aaners Beruf hin: Mathe, Deutsch, Basteln, Spiele (draußen), Spiele (drinnen) – alle waren akkurat beschriftet. Daneben stand noch ein Bücherregal. Horndeich überschlug: zwei Drittel Fachliteratur. Ein Drittel Belletristik. Krimis, leichtere Sachen. Zoe Beck fiel Horndeich auf. Nicht dass er momentan viel zum Lesen gekommen wäre. Aber die Autorin mochte er. Ansonsten nichts Auffälliges.
Auch das Arbeitszimmer von Paul Aaner wirkte auf den ersten Blick aufgeräumt. Das gleiche Bücherregal, in dreifacher Ausführung. Bücher über Autos, Fachzeitschriften, in Stehsammlern aufbewahrt – die Regale waren gefüllt bis auf den letzten Zentimeter.
»Hat sich offenbar für Autos interessiert«, mutmaßte Horndeich.
»Ja, er war Autohändler oder so was«, sagte Margot.
Auch hier gab es drei Rolloschränke, sie waren allerdings geschlossen. Und verschlossen, wie Margot nach kurzem Ruckeln feststellte.
»Wieso runzelst du die Stirn?«, fragte Margot ihren Kollegen, nachdem sie sich wieder erhoben hatte.
»Irgendetwas stimmt nicht.«
Margot folgte seinem Blick, der jetzt auf den Boden neben dem Schreibtisch geheftet war. »Der Computer fehlt.«
Auch hier waren die Kabel in einem Kabelbündelschlauch zusammengefasst. Aber sie führten in kein Gerät, sondern lagen auf dem Boden.
»Was meinst du? Wenn ich mir den Rest des Hauses anschaue, kann ich mir kaum vorstellen, dass Aaner die Kabel einfach so auf dem Boden herumliegen lässt.« Horndeich trat neben den Schreibtisch. »Schau, da ist ein Halter. Da hängt man den Kabelstrang ein, wenn der Computer nicht angeschlossen ist.«
Margot nickte. »Da könntest du recht haben. Also hat jemand den Computer mitgenommen.«
»Irgendwie seltsam. Der Täter rennt in den ersten Stock, klaut den Computer von Aaner, lässt den seiner Frau stehen und auch die sauteure Kameraausrüstung. Kapier ich nicht.«
»Es sei denn, der Computer ist genau das, was der Täter gesucht hat.«
»Und das Plündern des Tresors war nur Ablenkung? Das wirkt irgendwie auch nicht wirklich überzeugend.«
»Baader soll sich auf jeden Fall auch diesen Raum noch mal gründlich vornehmen.«
Das war das Signal, weiterzuziehen. Horndeich und Margot gingen in den Flur und öffneten die Tür zum letzten noch verbleibenden Raum.
Horndeich hatte mit allem gerechnet, mit einem Raum für eine Modelleisenbahn, mit einer Bibliothek, mit einem Atelier. Aber nicht mit einem komplett eingerichteten Kinderzimmer. Vom blau gestrichenen Zimmerhimmel baumelten Sterne und ein großer Mond herab. Eine Wiege stand im Raum, ein Kinderbettchen an der Wand, direkt neben einer Wickelkommode. Daneben ein Kleiderschrank. Auch der Windeleimer fehlte nicht.
»Die haben ein Kind?« Auch Margot war die Überraschung anzumerken. Horndeich öffnete den Kleiderschrank. Der Inhalt wirkte wie aus einem Geschäft für Babyausstattung. Auf den Millimeter genau waren die grünen und roten Strampler gefaltet und aufeinandergestapelt, Jäckchen, Tücher, Decken und Kissen ebenfalls exakt eingeordnet. Auf dem Boden des Schrankes standen drei Packungen Windeln für Neugeborene.
Margot schaute in die Wiege, dann in das Kinderbettchen. Auch darin waren Decken und Kissen gefaltet, wie es der Zimmerservice eines Hotels nicht akkurater hätte hinbekommen können.
»Das hat was Gruseliges«, meinte Horndeich. »Also bei uns sieht es nicht so aus. Das wirkt ja perfekter als in einem Möbelkatalog.«
»Und wo ist das Kind?«
Horndeich spürte, wie Adrenalin durch seinen Körper schoss. »Hier ist ein Kind in Gefahr!«, rief eine Stimme in seinem Inneren, wenn auch der rationale Teil seines Gehirns sagte, dass er hier kein lebendes Baby mehr finden konnte. Dennoch hechtete er ins Dachgeschoss. Er hoffte, dass ihm eine weitere grausige Enddeckung erspart bliebe. Und sein Wunsch wurde erhört: In den drei großen Räumen im obersten Stock des Hauses – zwei Gästezimmern und einem Abstellraum – fand er nichts Außergewöhnliches. Wie im ganzen Haus war alles aufgeräumt und am rechten Platz.
Margot trat hinter ihn. »Ich glaube nicht, dass hier ein Kind gelebt hat. Ist dir der Staub auf den Möbeln nicht aufgefallen?«
»Welcher Staub?«
»Im Kinderzimmer lag der Staub ziemlich hoch. So als ob länger nicht mehr geputzt worden wäre.«
»Na ja, da hat in den letzten zwei Wochen wohl auch keiner Staub gewischt.«
»Ich glaube, das Zimmer hat schon länger keiner mehr betreten.« Margot griff zum Handy, schaute in ihre Notizen und wählte die Nummer von Jasmin Selderath. Die ging nach dem zweiten Klingeln an den Apparat.
»Frau Selderath, hier ist noch mal Hesgart, Kripo Darmstadt. Ich hätte da noch eine Frage. Hatten die Aaners ein Kind?«
Horndeich konnte die Antwort nicht hören.
Margot bedankte und verabschiedete sich.
»Und?«
»Regine Aaner war schwanger, sagt die Freundin. Wohl im vierten oder fünften Monat.«
»Na, dann waren sie auf den Nachwuchs ja schon erstaunlich früh bestens eingestellt.« Doch wenn man betrachtete, wie akkurat die beiden ihr ganzes Haus in Schuss gehalten hatten, war das vielleicht gar nicht so ungewöhnlich. »Gut. Dann lass uns nach unten gehen. Vielleicht haben die Jungs ja schon was Neues rausgefunden.«
Als Horndeich und Margot wieder ins Erdgeschoss kamen, fing Baader sie sofort ab. »He, ihr beiden – ich hab da was, das überhaupt nicht ins Bild passt.«
Der Spurensicherer führte die Beamten in die Nähe der Terrassentür unweit der Stelle, an der der Tote gelegen hatte, den die Jungs vom Bestattungsinstitut dankenswerterweise bereits mitgenommen hatten. Baader deutete auf den Boden. Dort war der große Blutfleck nicht zu übersehen – ebenso die Glasscherben. »Seht ihr die Scherben?«
Horndeich zuckte nur mit den Schultern, dann sah er Baader an.
Der bückte sich und hob mit einer Pinzette ein Scherbenstück von der Größe einer Briefmarke auf.
»Und?«, fragte er.
»Mach es nicht so spannend«, nörgelte Horndeich.
Margot antwortete bereits. »Da ist kein Blut dran.«
Nun konnte auch Horndeich Baader folgen. Die Scherbe war einfach nur durchsichtig.
Baader setzte den Gedanken fort: »Wenn das Opfer getötet worden wäre, nachdem die Scheibe eingeschlagen worden ist, dann müsste Blut auf dem Glas sein. Aber auf keiner der Scherben ist auch nur der winzigste, verdammte Blutstropfen.«
»Das heißt, dass die Scheibe nach der Tat eingeschlagen wurde.«
»Ja, und zwar eine ganze Weile danach. Das Blut muss bereits getrocknet gewesen sein.«
Nun beteiligte sich auch Horndeich an den Schlussfolgerungen: »Dann hat also nicht der Mörder das Glas an der Terrassentür eingeschlagen – zumindest nicht unmittelbar vor der Tat. Und wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, gibt es keine weiteren Einbruchspuren.«
»Genau.«
»Wenn der Mörder aber nicht eingebrochen ist – dann müssen sie ihn reingelassen haben.«
»Und dann war es wahrscheinlich jemand, den sie kannten.«
»Oder der Postbote«, ergänzte Baader fachkundig. »Ich habe mit den Kollegen vom LKA gesprochen, die schicken uns einen Forensiker, der sich hier die ganzen Blutspritzer anschaut und uns dann vielleicht mehr zu dem Kampf sagen kann, der hier stattgefunden hat.«
Horndeich betrachtete die Blutspritzer an der Wand und anschließend die getrockneten Lachen auf dem Teppichboden. Was davon Blut war oder von anderen Körperflüssigkeiten herrührte, würden die Chemiker erst mühsam auseinanderpuzzeln müssen. Horndeich seufzte. Die Woche fing gar nicht gut an.
Margot war mit Horndeich wieder zum Präsidium gefahren. Der hatte sich daraufhin sofort in seinen Wagen gesetzt und war vom Parkplatz gebraust.
Früher waren sie oft zusammen einen Happen essen gegangen. Doch seit Horndeich Vater war, verbrachte er jede Mittagspause zu Hause. Das konnte Margot einerseits verstehen, andererseits fand sie es schade.
Normalerweise hätte sie sich jetzt in die Kantine gesetzt, irgendein Gericht in sich reingeschaufelt, mit einem Kaffee nachgespült und sich dann wieder an ihren Schreibtisch gesetzt. Doch an diesem Tag war ihr nach Gesellschaft beim Mittagessen. Warum, wusste sie nicht so genau. Was das Gefühl noch verstärkte. Womit es noch unangenehmer wurde, weil sie es nicht einordnen konnte. Die morgendlichen Leichenfunde? Schleichende Depression? Oder der Frust darüber, dass Doro mit Sandra ihren Urlaub mit dem Freund besprach und sie selbst weder von dem einen noch von dem anderen wusste? Bevor ihr Gehirn nur noch ein Wort mehr von der Liste der Dinge, die kein Mensch brauchte, rezitieren konnte, griff sie zum Handy.
Sie wischte sich auf dem Smartphone durch die Liste der angerufenen Nummern. Keine halbe Minute später hatte sie sich mit Jasmin Selderath zum gemeinsamen Mittagessen verabredet. Die Dame wohnte im Martinsviertel, in der Arheilger Straße, unweit des Vis à Vis, eines kleinen Suppenrestaurants. Sie würde jetzt lieber mit einer Zeugin sprechen, als allein in der Kantine zu essen. Zudem würde sie so auf dem schnellsten Weg ein wenig über das tote Ehepaar in Erfahrung bringen.
Jasmin Selderath saß bereits an einem der Tische im Freien, als Margot eintraf. Die junge Frau hatte sich bereits eine Suppe bestellt. Margot betrat das Restaurant, um zu bestellen. Die Inhaberin Alexandra, von allen nur Alex genannt, begrüßte sie: »Ah, die Frau Kommissarin. Heute ohne den Kollegen?«
»Ja«, erwiderte Margot knapp. Sie studierte die schwarze Schiefertafel, auf der die Gerichte angeschrieben waren, und entschied sich für eine Lauchsuppe mit Käse und Hackfleisch.
Dann verließ sie das Restaurant wieder und setzte sich draußen zu Jasmin Selderath an den Tisch. Alle Plätze waren besetzt – nicht ungewöhnlich um die Mittagszeit und bei dem sonnigen Wetter.
»Schön, dass Sie Zeit haben«, sagte Margot.
Jasmin Selderath nickte nur. »Sie sind sicher, dass die Toten Regine und ihr Mann sind?«
»Ja, ziemlich. Sie tragen die Eheringe am Finger. Wir lassen es uns noch vom Zahnarzt bestätigen – aber ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln.«
Jasmin Selderaths Augen waren gerötet und leicht geschwollen. Sie hatte ganz offensichtlich den Morgen über schon ein paar Tränen geweint. Doch jetzt konnte sie sich beherrschen.
Alex’ Schwester Meggie brachte die Suppen und eine Flasche Mineralwasser. Margots Zeugin hatte die gleiche Suppe wie sie bestellt.
»Essen Sie auch öfters hier?«, fragte Jasmin Selderath.
»Ab und an, vom Präsidium aus ist es ja doch etwas weiter. Und dann dauert das Parkplatzsuchen oft länger als das Suppeessen«, antwortete Margot und kam dann zur Sache: »Frau Selderath, haben Sie irgendeine Vorstellung, ob jemand Regine Aaner und ihrem Mann etwas Böses wollte? Gab es Streit, Feinde, irgendwelche Veränderungen?«
Die Antwort kam postwendend: »Nein. Nichts und niemanden.«
»Wie lange kannten Sie Frau Aaner schon?«
»Seit gut fünf Jahren. Sie kam an unsere Schule. Von Gießen aus. Hatte dort wohl private Probleme gehabt. So genau hat sie das nie erzählt. Klang sehr nach Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. Sie kannte niemanden in Darmstadt. Und wir haben uns sehr schnell angefreundet. Auch mein Mann fand sie sympathisch. Sie kam immer mal wieder zum Abendessen zu uns.«
»Und Regines Mann? War sie damals noch nicht verheiratet?«
»Nein. Ich und mein Mann waren erst etwas skeptisch, was Paul anging, weil er ja doch mehr als zehn Jahre älter war als sie. Aber Regine war richtig aufgeblüht, seit sie mit ihm zusammen war. Die Hochzeit kam schnell. Zehn Monate nachdem sie sich kennengelernt hatten, trug sie schon den Ring.«
»Und war die Ehe glücklich?«
Jasmin Selderath löffelte ihre Suppe. Und schwieg kurz. »Ja. Sie war glücklich. Und ich hatte den Eindruck, dass das echt war. Sie galten als das perfekte Paar. Er war immer um sie bemüht. Er ist ein richtiger Gentleman. Also war – bis zu seinem Tod.«
Margot sah, dass die Augen der Zeugin feucht wurden. Schnell schob sie die nächste Frage nach. »Wie war Regine als Lehrerin?«
Das Lächeln von Jasmin Selderath brachte zwei Grübchen zum Vorschein. »Die Kinder liebten sie, die Kollegen respektierten sie – und unsere Rektorin, Frau Dr. Rottenmark, nun, sie schätzte Regines fachliche Qualitäten, Regines Kompetenz, ihre Art, Dinge anzupacken und durchzuziehen.«
»Das klingt nach einem Aber.«
Das Lächeln wurde breiter. »Nun, unsere Rektorin musste immer wieder die Wogen glätten, wenn Regine gegenüber Eltern von Schülern mal ein deutliches Wort ausgesprochen hat.«
Jasmin Selderaths Lächeln erstarb.
»Sie denken an jemand Speziellen?«