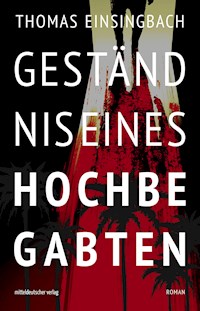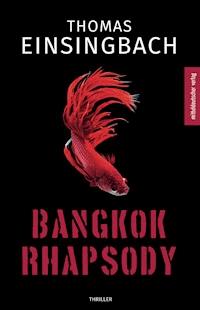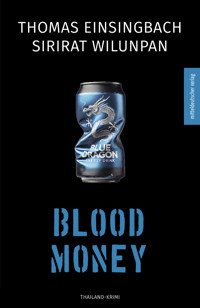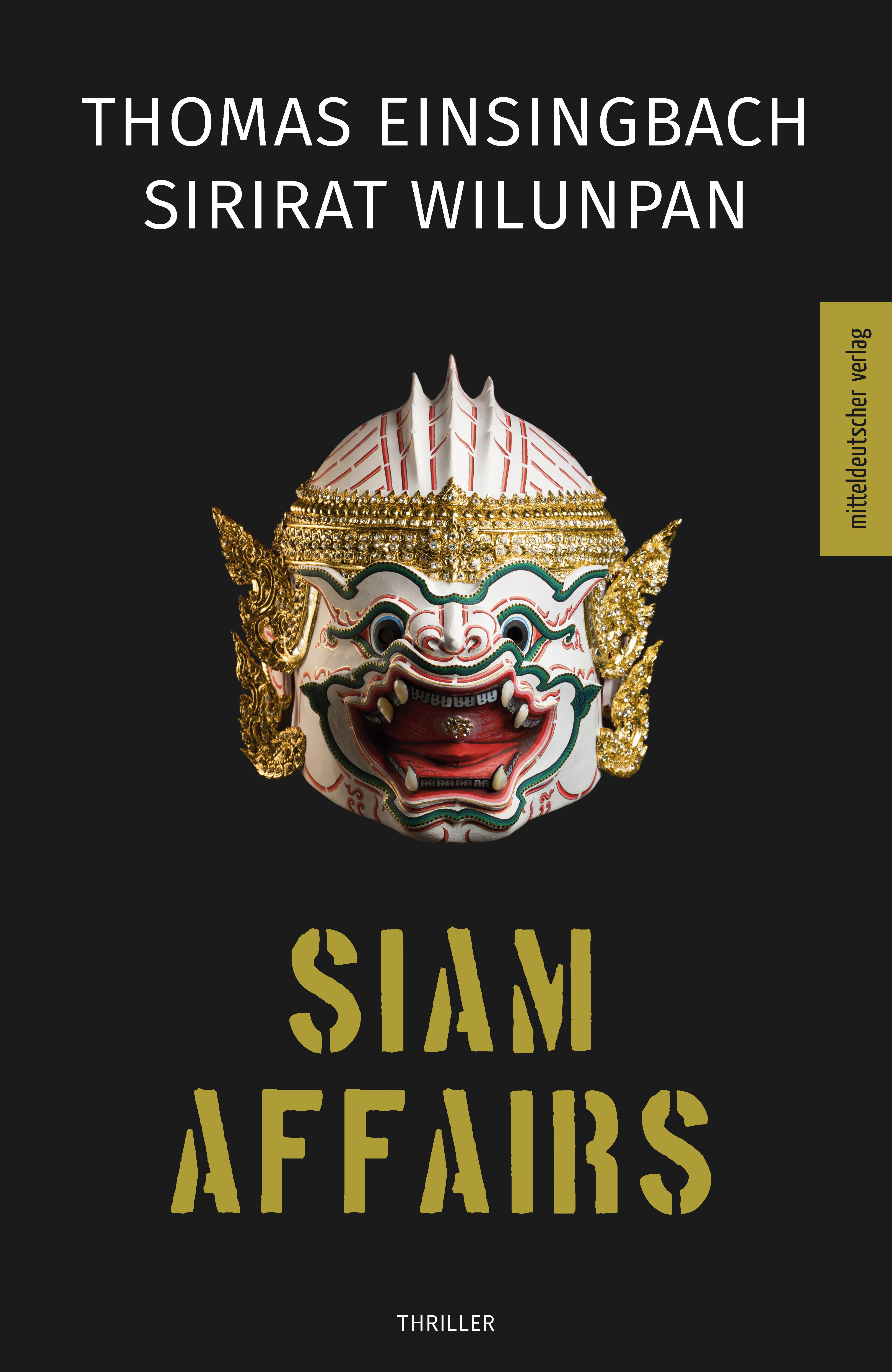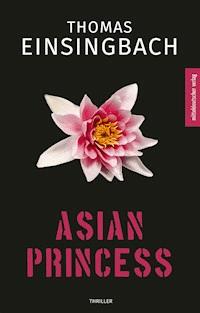
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Bankierswitwe wird in ihrer Villa im Taunus kaltblütig erdrosselt. Bei Heidelberg entdeckt man die brutal verstümmelte Leiche eines Asiaten, etwa zeitgleich wird dort das mysteriöse Verschwinden der thailändischen Gaststudentin und Milliardärstochter Suwannee festgestellt. Kurz darauf begeht ein Universitätsdekan Suizid und in einem Mannheimer Friseursalon kommt es zu einem grausamen Massaker. Was hat es mit dem Verschwinden der jungen Thailänderin auf sich – und wie hängen all diese dramatischen Ereignisse zusammen? Sein neuer Auftrag führt den Privatermittler William LaRouche von Bangkok in die Rhein-Neckar-Region, die Heimat seiner deutschstämmigen Mutter. Hier trifft er bei seinen Recherchen auf seltsame Verwandtschaft. Hat auch sie bei den Verbrechen ihre Finger im Spiel?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
THOMAS
EINSINGBACH
ASIAN PRINCESS
THRILLER
mitteldeutscher verlag
2017
© mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH, Halle (Saale)
www.mitteldeutscherverlag.de
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagabbildung: fotolia.com – Jiri Hera / Teteline
Gesamtherstellung: Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale)
ISBN 978-3-95462-968-8
E-Book-Umsetzung: Zeilenwert GmbH
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
PROLOG
Lacrimosa dies illa – Tränenreich ist jener Tag. Aus der Einsegnungshalle schwebten die Streicherstimmen des berühmten Requiems. William LaRouche beobachtete, wie eine elfenbeinfarbene Limousine den Ruländerweg zum Friedhofstor hinaufkroch. Dort angekommen, entstieg zuerst der Fahrer. Er umrundete das Fahrzeug, öffnete die Beifahrertür und bot einer Dame seine Hilfe beim Aussteigen an. Die hochgewachsene Frau trug einen dunkelbraunen Kamelhaarmantel und einen breitkrempigen Hut, dessen Schleier ihr Gesicht verbarg. Viele der Trauergäste wendeten sich ab. Nur wenige brachten den Mut für einen direkten Blick auf. Nie zuvor hatte William eine vergleichbare kollektive Bedrücktheit wahrgenommen, die noch dazu bei manchem mit einer verschämten Sensationslust verknüpft zu sein schien.
Die Menschen waren zum Katzenberg gepilgert – hinauf zum Friedhof, auf dem die Toten zu dieser frühen, schattigen Stunde nur selten in ihrer letzten Ruhe gestört wurden. Die Laubbäume zwischen den Grabreihen hatten längst ihre Blätter verloren. Pelziger Raureif ummantelte die kahlen Verästelungen und über allem lagen die Fetzen aufsteigender Dunstschwaden einer feuchtkalten Herbstnacht. Der Altweibersommer, der die Gegend in den letzten Wochen immer wieder mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen verwöhnte hatte, war Vergangenheit. Es roch nach Winter. Die Weingärten ringsum waren längst abgeerntet. Besonders der Spätburgunder versprach in diesem Jahr eine ordentliche Qualität, die ihre Liebhaber finden sollte.
Williams Blick strich über den Vorplatz der Trauerhalle,wo die in Grau und Schwarz gekleidete Gemeinde unruhig den Kies unter ihren Tritten knirschen ließ und weiße Atemwolken in den ungemütlichen Morgen des dritten Novembertages stieß. Zweifellos stand die bemerkenswerteste Beisetzung bevor, die man auf dem Katzenberg bis zu diesem Tage gesehen hatte. William konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass einige der Anwesenden das Gefühl auskosteten, Zeugen des letzten Aktes einer Verbrechensserie zu sein, die ganz Süddeutschland aufgewühlt hatte.
Nach all dem, was geschehen war, konnte auch William sich unmöglich auf die Position eines neutralen Beobachters zurückziehen. In den letzten Wochen hatte er die Bekanntschaft etlicher der Trauergäste gemacht, von denen eine Handvoll sogar verwandtschaftlich mit ihm verbunden war. Er spürte vereinzelte Blicke, die ihn halb zufällig, halb mit Vorsatz erreichten. In nicht allen erkannte er die wohlwollende Gastfreundschaft wieder, mit der er anfangs begrüßt worden war. Die Bluttaten, an deren Aufklärung er mitgewirkt hatte, würden auf ewig mit der beschaulichen Region um die älteste Universitätsstadt Deutschlands verwoben sein, die so stolz auf ihren tadellosen Ruf gewesen war.
Kamerateams bemühten sich derweil, ratlose Gesichter einzufangen, um damit die Ungeheuerlichkeit des Geschehenen zu unterstreichen. Reporter mit lässig verknoteten Schals umklammerten ihre Mikrofone und resümierten betroffen vor starren Objektiven noch einmal die schrecklichen Ereignisse.
Lacrimosa dies illa. Das eigene Kind zu Grabe zu tragen, zerreißt jeder Mutter das Herz. Für einen Moment schien die Frau mit dem Schleier zu zögern. Wäre es für alle nicht erträglicher, wenn sie umkehren würde? In diesem Moment löste sich ein anderes weibliches Wesen, deutlich kürzer an Wuchs, dunkelgrau gekleidet und mit farbenfrohen Accessoires geschmückt, aus der Menge. Sie schritt mutig auf die Vermummte zu. Die beiden Frauen umarmten sich, die kleinere strich der längeren dabei liebevoll über den Rücken. Ein kahlköpfiger, rundlicher Mann in einem halblangen Allwettermantel legte seine Hand auf die Schulter eines jungen Rollstuhlfahrers, der zu ihm aufblickte und stumm nickte. Dann bahnten sich die beiden Frauen den Weg durch das zurückweichende Menschenspalier zur Einsegnungshalle.
1
Einige Monate früher …
Es war ein lauer Spätsommerabend, viel wärmer, als es die Wettervorhersage angekündigt hatte. Und geregnet hatte es ebenso wenig. Hildegard Möller-Schwinnhoff begleitete ihre Freundinnen zur Tür. Betty, die Haushälterin, reichte den Damen ihre Sommermäntel, die allesamt in gedeckten Weißtönen gehalten und damit schwer zu unterscheiden waren. Dann wurden die Hüte und die vorsichtshalber mitgeführten Schirme verteilt. Man verabschiedete sich und versprach, in zwei Wochen wieder vollzählig zum Bridgespiel in der Villa Raabe zu erscheinen.
Nachdem die Gastgeberin ihrer Angestellten beim Aufräumen im Salon zur Hand gegangen war, fühlte sich die bald achtzig Jahre alte Witwe ein wenig schläfrig. Sie gab Betty für den Rest des Abends frei, die daraufhin freudig ihre Badesachen packte, um sich ein paar erholsame Stunden in den Taunusthermen im nahe gelegenen Bad Homburg zu gönnen, die an Samstagen erst um Mitternacht schlossen.
Hildegard Möller-Schwinnhoff zog sich in ihr Schlafzimmer in der ersten Etage zurück. Dort setzte sie sich in ihren Lieblingssessel ans Fenster. Um diese Jahreszeit, dem Übergang vom Spätsommer zum frühen Herbst, schien es die Sonne jeden Tag eiliger zu haben, der Dunkelheit das Regiment zu überlassen. Der Blick der betagten Dame streifte von der Höhenlage am Fuße des Altkönigs über die Hügellandschaft des Vordertaunus, strich über das kleine Steinbach, die Bürostadt Eschborn bis hinunter nach Frankfurt, wo die beeindruckende Skyline des Banken- und Finanzzentrums in der Abenddämmerung glitzerte.
Hildegard war ein wenig blümerant zumute. Die Roteichen und Bergulmen, die das Anwesen umgaben, schienen im Zwielicht zu verschmelzen und das Blattwerk tanzte blass verschwommen vor ihren Augen. Ihr fiel ein Eichendorff-Gedicht ein: Dämmrung will die Flügel spreiten, schaurig rühren sich die Bäume, Wolken ziehn wie schwere Träume – Was will dieses Graun bedeuten?
Wahrscheinlich der niedrige Blutdruck, überlegte sie. Oder war es der Eierlikör, dem man während des Kartenspiels in geselliger Runde zugesprochen hatte? Sie schloss die Augen und erinnerte sich an Josef, ihren verstorbenen Mann. Blümerant. Dieses Wort schien auf ewig mit Josef verknüpft zu sein. Auch er hatte sich stets blümerant gefühlt, wenn er zu tief ins Glas geschaut oder in der Sommerhitze seine Kopfbedeckung vergessen hatte. Sie war fünfzig Jahre mit diesem Mann verheiratet gewesen, ehe er dahingegangen war. Hildegard wollte nicht klagen. Sie hatte zwei anständige Söhne und es fehlte ihr an nichts. Selbst gesundheitlich war sie ihrem Alter entsprechend zufrieden. Manchmal kam es ihr unnatürlich vor, dass sie sich an keinen einzigen Streit mit Josef oder den Kindern in all den Jahrzehnten entsann. Aber so war es nun einmal gewesen. Vielleicht hatte es daran gelegen, dass im Hause Möller-Schwinnhoff grundsätzlich wenig gesprochen wurde, denn Josefs Lebens- und Hausregel lautete: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Gold hatte es auch nach seinem Tod genug gegeben. Als das Testament geöffnet wurde, war selbst Rechtsanwalt Messerschmidt, der langjährige Vertraute und beste Freund ihres Mannes, überrascht gewesen, dass Josef mehr als die Hälfte seines Millionenvermögens in Gold und Schmuck investiert hatte. Der Verschiedene gehörte einer Generation an, die Papiergeld misstraute und, obwohl er jahrelang der bedeutendsten deutschen Privatbank vorstand, im Persönlichen selbst um werthaltige Aktien und Immobilien, dem sogenannten Betongold, einen Bogen gemacht hatte.
Hildegard griff nach einer Sammlung romantischer Sonette von Heinrich Heine. Im Hirn spukt mir ein Märchen wunderfein, und in dem Märchen klingt ein feines Lied, und in dem Liede lebt und webt und blüht ein wunderschönes zartes Mägdelein. Und in dem Mägdlein wohnt ein Herzchen klein, las sie und legte das Buch beiseite. Sie schloss die Augen. Im Tresor der Villa Raabe fanden sich nach Josefs Tod Goldbarren, Schmuck, kostbare Uhren und Edelsteine. Von all dem hatte Hildegard zu Lebzeiten ihres Mannes keinen Schimmer gehabt. Einiges davon konnte sie mittlerweile verkaufen, aber das meiste war noch im Safe gebunkert. Plötzlich riss ein klirrendes Geräusch sie aus ihren Gedanken. Ihr fiel das halb gefüllte Glas Milch ein, das sie auf dem Küchentisch im Erdgeschoss hatte stehen lassen. Sicherlich war es eine der beiden jungen Katzen gewesen, die sich neugierig und ungeschickt an das Milchglas herangewagt hatte.
Als die einzige Hausangestellte die Villa verlassen hatte, war der Mann im Schutz der hereinbrechenden Nacht über die Parkmauer gestiegen und zu der Tür geschlichen, durch die man von der Küche in den Kräutergarten gelangte. Mit routinierten Handgriffen setzte er die veraltete Überwachungskamera außer Betrieb und brach das Schloss auf. Er schlüpfte in die Küche, wo sich seine Augen schnell an die Dunkelheit gewöhnten. Der Mann fluchte stumm, als er sah, wie zwei schwarz-weiß gefleckte Katzen auf den Küchentisch sprangen und kurz darauf ein Milchglas zu Boden ging, wo es zerbarst. Als daraufhin im Haus alles ruhig blieb, überprüfte er den Sitz seiner Skimaske, verstaute das Einbruchswerkzeug in seinem Rucksack und tastete nach der Waffe, die entsichert im Gürtel steckte. Er wusste genau, wohin er sich nun wenden musste. Er kannte den Grundriss der Villa und hatte sich auch mit dem Schließmechanismus des Tresors vertraut gemacht. Die Katzen, die sich nun über die verschüttete Milch hermachten, waren allerdings eine Überraschung. Der Mann stieg geräuschlos die Marmortreppe zur ersten Etage hinauf. Das Schlafzimmer mit dem Tresor befand sich am Ende des Ganges. Der Mann sah, dass die Tür nur angelehnt war und kein Licht brannte. Behutsam schob er die Tür auf und betrat den Raum.
Hildegard verfügte über einen ausgezeichneten Gehörsinn. Sie hörte einen ruhigen, kraftvollen Atem und Gummisohlen, die auf dem Fliesenboden kaum wahrnehmbar aufsetzten. Der Eindringling entnahm etwas aus seiner Tasche, es schien sich um einen Gegenstand aus Metall zu handeln. Hildegard wunderte sich, dass sie nicht die geringste Furcht verspürte.
„Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein?“, fragte sie mit ruhiger Stimme und blickte unverändert aus dem Fenster. Der Mann hielt verblüfft inne.
„Warum haben Sie nicht geläutet?“
Hildegard drehte sich nun zu ihrem unbekannten Gast und sah einen athletischen, schwarzgekleideten Mann. Sein Kopf steckte unter einer Skimaske und auf seinen Schultern lagen die Träger eines Rucksacks. Der Mann schob den Sessel samt Hildegard vom Fenster weg und packte die schmalen Handgelenke der alten Dame.
„Ich will keinen Muckser hören! Schweigen ist Gold! Schon mal gehört?“, zischte er, streifte den Rucksack ab und kniete sich vor den Kamin.
„Wenn Sie den Tresor öffnen wollen, brauchen Sie die Kombination. Es ist kein modernes Modell, aber äußerst robust. Mein Mann hat stets auf langlebige Qualität geachtet.“
Der Einbrecher schien überhört zu haben, was Hildegard gesagt hatte. Er entfernte die Verblendung der seitlichen Kaminwand, hinter der sich ein Geldschrank mit einem Vier-Scheiben-Schloss und einem mechanischen Schließzylinder befand. Aus dem Rucksack zog er einen schweren Hammer und einen Meißel.
„Junger Mann, Sie erleichtern sich die Sache und vermeiden unnötigen Lärm, wenn Sie die Kombination eingeben.“
Der Mann sah, wie die Frau vier zweistellige Zahlenkombinationen auf einen Notizzettel schrieb. Wortlos griff er nach dem Papier. Hildegard atmete flach und bemerkte erst jetzt, wie ihr Leib bebte. Natürlich war sie aufgeregt, aber noch immer hatte sie keine Angst. Wenn sie sich besonnen verhielt, würde ihr nichts geschehen. Der Mann machte einen vernünftigen Eindruck. Er war ein Räuber, aber ganz sicher kein Gewaltmensch. Kurz darauf sprang die Tresortür auf und der Mann entfaltete eine Sporttasche, die er seinem Rucksack entnahm.
„Sie können alles mitnehmen. Ich werde es nicht vermissen, bis auf eine Kleinigkeit …“
Hildegard versuchte vergeblich, Blickkontakt zu dem am Boden hockenden Eindringling herzustellen. „Hören Sie: In einer blauen Samtschatulle befindet sich eine antike Rolex. Sie hat meiner Mutter gehört. Es wäre sehr freundlich, wenn Sie mir diese Uhr lassen würden.“
Der Mann griff nach dem Behältnis, reichte es der alten Dame und widmete sich wieder dem Inhalt des Tresors. Hildegard öffnete wehmütig die Schatulle. Dieses Erinnerungsstück verband sie mit der unbeschwerten Zeit ihrer Kindheit und Jugend, in der in ihrem Elternhaus ausgiebig gelacht und herumgealbert wurde, man sich heftig stritt, um sich bald darauf wieder zu vertragen. Damals war alles ganz anders gewesen, als es später in ihrer stummen Ehe mit Josef werden sollte. Die goldene Rolex ihrer Mutter war der einzige Gegenstand in diesem schrecklichen Tresor, der für sie einen Wert darstellte. Ja, Hildegard fühlte sich sogar erleichtert, als sie den Mann dabei beobachtete, wie er sorgsam die Goldbarren und Schmuckkassetten in seine Sporttasche lud. Sie hatte aufgehört zu zittern und sah, wie ihre Katzen neugierig ins Zimmer schlichen.
Als der Mann seine Arbeit beendet hatte, richtete er sich auf. „Danke für die Kombination. Aber Sie können mir glauben, ich hätte es auch ohne Ihre Hilfe geschafft.“
„Ich glaube Ihnen. Sie werden mich vermutlich für verrückt halten, aber ich bin froh, dass ich den Tresor jetzt endlich entfernen lassen kann.“ Hildegard hob die Rolex in die Höhe und lächelte. „Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Ein Andenken an die schönste Zeit in meinem Leben.“
Der Mann schob den Sessel wieder in die angestammte Position zurück. Er stellte sich hinter die hohe Rückenlehne und sah gemeinsam mit Hildegard aus dem Fenster.
„Sie haben von hier oben einen herrlichen Blick. Sie sind zu beneiden. Aber eines wollte sich noch loswerden: Ich mag keine Katzen.“
„In der Tat, die Aussicht ist wunderbar. Dass Sie keine Katzen mögen, tut mir leid. Haben Sie eine Allergie?“ Hildegard drehte den Kopf zur Seite und suchte den Blick des Einbrechers. „Ich wünsche Ihnen viel Glück mit dem Inhalt Ihrer Sporttasche. Seien Sie doch so nett und schließen Sie beim Hinausgehen die Tür. Meine Betty kommt erst spät nach Hause. Ich habe ihr heute Abend freigegeben.“
Als das letzte Wort gesprochen war, legte sich der Metalldraht einer Garrotte um Hildegards Hals. Der Mann zog die an zwei hölzernen Griffstücken befestigte Drahtschlinge mit einem harten Ruck zu. Das scharfe Metall fraß sich in die faltige Haut. Helles Blut sickerte aus dem zerschnittenen Fleisch. Die Luftröhre verengte sich, Hildegard Möller-Schwinnhof ruderte hilflos mit den Armen, griff sich an die Kehle. Sie röchelte. Sie grunzte. Endlich verstummte sie. Blut tropfte auf ihr beigefarbenes Sommerkleid. Ihre Augäpfel schienen aus den Augenhöhlen herausquellen zu wollen. Die noch eben gütige Mimik verzerrte sich zu einer Fratze. Dann war die alte Dame tot.
Unbeirrt von all dem war eine der Katzen auf Hildegards Schoß gesprungen und schnupperte an dem blutdurchtränkten Kleiderstoff. Für einen Moment trafen sich die Blicke der Katze und des Mannes, der das Würgeisen entspannte und nach seiner Pistole griff. Eine Kugel zertrümmerte das Katzenköpfchen und der leblose Korpus rutschte klatschend zu Boden. Der Mann sah sich um. Das zweite Kätzchen war gerade dabei, sich mit schnellen Trippelschritten in den Flur zu retten. Ein Geschoss vereitelte die Flucht. Das Tier kippte zuckend auf die Seite. Aus dem aufgerissenen Leib quollen matschige Gedärme.
2
William LaRouche bestaunte mit einer Mischung aus tatsächlichem Interesse und gelangweiltem Müßiggang den Sonnenschirm, unter den man seine Strandliege geschobenen hatte. Zum Lesen war es zu warm und zum Essen noch zu früh. Der Schirm war ausschließlich aus Materialien der Kokospalme hergestellt. Palmwedel waren kunstvoll über Speichen aus Stammholz geflochten, wurden von aneinandergeknoteten Kokosfasern zusammengehalten und bildeten so eine Art Naturbaldachin. Das Ganze ruhte auf einem lotrecht montierten Ständer, für den das geölte Holz aus dem Palmenstamm verwendet worden war. William sog über einen Strohhalm die süßlich-milchige Flüssigkeit aus einer aufgeschlagenen grünen Frucht dieses Universalbaumes und wunderte sich, dass das Kokoswasser auch nach fast einer Stunde noch kühl und erfrischend durch seine Kehle rann.
Außer ihm lagen nur wenige andere Touristen auf dem privaten Strandabschnitt des gemütlichen Boutique-Hotels am Bophut Beach auf der Ferieninsel Koh Samui.
William verrieb eine Portion Sonnencreme auf der Brust. Während der Sommermonate war es ihm gelungen, sein Gewicht um zehn Pfund zu reduzieren. Er hatte sich mittlerweile daran gewöhnt, regelmäßig im New Yorker Central Park zu joggen, und sich außerdem für die Wintersaison in einem Fitnessstudio angemeldet. Schließlich war es einem Friseur, einem wahren Meister seines Fachs, gelungen, Williams ausgedünnte, blondstruppige Mähne in einen manierlichen Kurzhaarschnitt zu verwandeln. Nur das Rauchen und seine geliebte Coca-Cola hatte er sich nicht abgewöhnen können und gegen seinen hellen Hauttyp war er naturgemäß machtlos.
Man konnte eben nicht alles haben, dachte er im Stillen, als er seine krebsroten Schultern noch einmal mit der Lotion bearbeitete. Dann streckte er sich behaglich auf der Liege aus. Der Duft von gegrilltem Fisch schwebte von einer rollenden Garküche zu ihm herüber. Er beobachtete, wie hinter der Brandung, dort, wo sich die Wellen auf den Kontakt mit dem Festland vorbereiteten, zwei Speedboote um die Wette jagten. Weiter draußen machte er ein paar Fischkutter aus, die ohne wahrnehmbare Positionsveränderung auf der spiegelnden See des Golfs von Thailand schaukelten.
Für den Nachmittag waren Gewitterschauer angekündigt. Von Osten schoben sich wie bestellt regenschwere Wolkenungetüme der Küste Koh Samuis entgegen. Urgewaltig würden die Wassermassen auf die Insel herabprasseln, einer leidenschaftlichen musikalischen Eruption gleich. Und wenn nach dem Konzert der Vorhang gefallen war, stand ganz sicher einem Abendessen unter freiem Himmel nichts im Weg. William überlegte: Gedämpfter Seebarsch mit Ingwer, Frühlingszwiebeln und Knoblauch? Ein gegrilltes Thunfischsteak oder rotes Hühnercurry mit Erdnüssen und scharfem Chili? Vielleicht auch alles zusammen? Bis zum Abend war es noch eine Weile und zu dieser Jahreszeit fand sich in jedem Restaurant ein freier Tisch.
William zog seine Sonnenbrille von der hohen Stirn vor die Augen und ließ sich seinen Körper von der salzig-schwülen Brise streicheln, die von der offenen See heranwehte. Er döste vor sich hin und genoss es, für eine wunderbare Woche dem Alltag seiner Agentur für private Ermittlungen entflohen zu sein. Die Geschäfte liefen gut, er konnte nicht klagen. Sogar den Umzug seines Büros von Hoboken, New Jersey, ins East Village von Manhattan hatte er gewagt und war damit nicht schlecht gefahren. Mittlerweile arbeiteten drei Detektive und eine Sekretärin für ihn. Die Zeit, als er für ein paar mickrige Dollar Tageshonorar untreuen Ehemännern hinterhergeschlichen war, gehörte der Vergangenheit an. Vor fast genau einem Jahr war er im Auftrag des amerikanischen Justizministeriums nach Thailand gereist, um dort einen international gesuchten Folterspezialisten aufzuspüren. Dieser Einsatz hatte, trotz des tragischen Finales, seinem Leben eine Wendung gegeben und ihn zu einem Geheimtipp für komplizierte Vermisstenfälle gemacht. Ein fröhliches Gekicher ganz in der Nähe beendete Williams Tagträumerei für den Moment. Blinzelnd beobachtete er das junge Paar, das ihm schon beim Frühstück aufgefallen war. Die beiden waren offensichtlich bis über beide Ohren ineinander verliebt und damit beschäftigt, sich wechselseitig zu necken.
William zog eine Lucky Strike aus der Packung, zündete sich die Zigarette an und dachte an Penelope. War das, was vor einem Jahr zwischen ihm und der amerikanischen Juristin in Bangkok geschehen war, tatsächlich Liebe gewesen? Oder war es vielmehr eine Affäre zweier einsamer Seelen, die zur rechten Zeit aufeinandergetroffen waren, um sich gegenseitig Halt zu geben? Zumindest war nicht das eingetreten, was sich vielleicht jeder der beiden insgeheim erhofft hatte. Als Williams Auftrag beendet war, hatte sich Penelope Owens wieder auf ihre Klienten der Bangkoker Niederlassung einer New Yorker Wirtschaftskanzlei konzentriert, und auch William war in sein altes Leben nach Amerika zurückgekehrt. Immerhin hatte er dort das Verhältnis zu seiner Mutter Doris geklärt, war seelisch wieder einigermaßen in der Spur und hatte sich auch beruflich erheblich verbessert. Nicht gerade wenig für einen vorzeitig aus dem Dienst geschiedenen FBI-Agenten, dessen Leben noch vor zwölf Monaten trostlos und ohne Perspektive gewesen war.
William griff nach seiner Brieftasche, die unter dem Badetuch versteckt lag, und zog eine Fotografie heraus. Er hob die Aufnahme in weitem Abstand vor die Augen. Er konnte sich noch lebendig an den Abend erinnern, an dem dieses Foto aufgenommen worden war. Penelope und er hatten in Bangkoks Chinatown ein paar Kleinigkeiten gegessen und stundenlang geredet. Dabei hatte er eine Zigarette nach der anderen geraucht und sie etliche Flaschen Bier getrunken. Es war jene Nacht gewesen, in der William seine fast fünfzehn Jahre jüngere Landsmännin mit thailändischen Wurzeln das erste Mal geküsst hatte. Penelopes Lachen, ihre Stirnfalten, wenn sie etwas Wichtiges zu sagen hatte, der Duft ihres seidigen schwarzen Haars – das alles und noch viel mehr würde in Williams Erinnerung gegenwärtig bleiben. Aber es hätte zwischen ihnen nicht funktioniert. Für eine dauerhafte Beziehung waren sie sich einerseits zu ähnlich und andererseits zu verschieden. So lautete jedenfalls beim Abschied ihre einvernehmliche Analyse. Vielleicht war es aber auch die Unsicherheit, was geschehen würde, wenn man sich tatsächlich aufeinander einließ. Jedes Mal, wenn William das Foto betrachtete, spürte er von Neuem das Gefühlschaos, dem er damals vernünftigerweise entronnen war, indem er einen Ozean Abstand zwischen sich und Penelope gelegt hatte.
William sog den letzten Schluck aus der Kokosnuss. In Amerika ließ ihm seine Arbeit kaum Zeit für solch sentimentale Gedanken, was auch sein Gutes hatte. Auf jeden Fall war er mit Penelope in der kommenden Woche in Bangkok zu einem nostalgischen Abendessen verabredet. Anschließend würde er seinen Kurzurlaub in Thailand beenden und den Rückflug nach New York antreten. Seine Sekretärin hatte sicherheitshalber ein Flugticket ohne Umbuchungsmöglichkeit organisiert, schließlich warteten in Amerika interessante Aufträge. William zündete sich eine weitere Zigarette an und überlegte, ob Penelope sich über ein Souvenir von Koh Samui freuen würde.
3
Michael Kühnle stieg, wie an jedem Morgen, die Windungen der Silvanerstraße hinauf. Er passierte den Neubau der Winzergenossenschaft, legte am Aussichtspunkt unterhalb der Guldenburg eine erste Verschnaufpause ein und stieß einen schrillen Pfiff aus. Diabolo unterbrach daraufhin die Verfolgung einer aufgenommenen Fährte, hob den Kopf, stellte die Ohren auf und fand den Blick seines Herrchens. Dann trabte der Schäferhund den oberen Teil des Weges zurück.
„Sodele, do kumscht her un hogscht di hi.“
Die Kirchturmuhr von Sankt Michael zeigte kurz vor halb acht. Hund und Herrchen blickten einträchtig von der Anhöhe über das verschlafene Rebheim an der badischen Weinstraße. Die beiden schienen die sonntägliche Ruhe zu genießen.
„Was wolle mir denn heut Middach Feines esse? Mir hädde do noch zwee Brotwörscht un Kadoffelpannekuche“, schlug der alleinstehende Kühnle vor, als sie wenig später die Abkürzung zum Madonnenberg hinaufkletterten. Diabolo war folgsam bei Fuß geblieben und warf seinem Herrchen immer wieder einen kurzen Seitenblick zu.
„Alla hopp, dann spring mol widda!“
Michael Kühnle war viele Jahrzehnte Hauptmeister der Schutzpolizei gewesen. Als ihm nach etlichen Bandscheibenvorfällen ein Teil seines Rückgrats versteift wurde, hatte man ihm bis zu seiner Pensionierung die Leitung der Heidelberger Polizeihundestaffel übertragen. Diabolo, der sich im besten Hundealter befand, hatte ihn schließlich in den Ruhestand begleiten dürfen und Kühnle wollte den Tatendrang seines ehemaligen Diensthundes nicht durch seine eigene eingeschränkte Beweglichkeit lähmen. Und so überquerten die beiden Frühaufsteher in unterschiedlichem Tempo die mit Morgentau bedeckten Streuobstwiesen und erreichten den Höhenweg des Madonnenbergs. Ihr Ziel waren die Weingärten der südöstlichen Hanglage, über die bereits die Strahlen der aufgehenden Sonne strichen. Kühnle liebte die Jahreszeit, wenn der Sommer sich verabschiedete und der Herbst heranschlich. In wenigen Tagen würde die Hauptlese des Spätburgunders beginnen. Je näher sie den Weingärten kamen, desto deutlicher stieg ihm der fruchtig-säuerliche Duft der violettblauen Trauben in die Nase. Auch Diabolo hob die Nase und verharrte einen Moment. Dann sah Kühnle seinen Hund in einer Rebzeile verschwinden. Ein heller Pfiff durchschnitt die Stille. Ein weiterer folgte.
„Diabolo!“
Kühnle war es gewohnt, dass sein Hund, seit dieser keine dienstlichen Pflichten mehr zu erfüllen hatte, seine Freiheiten durchaus eigenwillig nutzte. Was den gutmütigen Pensionär üblicherweise nicht weiter besorgte, war mit Beginn der Weinlese eine andere Sache. Wenn sich in den Weingärten Vogelschwärme und andere Erntediebe über die Trauben hermachten, wurde der eine oder andere Winzer schon nervös. Da wurde nicht lange gefackelt und gelegentlich sogar scharf geschossen.
„Diabolo! Kumsch jetzt odder kumsch net?“
Endlich hatte auch Kühnle die steil ansteigende Rebzeile erreicht, in die sein Hund gewitscht war. Als er sich an Diabolo herangearbeitet hatte, sah er dessen Hinterteil hin und her schwingen und Hinterläufe, die sich in den feuchten Erdboden gruben. Diabolo schien in der nicht einsehbaren benachbarten Rebreihe mit etwas beschäftigt zu sein, das seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit beanspruchte. Kühnle schob das Blattwerk der Reben beiseite. Ein Schreck durchfuhr den ehemaligen Polizisten. Sein Blick fiel auf einen unbekleideten menschlichen Körper. Kühnle hatte in seinem Leben schon so manchen Toten gesehen, aber noch niemals zuvor in ein derartig entstelltes Gesicht geschaut. Tief klaffende Schnitte zogen sich von den Ohren und dem Kinn über die Nasenwurzel bis hinauf zum Haaransatz. Geronnenes Blut hatte das Antlitz in eine dunkelrote Krater- und Krustenlandschaft verwandelt, die teilweise noch von Raureif überzogen war und jede Menschenähnlichkeit verloren hatte. Das Schlimmste waren jedoch die Augenhöhlen. Man hatte dem Toten die Augäpfel herausgerissen und die Reste faseriger Nervenverbindungen und Muskelstränge hingen gespenstig aus den leeren Schädelöffnungen heraus.
Kühnle schaute sich um. Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Natürlich wusste er, wie ärgerlich es für die Kollegen der Kriminalpolizei war, wenn am Fundort einer Leiche die Aktivitäten der Entdecker möglicherweise aufschlussreiche ältere Spuren verwischten. Trotzdem konnte er seiner professionellen Neugier nicht widerstehen. Der Boden des Weinberges war rutschig und steil. Michael Kühnle suchte Halt an einem der Drahtspaliere, an denen die Rebtriebe aufgeheftet waren, und sah noch einmal durch das Blattgewirr. Nein, er hatte sich nicht getäuscht. Der schlanke, mittelgroße nackte Körper lag auf dem Rücken. Kühnle sah schmale Schultern und eine unbehaarte Brust. Als sein Blick hinab zum Geschlecht der männlichen Leiche wanderte, verspürte er einen Brechreiz. Der Penis fehlte. Nur ein blutverkrusteter Stumpf war übrig geblieben. Hatte man den Mann hier im Weinberg abgeschlachtet? War er möglicherweise bei lebendigem Leib verblutet? Kühnle wendete sich ab, zog das Mobiltelefon aus der Jacke und wählte die Nummer der Polizei.
4
William hatte sich für ein Restaurant am Jachthafen entschieden und gegrillte Riesengambas und Tom-Kha-Gai, eine mild-scharfe Kokossuppe mit Hühnerfleischeinlage, bestellt, als sein Mobiltelefon vibrierte. Er erkannte die Nummer von Penelopes Büro in Bangkok. Es war acht Uhr abends und eine Dreimannkapelle spielte den Uraltschlager „Dancing in the Dark“, wobei der schwergewichtige thailändische Sänger die Stimme Frank Sinatras verblüffend originalgetreu imitierte. William stöpselte die Ohrhörer ein und zog sich an die Bar zurück, wo der Geräuschpegel ein wenig geringer zu sein schien.
„Hallo, Penelope. Kannst du mich hören …?“
„Ja. Ich höre dich. Und ich höre Frank Sinatra. Amüsierst du dich gut?“
„Kann nicht klagen! Prima Wetter. Gutes Essen. Eiskalte Cola und ein dicker, brauner Frankie Boy singt Songs aus der Heimat.“ William versuchte seine Freude über Penelopes Anruf einigermaßen zu verbergen. „Wir sehen uns doch nächste Woche?“
„Klar! Der Termin steht. Aber ich muss vorher mit dir reden. Es ist dringend.“
Penelope wirkte konzentriert und geschäftsmäßig. William erinnerte sich, dass die Juristin gerne Beruf und Freizeit auseinanderhielt.
„In Ordnung. Ich hoffe, es stört unser Gespräch nicht zu sehr, wenn der Koh-Samui-Frankie inzwischen weitersingt. Also: Ich höre!“
„William, ich freue mich echt auf unser Wiedersehen in ein paar Tagen. Entschuldige bitte, dass ich dich in deinem Urlaub belästige, aber einer unserer Klienten hat ein Problem. Ich möchte dich um etwas bitten.“
„Mach’s nicht so spannend. Wie kann ich helfen?“
William war in entspannter Urlaubsstimmung, auf ihn wartete ein leckeres Abendessen, der Rückflug nach New York war gebucht und sein Hilfsangebot leichtfertig dahingesagt. Egal, dachte er bei sich, wenn Penelopes Anliegen eine telefonische Beratung überschritt, konnte er sich immer noch mit seinen Verpflichtungen in Amerika entschuldigen.
„William, du hast mir erzählt, dass du einigermaßen deutsch sprichst. Deine Mutter stammt doch aus Deutschland. War es nicht so?“ William entsann sich, dass er etwas in dieser Art erwähnt hatte, als sie sich in langen nächtlichen Gesprächen ihre Vergangenheit erzählt hatten.
„Ich spreche eigentlich nur mit meiner Mutter deutsch“, schränkte William ein, „aber ich denke, ich komme dabei ganz gut zurecht.“
„Das hört sich prima an“, lobte Penelope.
„Gibt es etwas zu übersetzen oder sucht einer deiner reichen Klienten einen Reiseführer für einen Trip nach good old Germany?“
„Mein Klient sucht seine Tochter. Sie studiert in Deutschland. In Heidelberg. Deine Mutter kommt doch aus Heidelberg, wenn ich nicht alles durcheinandergebracht habe?“
William musste schmunzeln. Nur Penelopes äußere Erscheinung war asiatisch. Ihre amerikanischen Adoptiveltern hatten sie als Säugling aus einem thailändischen Waisenheim adoptiert. Sie war in Washington aufgewachsen und vom Scheitel bis zur Sohle Amerikanerin. Er hatte ihr tatsächlich erzählt, dass seine Mutter aus Heidelberg stammte. Welcher Amerikaner kannte schon das verschlafene Rebheim am Rande des südlichen Odenwaldes, in dem sie wirklich aufgewachsen war.
„Es war doch Heidelberg? Nicht wahr? William, bist du noch am Apparat?“
Penelope hatte aus dem deutschen Heidelberg ein amerikanisches Haidelbörg gemacht, was William an seinen Vater erinnerte, der diesen Namen ebenso ausgesprochen hatte. „Heidelberg. Es heißt Heidelberg“, William betonte dabei das „e“ in der letzten Silbe.
„Okay. Haidelbörg“, wiederholte Penelope und begann das Problem ihres Klienten zu erläutern. William hörte zu, sein Interesse an Penelopes Ausführungen hielt sich jedoch in Grenzen. Er war vielmehr überrascht, was die mehrmalige Erwähnung von Heidelberg, einem Ort, den er noch nie besucht und von dem er keine rechte Vorstellung hatte, in ihm auslöste. Vor seinem inneren Auge tauchte unvermittelt seine Mutter auf. Doris LaRouche, geborene Klingenberger aus Rebheim bei Heidelberg, schien sich in den Momenten, in denen Penelopes Worte an ihm vorbeirauschten, in seinem Coca-Cola-Glas zu spiegeln. Er riss sich von diesem Bild los und hörte, dass Penelopes Klient seine Tochter zu einem Studienaufenthalt nach Heidelberg geschickt hatte. Bereits seit Tagen versuchte der Vater nun vergeblich seine Tochter zu erreichen. Da der Mann ausländischen Behörden grundsätzlich misstraute und zudem Zweifel an der Effizienz der deutschen Polizei in sich trug, hatte er sich an Penelope, die Niederlassungsleiterin der Goldstein-&-Schulman-Kanzlei in Bangkok, gewendet.
„Ich glaube, das ist keine große Sache. Das Mädchen ist Mitte zwanzig. Vermutlich genießt sie noch einmal in vollen Zügen ihre Freiheit, weit weg vom strengen Vater und mit großem Abstand zu den Aufgaben, die sie bei ihrer Rückkehr nach Bangkok erwarten. Mein Klient ist sehr einflussreich. Vermutlich würde in einer ähnlichen Situation in Thailand ein Anruf von ihm genügen, und die Royal Thai Police würde alles stehen und liegen lassen und sich mit Mann und Maus auf die Suche nach seiner Tochter konzentrieren“, mutmaßte Penelope. „Also, wenn du Lust auf einen gut bezahlten Abstecher in die alte Heimat deiner Mom hast …“
„Was sind das für Aufgaben, die auf das Mädchen in Bangkok warten? Wo ist der Haken an der Sache?“ In Williams Gehirnwindungen trieben erneut die drei Silben Hei-del-berg ihr Unwesen.
„Du fragst nach dem Haken? In der Tat gibt es da so etwas wie einen Haken: Mein Klient ist bereits Mitte achtzig und wenn er einmal nicht mehr lebt, wird seine Tochter das reichste Mädchen Thailands sein. Der Vater hat Sorge, dass seinem Kind etwas zugestoßen sein könnte. Der Mann ist mächtig. Natürlich hat er nicht nur Freunde. Es gibt Konkurrenten, die ihm das Leben schwer machen wollen.“
William blieb schweigsam. Vielleicht ein wenig zu lange.
„Hallo? William, bist du noch da?“
„Ja, ich bin noch da.“
Er nickte der netten Kellnerin zu, die ihm mit Gesten verständlich machte, dass sie sein Essen in der Küche warmgestellt hatte. „Ehrlich gesagt passt ein solcher Auftrag überhaupt nicht in mein Programm. Ich bin Anfang kommender Woche wieder in New York und habe dort einiges zu tun. Andererseits …“, William zögerte, „Deutschland, Heidelberg … das hört sich interessant an. Gib mir eine Nacht zum Überlegen. Ich melde mich morgen Vormittag bei dir.“
5
Claudia Bächle-Malvert, die Leiterin des Dezernats für Kapitaldelikte, und ihr Stellvertreter Malte Brettschneider waren aus Heidelberg, dem ausgelagerten Standort ihrer Abteilung, im Mannheimer Polizeipräsidium erschienen und betraten einen Konferenzraum, in dem noch die feuchtklamme Luft der vergangenen Nacht hing. Obwohl es tagsüber noch überwiegend freundlich und sonnig war, wurde es in den Nächten schon empfindlich kühl und der erste Nachtfrost schien nicht mehr fern.
Die Kriminalrätin zögerte, ihren Mantel und die Mütze abzulegen. Der Hausmeister hatte erst vor wenigen Minuten die angekippten Fenster geschlossen und die Heizkörper aufgedreht. Immerhin standen schon zwei Thermoskannen Kaffee, Pappbecher und mehrere Schalen mit Gebäck auf dem Besprechungstisch. Auch die Pressemappen lagen in ausreichender Menge bereit. Claudia schenkte sich einen Kaffee ein, der tiefschwarz dampfte und nur kleine Schlucke zuließ. Dann erst schälte sie sich aus ihrem Loden- und Strick-Outfit und ihre üppigen weiblichen Rundungen kamen deutlicher zum Vorschein.
„Scheißherbst. Tut meinem Bein gar nicht gut“, beschwerte sie sich, fuhr sich mit den Fingern durch ihre brünette Kurzhaarfrisur und frischte mit einem Fettstift den Schutz ihrer zu dieser Jahreszeit stets zu trockenen Lippen auf.
„Es ist bald Winter, dann geht’s dir wieder besser“, versuchte Malte seine Chefin aufzumuntern. In Kürze war die traditionelle Statistik-Pressekonferenz angesetzt, auf der die Anzahl der unterschiedlichen Delikte und Verbrechen des Vorjahres sowie deren Aufklärungsquoten der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Auch wenn noch kein einziger Journalist erschienen war, hörte Claudia schon jetzt die süffisanten Fragen, weshalb die Ergebnisse für den mittlerweile weit zurückliegenden Berichtszeitraum mit einer derartigen Verspätung bekannt gegeben wurden. Sollte sie das übliche Lamento der Überlastung des öffentlichen Dienstes anstimmen, was diesmal in der Tat mehr als berechtigt war? Mitarbeiter sämtlicher Polizeidienststellen waren seit Monaten in die Registrierung der Flüchtlingsströme aus dem mittleren Osten und aus Afrika eingebunden. Zehntausende von Überstunden hatten sich aufgetürmt. Zunehmend meldeten sich Kollegen wegen Erschöpfung dienstunfähig, selbst Polizeidirektor Kachelmann hatte es erwischt. Mit kaum hörbarer Stimme hatte der Behördenchef Claudia zu nachtschlafender Zeit mitgeteilt, dass er selbst unmöglich die Pressekonferenz leiten könne und sie sich, in ihrer Funktion als seine zweite Stellvertreterin, stattdessen mit den Medienvertretern herumschlagen dürfe.
Claudia fühlte sich ausgelaugt. Sie plagten Phantomschmerzen, gegen die es kaum wirksame Medikamente gab, und die Prothese hatte ihren Unterschenkelstumpf wundgescheuert. An ihrem ursprünglich freien Wochenende war sie am Sonntagmorgen in den kleinen Ort Rebheim geeilt, wo eine Leiche gefunden worden war. Es war das erste vollendete Kapitalverbrechen des laufenden Jahres im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Mannheim. Die Spurensicherung vor Ort, die Zusammenstellung einer Sonderkommision, die Auswertung der ersten Erkenntnisse und die Kontaktaufnahme zur Gerichtsmedizin – das alles hatte sich bis weit in die Nacht zum Montag hingezogen und nur drei unruhige Stunden Schlaf ermöglicht.
„Wir gehen folgendermaßen vor.“ Claudia wandte sich müde an ihren Kollegen. „Du erläuterst die Statistik der Kapitalverbrechen. Hier gibt es immerhin Erfreuliches zu vermelden. Bei den Wohnungseinbrüchen, den Verkehrsdelikten und den Sexualstraftaten fassen wir uns kurz und verweisen auf die Pressemappe. Bei Detailfragen sollen sich die Herrschaften an Kachelmanns Büro wenden. Ich denke, in einer halben Stunde haben wir die Meute wieder aus dem Saal.“
„Was ist, wenn der Rebheimer Mord ein Thema wird?“ Malte hatte am Sonntag den Pokalsieg der Fußballmannschaft seines Sohnes gefeiert und war erst in den Abendstunden zur Sonderkommission, der man den Namen „SK Madonnenberg“ gegeben hatte, gestoßen.
„Du meine Güte! Die Leiche wurde doch gerade erst entdeckt. Da gibt’s noch nichts zu berichten.“
„Die Meldung kam heute früh schon im Radio. Der Moderator hat’s dramatisch gemacht: ‚Bestialischer Mord im Weinberg.‘“
„Woher wissen die, dass es ein Mord und der Tatort ein Weinberg war?“, fragte Claudia verärgert. „Sei’s drum! Sie haben erfahren, dass es eine Leiche gibt, und spekulieren nun herum, obwohl sie keine Ahnung haben. Wenn’s denn sein muss! Du hältst dich in dieser Sache zurück und lässt mich reden.“
Claudia wollte eigentlich noch anfügen, dass sie gerade heute große Lust verspürte, den Medienleuten einmal ihre Meinung zu deren vorschnellen und unverantwortlichen Vermutungen vorzutragen, als sich die Tür öffnete und ein Polizeibeamter in Uniform eintrat.
„Kriminalrätin Bächle-Malvert? Entschuldigen Sie meine Verspätung. Mein Name ist Klingenberger. Sie hatten mich für acht Uhr bestellt.“
„Ah, Sie sind also Polizeimeister Klingenberger, der Leiter des Polizeipostens von Rebheim. Guten Morgen.“
„Kommissarischer Leiter, Frau Kriminalrätin. Ich habe die Leitung des Postens bis auf Weiteres vertretungsweise übernommen. Eine Entscheidung über die Nachfolge von Polizeihauptmeister Lorenz ist noch nicht gefallen“, korrigierte der Beamte. Claudia reichte ihm die Hand und musterte den jungen Polizisten.
„Wie alt sind Sie?“
„Sechsundzwanzig.“
„Herr Klingenberger, Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Die Absperrung des Tatortes und das Protokoll der Aussage des ehemaligen Kollegen Kühnle, der die Leiche entdeckt hat, waren vorbildlich“, lobte Claudia und fuhr fort: „Ich möchte Sie bitten, dass Sie an der Pressekonferenz teilnehmen. Es könnte sein, dass die Rebheimer Leiche schon jetzt ein Thema für die Medien ist. Vielleicht ist es nötig, mit ein paar objektiven Information den wilden Spekulationen …“
„Es kam heute früh schon im Radio“, unterbrach Klingenberger. „Ich verstehe nicht, warum die Medien nicht begreifen, dass sie mit dieser Art der Berichterstattung die Arbeit der Polizei nicht einfacher machen.“
„Da haben Sie verdammt noch mal recht“, stimmte Claudia zu und setzte zu einem schrägen Vergleich an: „Diese Pressegeier stürzen sich auf jedes ungelegte Ei, in dem sie eine Sensation vermuten.“
„Eine Leiche ist schon ein wenig mehr als ein ungelegtes Ei“, korrigierte Malte seine Chefin, als endlich die ersten Journalisten mit zehn Minuten Verspätung den Raum betraten.
„Meine Dame, meine Herren. Bitte nehmen Sie Platz und bedienen Sie sich. Das Polizeipräsidium scheut keine Kosten und Mühen und spendiert Ihnen zur Feier des Tages echten Bohnenkaffee und Selbstgebackenes“, begrüßte Claudia ihre Gäste, unter denen sie nur ein weibliches Wesen entdeckte. Die junge Frau mit neugierigen Augen und blonden Zöpfen wurde von einem Mann etwa gleichen Alters begleitet, der eine Kamera auf der Schulter trug. Claudia war überrascht. Das erste Mal seit Einführung der öffentlichen Bekanntgabe der Kriminalstatistik beehrte eine Abordnung des privaten Fernsehsenders Badenia-TV die Veranstaltung.
Als alle ihre Plätze gefunden hatten und die Pressemappen verteilt waren, begann Hauptkommissar Malte Brettschneider mit seinem Vortrag. In einer monotonen, einschläfernden Stimmlage verwies er auf den erfreulichen Rückgang der Gewaltkriminalität und hob die beruhigende Entwicklung im Bereich der Kapitalverbrechen hervor. Im Vorjahr hatte es in den Landkreisen zwischen Rhein und Neckar und in den Großstädten Mannheim und Heidelberg, einem Gebiet in dem immerhin eine Million Menschen beheimatet waren, lediglich zwei vollendete Tötungsdelikte und fünf Fälle von versuchtem Mord gegeben. Die Aufklärungsquote betrug einhundert Prozent. Die Täter saßen bereits hinter Schloss und Riegel.
„Die Bürger der Rhein-Neckar-Region können sich sicher fühlen und stolz auf ihre Polizei sein.“ Malte beendete seinen Vortrag und blickte zufrieden in den Kreis der Zuhörer. Statt eines dankbaren Beifalls erntete er eher gelangweilte Blicke. In Claudia keimte der Verdacht, dass es nicht der Pulverkaffee und die Discounter-Kekse, sondern ein ganz anderes Interesse war, das die erstaunlich umfangreiche Herde ins Polizeipräsidium getrieben hatte.
„Meine verehrten Vertreter der regionalen Medien. Sollten Ihnen die Ergebnisse unserer erfolgreichen Polizeiarbeit zu öde und zu wenig schlagzeilenträchtig erscheinen, könnten Sie Ihre Kundschaft möglicherweise durch Vergleichswerte ein wenig aufmuntern: Im ähnlich großen Stuttgarter Raum wurden im selben Zeitraum dreiundzwanzig Morde und Tötungsversuche verübt.“ Endlich kratzten die ersten Stifte über die Notizblöcke und die Kriminalrätin legte nach: „Und wem das nicht genügt, dem empfehle ich, bei jeweils vergleichbaren Einwohnerzahlen, die Partymetropole Kingston auf Jamaika, hier fielen fast fünfhundert Menschen einem vollendeten Kapitalverbrechen zum Opfer. Oder wie wär’s mit dem Urlaubsparadies Acapulco mit eintausendneunundzwanzig Mordfällen, im Durchschnitt fast drei an jedem gottverdammten Tag eines Jahres. Das sind doch wahre Paradiese für Sensationsreporter. Kein Mensch hindert Sie daran, sich dorthin versetzen zu lassen.“
Kaum war die zynische Zahlenparade verklungen, meldete sich die blonde Mitarbeiterin von Badenia-TV zu Wort und ihr Begleiter schaltete seine Kamera ein. „Frau Kriminalrätin, der Vortrag über die bemerkenswerte Arbeit unserer Polizei war nett, handelt aber von längst Vergangenem. Was zählt, ist die Gegenwart.“ Ein kühles Lächeln traf Claudia.
„Was können Sie uns über den Mord auf dem Rebheimer Madonnenberg berichten? Ist es wahr, dass der Mann asiatischer Herkunft ist? Handelt es sich womöglich um einen asylsuchenden Flüchtling? Was folgern Sie aus der Tatsache, dass die Leiche splitternackt aufgefunden wurde? Könnte das Verbrechen einen fremdenfeindlichen Hintergrund haben?“
Claudia schwante Unerfreuliches. Ganz bestimmt würde der mysteriöse Leichenfund schon sehr bald auch die Bluthunde überregionaler Medien anlocken. Das provozierende Auftreten der Badenia-TV-Reporterin war ein Vorgeschmack auf das Kommende. Claudias Blick traf Polizeimeister Klingenberger, der die Pressekonferenz bis hierher konzentriert verfolgt hatte. Seine Uniform saß perfekt, immer wieder ließ er seine weißen Zahnreihen aufblitzen und trotz seiner Zurückhaltung umgab ihn eine charmante Selbstsicherheit. Alles in allem wirkte der junge Schutzpolizist eher wie ein medienerprobter, gut erzogener Fußballprofi, der jede noch so aufdringliche oder dämliche Journalistenfrage souverän wegzulächeln vermochte. Vielleicht wäre es kein schlechter Schachzug, Klingenberger, der zudem ein guter Polizist zu sein schien, vorübergehend als eine Art Pressesprecher der Sonderkommision Madonnenberg zu verwenden. Claudia war aufgefallen, wie nicht nur die forsche Fernsehreporterin den telegenen Kollegen wohlwollend taxiert hatte.
„Sie haben Glück, dass ich heute in guter Laune bin“, begann Claudia mürrisch. Sie wusste, wie unvorteilhaft ihr Äußeres auf Fotos oder in bewegten Bildern wirken konnte, und gab sich erst gar keine Mühe, freundlich zu erscheinen. „Wenn Sie keine Fragen zum Vortrag von Hauptkommissar Brettschneider haben, gebe ich Ihnen ein erstes Statement zum Stand der Ermittlungen im Zusammenhang mit dem erwähnten Leichenfund. Nach meiner Erklärung ist die Pressekonferenz beendet. Sie gehen dann zum Frühstück in Ihre Redaktionen und wir können uns endlich wieder der Aufklärung von Verbrechen zuwenden.“
Ein aufgeregtes Murmeln ging durch die Reihen. Die schreibenden Journalisten setzten die Sprachaufnahmefunktion ihrer Mobiltelefone in Gang. Der Kameramann nahm Claudia Bächle-Malvert ins Visier, die grimmig ins Objektiv starrte und das Wenige wiederholte, was sich unter den Journalisten sowieso schon wie ein Lauffeuer verbreitet hatte.
6
„Bitte folgen Sie mir!“
Arusa Pisuphans Privatsekretär öffnete die zweiflügelige Tür zu einem großzügigen Empfangszimmer. „Direktor Pisuphan wird Ihnen in wenigen Minuten zur Verfügung stehen. Nehmen Sie bitte Platz. Darf ich Ihnen etwas anbieten?“
„Danke. Im Moment nicht.“
„Wie Sie wünschen.“ Der Sekretär verbeugte sich und verließ nahezu geräuschlos den Raum.
William blickte sich um. Der Salon war mit antikem chinesischen Mobiliar eingerichtet. Das meiste davon stammte aus der späten Qing-Dynastie des 19. Jahrhunderts. William kannte sich ein wenig aus, er hatte während seiner Zeit als FBI-Agent hier in Bangkok selbst einige Antiquitäten erworben. Die Wände zierten kostbare Seidentapeten. Schwere dunkelrote Samtvorhänge verhinderten den Einfall von Tageslicht und dämpften zugleich die hektischen Geräusche der Außenwelt. Der hohe Raum wurde angenehm von indirektem Licht beleuchtet. Einzelne Punktstrahler hoben wertvolle Porzellanvasen und Rollbilder mit Darstellungen aus der Zeit des kaiserlichen Chinas hervor.
Penelope hatte erwähnt, dass Arusa Pisuphan der chinesischen Minderheit Thailands angehörte, die sich trotz erfolgreicher Assimilierung überwiegend den Werten und Traditionen des Konfuzianismus verpflichtet fühlte. Wie die meisten Thai-Chinesen hatte Pisuphan seinen ursprünglichen chinesischen Familiennamen abgelegt und stattdessen einen thailändischen angenommen. Nachdem William eine Weile herumgewandert war und die Einrichtung bewundert hatte, setzte er sich in einen der Sessel aus schwarz gefärbtem Birnbaumholz, die sich um einen halbhohen Lacktisch mit Perlmuttintarsien gruppierten.
Die Klimaanlage summte dezent und William entdeckte zwei unscheinbare Überwachungskameras, die jeden Winkel des Raumes erfassten. Ließ ihn sein Gesprächspartner womöglich absichtlich warten und dabei beobachten? Offenbar war die Sache doch nicht so eilig, wie Penelope es ihm in ihrem letzten Telefonat weiszumachen versucht hatte.
William hatte seinen Erholungsurlaub auf Koh Samui zwei Tage früher als geplant beendet und war nach Bangkok geeilt, wo ihn Penelope am Flughafen in Empfang nahm. Nach einer zunächst warmherzigen Begrüßung konnte die vielbeschäftigte Juristin nur schlecht verbergen, wie sehr sie unter Zeitdruck stand. Als sie Williams Ernüchterung spürte, verschob sie kurzerhand den Nachfolgetermin und lud ihn zu einem Kaffee ein, bei dem sich ihre Angespanntheit nur unwesentlich verlor. Obwohl Penelopes Lächeln, wie damals vor einem Jahr, immer wieder aufblitzte und sie sich mehrmals auf die gewohnte vertraute Weise berührten, empfand William eine Distanz, die ihn auf schmerzliche Weise erkennen ließ, dass der Zauber ihrer Beziehung verflogen war. Während Penelope im Telegrammstil noch einmal die wichtigsten Informationen zum Auftragsangebot ihres Klienten vortrug, nippte William an seinem Getränk und hing ganz anderen Gedanken nach. War es eigentlich zwangsläufig, dass selbst einer von ganzem Herzen empfundenen Seelenverwandtschaft eine Art Verfallsdatum innewohnte, das umso näher rückte, je kleiner die Schnittmenge des gemeinsam erlebten Alltags wurde?