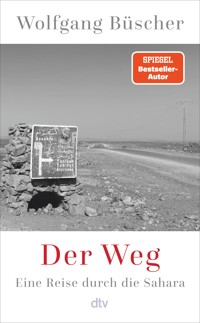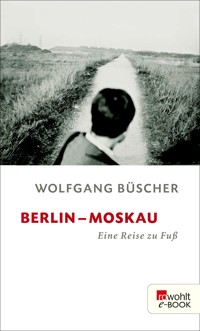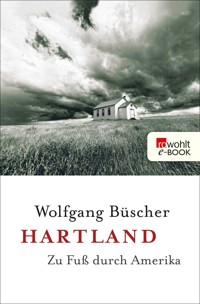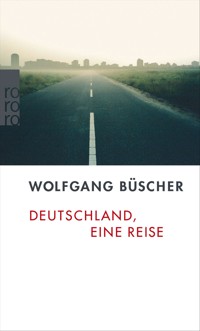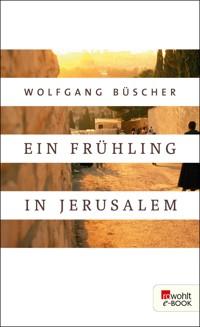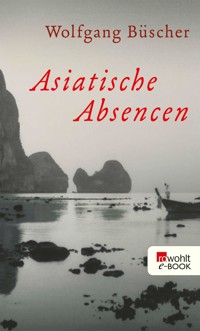
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unter fremden Göttern In Indien will ihn ein Yogapriester rekrutieren, mit nepalesischen Schamanen besteigt er deren heiligen Berg, auf einem Öltanker im Indischen Ozean freundet er sich mit einem Seemann an, der ständig Kricket übt, aber nie mehr an Land will. Es sind Geschichten dieser Art, die Wolfgang Büscher von seinen Asienreisen mitgebracht hat. Er erzählt sie auf melodiös-sinnliche Weise, auf den literarischen Spuren von Rudyard Kipling und Joseph Conrad. «Schönere literarische Reiseberichte werden Sie in der Gegenwartsliteratur nicht finden.» (Deutschlandfunk) «Seit Jahren hat niemand in Deutschland solche Prosa geschrieben.» (Werner Herzog)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Wolfgang Büscher
Asiatische Absencen
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Ein Nachmittag in Indien
Der Kricketspieler
Mekong Mama
Unter Schamanen
Der Gott von Roppongi
Shangri-La
Für Anni
Ein Nachmittag in Indien
Nun endlich nichts mehr. Nur die Schreie der Papageien durch die offene Tür, wie von sehr fern – dieses Zimmer, die staubige Stille darin, die Pritsche, auf der ich lag. Wie lange schon? Wie spät war es wohl? Würden die Gefährten Wort halten und wiederkommen? Fragen, die verglühten.
Ich mochte das Fieber. Ich hatte es schon als Junge gemocht. Tage allein im Haus. Der Gang der Uhr unten im Eßzimmer, ein Schaben unter den Dielen, und wie es arbeitete im Gebälk, in den Mauern – wie Zähneknirschen im Schlaf. Es war Herbst geworden. Sturmgarben peitschten das Haus, ich aber lag im Fieber geborgen und lauschte dem Regen und kroch tiefer in das Buch, das man mir gegeben hatte, um den Tag zu bestehen, ein indisches Abenteuer. Im Schutz der Nacht floh ein Landsmann vom Schiff seines tyrannischen Kapitäns, ein deutscher Schiffsjunge in Kalkutta. Eine indische Gauklertruppe las ihn auf, geführt von einem schlauen, geldgierigen Zwerg, dem nicht zu trauen war. Doch der Elefantenführer wurde sein Freund. Fürs erste war der Junge gerettet – waren wir gerettet, denn ich war längst dabei und folgte ihm tief ins Land, ins Fremdeste vom Fremden. Was ein unbestimmt mulmiges Gefühl gewesen war, zog sich nun zu wie eine Schlinge. Der Zwerg diente einem geheimen Kult, einem, der Opfer verlangte, richtige aus Fleisch und Blut, nicht bloß Rupien und Reiskörner. Noch einmal glückte die Flucht, mit Hilfe des Elefantenführers, doch unser Retter blieb tödlich verwundet zurück. Ich glühte, als meine Mutter mich fand, die Hand auf der letzten Seite, den Namen des sterbenden Mahut flüsternd. Das indische Fieber, hörte ich unseren Hausarzt sagen. In jungen Jahren war er Schiffsarzt in der Südsee gewesen, nun beugte er sich über mich, sonderbar lächelnd, kühlte mir die Stirn und fühlte meinen Puls. «Schlaf jetzt, Junge, schlaf es weg.»
Ich richtete mich auf und sah mich im Zimmer um – so deutlich hatte ich das Murmeln gehört, als säße der alte Hausarzt hier bei mir auf der Pritsche. Das konnte nicht sein. Hier war Indien, und der Doktor war lange tot. Wo aber war meine Armbanduhr? Nicht am Arm, in Reichweite abgelegt auch nicht. Fort also. Unterwegs verloren, auf irgendeiner staubigen Piste oder in einer Ritze des Jeeps. Der Jeep – darin hatten die Gefährten mich hergebracht, als das Fieber gekommen war, und gleich, gleich würde ich mich auf alles besinnen, auf lauter Details der Reise, fände ich nur erst die Armbanduhr. Welche Stunde? Wann holen sie mich hier heraus? Schlaf, weißer Mann, schlaf. Affen hüten deinen Schlaf, Affen und Papageien.
Irgendwann, ich war eingedöst, aufgewacht, wieder eingedöst, lag das Zimmer in fahlerem Licht, die Dinge warfen schwächere Schatten, eine letzte Spur des vergehenden Tages fiel durch die Tür. Die Stunde der Geckos, dachte ich. Doch zuerst kroch ein Name hervor, ein schöner, ja eleganter Name, von einer seiner dunklen Silben zur anderen federnd – Jodhpur.
Von Jodhpur waren wir gekommen – der Fotograf, der Bilder von Indien suchte, ein indischer Freund, der uns fuhr, ein älterer, beinah zwergenhaft kleiner Mann, auf dessen Visitenkarte «Professor» stand und der für uns übersetzte, und ich, das Notizbuch auf dem Schoß. Wir hatten keinen besonderen Plan, nur die Idee, von Norden nach Süden zu fahren, in ein Land voller Götter. Ihnen auszuweichen war unmöglich, die Luft war erfüllt von Opferrauch und Devotion; ein indischer Atemzug enthielt mehr Religion als ein ganzer deutscher Advent. Ich sog es ein und konnte die Augen nicht losreißen vom Rajput am Wege, vom grundlosen Stolz des Mannes aus der Kriegerkaste, Silberreifen an den nackten Füßen. Und von der dürren Alten. Es war Abend, sie hatte Buschwerk für ihre Tiere geschnitten. Aufrecht stand sie da, die gespreizten Zehen im Staub, dunkel um die Augen, die Arme dünner als der Stiel ihrer Sichel, auf den sie sich stützte wie ein Jäger auf den Speer. Ich bemerkte ihr hohes Alter und fragte, was sie sich noch wünsche im Leben. Sie sah mich an mit einem Blick, in dem Verwunderung lag, auch Spott. «Hari Bhavan!» sagte sie, Gottes Haus. Ihre Augen jubelten. Bald wird er mich rufen aus diesem Körper, diesem Staub, endlich zu ihm. Der Krieger und die Alte, sie leuchteten, sie schienen etwas zu sehen, das sie geringachten ließ, was unsereinem groß vorkam oder unerträglich.
Und dann, wir steckten fest im Gewühl einer Stadt, erblickte ich den Gott in der Gosse. Wie ein Fluch lag die Hitze auf allem, und ich wurde unruhig auf dem Rücksitz des Jeeps, betäubt von Abgasen und Gerüchen. Es ging nicht voran. Alles drängte, hupte, gab Gas. Alles stand. Ich stieß die Tür auf und bewegte sie hin und her als Fächer, so heftig ich konnte, um ein wenig Wind zu machen, und da, wir waren ein paar Meter weitergerollt, erschien Ganesh im Türrahmen, der elefantenköpfige kleine Gott. Nicht größer als meine Faust war er und saß in der Falte zweier Wurzelpranken eines gewaltigen Straßenbaums, dort hinein hatte man ihm sein ebenso puppenhaftes Tempelchen gebaut, wie zurückgelassen von spielenden Kindern. Und einen winzigen Blumenkranz hatte man ihm geflochten, den trug er um seinen winzigen, gedrungenen Elefantenhals.
Er schien in Sorge. Seine alten Augen lagen in Falten, als betrübe ihn etwas, das er sah oder kommen sah. Was konnte ich tun – ihm Blumen streuen? Ich hatte keine. Seine Lieblingsspeise? Ich wußte sie nicht. Ein paar Münzen wenigstens? Ich tat nichts. Ich kam mir arm vor, nutzlos, dumm. Endlich ging ein Schub durch die Menschen- und Lastenmasse, sie stieß und riß unseren Jeep weiter, der kleine Gott verschwand so jäh, wie er aufgetaucht war.
Wir trieben mehr dahin, als daß wir fuhren. Die Straßen waren niemals versiegende, kataraktreiche Ströme sich vorwärts drängender Leiber. Ich sah Fahrzeuge aller Zeiten, von der Bronzezeit an, hochrädrige, von Hand gezogene Karren neben fabrikneuen Transportern, die einen wie die anderen mit Götterbildern bemalt und der unnötigen Aufforderung am Heck: «Please horn!» Jeder hupte immerzu.
In der Enge dieser Stadt – ich war ausgestiegen und zu Fuß weitergegangen – kam ein helles Zwitschern auf, aber es klang nicht wie Vogelstimmen, es klang metallisch. Ich folgte ihm und dachte an einen futuristischen Vogelschwarm, silbrige, von Chips gesteuerte Kolibris, zum Vergnügen programmiert oder für den Einsatz in einem subtilen Krieg. Dann, um eine letzte Ecke biegend, sah ich sie: Es war der Schwarm der Schreiber, es war ihr Platz. Zu Hunderten saßen sie auf dem Steinboden, vor sich kurzbeinige Tischchen, darauf warteten ihre mechanischen Schreibmaschinen auf Kundschaft. Schreiber von Petitionen gab es, von Bewerbungen und Anträgen jeder nur denkbaren Art, sie setzten Kauf- und Heiratsverträge auf und tippten wichtige, ihnen ins Ohr geflüsterte Briefe. Ab und zu legte sich das Gezwitscher, das mich angelockt hatte, um bald wieder einzusetzen – der vielhundertfache Anschlag all dieser Schreibmaschinen. Als ich ging, loderte es auf wie ein Busch voller Spatzen.
Das nächste, was ich sah, war ein nackter Bettler mitten auf der Straße, ein magerer brauner Körper, groteske Verrenkungen darbietend. Der Verkehr teilte sich und umfloß geschmeidig selbst seine exaltiertesten Gesten. Alles drängte weiter, vorbei. Was lag, blieb liegen. Jeder lenkte seinen Bus, sein Mofa, sein Tier um den Nackten herum, ohne ihn zu beachten. Kamele, Menschen, Esel, vor schwankende, hochbeladene Karren gespannt – das Rad des Lebens war kein Bild, keine mystische Idee, es war hier. Es rollte fort und fort, es versetzte mir sanfte und grobe Stöße, und gab ich nicht acht, würde es mich überrollen, wie es so viele vor mir mitleidlos überrollt hatte, angeschoben und immer weitergeschoben von Wünschen und Nöten, Träumen und Begierden, von Muskeln und dünnen Sehnen und verbranntem Benzin – unablässig um die alte Achse sich drehend, mahlend, mahlend, zu Asche, zu Staub.
Nur eine Art ging unberührt durch den großen Lärm, aufreizend langsam: die heilige Kuh. Auf ihrem Pfad durch die ewige Rushhour aus blechernen und fleischlichen Leibern und den Morast, den sie hinterließen, zeigte das Kuhgesicht immer denselben mürrischen Gleichmut, ob die Lippen nun saftige grüne Blätter rupften oder weggeworfene Reste von Dal fanden, dem Linsengericht. In dieser vollkommenen Unbekümmertheit um die Blicke der Menschen glichen die heiligen Kühe den heiligen Männern, die irgendwann ihre Familien verlassen hatten und ihr ganzes emsiges Leben, um safranfarben gekleidet oder auch nackt durch den Rest ihrer Tage zu ziehen. Beide gingen durch die Welt, ohne ihr noch anzugehören.
Die heiligen Männer lagen in Tempeln oder auf eisigen Höhen, rauchend, uralte Verse murmelnd, von dem einzigen Wunsch beseelt: Nach diesem Leben nicht noch einmal in den Strom, unters Rad, in noch eine Haut, die so vieles halten muß, was sich stößt und sticht und auseinanderwill. Bei einem hatte ich eine Weile gesessen, vor einem Dorf, das er den Sommer über als Bleibe gewählt hatte. Da hockte er, rauchte Bidis, schwieg meistens und ließ sich von den Dörflern versorgen, die sich glücklich schätzten, so einen heiligen Vogel zu haben, einen zugeflogenen Sadhu. Nach Stunden hatte ich genug gesessen, stand auf und ging. Er beachtete es ebensowenig wie mein Erscheinen.
Irgendwann bemerkte ich, daß mir der Ekel abhanden gekommen war – der Ekel vor Indiens Dünsten, den süßen, den scharfen, denen von Fäulnis, Kot und Verwesung, vor der hellroten Spucke der Betelnußkauer auf Schritt und Tritt, wie verspritztes Blut. All das griff mich nicht mehr an, der körperliche Aufruhr gegen das Fremde in seiner abstoßenden Gestalt blieb aus. Und gegen Indiens Hitze half Hitze, eine Kelle heißen Tees genügte, milchiggrau, ingwerscharf, aus dem nächsten Topf am Straßenrand. Der Ingwer linderte den Husten, der von den Abgasen kam, die Dosis hielt vor bis zur nächsten Teeambulanz.
So gleichmütig man uns in den Städten begegnete, so weidlich bestaunt wurden wir in den Dörfern. Keine Minute verging, wenn unser Jeep in eines hineinfuhr, bis ihn die Kinder entdeckten. In ihrem Tumult ging der Jeep unter wie ein Stück Wild in einem Rudel junger Löwen. Es waren stille Tumulte. Das leise Rascheln der baumwollweißen Kleider, aus dem plötzlich ein kehliges Wort aufflog, ein helles Auflachen der Meute zur Antwort; der Wink eines Altklugen, doch zu schweigen, dämpfte alles wieder zu einem Flüstern. Sie kamen nahe heran. Die Fensterrahmen des Jeeps waren ausgefüllt mit scheuen, neugierigen Kindergesichtern.
Wieder ein Dorf, wieder das Geraschel und Geflüster der Kinder. Ich sah nicht hin, ich hörte es nur, auf der Rückbank dösend. Mit einem Mal verstummten Rascheln und Flüstern. Ich fuhr hoch und sah in aufgerissene, rotunterlaufene Augen in einem dunklen, erregten Gesicht– Augen, in denen nichts Klares war, nur Fieber, Wahn. Wir rollten langsam weiter, der Mann hielt Schritt, das Weiße seiner Knöchel trat hervor, so klammerte er sich an den Jeep. Er starrte, er ließ mich nicht los mit seinen Augen. Er sah etwas, das ihn verrückt machte. Seine auberginefarbenen Lippen öffneten sich zu einem Laut, der nicht kam. War er stumm? Mit Visionen geschlagen? Oder blickte er in einen Spiegel, und der Spiegel war ich? Der Jeep stand jetzt, die Hitze brannte. Endlich bemerkten die Freunde, was hinten geschah, der Jeep heulte auf, hupte sich eine Gasse frei, beschleunigte. Der Mann rannte mit, am offenen Fenster hängend, die Leute wichen zurück, der Jeep raste aus dem Dorf und schüttelte die Augen ab. Der Hausarzt fiel mir ein: «Er hat das indische Fieber.»
Am Tag darauf merkte ich, wie meine Temperatur stieg. Alles wurde zur Qual, die schaukelnde Fahrt, die Gespräche, die elende Hitze. Die letzten Stunden im Jeep waren kaum zu ertragen, der Weg versetzte mir harte Stöße, die Schwüle nahm mir den Atem. Die Betelspucke, wenn wir hielten – überall Blut. Ghee, Ingwer, Curry, Dal, alles mischte sich mit dem fetten Qualm der Scheiterhaufen am Fluß. Keine Krieger mehr – dünne Männer am Boden, Eisenschrott vor sich und ein paar rostige Hämmer, umherziehende Schmiede, sehr niedere Kaste. Auch mit den Kühen ging etwas vor. Eine kaute, während wir ihr den Vortritt ließen, eine zerfetzte Plastiktüte, stinkende Essensreste klebten daran. Die Bilder würgten mich auf dem hüpfenden Rücksitz, dieselben, von deren unbegreiflicher Schönheit ich gestern die Augen nicht hatte lassen können. In einer leichten Drehung der Welt, einem leicht veränderten Einfall des Lichts, zeigten dieselben Wesen und Dinge plötzlich Grimassen des Todes.
Und wie eine aufsteigende Übelkeit immer neu ausgelöst und gesteigert wird, einer bestimmten Speise, eines Geruchs, ja sogar einer Farbe, eines Wortes wegen, das auf einmal Ekel erregt, so war es das Blutunterlaufene jener Augen, das mein Fieber schürte. Es stieg, und solange ich die Augen vor mir sah, würde es weiter steigen. Mit aller Gedankengewalt, die mir noch zur Verfügung stand, versuchte ich, sie ins Nichts zurückzupressen, aus dem sie so unerwartet aufgetaucht waren. Als das nicht gelang, versuchte ich meinen Geist auf etwas Kühles zu lenken. Eis. Auf etwas Technisches – die Tachonadel des Jeeps. Es klappte nicht. Der Jeep schlingerte in den Fahrrillen der Piste, die Nadel tanzte wild hin und her, bot keinen Halt, wie die Fahrt selber, deren Sinn ich nicht mehr verstand – wohin fuhren wir denn?
Der Professor wollte mich immer wieder aufmuntern. Vom Vordersitz wandte er sich um, um mich zum Durchhalten zu bewegen, als die Hitze des Tages ihren Zenit erreichte. Er wisse ein Haus für mich, dort fände ich Heilung und Frieden, healing and peace, dabei wackelte er mit seinem kahlen Kopf auf schwer nachzuahmende Art – dieser Tanz des indischen Kopfes, der alles und nichts sagen konnte, ungewiß lächelnd, sich wiegend in der Mitte zwischen Ja und Nein. Ich stützte mich auf und nickte. Gut, gut. Wenn es nur bald geschafft ist.
Die anderen drängten mich, in ein Krankenhaus zu gehen, dort gehöre ich hin, aber dazu war ich nicht zu bewegen. Ich wollte Stille, sonst nichts. Stille und ein paar Flaschen Wasser. Der Professor hielt sich aus dem Streit heraus. Als er sah, daß ich mich nicht umstimmen ließ, kam er auf seinen Vorschlag zurück – «ein altes Hospital in einem verwilderten Park».
«Ein Hospital? Ich gehe nicht ins Hospital.»
Er wiegte den kleinen Kopf. «Eines, das Ihnen gefallen wird, ein Hospital ohne Ärzte. Es steht seit langem leer.»
«Was war es früher?»
«Ein Haus für Leprakranke. Es wurde aufgegeben, als die neue Klinik eröffnete.»
«Ist es schön?»
«Zauberhaft schön. Dort finden Sie, was Sie jetzt brauchen, Ruhe. Stille. Ein guter Ort. Natürlich lassen wir Ihnen alles Nötige da.»
Einen Augenblick lang erregte es mein Mißtrauen, wie eifrig er mir das verlassene Hospital ans Herz legte, aber die Vorstellung, endlich Ruhe zu haben, kein Jeep, kein Lärm, verscheuchte alle Bedenken. Ich willigte ein.
Die Freunde gaben ihren Widerstand auf, und der Professor kam ins Reden. Wieder schien es mir, als wolle er uns beschwichtigen, aber seine Erzählungen waren alles, was noch half. Lange könne es nicht mehr dauern, versicherte er mir, er kenne das stille weiße Hospital genau, eine Gründung des Maharadschas, des alten, er betonte das. Der Maharadscha – ich hatte seinen Palast gesehen, wir waren an einer nicht enden wollenden Mauer entlanggefahren, Palmwipfel waren dahinter erschienen, verspielte Türme und Kuppeln, eine Mischung aus allen möglichen morgen- und abendländischen Märchen.
Der Professor erzählte Maharadscha-Geschichten. Seit jeher sei er ein Parteigänger der neuen Zeit gewesen, so hatte er sich am ersten Abend in Jodhpur vorgestellt als unser indischer Lotse und Dolmetscher auf dieser Reise. Und mit der neuen Zeit war er alt geworden. Aber unterwegs verlor sich seine fortschrittliche Haltung, Tag für Tag mehr. Eine trotzige, meckernde Lust, den Grund aufzubrechen, den er ein Leben lang festgestampft hatte mit seinen festen progressiven Ansichten, brach aus ihm hervor. Er fiel, ein kleiner, dürrer Mann aus einer hohen Kaste, jedesmal in dieses meckernde Lachen, wenn er genötigt war, uns in einem der sozialistischen Gästehäuser einzuquartieren, die es noch überall gab und die er anscheinend auch alle kannte; wenn es schwierig war, einfachste Annehmlichkeiten zu verhandeln und die einst großzügig gedachten Herbergen so unwirtlich dalagen und ihre Räume das stockfleckige Aussehen lange verschlossen gewesener Sterbezimmer einstiger Parteiführer hatten.
Ich mußte ihn geradezu nötigen, auch einmal eine in seinen Augen unvorteilhafte Maharadscha-Begebenheit zu erzählen, so quoll der alte Sozialist über vom Lob der von ihren Thronen vertriebenen Fürsten. Ach, die Sache mit dem hundenärrischen Maharadscha von J., die werde im Ausland übertrieben. Dieser Fürst habe seine Hunde geliebt, ja, sicher, und in der Tat seien es viele gewesen, sehr viele sogar, aber nach seiner, des Professors Meinung nicht achthundert, wie immer behauptet werde. Eher sechshundert oder vielleicht auch nur vierhundert, man vertue sich da leicht, und die Europäer neigten bekanntlich dazu, ihre indischen Abenteuer maßlos zu übertreiben und auszuschmücken. Im übrigen bezweifle er, daß wirklich jeder dieser angeblich achthundert Hunde sein eigenes Zimmer und seinen eigenen Diener gehabt habe, wie es kolportiert werde. Nicht wenige indische Fürsten seien damals Hundenarren gewesen, eine englische Mode aus der Zeit Königin Viktorias. Ich gab so schnell nicht auf, ich hatte darüber gelesen und war meiner Sache ziemlich sicher, er aber redete alles klein und rechnete alle indischen Ausschweifungen solange herunter, bis kaum etwas blieb. «Eine englische Mode», wiederholte er, «eine viktorianische Dekadenz.»
Ich fragte ihn nach den Hundehochzeiten, vom ganzen Hofstaat zelebrierte tagelange Vermählungsfeste der Lieblingshunde des Fürsten. Wieder wand sich sein tanzender kleiner Kopf, als suche er einen Ausweg. Ja, dergleichen habe es gegeben, gestand er zu meiner Verwunderung ein, aber bei dem Maharadscha, durch dessen Land wir nun fuhren, habe es damit seine eigene Bewandtnis gehabt, und eine menschlich tief anrührende. Einmal sei er bei der Jagd, in dem Moment, als er von seinem Elefanten stieg, um den eben erlegten Tiger von nahem zu betrachten, von diesem angegriffen und nur durch das furchtlose Eingreifen seiner Jagdhunde gerettet worden, die sich ganz gegen ihre Hundenatur auf den bloß angeschossenen Tiger geworfen und ihren Herrn vor dem sicheren Tod bewahrt hätten. Was Ausländern als indische Narretei erscheine, sei die lebenslange Dankbarkeit des Fürsten gegen die Hunde gewesen, gegen alle, ohne Ansehen des einzelnen Tieres und seiner Verdienste.
Bedauerlicherweise, bemerkte der Professor nach einer Pause, sei der junge Maharadscha nicht wie der alte, auch zum Leidwesen seiner Maharani, einer sehr vernünftigen Herrin, die darum ringe, von der Bedeutung des früher mächtigen Fürstenhauses zu retten, was eben zu retten sei. Daran zeige der gegenwärtige Maharadscha aber nicht das geringste Interesse. «Immer nur Sitar, Sitar, tagein, tagaus. Und an hohen Feiertagen spielt er für seine Affen, Sie haben es ja selbst gesehen.»
Das Los des Fürstenstaates beklagend, geriet der Kopf des Professors in immer heftigeres Schaukeln. Mich rüttelte der Jeep. Schweiß floß herab, warm wie Blut, die Glieder schmerzten, hinter der Stirn pochte es, der Fahrtwind brachte keine Linderung, glühend heiß, wie er war, blies er nur neue Glut auf mich, aber ich mußte lächeln beim Gedanken an den sitarspielenden Fürsten. Der Professor hatte mich überrascht. Er hatte es fertiggebracht, uns eine Einladung beim Maharadscha zu besorgen, wahrscheinlich nutzte er für so etwas seine alten Kastenbeziehungen. Es war erstaunlich zu sehen, wie es ihm noch in den Gliedern steckte. «Nicht zu hastig, nicht zu müßig», hatte er mir zugeraunt, als wir auf den Palast zugingen, und auf dem ganzen Weg hatte er sein entzücktes Lächeln gewahrt, als seien alle Palastaugen auf uns gerichtet, was sie vielleicht auch waren.
Ein Diener hatte uns am Tor erwartet, um uns durch dunkle Gänge in einen Saal zu führen, wo wir uns von der Reise erholen konnten. Es war ein Spiegelsaal, aber nicht festlich-erhaben, sondern verspielt. Hunderte, wenn nicht tausende kleinster Spiegel, zu Mosaiken gefügt, fingen das rote Abendlicht auf, das durch die lange Fensterfront fiel, brachen es in zigtausend Splitter und warfen sie in den Saal, daß es nur so funkelte. Der Diener brachte Erfrischungen und heiße, feuchte Tücher wie im Flugzeug, und wer weiß, vielleicht war die Sitte wirklich aus der Business Class in diesen Palast gelangt.
Die Dinge beeilten sich nicht, ihren Lauf zu nehmen, man schien Zeit zu haben und ließ uns allein. Meine Befangenheit legte sich, als ich sah, wie leicht sich der Professor in die Palastgebräuche fand, wie vertraut ihm das alles war. Er unterhielt uns mit Begebenheiten aus der Geschichte der Fürstenfamilie, dazu aßen wir getrocknete, säuerliche rote Beeren und persisches Honigkonfekt und tranken Lassi. Gerade als der Professor bei dem Vorfahren angelangt war, der nach einer Periode von Dekadenz und Verfall den Staat wieder zu Sittenstrenge, Macht und Ausdehnung geführt hatte, flog die Tür auf und der Fürst trat ein. Er verneigte sich, erkundigte sich nach unserem Befinden und lud uns, ohne eine Antwort zu erwarten, zum Konzert kurz vor Sonnenuntergang auf die Westterrasse ein. Dann flog die Tür erneut auf, und er war fort.
Ich konnte nicht einmal sagen, wie er aussah, so schnell war es gegangen. Die Vorstellung peinigte mich, ihm im Palast zu begegnen, ohne ihn zu erkennen. Als die Sonne sank, öffnete der Diener – er hatte die ganze Zeit reglos wie eine Wache in unserer Nähe gestanden – eine Flügeltür, und wir folgten ihm in einen größeren, prächtigeren