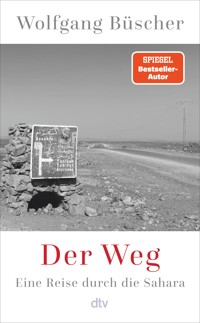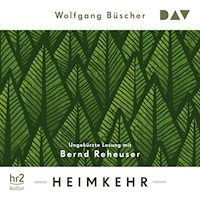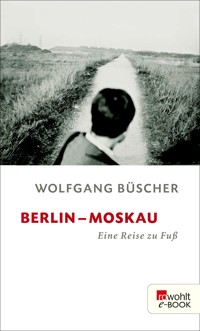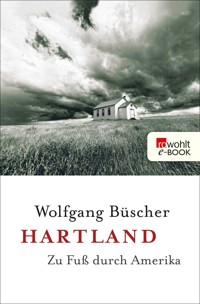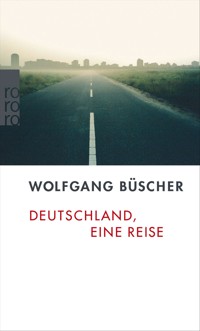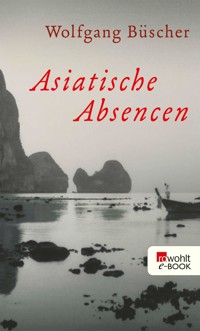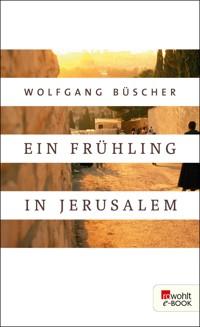
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Büscher in Jerusalem: Zwei Monate hat er in der Altstadt gelebt, erst in einem arabischen Hostel am Jaffator, dann in einem griechischen Konvent aus der Kreuzritterzeit. Er war einfach da, und doch hat er sich auf fast zweitausend Jahre alten Spuren bewegt – schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus gingen Europäer nach Jerusalem, um eine Weile zu bleiben oder sogar ganz. Büscher bewegt sich durch die Räume, den Widerhall dieser zweitausend Jahre. Ein Ort, aufgeladen mit Religion, Prophetie, Politik. Früh um fünf auf dem Ölberg stehend, kann man es hören und sehen – erst die Muezzine, dann die Glocken, dann das erste Sonnenlicht auf der goldenen Kuppel des Felsendoms. In all das taucht Büscher ein. Er hört Jerusalem zu, nimmt seine Bilder und Stimmen auf, dringt immer tiefer ein in die Geheimnisse der Stadt. Verbringt die Tage im arabischen, christlichen, jüdischen Viertel, in den halbdunklen Gassen und Souks, auf der Via Dolorosa, an der Klagemauer und in Gewölben, in denen arabische Männer Kardamomkaffee trinken und Wasserpfeife rauchen. Er läuft durchs Kidrontal, durch den Garten Gethsemane, wandert über das Dach von Jerusalem und lässt sich eine Nacht lang in der Grabeskirche einschließen. Ein Frühling in Jerusalem: eine einzigartige Reise in eine unerschöpfliche Vergangenheit, in eine faszinierende Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Wolfgang Büscher
Ein Frühling in Jerusalem
Über dieses Buch
Wolfgang Büscher in Jerusalem: Zwei Monate hat er in der Altstadt gelebt, erst in einem arabischen Hostel am Jaffator, dann in einem griechischen Konvent aus der Kreuzritterzeit. Er war einfach da, und doch hat er sich auf fast zweitausend Jahre alten Spuren bewegt – schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus gingen Europäer nach Jerusalem, um eine Weile zu bleiben oder sogar ganz. Büscher bewegt sich durch die Räume, den Widerhall dieser zweitausend Jahre. Ein Ort, aufgeladen mit Religion, Prophetie, Politik. Früh um fünf auf dem Ölberg stehend, kann man es hören und sehen – erst die Muezzine, dann die Glocken, dann das erste Sonnenlicht auf der goldenen Kuppel des Felsendoms.
In all das taucht Büscher ein. Er hört Jerusalem zu, nimmt seine Bilder und Stimmen auf, dringt immer tiefer ein in die Geheimnisse der Stadt. Verbringt die Tage im arabischen, christlichen, jüdischen Viertel, in den halbdunklen Gassen und Souks, auf der Via Dolorosa, an der Klagemauer und in Gewölben, in denen arabische Männer Kardamomkaffee trinken und Wasserpfeife rauchen. Er läuft durchs Kidrontal, durch den Garten Gethsemane, wandert über das Dach von Jerusalem und lässt sich eine Nacht lang in der Grabeskirche einschließen. Ein Frühling in Jerusalem: eine einzigartige Reise in eine unerschöpfliche Vergangenheit, in eine faszinierende Gegenwart.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2016
Copyright © 2014 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann
Umschlagabbildung Atlantide Phototravel/Corbis
ISBN 978-3-644-11791-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Karte der Altstadt von Jerusalem
Schwarze Fahrt
I. Die erste Zeit
Das Fenster
Zwei Felsen
Ist Jerusalem schön?
Charly Effendi
Ein Geheul in der Nacht
Der König des Muristan
Wie es sein könnte
Arabische Höhle
Der Rabe an meinem Fenster
Eine Zigarette
II. Das Oleanderhaus
Griechisches Dorf
Warten auf Mrs. Nora
Golgatha, früh um sieben
Der Mönch
Gute alte Boheme
Superfreitag
Nora
Züchtigung des Grabesnarren
Die Nacht
III. Stille Kriege
Die Siedler
Ada
Soldaten
Der Stachel
Das Auge
Das Flüstern der Häuser
Der Korb des Patriarchen
Arabischer Adel
Abend am Jaffator
Der Mukhtar der Siedler
Zünder
Beim Rabbi
Richard Wagners Beitrag zur jüdischen Orthodoxie
IV. Adieu, Jerusalem
Lauter Abschiede
Der Effendi möchte mir noch etwas zeigen
Rauch in den Kleidern
Dank
Schwarze Fahrt
Eine kuriose Fracht war es, die der kleine Bus hinauf nach Jerusalem fuhr, als habe ein Spötter sich das ausgedacht – zehn Fahrgäste in einem Großraumtaxi, blaß und ernst und in frommes Schwarz gekleidet fast alle, chauffiert von einem mürrischen Fahrer, der sie am Flughafen aufgelesen hatte. Dort hatten sich die Fluggäste in zwei Gruppen geteilt; die einen fuhren zum Feiern nach Tel Aviv, die anderen fuhren zum Beten nach Jerusalem. Die vorderen Plätze im Taxi nahmen drei Amerikaner ein, orthodox auf den ersten Blick mit ihren Vollbärten, schwarzen Mänteln und schwarzen Hüten, eigentlich schauten nur Hände, Lippen und Augen aus all dem Schwarz hervor. In den Händen hielten sie zerlesene Büchlein, die Augen hingen an den keilschriftartigen Zeichen darin, die Lippen lasen stumm mit.
Hinter ihnen saßen sehr aufrecht drei junge russische Nonnen, die Gesichter bleich wie Milch unter den eng gebundenen schwarzen Hauben. Das einzige Zugeständnis an ihre Weiblichkeit waren frei um die Schultern spielende Samtbänder, die dem fußlangen Schwarz ein wenig von seiner Strenge nahmen. Die Rückbank endlich teilten sich ein älteres englisches Ehepaar, ein schläfenlockiger junger Schlaks im glänzenden schwarzen Kaftan, der unentwegt telefonierte, und ich, der das alles sah.
Je mehr mein Nebenmann in sein Mobiltelefon hineinredete, einen abgenagten Knochen aus der Frühzeit dieser Technologie, desto schwerer fiel es mir, ihm nicht zuzuhören, und es lag nicht nur an seinem sanft raspelnden Bariton. Die Sprache selbst weckte meine Neugier. Vertraute Wörter blitzten darin auf, helles Treibgut im dunklen Strom seiner Rede. Was ich da aufschnappte, das waren, wenn auch sonderbar intoniert, Brocken meiner Muttersprache. «Die Eltern» fiel mehrmals, und «kein TV». Seine Eltern besäßen keinen Fernseher, das war es wohl, was er dem, mit dem er die ganze Zeit telefonierte, klarzumachen versuchte.
Kehlig kam das alles aus ihm heraus. Die «Eltern» sprach er mit breitem «Ä», das «kein» kaute er zu «kejn». Ein altmodisches, irgendwie osteuropäisch klingendes, singendes Kryptodeutsch, fremd und vertraut zugleich. Ich ahnte, was es sein mochte, aber erst als er eine Telefonnummer durchgab, war ich ganz sicher. «Fünneff – zwej – fünneff – drej – sechse – siebene – achte!»
«It’s Yiddish», sagte der Engländer in mein spätes Begreifen hinein, «die Sprache der Ostjuden», und mit einer Kopfbewegung zu dem zwischen uns Sitzenden hin: «Bei denen ist sie immer noch in Gebrauch.» Dem Schlaks schien es nichts auszumachen, daß nun über ihn geredet wurde, so über ihn hinweg. Er lächelte freundlich und nickte zu allem, was wir über ihn und seine Welt sagten, die Welt der Ultraorthodoxie. Er verstand es wohl nur halb, sein Englisch war, wie sich zeigte, schwach.
Inzwischen hatte der Bus die Straße, die von der Küstenebene ins judäische Bergland hinaufführt, verlassen und erreichte nun Jerusalems westliche Vorstädte. Er fuhr aber nicht geradezu in die Stadt hinein, er brachte jeden Fahrgast bis vor seine Tür. Der Fahrer ließ keinen Umweg aus, er nahm all die Hänge und Haarnadelkurven, so schnell er konnte, erfüllt von einer grimmigen Freude, seine schwarze Fracht ordentlich zu rütteln und zu rollen. Linksherum riß er das Steuer, rechtsherum, jagte bergan und bergab, neben mir gerieten die Schläfenlocken ins Schwingen. Tief drangen wir in Jerusalems kalkweiße Vorstädte ein, steil aufragend an den Hängen wie Festungswerke.
Jetzt hielt der Bus. Und weil er auf einer Anhöhe hielt, bot sich freie Sicht weit ins Land. Ich sah, wo ich war, und erschrak. Es war aber nicht das Land, es war das Licht. Einer war über die Erde gegangen und hatte Schwefel gesät. Viel Himmel sahen wir, ganz Jerusalem sah ich daliegen, dahinter die Berge von Judäa, wieder dahinter das Land Moab jenseits des Jordantals, und alles in diesem schwefligen Unheilslicht. Es griff nach dem Verstand, nach dem Glauben, daß alles gut wird, es stach in die Gegend des Solarplexus – Innewerden eines unverzeihlichen Leichtsinns, einer Gefahr. Ich war nicht der einzige im Bus, dem so zumute war. Alle ließen von ihren leisen Gesprächen ab, sahen von ihren Büchern auf, schauten hinaus und verstummten.
Vielleicht der Chamsin, versuchte ich mich zu beruhigen, der Wind aus der Wüste, der Jerusalem immer wieder in seinen gelben Dunst hüllt und das Gemüt auch, der Idiotenwind, der einen Schweif von Verrücktheit nach sich zieht. Aber der Chamsin kam gewöhnlich im Frühling, und noch war Winter. Wenn es nicht der Chamsin war, was war es dann? Wo hatte ich dieses Licht schon einmal gesehen, diesen schwefligen Vorschein einer Gefahr? Plötzlich wußte ich es – auf Bildern. Bildern, die nichts Gutes verheißen. Es gab Maler, die dieses Licht kannten.
Noch vor einer Stunde war ich unter Menschen gewesen, die guten Mutes waren oder wenigstens so taten, die ein Zutrauen in die Welt an den Tag legten, und die Welt gab sich alle Mühe, ihnen eine vertraute zu sein – die eingespielten Flughafenriten, der gute Espresso an der Flughafenbar, die beruhigenden Ansprachen des Kabinenpersonals. Der Bus fuhr wieder an, fuhr durch Straßen und Viertel, in denen lauter Schwarzgekleidete ihrer Wege gingen. Was war das da draußen, ein Leichenbegängnis? Etwas fehlte, das Leichte, der leichte Sinn, der den Tod verlacht. Gesenkten Hauptes gingen die Leute einher, als wagten sie nicht aufzuschauen und fürchteten, etwas zu erblicken. In diesem Licht konnte ein Zeichen erscheinen, eines, das man wünschte, nie gesehen zu haben.
Als die anderen Fahrgäste ausgestiegen waren und nur noch das englische Paar und ich im Bus saßen, riß der Mann ein Blatt aus seinem Taschenkalender, schrieb ein Wort darauf und gab es mir – «Akedah». Ein wichtiges Wort, sagte er, ich möge ihm einmal nachgehen. Ich versprach, es zu googeln. Er schüttelte den Kopf. Etwas mehr Mühe würde ich mir schon geben müssen. Er sagte noch, ein Lied heiße so, geschrieben habe es ein spanischer Sepharde im 12. Jahrhundert, «und wir singen es noch immer, am Abend, bevor der Schofar geblasen wird. Sie kennen den Schofar, das Widderhorn?»
Ich nickte, es war Zeit für mich. Ich steckte das Blatt ein, zahlte den Fahrer, sprang ab, riß die Hecktür auf, die wilde Fahrt hatte alles Gepäck durcheinandergeworfen, zog meinen zerbeulten, zerschrammten blauen Koffer hervor und stand vor der Mauer, hinter der ich die nächsten Wochen und Monate verbringen würde, vor Sultan Süleymans Mauer um das dreitausendjährige Jerusalem. Den blauen Koffer in der Hand, betrat ich durchs Jaffator die Heilige Stadt.
I. Die erste Zeit
Das Fenster
Sobald das Tor durchschritten war, fiel alle Beklommenheit von mir ab – gerettet. Es war nur ein altes Stadttor, eines von sieben in Jerusalems osmanischer Mauer, aber diese Mauer stand fest. Jerusalem stand fest. Ich war in festen Mauern und würde sie so bald nicht wieder verlassen.
Rasch regelte ich, was mit dem arabischen Wirt meines Hostels am Jaffator zu regeln war, schob den Koffer ins Zimmer, das er mir zuwies, die Nummer 29, eine strenge, steinerne Kammer, das Eisenbett füllte sie fast ganz aus, schloß die Tür gleich wieder zu und ging los, einem Bild nach, einer Erinnerung. Jetzt war der richtige Moment, danach zu suchen, die Stunde der Abenddämmerung, in der die Häuser erleuchtet werden und warmes Licht aus den Fenstern fällt.
Schon einmal war ich hier gewesen, um diese Abendzeit in diesen stillen Treppengassen, in denen, während hoch am Himmel der Tag in verschwenderischen Farben verglüht, schon die Nacht steht. Da hatte ich das Fenster gesehen – den erleuchteten Raum, den gedeckten Tisch. Der Anblick traf mich wie ein Schlag aufs Herz. Reglos verharrte ich vor dem Fenster und starrte hinein, bis der Gedanke mich aufschreckte, du kannst hier nicht bleiben, man wird dich sehen. Die Tür in die Wohnung hinein stand halb offen, gleich würden die, denen der Tisch bereitet war, eintreten zu ihrem Sabbatmahl.
Ich hatte mich losgerissen und war ins Dunkel zurückgetreten, aus dem ich gekommen war, aber ich ging nicht mit leeren Händen. Ich schnitt das Bild aus dem Fensterrahmen und nahm es mit, ein Dieb in der Nacht.
Viele Jahre war das her, wieder lief ich durch diese Gassen und suchte das Fenster, dachte darüber nach, was mich damals so getroffen hatte. «Der bereitete Tisch», so hieß das gestohlene Bild, darum ging es. In einer sich auflösenden Welt stand der Tisch da, wie er immer dagestanden hatte, und verweigerte die Auflösung. Jemand wollte es so, jemand hatte ihn für die Seinen festlich gedeckt, jemand hielt diese Stunde heilig, und die Welt legte sich und wurde still, wie der Wind sich legt am Abend, sie wurde heil für ein paar Minuten.
Ich nahm es mir nicht vor, und doch fand ich mich Abend für Abend, wenn die Dämmerung einsetzte, durch die Treppengassen des jüdischen Viertels über der Klagemauer streunend, auf der Suche nach etwas so Lächerlichem wie einem Fenster, an dem ich vor Jahren ein paar Sekunden lang stehengeblieben war. Einige Male ging mein Puls schneller, dann glaubte ich, es gefunden zu haben, aber jedesmal irrte ich mich und gab die Suche auf, für diesen Abend und schließlich ganz. Hier wird viel gebaut, sagte ich mir, dein Fenster gibt es nicht mehr.
Zwei Felsen
In einer so strahlenden Frühe erwachte ich in meinem Eisenbett, als wisse die Welt nichts von gestern und kenne kein Morgen. Dann stand ich im eiskalten Wasser, das von der Decke fiel. Nach dem Duschen nahm ich den Feger und schob die Duschwasserlache in das Loch im Steinboden, zog meine wärmsten Sachen an und die Tür von Zimmer 29 zu, beachtete die in Tabletspielen gefangene Hostelwache so wenig wie sie mich, sprang die steile Treppe hinab, zwängte mich an der Wechselstube im Eingang vorbei, hinein ins Gedränge der David Street.
Eine enge Ader des alten Jerusalem, in die nie ein Sonnenstrahl fiel, vom Jaffator her strömten unablässig Menschen herein. Ich wartete eine Lücke ab und glitt in den Strom. Darin standen die Händler wie Bären in einem fischreichen Fluß. Wie jene, mußten sie sich keine Mühe geben beim Fischen, sie sperrten einfach den Mund auf. «Hello, Sir! Shopping, Sir! Come see my shop!» Der vertraute Refrain des Basars, der vertraute Reflex stellte sich ein: Augen zu Boden, nur nicht hinsehen. Einige pfiffen nach Kundschaft. Jeden fahrlässigen Blick fingen sie ein, es würde Kraft kosten, sich wieder loszureißen. Einmal hineingelockt in einen dieser schmalen, aber oft tiefen Läden, fällt es dem Nichtorientalen in seiner skrupulösen Unbeholfenheit schwer, freizukommen, die Händler wissen das – die jahrtausendalte Basarschläue der Heiligen Stadt. Wer nach Jerusalem pilgert oder reist, der will aus Jerusalem auch etwas heimbringen, das ist immer so gewesen, darauf ist Verlaß.
Jerusalem, made in China. Souvenirs der religiösen, der politischen, der folkloristischen Art. Falsche Antiquitäten, vielleicht auch ein paar echte darunter. Teppiche, garantiert beduinisch, Ikonen, garantiert altrussisch, «special prize, Sir!». Die meisten Händler sind Moslems, aber natürlich führen sie alle gängigen Kippa-Sorten. Schlichte schwarze, wie fromme Juden sie tragen, und die aus schwarzem Samt für die ganz Frommen. Auch gehäkelte weiße mit Symbolen darauf nach dem weit schlechteren Geschmack der Siedler. «Dazu vielleicht ein T-Shirt, Sir, das hier mit dem Fallschirmjägerlogo? Oder lieber das mit ‹Guns N’ Moses›? Katholische Meßgewänder, bitte sehr, in Rot, Grün und Weiß. Oder darf es eine schwarze Ganzkörperhülle sein, mit Sehschlitz für die Salafistengattin? Doch lieber etwas Traditionelles? Ein Kopftuch vielleicht im haschemitischen Stil, rot-weiß mit schwarzer Kordel, wie der jordanische König es trägt? Kommen Sie, Sir, ich zeige Ihnen, wie man es anlegt. Ah, Sie bevorzugen ein palästinensisches, schwarzweiß wie auf den Jassir-Arafat-Plakaten? Auch nicht, zu politisch, lieber was aus Bethlehem? Eine Krippe, aus Olivenholz geschnitzt, in jeder gewünschten Größe. Oder sind Sie Moslem, Sir? Schauen Sie – die Kaaba, in Kupfer getrieben, dazu gratis den heiligen Qur’an.»
Das alles dutzendfach, tausendfach, dicht an dicht, ein Angebot, scharf zugeschnitten auf die Segmente Pilger, Tourist. Aber auch für den durchreisenden Fanatiker ist etwas dabei, und selbst die bedauernswerteste aller Gruppen, die ganz Unmusikalischen, die an Jerusalem nur mal nippen wollten und bald merkten, daß das nicht geht – selbst solche Leute fanden hier in der David Street irgendein buntes Tuch, eine armenische Vase, ein Mitbringsel aus dem Morgenland.
Wenn ich früh durch die Gassen ging, über Steine manchmal, über die schon Römersandalen gelaufen waren, wuchtige Platten, so weich getreten von Byzantinern, Mamelukken, Kreuzfahrern, Osmanen, daß ich bei Regen auf ihnen ausglitt; wenn ich dann den Basarhändlern zusah, wie sie ihre blechernen Läden, die mitunter ihr ganzes Geschäft enthielten, aufklappten wie Schwarzmarkthändler ihre langen Mäntel, wie sie mit langen Hakenstöcken ihre Köder hochhängten, Morgen für Morgen dieselben Teppiche, Burnusse und lustigen T-Shirts, die durchsichtige Bauchtanzwäsche für das Abenteuer daheim, rot oder quietschgelb und mit falschen Goldmünzen behängt, dann hatte der Basar etwas verzweifelt Trostloses, und es wiederholte, steigerte, vervielfachte sich von Laden zu Laden.
Wie auch nicht. Jerusalem hat nichts anderes zu bieten als das, nie zu bieten gehabt. Kein Gold, kein Öl, keine seltenen Erden. Nicht einmal die Orangen und Granatäpfel, die von früh bis spät in seinen vier Vierteln – dem armenischen, christlichen, jüdischen, moslemischen – zu Saft gepreßt und zu nicht minder saftigen Preisen den Fremden gereicht werden, nicht einmal diese Früchte kommen von hier. Sie wachsen in der fruchtbaren Küstenebene unten am Mittelmeer, dem Land der Philister, das im Namen der Palästinenser fortlebt. So arm ist Jerusalem, weltlich betrachtet. Bettelarm.
Nur eines hat die Stadt zu bieten, ihre Heiligkeit für den Rest der Welt. Ein guter Ort, um das zu begreifen, war das Dach meines Hostels. Ich hatte ohnehin genug vom Trubel, und so stieg ich aus der Schattenwelt der Basargassen wieder die enge Treppe hinauf ins Hostel und die noch engere aufs Dach. Nun sah ich klarer. Hingebreitet im gleißenden Mittagslicht lag das steinerne Jerusalem, und aus dieser weißgrauen Steinlandschaft ragten zwei Hügel heraus, zwei Kuppeln, seine beiden heiligen Felsen: Golgatha und Tempelberg.
Was vom Felsen auf dem Tempelberg gesagt wird, reicht so tief wie möglich hinein in die Anfänge alttestamentarischer Erinnerung. Es ist der Fels vieler Namen. Grabhöhle Adams. Verschlußstein der Sintflut. Thronsitz Jahwes. Nabel der Welt. Und noch ein Wort gehörte hierher, der englische Sepharde hatte es mir im Taxi aufgeschrieben. Akedah, das heißt Bindung. Auf den Tempelbergfelsen dort drüben soll Abraham seinen gebundenen Sohn gelegt haben, Isaak, bereit, ihn zu opfern. Akedah – die Bindung des eigenen Sohnes mit Stricken als Bund des Vaters mit Gott, dem Gott, der ein solches Opfer nicht will und Abraham in den Arm fällt. Aber auch die Bindung des Abraham, seine Bereitschaft, so weit zu gehen.
Der Fels auf dem Tempelberg ist der alttestamentarische, der jüdische Felsen. Dort zu wohnen, mitten unter seinem erwählten Volk, hatte Gott den Juden verheißen. Auf diesem Fels bauten sie Jahwe ein irdisches Haus, den großen Tempel, den erst die Babylonier und dann endgültig die Römer zerstörten, im Jahre 70 nach Christus. Der Überlieferung nach stand das Allerheiligste im Inneren des Tempels auf dem Felsen selbst. Auf ihn legte der Hohepriester die Schaufel mit glühenden Kohlen, hier räucherte er, hier stand der Brandopferaltar, hier floß das Blut der Opfertiere. Es war der heiligste jüdische Ort der Tempelzeit.
Auf dem zweiten Fels hatte das Kreuz gestanden. Nur ein paar hundert Meter von Abrahams Opferstein entfernt – und ihm so fern wie nur möglich, das andere Ende der biblischen Parabel. Dem Abraham, der ihm den Sohn opfern will, verwehrt Gott dieses Opfer im letzten Moment. Auf Golgatha opfert er selbst seinen Sohn. Der eine Felsen antwortet dem anderen.
Von meinem Dach aus war das alles nicht zu begreifen. Es war nicht einmal zu sehen, denn zwei Kuppeln verstecken die beiden Felsen – die goldene Kuppel des Felsendoms bedeckt Adams Grab, und die graue Kuppel der Grabeskirche überwölbt Golgatha. Und um es noch komplizierter, noch magnetischer zu machen – der Fels auf dem Tempelberg ist auch ein moslemischer heiliger Ort.
Hierher, zum allerheiligsten Stein des jüdischen Tempels, sah sich ein halbes Jahrtausend nach dessen Zerstörung der Prophet Mohammed entrückt. Zum Tempelberg habe er, so glauben die Moslems, al-Isra angetreten, seine mystische Nachtreise von Mekka nach Jerusalem. Als sein Nachfolger, der Kalif Omar, 638 Jerusalem eroberte, fand er den jüdischen Tempelberg so vor, wie ihn die Römer hinterlassen hatten, zerstört, verwaist. Und er stieß auf die belebte Grabeskirche, denn das Jerusalem, das er einnahm, hatte bis dahin zum christlichen Reich von Byzanz gehört, es war eine weithin christliche Stadt.
Omars Nachfolger, der Kalif Abd al-Malik, mochte den Felsendom nicht so einzig und dominant stehenlassen. Er ließ Ende des 7. Jahrhunderts syrische und byzantinische Architekten einen ebenso prächtigen Dom über den Felsen auf dem Tempelberg bauen, nach dem Vorbild der Grabeskirche. Damit legte er den Grundstein für den explosivsten Ort im Jerusalem der Gegenwart – der heiligste Ort der Juden befindet sich im Innersten des ersten moslemischen Sakralbaus der Welt.
Die Nacht zog herauf, ich stieg wieder herab vom Dach und lief durch die Gassen, doch der Basar, die tägliche Zirkulation der Menge, das ganze Treiben der heiligen Stadt, das mich noch vor einer Stunde eingenommen hatte, ließ mich nun kalt. Das war nur die Schale, der harte Kern blieben die beiden Stifterfelsen, deren einen ich eben berührt hatte. Grabeskirche und Tempelberg – nichts wäre Jerusalem ohne dieses Magnetfeld. Zu allen Zeiten zog es Suchende an, solche, die Gott und solche, die Zuflucht suchten, und oft war das ein und dasselbe gewesen. Die ersten Pilger aus Europa kamen bald nach der Kreuzigung, und der Strom riß nie ab.
Jerusalem wäre nicht Jerusalem, spielte historische Zeit eine Rolle. Überall sonst auf der Welt wären solche Orte abgekühlt, wäre ihr Magnetismus längst erloschen. Nicht hier. Wie stark aufgeladen beide Felsen noch waren, ich würde es bald erfahren.
Ist Jerusalem schön?
Mein Weg zum anderen Felsen führte durch die Christian Quarter Street, die Hauptachse des Christenviertels. Hier in der Nähe der Grabeskirche werden die angebotenen Devotionalien edler und, wie ich bald erfuhr, die Angelkünste der Pilgerfischer subtiler. Einer kam auf mich zu, treuherzig abwinkend, sonor meine Skepsis beschwichtigend: «No business, Sir, just a question, nur eine Frage – Sie sprechen doch deutsch?»
Er selbst sprach ziemlich akzentfrei deutsch und bewies nebenbei sein Talent, den Vorüberströmenden ihre Nationalität anzusehen. Woran? Am Gesicht, an den Gesten, an ihrer Art, sich durch diese fremde Welt zu bewegen. Nicht so sehr an der Kleidung, fast alle Fremden trugen die gleiche Freizeitkluft. Nur die russischen Pilgerinnen erkannte man schon von weitem an ihren frommen Kopftüchern.
Der Mann beteuerte, er bitte nur um eine Sprachauskunft, eine kleine Formulierungshilfe. Sein Vater habe nämlich ein offizielles Schreiben an das deutsche Konsulat zu richten, es gehe um den Kauf von Spezialmaschinen zur Verarbeitung von Halbedelsteinen aus Idar-Oberstein. «Wir lassen unseren Schmuck in Jordanien herstellen, wissen Sie, und importieren die Maschinen dafür aus Deutschland.»
Das klang nicht unplausibel, und die Frage, die er mir stellte, nachdem er mich in seinen Laden gebeten hatte, konnte ein arabischer Geschäftsmann aus Jerusalem, der mit dem deutschen Konsulat korrespondierte, durchaus haben. Es ging um die korrekte Grußformel am Ende. «Schreibt man in diesem Fall ‹Hochachtungsvoll› oder ‹Mit freundlichem Gruß›?»
«Es handelt sich um einen offiziellen Brief, nicht etwa an einen Bekannten?»
«So ist es.»
«Dann schreiben Sie: Hochachtungsvoll.»
«Ich werde es meinem Vater sagen, vielen Dank. Und sehen Sie hier, solche Dinge sind es, die wir herstellen. Darf ich Ihnen ein paar schöne Stücke zeigen? Sie bleiben doch auf einen Kaffee?»
Ich mußte ihn bewundern, er hatte mich eingefangen auf eine elegante und liebenswürdige Art, eine jedenfalls, die mir neu war. Aber schon bald begriff ich, nur ich war hier neu, darum hatte der Kniff gewirkt. In den nächsten Tagen wurden etliche mehr solcher treuherzigen Bitten um kleine Formulierungshilfen an mich herangetragen. «No business, Sir, nur eine Frage.»
Gut, sagte ich mir, die Basartaufe ist überstanden, und spielte den Ball mit der gleichen Liebenswürdigkeit zurück. «Sehr gern, Habibi, jetzt bin ich leider in Eile, aber morgen habe ich Zeit. Oder übermorgen, sprich mich nur an, wir sind ja Nachbarn, Habibi, ich wohne gleich um die Ecke.» Ich wurde immer besser, trat geschmeidiger auf, das war das Geheimnis. Schwimmen, nicht fuchteln und sträuben. Allmählich hatte ich diesen gewissen Gestus raus, der mich unbehelligt durch den Basar gleiten ließ und die Händler auf Abstand hielt. Ihr Lockruf war nur mehr ein Geräusch, wie Sprühregen, durch den ich ging. Er drang an mich, aber er bedrängte nicht mehr.
Ein Tagträumender, so ging ich durch das alte Jerusalem, meine Klause für die nächsten Monate. Sie machte mir das Tagträumen leicht. Morgenland! So roch es, so klang es, so sah es aus, und im nächsten Moment läuteten Kirchenglocken wie an einem Sonntagmorgen in Köln. Abendland! Auf einmal roch es und klang es und sah sogar aus wie daheim. Nur das richtige Türchen mußte ich öffnen und stand im Parlando eines italienischen Klosters, im Weihrauchnebel einer kleinen griechischen Kirche, im Goldglanz eines russischen Nonnenkonvents, im kaiser-und-königlichen Hospiz an der Via Dolorosa oder in einem wahrhaftigen Wiener Kaffeehaus, wo junge Araber warmen Apfelstrudel zur Melange servierten oder eine Tiroler Brotzeit zum Gösser-Bier.
Frühmorgens meist, wenn es den Basarbetrieb nicht zu sehr störte, zogen Prozessionen von Station zu Station. Pilger aus Rio de Janeiro und aus Krakau, aus Kalkutta und Chicago, einer vorweg, ein großes Holzkreuz tragend. Ein Zug Fallschirmjäger kreuzte den Weg der Pilger, das sachte Klackern, wenn die herabhängenden Sturmgewehre an ihre Beine schlugen. Vielleicht waren sie unterwegs zur Klagemauer, vielleicht fand dort eine Rekrutenvereidigung statt. Ein anderer Zug kreuzte. Statt verbeulter Stahlhelme trugen diese Männer storchennestgroße Fuchsfellhüte auf den Köpfen und statt der M16 gerieten ihre herabhängenden Schläfenlocken ins Schlenkern, so eilig hatten sie es von ihrem Viertel Mea Shearim zur Klagemauer, ein Weg, der direkt durchs Moslemviertel führt.
Das Arabische ist der Mörtel des alten Jerusalem. Das, was immer da ist, der Sand in den Ritzen, der Sound in der Luft. Die jäh und immer wieder unerwartet einsetzende Rezitation der Suren, vom Minarett herab oder von einer CD. Manche Händler spielten sie so laut ab, daß es die halbe Gasse hörte und ihre Geschäfte zum Erliegen kamen. Ein flüchtiger Seitenblick in die Tiefe eines Ladens konnte den Moment erfassen, in dem der Friseur, der mich immer grüßte, der Antiquitätenhändler, der immer fragte, wann ich hereinschaue, der Chef des Internetcafés, in dem oft dieser dicke griechische Mönch beim Ballerspiel saß – daß sich diese Männer mit beiden Händen übers Gesicht strichen und, auf dem Gebetsteppich kniend, gen Mekka beugten.
Arabien, das sind die beleibten Frauen am Damaskustor, mitten im Passantenstrom auf der Gasse sitzend, ihn teilend wie Felsen die Flut, vor sich ihre Ware, kleine Kräuterhaufen auf Plastikplanen. Und natürlich die Kaffeesieder in ihren düsteren Gewölben, diese Virtuosen der Kupferkännchen über den lodernden Flammen ihrer Gaskocher. Nicht zu vergessen die Jungen, die durch die Reihen der Alten gehen, um deren Wasserpfeifen mit frischer Kohle zu versorgen, als handelten sie im geheimen Auftrag, die arabische Glut nie erlöschen zu lassen.
Schließlich ihre kleinen quirligen Brüder, stets auf dem Sprung, den großen Bleichgesichtern, diesen immer etwas ungelenken, sperrigen Abendländlern, die sich ins arabische Gewirr getraut haben und nun nicht recht weiterwissen, die Orientierungsnot vom Gesicht abzulesen und diese schwerfälligen Wesen wieder aus der Wildnis herauszuführen wie junge Hirten ein verirrtes Tier, gegen einen Lohn, den sie lautstark fordern, mit rauher Stimme schon sie, die den Stimmbruch noch vor sich haben.
Auch wenn die Stadt voller Pilger war, voller Nonnen und Mönche, voller Kirchen, Hospize, Patriarchate, Klöster und Kreuzwegstationen – das christliche Herz Jerusalems schlägt in einem orientalischen Körper.
Nichts für schwache Nerven war dieses Durcheinander aus Himmel und Erde, aus Allerheiligstem und Rinnsalen von Wasser und Blut, in der Gasse der Schlachter. Das Chaos der Düfte. Herrlich roch es aus der schwärzlichen Bäckerhöhle nach frischem Brot, aus dem Laden für Eisenwaren nach Eisen, gleich darauf süßlich nach frischen Innereien. Clash der Dünste und Offenbarungen als Normalzustand. Sich kreuzende, ineinander bohrende, einander ignorierende Züge und Prozessionen der gegensätzlichsten Art auf diesem einen Quadratkilometer. Pilger und Soldaten, Bettler und Irre, Gläubige und Geschäftemacher, Freund und Feind, Russen und Amerikaner, Juden und Araber, Türken und Armenier, und das alles in der Enge der uralten Tunnel und Gassen.
Im jüdischen Viertel gaben sich die Bettler als fromme Juden aus, ließen sich Bärte wachsen, warfen sich in lange schwarze Mäntel und segneten jeden, der ihnen unterkam. Legten ihm, ob er wollte oder nicht, die Hand aufs Haupt, murmelten nachlässig etwas dazu, nötigten ihm die Gabe ab. Im Moslemviertel kostümierten die Bettlerinnen sich als fromme Moslems. Vollverschleiert zu schwarzen Gespenstern, saßen sie auf der Gasse, lebende Appelle an die Pflicht zur milden Gabe.
Bei den Verrückten war es so: Die weiblichen unter ihnen zogen es vor, drinnen verrückt zu sein, sie gingen in Cafés und Kirchen um, ihre Verrücktheit wirkte in der Intimität der Räume. Die Männer aber waren draußen verrückt, ihr Wahnsinn, schweifender als der weibliche, brauchte die Weite der großen Stadttore und Plätze.
Manchmal schloß ich die Augen, dann war Jerusalem ein Duft aus glühender Wasserpfeifenkohle, Unrat und starken Gewürzen, ein Wirrwarr aus heiseren Rufen und Glocken, hellen und harten. Die geflüsterte Bitte der Bettlerin wehte heran, übertönt von Pilgergesang und frommen Rezitationen der Eiligen, unterwegs zum Felsendom oder zur Klagemauer, dann wieder unbefangen lautes Geplapper, oft russisch oder amerikanisch.
Jerusalem eine Stadt zu nennen, wäre irreführend – eine Stadt, verstanden als halbwegs planvolles, lesbares Menschenwerk aus Straßen und Häusern. Sollte ich es einem schildern, der es nicht kennt, ich würde ihn bitten, nicht an Städte zu denken. Ein Brot ist Jerusalem, ein hartes Brot, gebacken nach uraltem Rezept, gewürzt mit Geschichten, Geheimnissen, Prophetien. Als habe jemand das alles lange geknetet und in den Jahrtausendofen geschoben, so einen, wie ich sie frühmorgens sah, wenn die Bäckerjungen aus den väterlichen Backhöhlen stiegen, das duftende Brot auf Brettern auf der Schulter tragend.
Die Jerusalem-Sehnsucht hat zu allen Zeiten die unterschiedlichsten Liebhaber ergriffen. Von den ersten Jahrhunderten nach Christus an zog es Pilger zum Heiligen Grab. Mönche, Laien, Könige. Kreuzritter gaben ihr Vermögen daran, Jerusalem zu sehen, und machten ihr Testament, wissend, daß die Chance, lebend heimzukehren, gering war. Der heilige Franziskus versuchte es immer wieder und scheiterte immer wieder, bis es ihm endlich gelang.
Und zu allen Zeiten verließen Rabbiner ihre Städte in Rußland, Galizien, Spanien oder Marokko, um sich mit ihren Schülern in Jerusalem anzusiedeln. «Nächstes Jahr in Jerusalem!», in manche fuhr der Ruf so stark, daß sie hinmußten, koste es, was es wolle. Wer für diesen Ruf kein Ohr hatte, wer unmusikalisch war für das Heilige der Heiligen Stadt, der hatte hier nichts verloren.
Ist Jerusalem schön? Oh ja, aber seine Schönheit zeigt sich nicht jedem und nicht umsonst. Jerusalem ist eine orientalische Frau. Wer sie sehen will, muß erst durchs Dunkel wandern, lange durch obskure Tunnel irren, durch Gänge und Gewölbe, auf den Abend warten. Den richtigen Moment finden, die richtige, unscheinbare Tür oder Treppe. Irgendwo führt immer eine Stiege hinauf auf ein Dach. Diese flachen Steindächer sind Jerusalems Königslogen – und nun war es soweit, die Vorstellung konnte beginnen.
Der Abendhimmel goß sein Licht verschwenderisch aus. Was steinweiß gewesen war und steingrau, also alles hier, das errötete jetzt. Alles lag hingebreitet, Stadt und Welt, ein einziger Körper, alle Partien ausgebildet, die Täler und Hügel grandios beleuchtet, die Stadt, in ihre Mauer gegürtet, hart darunter die große Falte, das Kidrontal, drüben am Ölberg Gethsemane, der Garten der letzten Nacht vor der Passion, hinter dem Ölberg die Judäische Wüste. Steinernes Land. Dornen und Fels. Aber der Stein ist fruchtbar. Bilder entspringen, schlägt man nur drauf.
Moses, der aus der Wüste kam. Johannes, der Wüstenheilige, der von sich sagte, er taufe mit Wasser, es werde aber einer kommen, der taufe mit Feuer. Dieser Jesus dann selbst in der Wüste, vierzig Tage lang fastend. Schließlich die große Szene, in der Satan ihn aus der Wüste nach Jerusalem holt, ihn auf die Zinne des Tempels stellt und danach auf einen Berg, ihm die Reichtümer dieser Welt zeigt, ihm das alles verspricht, wenn er ihn nur anbete. Der Dialog der beiden dann, Gottes Sohn und der Teufel im Schlußplädoyer, und beide fechten mit denselben Waffen, beide zitieren dieselbe Heilige Schrift. So etwas konnte einem nur hier einfallen, das konnte nur hier geschehen.
Jerusalem leuchtete im letzten verrückten, verzückten Licht, und mir leuchtete das alles ein auf meinem Dach, als sei es nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit einem Extrakt aus Dornbuschsaft, gekocht auf offenem Feuer vor einem der schwarzen Beduinenzelte in der Wüste. War Jerusalem schön? Hätte der Versucher dem Mann aus der Wüste lieber Rom zeigen sollen? Persepolis? Alexandria? Man sagt, der Teufel habe einen guten Geschmack.
Bis die Nacht kam, stand ich da oben, dann stieg ich wieder hinab ins ewige Halbdunkel der Höhlen, Tunnel, Konvente, tagsüber im immerwährenden Schatten, nun schwach beleuchtet, und fragte mich, ob es wohl einen gab in ganz Jerusalem, einen einzigen, der von sich sagen durfte, er kenne seine Stadt. Ich bezweifelte es.
Charly Effendi
Um so neugieriger war ich auf den Mann, den ich am nächsten Abend treffen würde. Ein Freund hatte ihn mir ans Herz gelegt – wenn einer Jerusalem kenne, dann dieser armenische Fuchs. Nur eines hatte der Freund vergessen, mir den Mann zu beschreiben. «Am Jaffator um sechs», war die knappe Antwort, als ich ihn anrief, um zu fragen, wann er Zeit habe. Um Viertel vor sechs stand ich dort. Meine Sorge, ihn zu verpassen, schien begründet, es war schon dunkel und der Platz am Jaffator weitläufig und sehr belebt um diese Zeit.
Um Punkt sechs sah ich einen Mann vom armenischen Viertel herbeischlendern. Er fiel auf in der Menge, aber nicht weil etwas äußerlich Auffälliges an ihm gewesen wäre. Unscheinbar kam er daher, nicht groß, von robuster Gestalt, in dunkler Hose und dicker Jacke, eine etwas zu kleine Strickmütze spitz auf dem Kopf. So ähnlich liefen jetzt im Winter