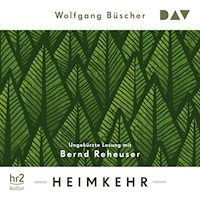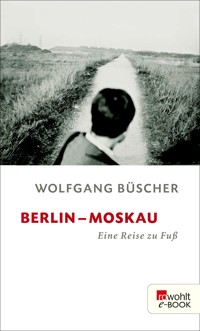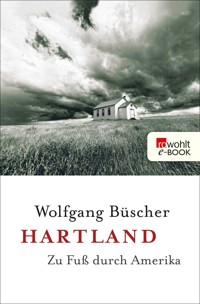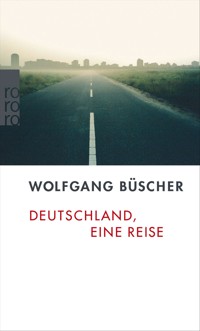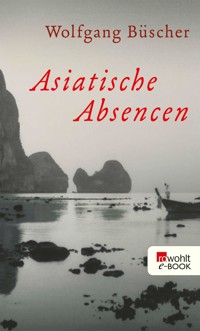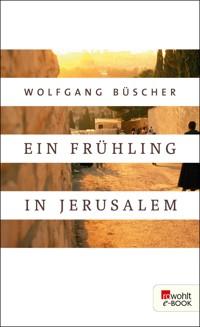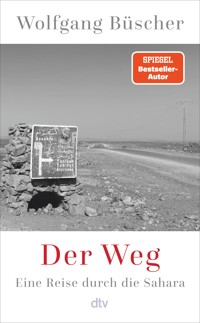
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit den Tuareg durch die Sahara auf den Berg des Einsiedlers Tief in der algerischen Wüste steht ein Haus, roh auf einem Hochplateau, es hat einen einzigen Raum. Eine Klause, ein Rückzugsort. Der Mann, der es baute, war glücklich dort. Immer tiefer hatte es ihn in die Wüste gezogen; nun war er ganz allein. Nachts mit den Sternen, und wenn er früh aus der Tür trat, sah er in eine unendliche Landschaft aus gelben Bergen. Wie oft bei seinen Büchern, war es auch diesmal ein Bild, das bei Wolfgang Büscher den Wunsch auslöste, dorthin zu gehen. Eine Reiseerzählung aus der Sahara – und über Charles de Foucauld, den Mann, der dort in den Hoggar-Bergen sein Haus gebaut hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
»Von Algier waren wir losgeflogen, eine Stunde vor Mitternacht. Der Hohe Atlas lag wohl hinter uns und unter uns nun die Sahara, doch das blieb eine Vermutung. Im Vollmondlicht hatte ich die Wüste sehen wollen, erstmals im Leben, aber der Mond zeigte sich nicht. Die Nacht blieb schwarz, die Wüste unsichtbar. Ich hatte sie lange gemieden, warum? Das wusste ich nicht, nun flog ich hinein, so tief hinein wie nur möglich in dieser sternlosen Nacht. Alles, was leuchtete, waren die Zeichen über mir. Nicht rauchen. Anschnallen. Hilfe. Neben mir döste alles in seinen Sitzen, nur ich starrte hinaus ins Dunkel. Ich gab es auf, schloss die Augen und überließ mich dem einschläfernden Brummen der Motoren, ließ mich fallen in das, was kommt, wenn die Lider sinken. Ein Traum, immer der gleiche. Auf einem Berg sitzend, oben am Hang, noch einmal die Welt sehen in ihrer Schönheit und ihrem Drama, aber nicht mehr nah, schon in einigem Abstand, nicht mehr lärmend, kein Wimmelbild – die Welt als Wüste. Sandig, steinig, da sumpft und fault nichts.«
Wolfgang Büscher
Der Weg
Eine Reise durch die Sahara
Inhaltsverzeichnis
I
Nacht über Afrika
Großer Süden
Kat-Kat
Eine Freundschaft in der Wüste
Ahaggar – wo die Vulkane schlafen
Der stille Fahrer
Etwas dämonisch Packendes
Bildnis des Wüstenheiligen als junger Lebemann
II
Ein neuer Gefährte
Nachts reisen nur die Räuber
Caravan Highway
Ein unstillbarer Durst
Der Wind in den Dünen – Erg Admer
Ein Abend in Djanet
La vache qui rit, la vache qui pleure
Das geschenkte Gewehr
Sand und Gold – Amadror
Spiel mir, Königin, ein Lied auf dem Haar meines Feindes
III
Verloren gehen
Stille aus Stein – Atakor
Der Stumme
Der letzte Tag des Marabout
Ein betender Berg
Das Haus auf dem Mars
Eremitische Nacht
Dank
I
Nacht über Afrika
Von Algier waren wir losgeflogen, eine Stunde vor Mitternacht. Der Hohe Atlas lag wohl hinter uns und unter uns nun die Sahara, doch das blieb eine Vermutung. Im Vollmondlicht hatte ich die Wüste sehen wollen, erstmals im Leben, aber der Mond zeigte sich nicht. Die Nacht blieb schwarz, die Wüste unsichtbar. Ich hatte sie lange gemieden, warum? Das wusste ich nicht, nun flog ich hinein, so tief hinein wie nur möglich in dieser sternlosen Nacht. Alles, was leuchtete, waren die Zeichen über mir. Nicht rauchen. Anschnallen. Hilfe.
Neben mir döste alles in seinen Sitzen, nur ich starrte hinaus ins Dunkel. Ich gab es auf, schloss die Augen und überließ mich dem einschläfernden Brummen der Motoren, ließ mich fallen in das, was kommt, wenn die Lider sinken. Ein Traum, immer der gleiche. Auf einem Berg sitzend, oben am Hang, noch einmal die Welt sehen in ihrer Schönheit und ihrem Drama, aber nicht mehr nah, schon in einigem Abstand, nicht mehr lärmend, kein Wimmelbild – die Welt als Wüste. Sandig, steinig, da sumpft und fault nichts.
Jetzt zuckte draußen ein Licht, es riss mich aus meinem Traum, es musste real sein. Ein anderes Flugzeug auf seinem rasenden Kurs, eine Sternschnuppe, ein Irrlicht? Begann nicht so alles Reisen ins Unbekannte – irrlichternd, unbestimmt, intuitiv? Eines Tages losgehen, besser eines Nachts. Nach Gründen gefragt, konnte ich nur solche nennen, an die ich nicht glaubte. Ins Fremde gehen, es blieb ein Entschluss ohne Zweck, ohne Ziel. Nach Moskau gehen, durch Amerika, nach Jerusalem, hatte es je einen Grund dafür gegeben, einen vernünftigen gar?
Es brauchte keine Gründe, es reichte ein wenig Schmierstoff, ein Reiz. Ein Bild, das mir nicht aus dem Sinn ging, eine Liedzeile, die sich ins Hirn bohrte, oder der Bericht von einem, der dort gewesen war, und sei, was er berichtete, noch so vage. Oder, wie jetzt, ein unscharfes Foto im Internet – ein Wald gelber Felsnadeln, ein Konvent alter Vulkane im Herzen der Wüste. Es reichte der Klang dieser Namen, schön und fremd.
Ahaggar. Ajjer. Erg Admer.
Amadror. Atakor. Assekrem.
Und der Zauberspruch hatte seine Wirkung getan, sein Silbengeläut die alte Wüstenscheu zum Teufel gejagt und mich auf meinen Flug gebucht. Ich zog die Karte hervor, sie war immer griffbereit. Carte Internationale du Monde, Édition speciale Tamanrasset. Sie enthielt all die Namen dieser Berge und Wüsten. Und noch ein Name stand da, beim Gipfel des Assekrem: Ermitage de P. de Foucauld.
Auch da hinauf wollte ich, zu seiner Gipfelklause. Ein seltsamer Heiliger, dieser Père de Foucauld. Aristokrat, Soldat, Abenteurer, Einsiedler in der Wüste, ein zeitlebens seinen Weg suchender Mann – den ihm bestimmten Weg, das richtige Leben. Am Ende fand er einen gewaltsamen Tod. Der weiße Marabout, so hatten ihn die Tuareg genannt. Meine Karte verzeichnete seinen Namen auf dem Gipfelplateau des Assekrem.
Noch so ein hochinfektiöses Internetfoto. Seine Klause dort oben aus schwarzen Steinen im schwarzen Land Atakor. Sie stand noch immer dort, seit über hundert Jahren, und es hieß, es lebten noch immer Eremiten auf dem Assekrem, solche wie er. Am Ende meiner Reise würde ich dort hinaufsteigen und sehen, was war.
Ein hässliches Dingdong riss mich aus meinen Träumereien, eine weibliche Stimme sagte auf Arabisch und dann auf Französisch, der Kapitän habe die Anschnallzeichen eingeschaltet, man erwarte Turbulenzen – des turbulences. Es ruckelte ein bisschen, und als wir wieder sacht dahinflogen, kroch der Mond doch noch aus dem Gewölk und ließ mich die Wüste immerhin ahnen.
Formlos, farblos erst, dann meinte ich, etwas wie Wellen zu erkennen, als wäre ein Ozean abgeflossen und hätte auf dem sandigen Meeresgrund seinen Abdruck zurückgelassen. Es wurde noch etwas heller, oder meine Augen gewöhnten sich an das vage Licht, nun machte ich Höhen und Tiefen dort unten aus, Dünenkämme und hier und da ein Oued, ein ausgetrocknetes Flussbett.
Ich sah den Abendstern, einsam in eisigem Stolz. Aber so allein war er nicht. Ihm antwortete tief unten ein Licht, als spiegele er sich im Wüstensand. Ein Licht, ebenso einsam, aber nicht eisig, es musste menschengemacht sein, ein Feuer vielleicht, das eines Nachtlagers, denn es bewegte sich nicht wie eben das zuckende Licht, es blieb an seinem Ort. Ein Mensch an seinem Feuer, wenigstens einer in der menschenlosen Weite dort unten.
Er hatte sich den Lagerplatz für diese Nacht gesucht, war hinaus in die Wüste gegangen, um trockene Äste und Zweige zu sammeln, nun rückte er dicht an die Glut, sich wärmend in der nächtlichen Kälte, oder lag schon hingestreckt da, den Schlaf erwartend, die Sterne betrachtend. Wo werden deine Feuer brennen in den Nächten, die kommen? Wer wird mit dir dort unten lagern, und werden sie dich mitnehmen in ihre Wüste, in das, was sie von ihr wissen, und wirst du ihnen vertrauen? Wirst du genug Holz finden, um dein Feuer zu unterhalten, und Schlaf unter den kalten Sternen? Wie wird es sein?
Großer Süden
Terra deserta – verlassenes Land, so wurde die Sahara in römischer Zeit genannt. Große Wüste, so hieß sie im Mittelalter. In diesen Namen schwangen Scheu und etwas wie Ehrfurcht mit. Auch im heute gebräuchlichen Namen für ihren algerischen Teil, den wir in dieser Nacht überflogen, schwang die Grandiosität der weltgrößten Wüste mit, größer als Spanien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Polen zusammen: Le Grand Sud.
Die Oase, auf die unser Sinkflug zuhielt, lag da wie eine Milchstraße in einem Himmel aus Sand. Eine dunkle Schneise teilte sie in zwei helle Streifen, das musste das Oued sein, das trockene Bett des Tamanrasset-Stroms, der hier vor Zeiten geflossen war. Eine Oase? So sah keine Oase aus. Eine Stadt, groß, lichterflirrend, einzigartig im Großen Süden, Tagesreisen entfernt von anderen Orten, die sich Stadt nennen durften. Weit und breit nur Nomadensiedlungen und winzige Dörfer.
Die Stadt stellte die Wüste um sich her in den Schatten, als schämte sie sich ihrer Oasenherkunft. Wäre ich in einer Nacht vor hundert Jahren darübergeflogen, da wäre keine Milchstraße gewesen, allenfalls hätten ein paar Feuer geflackert, vielleicht nicht einmal das.
Ein junger Mann der Agentur, ohne die ich die Reise nicht hätte antretreten dürfen, erwartete mich am Flughafen und fuhr mich durch die nächtliche Stille der Wüstenstadt. Kein Straßenleben um diese Nachtzeit, ich sah Tamanrasset, wie man eine Schlafende sieht. Oder eine Halbschlafende. Meinem Blick ausgeliefert lag sie da, alles andere als feingemacht. Alles an ihr schien staubig, unfertig, unstet.
Rohbauten, rasch hochgezogen, manche auf halbem Weg aufgegeben. Aus dem Beton stachen Moniereisen in die Nacht, senkrecht wie Antennen. Garagenhafte Läden überall, mit Rolltoren statt Türen, in manchen brannte noch Licht, und es war weit nach Mitternacht. Wer ging jetzt noch aus, um Orangen zu kaufen?
Aber der Gemüsemann hielt seinen Stand erleuchtet und geöffnet, als wäre das eine dumme Frage. Wer holte sich jetzt noch eines der verbrutzelten Brathähnchen, die sich aufreizend langsam unter nackten Glühbirnen an ihren Spießen drehten, wahrscheinlich schon den ganzen Tag und die halbe Nacht – hatte man vergessen, den Bratapparat auszuschalten, oder war auch dies der idiotische Einwand eines Fremden, der Tamanrasset nicht verstand?
Alles bestärkte den Eindruck eines improvisierten Ortes in Unrast, an dem man jederzeit ankommen und den man zu jeder Tages- und Nachtzeit verlassen konnte, für Proviant war immer gesorgt, auch jetzt, früh um drei. Erklärungen würden schon bald meine Reisegefährten liefern. Zwei von ihnen waren Ahaggar-Tuareg, also Leute von hier. Tamanrasset, würden sie mir wieder und wieder sagen, sei einst ihre Oase gewesen und dann ihre Stadt, aber die sei es nicht mehr, es sei eine Stadt derer geworden, die aus dem Norden herzogen, und derer, die aus dem Süden durchzogen, une ville des étrangers.
Eine Stadt der Fremden, die als Soldaten, Polizisten, Beamte aus dem arabischen Norden kamen und die Kasernen und Behörden bevölkerten. Dass die Stadt eine bedeutende Garnison war, zeigte schon die nächtliche Fahrt. Immer wieder passierten wir Armeekasernen, leicht zu erkennen an ihren Wachtürmen, manche mit Sandsäcken in den Schießscharten, und auch solche der Gendarmerie und der Polizei. Wo vor größeren Gebäuden die Staatsflagge gehisst war, vermutete ich Behörden hinter den hohen Mauern.
Zugleich war Tamanrasset eine Stadt der Fremden aus dem Süden, die auf den Baustellen und in den Küchen der Cafés und Imbisse arbeiteten, bis sie genug Geld hatten für die Weiterreise nach Norden und übers Mittelmeer nach Europa, denn das war am Ende ihr Ziel, nicht Tunis, Oran oder Algier. Ich dachte an Frontier Towns, die rasch aus dem Staub gezimmerten Städte der Siedlerjahre des amerikanischen Westens.
Die Frontier, la frontière, das war hier der Süden. Zu den Grenzen von Mali und Niger waren noch einige hundert Kilometer Wüstenroute zu bewältigen. In umgekehrter Richtung aber war Tamanrasset das erste attraktive Ziel nördlich von Schwarzafrika, die erste große Station auf der Route aus dem Süden in den arabischen Norden des Kontinents, an die lockende Küste und weiter, weiter.
Der Fahrer hielt vor einem kleinen Hotel, das eine Baustelle war. Ich fiel, kaum ausgestreckt auf dem Bett, in einen reglosen, traumlosen Schlaf, bis die Baustelle mich weckte. Die Stimmen der Arbeiter vor meinem Fenster waren ausnahmslos die von Schwarzafrikanern. An der nächsten Straßenecke fand ich ein Café, eigentlich nur ein hüfthoch ummauertes Blechdach mit Tischen und Stühlen darunter und eine Bude mit Espressomaschine, sodass fast immer eine angenehme Brise durch den luftigen, nach allen Seiten offenen Raum strich.
Es blieben ein paar Tage Zeit bis zum Aufbruch in die Wüste, und so lief ich durch die Straßen oder saß da, um dem Leben zuzusehen in der Stadt der Fremden, und wie es mit Erkenntnissen ist, die einen springen ins Auge, andere stellen sich erst nach und nach ein. Ins Auge fielen all die Männer, die hier Etappe machten. Der vielbeschrittene Sehnsuchtsweg nach Norden versorgte die Stadt mit billigen Händen. Wo unter praller Sonne geschaufelt, gehämmert und Betonmischer gefüttert wurden, wo Gruppen junger Männer an den Straßen der Stadt hockten, wartend, dass ein Transporter hielt und man sie für solche Arbeiten anwarb und auflud, da handelte es sich ausnahmslos um junge Männer aus Schwarzafrika.
Andere sah ich, wie sie, schon angeworben, dicht gedrängt auf offenen Lastern zu den vielen Baustellen der Stadt gebracht wurden. Oder wie sie durch die Straßen liefen in abgetragenen oder zerfetzten Hosen und Hemden, die Wollmütze auf dem Kopf, den schweren Hammer in der Hand, ihr eigenes, einziges Werkzeug. Wer gar nichts konnte oder hatte, watete bis zu den Knien im Müll an den Straßen oder im Oued, auf der Suche nach Dingen, die sich noch brauchen oder, wer weiß, verkaufen ließen.
Wieder andere hatten es offenbar geschafft, aus der Mühsal harter körperlicher Arbeit aufzusteigen zu Straßenhändlern. Übergroße, golden blinkende Armbanduhren. Glitzernder Schmuck. Handy-Ladekabel und sonstiges Zubehör. Spiegelnde Sonnenbrillen. Tuareg-Schwerter. Bunte Parfümflakons. Eine Kiste Bananen. Ein Glas Tee. Das alles feilgeboten auf einem wackligen Tischchen oder in einem Pappkarton. Und durch die Cafés zogen bettelnd die Kinderscharen des Südens.
Bei meinen Gängen stieß ich auf die Reste einer kühnen Idee – eine prächtige Promenade am Oued, am ausgetrockneten Tamanrasset-Strom. Jemand hatte den Plan gefasst, den toten Strom wiederzubeleben. Eine Uferpromenade an einem Fluss, der kein Wasser mehr führte, und der Plan war ausgeführt worden. Ich schritt die Promenade quer ab: mehr als 25 Schritte breit. Ich zählte ihre Arkaden, in denen niemand sich niederlassen mochte, kein Geschäft, kein Café, nicht mal ein müder Passant: 156 doppelt mannshohe Bögen.
Doch was so kühn gedacht war, es verfiel unter der Wüstensonne. Ich bedauerte die Palmen, die gusseisernen Bänke und Laternen der verschmähten Promenade, sie litten alle. Palmen verdorrten, Bänke waren halb abgerissen, für den Schrottwert ihres Eisens vielleicht, Laternen spendeten längst kein Licht mehr, manche standen geköpft da.
Diese Promenade an einem Strom, in einer Stadt am Rio de la Plata oder am Mekong, hätte ein von Leben und Nachtleben sprühender Ort werden können. Hier war die Rebellion der menschlichen Phantasie gegen die Macht der Wüste gescheitert, die Wüste hatte gesiegt.
Dass sie einst eine grünende Savanne gewesen war, imstande, große Säugetiere zu ernähren, und dass Menschen hier Kamele und Rinder gehalten hatten, bezeugten viele neolithische Felsmalereien. Gewissheit darüber, dass vor rund 5000 Jahren ein gewaltiger Strom durch diese Savanne geflossen war, brachten Satellitenaufnahmen. Sie fanden ein halb Nordafrika durchmessendes Flussbett unter dem Wüstensand. Zudem wurden Sedimente eines prähistorischen Flussdeltas vor der mauretanischen Küste entdeckt.
Beides passte zusammen – der Tamanrasset-Strom, entsprungen im Bergland des Ahaggar, hatte die riesige Savanne belebt, durch die Giraffen zogen, Elefanten und Strauße, wo Menschen jagten und Herden weideten, und war in jenem Delta in den Atlantik gemündet. Schon als wir das Flussbett in der ersten Nacht überquerten und die Brücke nicht enden wollte, hatte ich eine Ahnung davon bekommen, wie breit der urzeitliche Strom gewesen sein musste, nun bei Tage sah ich es klar.
Eine Erkenntnis, die nicht gleich ins Auge sprang, die sich ein, zwei Tage lang lediglich als leise Verwunderung regte: Wohin ich auch ging, ich blieb unter meinesgleichen, ein Mann unter Männern. Immer nur Männer. Nie Frauen. So war es in meinem luftigen Lieblingscafé, so war es in den anderen Kaffeebuden, die ich aufsuchte, und überhaupt tagsüber auf der Straße. Und abends auch, wenn ich auf der immergleichen Terrasse, wo man mich schon wie einen Stammgast grüßte, meinen Lieblingstisch ansteuerte und die immergleichen vier Grillspieße bestellte, mit Salat, Pommes und Wasser, dazu kamen große Körbe voll geschnittener Baguettes auf die Tische.
Wahrscheinlich war mir das Unter-sich-Sein mit meinesgleichen nicht gleich aufgefallen, weil es erst einmal nicht störte. Es war keineswegs unangenehm, ein Mann unter Männern zu sein. Es hatte sogar etwas beruhigend Homogenes. Unaufgeregt ging es zu, oft freundlich. Und kam es zu Spannungen, wurde im luftigen Café ein Tisch junger Männer einmal laut, legten ein oder zwei ihren Auftritt hin, so blieben es doch kurze, fast sportliche Aufwallungen unter ihresgleichen. Das Gefühl eines Mangels stellte sich erst mit der Zeit ein. Es fehlte die Grundspannung – die der Geschlechter. An diesen Orten knisterte nichts.
Männer an den Tischen als Gäste, Männer in den Küchen und als Kellner, Männer an den Hebeln der Kaffeemaschinen, ohne Ausnahme. Natürlich liefen Frauen durch die Stadt, aber sie und die Männer bewegten sich bloß scheinbar im selben Raum. Tatsächlich waren sie in verschiedenen Sphären unterwegs, in eigenen Umlaufbahnen, die einander nie berührten. Frauen eilten, Männer verweilten.
Die einen hatten offensichtliche Gründe, kurz auf die Straße zu gehen, sie trugen Einkäufe heim oder führten Kinder an der Hand, oder sie waren Schülerinnen und gingen in Mädchengruppen von der Schule heim. Die anderen brauchten solche Gründe nicht, sie hatten einfach Zeit und Lust, draußen unterwegs zu sein, im Café zu sitzen, zu rauchen, Freunde zu treffen. Es war ihr Raum, und meiner.
Was mich anging, so lief ich außer Konkurrenz durch die Stadt, ich gehörte keiner ihrer Kategorien an. Zählte nicht zu den Fremden von Tamanrasset, nicht zu denen aus dem Norden noch zu denen aus dem Süden. Ein Europäer fiel auf, wurde auf den ersten Blick bemerkt, wurde angelächelt, vielleicht sogar angesprochen, denn viele meinesgleichen sah man hier nicht, so einer war eine Rarität. Kein Ärgernis, das nicht, nur interessant.
Was wäre, nähme statt meiner eine Frau an meinem Tisch Platz? Die Antwort blieb aus, dergleichen geschah nicht. Was wir Männer taten in unserer Sphäre, taten Frauen nicht. Sie liefen durchs Bild und verschwanden. Überquerten die Straße oder gingen vorbei an meinem luftigen Aufenthalt, ohne Halt, ohne Neugier, ohne einen Blick. Sie liefen durch Bilder, bewohnt von uns Männern.
Es wurde Zeit, an den Aufbruch in die Wüste zu denken. Ein letztes Mal schlenderte ich durch Tamanrasset, und wieder waren die Bettlerinnen da. Tagein, tagaus schwärmten sie durch die Straßen, Cafés und Imbisse – eine Frau oder ein etwas älteres Mädchen von sieben oder acht Jahren führte eine Schar kleiner und kleinster Kinder, allesamt aus dem Süden heraufgezogen, und schon die kleinsten Mädchen, zwei oder drei Jahre alt, trugen das Kopftuch, eng ums Gesicht gebunden, lang herabhängend.
Es hüllte ihre winzigen Körper ganz ein, bis zu den nackten Füßen. In dieser Verhüllung, die an angelegte Flügel denken ließ, glichen sie ernsten, zarten Vögeln, wenn sie durch die Cafés und Imbisse von Tamanrasset zogen und die Hände aufhielten oder fordernd an einem Ärmel zupften. Ihre eng in die Ganzkörperschleier gewickelten Köpfchen bestärkten das Bild eines Vogelschwarms.
Mehr sah man von ihnen nicht als dieses dunkle Gesichtsoval, gerahmt vom oft helleren Schleier, als ihre dunklen Hände und Füße. So schwirrten sie durch die Cafés, Spatzenwolken auf der Suche nach Krumen, nach Münzen, nach einem erst halb aufgegessenen Kuchen auf einem Plastikteller, einer noch nicht ganz ausgetrunkenen Cola. Flatterten durch den Raum und dann weiter zum nächsten, um dort Krumen zu suchen, Münzen zu fordern.
An diesen Kindern war keine Scham oder Befangenheit, sie taten das von klein auf, und Spiel und Ernst waren unzertrennlich. Manchmal schmiegten sie sich an einen der Gäste, vielleicht weil sie ihn kannten oder weil sie einige Augenblicke dem folgten, was er auf seinem Handy spielte. Manche waren so klein, dass sie nur bis zu den Knien der Männer in den Cafés reichten. Die gaben etwas, kleine Münzen oder etwas zu trinken. Oder auch nicht.
Auch an den Männern war keine Befangenheit, keine Moral, nichts von dieser Art. Nur manchmal, wenn es einem Imbisschef zu aufdringlich wurde, vertrieb er die Spatzenwolke aus seiner Bude, ohne übertriebene Mühe, ohne Wut. Eher wie man Fliegen vom Teller verscheucht. Wusste er doch, sie kamen wieder. Sie würden immer da sein.
Am letzten Abend betrat ein alter Mann in abgetragener Tuareg-Kleidung die Terrasse der Baguettebrote und Fleischspieße, auf der ich, wie üblich, saß. Wie viele hier trug er Chech und Gandoura, den meterlangen, um den Kopf geschlungenen Schal und das fußlange Hemdkleid. Die Farben der anderen Schals und Kleider waren Blau oder Grün, Weiß oder Schwarz – seine hatten keine erkennbare Farbe mehr.
Er ging an einem langen Stock wie ein archaischer Hirte, er ging langsam, wie alte Männer gehen, ging in abgewetzten Kleidern, wie Bettler sie tragen, aber mit ruhigen Bewegungen, wachen Augen, seine beherrschte, fast stolze Art stand im Kontrast zu seinem Äußeren. Er setzte sich an einen Tisch im Schatten, aufrecht, und ruhte ein wenig aus, bis man sein Essen brachte, aber nicht auf einem Teller wie mir und den anderen Gästen, ihm hatte man es in eine Plastiktüte gesteckt.
Er stand auf, hängte das Essen an seinen Stock, schulterte ihn und ging so stolz und beherrscht, wie er erschienen war, wieder hinaus in die Wüstensonne. Und sein schwer zu lesendes Wesen spiegelte sich in der Art, wie ihn die Kellner behandelten. Wie einen Bettler und König zugleich. Offenbar kannten sie ihn, sie gaben ihm zu essen, wie man Almosen gibt, und doch behandelten sie ihn mit großer Höflichkeit.
»Er könnte mein Großvater sein«, sagte der Kellner, den ich ansprach, gefolgt von einem Al-hamdulillah. Gelobt sei Gott, Dank sei Gott. Ich würde die Formel noch viele Male hören unterwegs. Manchmal bestanden Gespräche aus nichts anderem als dem fünffachen, zehnfachen Austausch solcher Gotteslobe. Dann sagte der Mann noch etwas auf Tamahac, der Sprache der Tuareg des Ahaggar, die ich nicht verstand, aber auch das klang nicht abfällig, eher nach einem Segenswunsch für den rätselhaften alten Mann.
Kat-Kat
Am dritten Morgen, zur vereinbarten Stunde, traf ich meine Reisegefährten am Hotel. Drei Männer, zwei unübersehbar Tuareg in ihrer traditionellen Kleidung, fußlangen Gandouras und Gesichtsschleiern. Der Ältere, hager und nicht leicht lesbar hinter seiner dunklen Sonnenbrille, war der Fahrer, der jüngere der Koch. Der Dritte, ein arabischer Algerier, großgewachsen, sportlicher Typ, stellte sich als mein Guide vor. Sie standen bei dem weißen Toyota, mit dem wir unterwegs sein würden, einem der hier üblichen Geländewagen, Kat-Kat genannt, ein Kurzwort für Allradantrieb, französisch quatre-quatre.
Unser Kat-Kat war gezeichnet von vielen Wüstenfahrten. Seine rostigen Beulen flößten mir Vertrauen ein, er war immer durchgekommen, lange schon, das sprach dafür, dass er wieder durchkam. Meine Begleiter hatten ihn vollgepackt mit Wasser, Essen, Kochgerät, Matten, einem kleinen Zelt für mich und einer Menge Decken für die kalten Nächte, die uns erwarteten. Auf dem Dach waren weitere Vorräte mit sonnengebleichten blassblauen Seilen festgezurrt.
Zu viert waren wir, so war es gewünscht und ausgemacht mit den Behörden, darauf hatte ich keinen Einfluss gehabt. Eine ungewohnte Art, unterwegs zu sein, für einen, der immer allein gereist war. Ich hoffte, es würde gut gehen mit uns Vieren. Den halbherzigen Versuch, uns bei unseren richtigen Namen zu nennen, gaben wir rasch auf. Alle sahen, wie unpraktisch es war. Wir brauchten handliche Namen, Reisenamen auf Zeit, leicht auszusprechen und kurz, zwei Silben, besser eine. Und so gaben wir uns welche.
Der Guide war ein großer Kerl, also hieß er Kabir, arabisch für: der Große. Der Koch brachte mir unbeabsichtigt mein erstes Wort in Tamahac bei, weil er es oft gebrauchte und es sich so leicht einprägte: Ayo, das bedeutet so viel wie okay. Also hieß er Ayo. Ich war Leloup. Ohne Monsieur, einfach Leloup, ein Kürzel meines Vornamens, das erstbeste, das mir einfiel, als ich sah, wie unaussprechlich er für meine Begleiter war. Abends am Feuer, wenn sie untereinander arabisch sprachen, war ich manchmal el Gauri – der Fremde.
Ein Reisename fehlte noch, der des stillen Fahrers, sein echter Name war viel zu lang. Als wir über die Karawanen sprachen, die einst durch die Wüste gezogen waren, und das Tamahac-Wort für Karawanenchef fiel, Amalwei, war das Problem gelöst. Mit der Zeit schliff es sich ab zu Amal, das passte auch im Arabischen, da bedeutet es: hoffen. Und zu hoffen war einiges.
Nie war ich in Begleitung gereist, schon gar nicht zu viert, aber im algerischen Grand Sud wäre es anders nicht möglich gewesen. Ich konnte noch von Glück sagen, einige Monate zuvor hätte eine bewaffnete Eskorte uns begleitet, drei Jeeps mit je fünf Polizisten. Das forderten die Behörden nun nicht mehr. Aber jeden Abend suchte sich Kabir einen Berg in der Nähe des jeweiligen Nachtlagers, auf dem Handyempfang zu erwarten war, und stieg hinauf.
Ich dachte, er rufe daheim an, bis er mir sagte, er sei angehalten, jeden Abend unsere Position in der Wüste durchzugeben. Wem genau, sagte er nicht, und ich fragte auch nicht danach. Ich nahm es hin, es war mir sogar recht. Wir fuhren ins Unwegsame, in menschenleere Gegenden, und sollte ein ernstes Problem auftauchen, war es besser, jemand in Tamanrasset wusste, wo wir steckten.
Es hatte Entführungen gegeben, vor Jahren zwar, aber jenseits der Südgrenze kontrollierten überall finstere Mächte die Wüste. Warlords, russische Söldnertruppen, Islamisten, Putschisten. Lösegeld war in diesen Kreisen eine probate Finanzquelle. Ein Diplomat, der die Region gut kannte, hatte es mir daheim schonend beigebracht. »Remember, you are a commodity.« Denken Sie daran, Sie sind eine Ware, ein Handelsgut. Amal winkte ab, als ich davon sprach. Alte Geschichten, in den Wüsten des Großen Südens sei es heutzutage vollkommen sicher.
Auch über die Stadt Tamanrasset hatte er seine eigenen Ansichten. Ich erwähnte, dass dort viele Männer in der typischen Tuareg-Kleidung herumliefen, die auch er trug, in Gandoura und Chech, und schloss daraus, dass Tamanrasset bis heute ein von den Tuareg geprägter Ort sei. Der Chech war für vieles gut, er konnte alles Mögliche sein. Schutztuch gegen Staub und Hitze. Spieltuch, an dem es sich im Gespräch oder bei Langeweile herumfingern ließ. Schamtuch vor dem Mund als intimer Zone. Augenwischtuch, Schnupftuch und Putztuch für die Sonnenbrille. Sogar als improvisierten Gebetsteppich hatte ein Mann seinen Chech benutzt.
Diese Kleidung wurde in allen Farben und Preislagen getragen. Edle, teure Chechs hatte ich in der Stadt gesehen, wie aus alten Wüstenfilmen, die edelsten davon in einem so tiefen Indigoblau, dass es fast schwarz zu sein schien. Das Indigo färbte auf die Haut seines Trägers ab, daher kam die Bezeichnung hommes bleues für die Tuareg. Weit häufiger aber sah ich einfache Chechs und mitunter verschlissene, die an einen dreckigen Kopfverband denken ließen. Gerade waren chintzartig glänzende Stoffe beliebt, manche Männer in solchen Gandouras funkelten schon von Weitem im Sonnenlicht.
Amal hörte sich meine Eindrücke von Tamanrasset an, und ich sah in seinem Gesicht, dass ihm etwas daran nicht gefiel. Es war meine Naivität, meine Unkenntnis der Verhältnisse. Die meisten Tuareg, die ich in der Stadt gesehen hätte, seien gar keine, sagte er, oder jedenfalls keine von hier. Aus dem Süden kämen sie, aus Mali oder Niger oder Burkina Faso.
Ob er denn Hiesige so sicher von Fremden unterscheiden könne, fragte ich ihn, und die Antwort war ein entschiedenes Ja. »Und woran erkennst du den Unterschied?« – »An der Sprache. Und an ihrer ganzen Art.« Ich hatte nur die für den Blick des Europäers offensichtlichen Unterschiede wahrgenommen. Die einen stiegen aus teuren Geländewagen in frisch gebügelter traditioneller Kleidung, andere, und weitaus mehr, fuhren in verbeulten japanischen Pick-ups oder betagten französischen Kleinwagen umher.
Das Letzte, was noch zu tun war, bevor wir in die Wüste aufbrachen, erledigten wir in einem Viertel von Tamanrasset, in dem es viele kleine Läden gab. Bei einem Ersatzteilhändler prüfte Amal den Luftdruck der Reifen. Um im tiefen Sand zu fahren, müsse der Druck maximal sein, erklärte er mir. Und Ayo kaufte Vorräte beim Gemüsehändler und beim Bäcker einen Armvoll Baguettes.
Dann wollten beide mir noch etwas zeigen. »Dieses Viertel«, sagte Amal, »heißt Soro, es ist der alte Kern von Tamanrasset und um den Palast von Moussa ag Amastan herum entstanden.« Der legendäre Amenokal aller sechzehn Stämme der Ahaggar-Tuareg wollte die zu Anfang des 20. Jahrhunderts schwach besiedelte Oase aufwerten und zu seinem Zentrum machen, darum ließ er dort einen Palast errichten. Die Wirkung dürfte stark gewesen sein, ein wenig so wie die Wirkung gotischer Dome im Mittelalter, die sich weithin sichtbar über niedrigen, verwinkelten Gassen erhoben. Ein freistehender, aus Steinen gemauerter Prachtbau inmitten der Hütten der etwa vierzig sesshaften Familien, die damals hier lebten.
Amenokal, diesen Titel hatte ich in der Literatur unterschiedlich übersetzt gefunden – mal Fürst, mal König, mal Präsident. Ich fragte die beiden Tuareg, was für sie die passende Übersetzung sei, und wir kamen zu dem Schluss, un roi présidentiel drücke den Status des Amenokal am besten aus. König aller Stämme, das schon, aber einer von präsidentieller Art. Der Titel schuf seine aristokratische Würde, aber bei seinen Entscheidungen musste der König sich mit den Oberhäuptern der sechzehn Stämme des Ahaggar abstimmen – das war die präsidiale Mäßigung seiner Macht.
Den Amenokal stellten traditionell die Kel Ahaggar, ein adeliger Kriegerstamm, im Unterschied zu nicht-adeligen Stämmen wie etwa dem der Kel Ulli, dem Stamm der Ziegenhirten, wörtlich: die Ziegenleute. Auf den regierenden Vater folgte der Sohn. Moussa ag Amastan hieß Moussa, Sohn des Amastan, wörtlich: des Beschützers.
Amal hielt vor der sandgrauen Ruine, die vom Königssitz übrig war. Wir gingen hinein. Ihre Ausmaße und Räume ließen den palastartigen Bau erahnen, der hier bis vor einigen Jahren gestanden hatte. Übrig waren nur noch seine aus sandigen Backsteinen gemauerten Wände, die Dächer fehlten und auch sonst alles, was nicht aus Stein war. Überall lag Müll herum, drinnen und draußen, es stank. »Sie haben alles rausgerissen. Türen, Fenster, Balken.«
Die Frage, wer denn sie seien, stellte ich nicht, die Antwort glaubte ich schon zu kennen. Auch hier, im alten Stadtkern, lebten inzwischen viele aus dem Süden. »Als es losging mit der Wanderung, vor zehn, fünfzehn Jahren, stand der Palast noch, und sein Garten existierte auch noch. Weil sie nicht wussten, wo sie schlafen sollten, sind sie hier hinein und haben alles, was sie brauchen konnten, herausgebrochen, verfeuert oder weggetragen.«
Nun lag der Palast ausgeweidet da, ein trauriger Rest. Die steinerne Großtat des Königs der Ahaggar-Tuareg hatte nicht überlebt. Seine andere schon, sie war geistiger Natur – die Freundschaft des Moussa ag Amastan mit dem Mann, der in jeder denkbaren Hinsicht radikal anders war als er und ihm doch seelenverwandt.