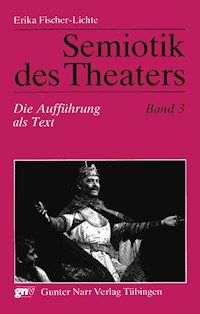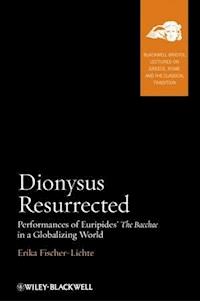17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Spätestens seit den 60er Jahren lassen sich zeitgenössische Kunstwerke nicht mehr in den Begriffen herkömmlicher Ästhetiken erfassen. Anstatt "Werke" zu schaffen, bringen die Künstler zunehmend Ereignisse hervor, die in ihrem Vollzug die alten ästhetischen Relationen von Subjekt und Objekt, von Material- und Zeichenstatus außer Kraft setzen. Um diese Entwicklung nachvollziehbar zu machen, entwickelt Erika Fischer-Lichte in ihrer grundlegenden Studie eine Ästhetik des Performativen, die den Begriff der Aufführung in den Mittelpunkt stellt. Dieser umfaßt die Eigenschaften der leiblichen Kopräsenz von Akteuren und Zuschauern, der performativen Hervorbringung von Materialität sowie der Emergenz von Bedeutung und mündet in eine Bestimmung der Aufführung als Ereignis. Die Aufhebung der Trennung von Kunst und Leben, welche die neueren Ausdrucksformen anstreben, wird hier ästhetisch auf den Begriff gebracht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Spätestens seit den 60er Jahren lassen sich zeitgenössische Kunstwerke nicht mehr in den Begriffen herkömmlicher Ästhetiken erfassen. Anstatt »Werke« zu schaffen, bringen die Künstler zunehmend Ereignisse hervor, die in ihrem Vollzug die alten ästhetischen Relationen von Subjekt und Objekt, von Material- und Zeichenstatus außer Kraft setzen. Um diese Entwicklung nachvollziehbar zu machen, entwickelt Erika Fischer-Lichte in ihrer grundlegenden Studie eine Ästhetik des Performativen, die den Begriff der Aufführung in den Mittelpunkt stellt. Dieser umfaßt die Eigenschaften der leiblichen Kopräsenz von Akteuren und Zuschauern, der performativen Hervorbringung von Materialität sowie der Emergenz von Bedeutung und mündet in eine Bestimmung der Aufführung als Ereignis. Die Aufhebung der Trennung von Kunst und Leben, welche die neueren Ausdrucksformen anstreben, wird hier ästhetisch auf den Begriff gebracht. Erika Fischer-Lichte lehrt Theaterwissenschaften an der Freien Universität Berlin.
Erika Fischer-Lichte
Ästhetikdes Performativen
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2004
Originalausgabe
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-78540-9
www.suhrkamp.de
Inhalt
Erstes KapitalBegründung für eine Ästhetik des Performativen
Zweites KapitelBegriffsklärungen
1. Der Begriff des Performativen
2. Der Begriff der Aufführung
Drittes KapitelDie leibliche Ko-Präsenz vonAkteuren und Zuschauern
1. Rollenwechsel
2. Gemeinschaft
3. Berührung
4. »Liveness«
Viertes KapitelZur performativen Hervorbringungvon Materialität
1. Körperlichkeit
– Verkörperung/embodiment
– Präsenz
– Tier-Körper
2. Räumlichkeit
– Performative Räume
– Atmosphären
3. Lautlichkeit
– Hör-Räume
– Stimmen
4. Zeitlichkeit
– Time brackets
– Rhythmus
Fünftes KapitelEmergenz von Bedeutung
1. Materialität, Signifikant, Signifikat
2. »Präsenz« und »Repräsentation«
3. Bedeutung und Wirkung
4. Lassen sich Aufführungen verstehen?
Sechstes KapitelDie Aufführung als Ereignis
1. Autopoiesis und Emergenz
2. Einstürzende Gegensätze
3. Liminalität und Transformation
Siebtes KapitelDie Wiederverzauberung der Welt
1. Inszenierung
2. Ästhetische Erfahrung
3. Kunst und Leben
Wolle die Wandlung. O sei für die Flamme begeistert,
drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt;
jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert,
liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt.
Was sich ins Bleiben verschließt, schon ists das Erstarrte;
wähnt es sich sicher im Schutz des unscheinbaren Grau’s?
Warte, ein Härtestes warnt aus der Ferne das Harte.
Wehe –: abwesender Hammer holt aus!
Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung;
und sie führt ihn entzückt durch das heiter Geschaffne,
das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt.
Jeder glückliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung,
den sie staunend durchgehn. Und die verwandelte Daphne
will, seit sie Lorbeern fühlt, daß du dich wandelst in Wind.
Rainer Maria Rilke
Erstes KapitelBegründung für eine Ästhetikdes Performativen
Am 24. Oktober 1975 trug sich in der Galerie Krinzinger in Innsbruck ein merk- und denkwürdiges Ereignis zu. Die jugoslawische Künstlerin Marina Abramović präsentierte ihre Performance Lips of Thomas. Die Performance begann damit, daß die Künstlerin sich vollständig ihrer Kleidung entledigte. Danach ging sie zur Rückwand der Galerie, um dort eine Photographie von sich anzupinnen, die sie mit einem fünfzackigen Stern umrahmte. Von dort begab sie sich an einen nicht weit von der Rückwand plazierten Tisch, der mit einer weißen Tischdecke, einer Flasche Rotwein, einem Glas Honig, einem Kristallglas, einem Silberlöffel und einer Peitsche gedeckt war. Sie ließ sich auf dem Stuhl am Tisch nieder, griff nach dem Honigglas und dem Silberlöffel. Langsam leerte sie das Glas, bis sie das Kilo Honig aufgegessen hatte. Sie goß sich Rotwein in das Kristallglas und trank ihn in langsamen Zügen. Sie wiederholte diese Handlung, bis Flasche und Glas leer waren. Dann zerbrach sie das Glas mit der rechten Hand. Die Hand fing an zu bluten. Abramović stand auf und ging zu der Wand, an der ihre Photographie befestigt war. Den Rücken zur Wand und frontal zu den Zuschauern, ritzte sie sich mit einer Rasierklinge einen fünfzackigen Stern in den Bauch. Blut quoll hervor. Dann ergriff sie die Peitsche, kniete sich mit dem Rücken zum Publikum unter ihrem Bild nieder und geißelte sich heftig den Rücken. Blutige Striemen erschienen. Anschließend legte sie sich auf ein Kreuz aus Eisblöcken, die Arme weit ausgebreitet. Von der Decke hing ein Heizstrahler, der auf ihren Bauch gerichtet war. Seine Wärme brachte den eingeritzten Stern erneut zum Bluten. Abramović blieb reglos auf dem Eis liegen, offensichtlich gewillt, ihre Marter andauern zu lassen, bis der Heizstrahler das Eis zum Schmelzen gebracht haben würde. Nachdem sie dreißig Minuten auf dem Kreuz aus Eis ausgeharrt hatte, ohne Anstalten zu machen, die Tortur abzubrechen, vermochten einzelne Zuschauer ihre Qual nicht länger mehr zu ertragen. Sie eilten zu den Eisblöcken, ergriffen die Künstlerin, holten sie vom Kreuz und trugen sie hinweg. Damit setzten sie der Performance ein Ende.
Die Performance hatte zwei Stunden gedauert. Im Verlauf dieser zwei Stunden gestalteten die Performerin und die Zuschauer ein Ereignis, das durch die Traditionen, Konventionen und Standards weder der bildenden noch der darstellenden Künste vorgesehen oder gar legitimiert gewesen wäre. Die Künstlerin stellte mit den Handlungen, die sie vollzog, nicht ein Artefakt her; sie schuf kein Werk, das von ihr ablösbar, fixier- und tradierbar gewesen wäre. Andererseits stellte sie mit ihnen aber auch nicht etwas dar. Sie agierte nicht als Schauspielerin, welche die Rolle einer dramatischen Figur spielt, die zu viel Honig ißt und zu viel Wein trinkt und sich die unterschiedlichsten Verletzungen zufügt. Ihre Handlungen bedeuteten nicht, daß eine Figur sich selbst verletzt. Mit ihnen verletzte Abramović vielmehr tatsächlich sich selbst. Sie mißhandelte ihren Körper unter entschiedener Mißachtung seiner Grenzen. Zum einen führte Abramović ihm im Übermaß Substanzen zu, die, in kleinen Dosen genossen, durchaus stärkend wirken mögen, in diesen Mengen jedoch zweifellos Übelkeit und Unwohlsein erzeugen. Um so merkwürdiger mochte es anmuten, daß sich weder auf dem Gesicht noch in den Bewegungen der Künstlerin entsprechende Symptome zeigten. Zum anderen fügte sie sich so schwere äußere Verletzungen zu, daß der Zuschauer auf einen starken körperlichen Schmerz schließen mußte. Allerdings brachte die Künstlerin auch in diesem Fall keine Zeichen hervor, die Schmerz ausdrücken – sie stöhnte nicht, noch schrie sie, noch verzog sie das Gesicht im Schmerz. Sie vermied generell, jene Art von körperlichen Zeichen zu zeigen, die als Ausdruck von Unwohlsein oder Schmerz gelten, ohne allerdings dem Beobachter immer zu erlauben, mit Sicherheit zu entscheiden, ob es sich hier um den Ausdruck eines tatsächlich empfundenen Schmerzes handelt oder ob ein Schmerz dargestellt wird, der lediglich gespielt ist. Die Künstlerin beschränkte sich darauf, die Handlungen zu vollziehen, die ihren Körper wahrnehmbar veränderten – ihm Honig und Wein einverleibten und ihm sichtbare Verletzungen zufügten –, ohne äußere Zeichen für die dadurch verursachten inneren Zustände hervorzubringen.
Damit versetzte sie den Zuschauer in eine irritierende, zutiefst verunsichernde und in diesem Sinne qualvolle Situation, in der bisher fraglos gültige Normen, Regeln und Sicherheiten außer Kraft gesetzt zu sein schienen. Für den Besuch einer Galerie oder eines Theaters bestand traditionell die Regel, daß die Rolle des Besuchers als diejenige eines Betrachters bzw. Zuschauers definiert ist. Der Galeriebesucher betrachtet die dort ausgestellten Werke aus größerer oder geringerer Entfernung, ohne sie jedoch jemals zu berühren. Der Theaterbesucher schaut dem Geschehen auf der Bühne auch bei größter innerer Anteilnahme und Bewegung zu, ohne jemals einzugreifen, auch wenn auf der Bühne eine Figur (z. B. Othello) sich anschickt, eine andere (in diesem Fall Desdemona) umzubringen, wohl wissend, daß der Mord nur gespielt ist und die Darstellerin der Desdemona am Ende vor den Vorhang treten und sich gemeinsam mit dem Darsteller des Othello artig verbeugen wird. Im Alltagsleben dagegen gilt die Regel, sofort einzugreifen, wenn einer sich oder einen anderen zu verletzen droht – es sei denn, man setzt sich damit selbst einer Gefahr für Leib und Leben aus. Welche Regel sollte der Zuschauer in Abramovićs Performance anwenden? Ganz offensichtlich verletzte sie sich tatsächlich und war gewillt, ihre Selbstfolterung weiter andauern zu lassen. Hätte sie dies irgendwo auf einem öffentlichen Platz getan, hätte der Zuschauer vermutlich nicht lange gezögert und eingegriffen. Aber hier? Erforderte es nicht der Respekt vor der Künstlerin, sie ausführen zu lassen, was ihr Plan und ihre künstlerische Absicht zu sein schienen? Würde man nicht das Risiko eingehen, ihr »Werk« zu zerstören? Andererseits: Ließ es sich mit den Gesetzen der Humanität, mit dem menschlichen Mitgefühl vereinbaren, ihr ruhig dabei zuzuschauen, wie sie sich selbst Verletzungen zufügte? Wollte sie den Zuschauer etwa in die Rolle eines Voyeurs drängen? Oder wollte sie ihn testen, um herauszufinden, wie weit sie noch gehen mußte, ehe Zuschauer sich anschickten, ihrer Qual ein Ende zu bereiten? Was sollte hier gelten?
Abramović schuf in und mit ihrer Performance eine Situation, welche die Zuschauer zwischen die Normen und Regeln von Kunst und Alltagsleben, zwischen ästhetische und ethische Postulate versetzte. In diesem Sinne stürzte sie sie in eine Krise, zu deren Bewältigung nicht auf allgemein anerkannte Verhaltensmuster zurückgegriffen werden konnte. Die Zuschauer reagierten zunächst, indem sie eben solche körperlichen Zeichen hervorbrachten, welche die Performerin verweigerte: Zeichen, die auf innere Zustände schließen lassen, wie auf das ungläubige Staunen, welches sich im Verlauf des Essens und Trinkens einstellte, oder auf das Entsetzen, welches das Zerbrechen des Kristallglases mit der Hand hervorrief. Und als die Künstlerin anfing, sich mit der Rasierklinge ins eigene Fleisch zu schneiden, war buchstäblich zu hören, wie die Zuschauer ob des Schocks, den diese Handlung auslöste, den Atem anhielten. Was immer die Transformationen waren, welche die Zuschauer während dieser zwei Stunden durchliefen – Transformationen, die sich zum Teil durchaus in wahrnehmbarem körperlichem Ausdruck manifestierten –, sie mündeten in den Vollzug von allgemein wahrnehmbaren Handlungen ein, die wahrnehmbare Konsequenzen hatten. Sie setzten der Qual der Performerin und damit der Performance ein Ende. Sie verwandelten die beteiligten Zuschauer in Akteure.
Wenn in früheren Zeiten die Rede davon war, daß Kunst verwandelt, daß sie sowohl den Künstler als auch den Rezipienten zu transformieren vermag, so war in der Regel damit gemeint, daß der Künstler von Inspiration ergriffen oder im Rezipienten ein inneres Erlebnis hervorgerufen wird, das ihm wie Rilkes Apoll zuruft: »Du mußt dein Leben ändern.« Zwar ist allgemein bekannt, daß es zu allen Zeiten Künstler gegeben hat, die ruinös mit ihrem Körper umgegangen sind. Künstlerlegenden oder auch Autobiographien einzelner Künstler berichten immer wieder von Schlafentzug, Drogeneinnahme, Alkohol- und anderen Exzessen oder auch von Selbstverletzungen. Aber die Gewalt, die Künstler in diesen Fällen ihrem Körper antaten, wurde weder von ihnen als Kunst ausgegeben noch von anderen als Kunst verstanden.1 Entsprechende Praktiken wurden den Künstlern im 19. und 20. Jahrhundert, aus denen die einschlägigen Quellen stammen, bestenfalls nachgesehen, als eine mögliche Inspirationsquelle für das künstlerische Schaffen in Kauf genommen, zwar als Preis für das so entstandene Kunstwerk gebilligt, jedoch nicht dem Kunstwerk selbst zugerechnet.
Dagegen gab – und gibt – es andere kulturelle Bereiche, in denen Praktiken, mit denen Menschen sich selbst Verletzungen zufügen und ernsthaften Gefahren aussetzen, nicht nur als »normal«, sondern zum Teil geradezu als vorbildlich und modellhaft gelten. Es sind dies insbesondere die Bereiche religiöser Rituale sowie der Jahrmarktsspektakel. In vielen Religionen sind es die Asketen, die Eremiten, Fakire, Yogi, denen gerade deshalb eine besondere Heiligkeit zugesprochen wird, weil sie ihrem Körper nicht nur für den normalen Sterblichen undenkbare Entbehrungen und Gefährdungen zumuten, sondern ihm auch die unglaublichsten Verletzungen zufügen. Um so erstaunlicher ist es, daß sich zu bestimmten Zeiten sogar Massenbewegungen derartige Praktiken zu eigen machen, wie dies bei der Geißelung der Fall ist. Als individuell oder gemeinsam geübte Praxis der Nonnen und Mönche seit dem 11. Jahrhundert entwickelt, wurde sie seitdem vielfach aufgegriffen: von den Geißlerzügen, die um die Mitte des 13. und 14. Jahrhunderts durch Europa zogen und öffentlich, meist vor großem Publikum, ihr Ritual vollzogen, von den Bußgesellschaften, die in romanischen Ländern besonders verbreitet waren und deren Mitglieder sich bei bestimmten Anlässen gemeinsam geißelten. In der Karfreitagsprozession in Spanien und einzelnen Orten in Süditalien, in der Liturgie der Semana Santa und der Fronleichnamsprozession hat sich die freiwillige Selbstgeißelung bis heute als lebendige Praktik erhalten.
Wie aus der Beschreibung des Klosterlebens der Dominikanerinnen im Kloster Unterlinden bei Kolmar zu erfahren, die Katharina von Gebersweiler zu Beginn des 14. Jahrhunderts abgefaßt hat, stellte die freiwillige Geißelung einen wesentlichen Bestandteil der Liturgie, wenn nicht gar ihren Höhepunkt dar:
Am Ende der Matutin und der Komplet blieben die Schwestern gemeinsam im Chor stehen und beteten, bis sie ein Zeichen bekamen, worauf sie mit der hingebungsvollen Verehrung begannen. Die einen quälten sich mit Kniebeugen, während sie die Herrschaft Gottes priesen. Andere wiederum konnten, vom Feuer der göttlichen Liebe verzehrt, ihre Tränen nicht zurückhalten, die sie mit hingebungsvoll klagender Stimme begleiteten. Sie bewegten sich nicht von dannen, bis sie in neuer Gnade erglühten und den fanden, ›den seine Seele liebt‹ (Hohelied, 1,6). Andere schließlich peinigten ihr Fleisch, indem sie es täglich aufs heftigste malträtierten, die einen mit Rutenhieben, andere mit Peitschen, die drei oder vier verknotete Riemen besaßen, die dritten mit eisernen Ketten, die vierten mit Geißeln, welche mit Dornen versehen waren. Im Advent und während der gesamten Fastenzeit begaben sich die Schwestern nach der Matutin in den Kapitelsaal oder an andere geeignete Orte, wo sie ihre Körper mit den verschiedensten Geißelinstrumenten aufs schärfste traktierten, bis das Blut floß, so daß der Klang der Peitschenhiebe durch das ganze Kloster hallte und sich süßer als jede andere Melodie zu den Ohren des Herrn Sabaoth erhob.2
Das Ritual der Selbstgeißelung hob die Nonnen über ihren klösterlichen Lebensalltag hinaus und versetzte sie in einen Zustand, der ein transformatorisches Potential barg. Die Qual, die sie ihrem Fleisch zufügten, die Gewalt, die sie ihrem Körper antaten, die wahrnehmbare leibliche Transformation vollzog sich zugleich als Prozeß einer spirituellen Verwandlung: »Jenen, die sich Gott auf all diese verschiedenen Weisen näherten, wurden die Herzen erleuchtet, ihre Gedanken wurden rein, ihr Gefühl entbrannte, ihr Gewissen klärte sich, und ihr Geist erhob sich zu Gott.«3
Die freiwillige Selbstgeißelung, die dem Körper Gewalt antut, um eine spirituelle Verwandlung herbeizuführen, gehört bis heute zu den von der katholischen Kirche anerkannten Bußpraktiken.4
Einen zweiten kulturellen Bereich, in dem Selbstverletzungen und -gefährdungen akzeptiert sind, bilden die Jahrmarktsspektakel. Hier werden zum einen Künste vorgeführt, die »normalerweise« zu schweren Verletzungen führen, den Artisten jedoch wundersamerweise nichts anzuhaben vermögen, wie das Feueroder Schwertschlucken, das Durchbohren der Zunge mit einer Nadel u. a. mehr. Andererseits werden äußerst riskante Aktionen vollzogen, die den Artisten einer tatsächlichen Gefahr, häufig sogar der Lebensgefahr aussetzen. Die Meisterschaft des Artisten beweist sich gerade darin, daß er dieser Gefahr zu trotzen vermag.
Bei Drahtseilakten ohne Netz, bei Dressuren von Raubtieren und Schlangen genügt es, daß die Konzentration des Artisten für den Bruchteil einer Sekunde nachläßt, um die stets lauernde Gefahr hereinbrechen zu lassen: Die Seiltänzerin stürzt ab, der Dompteur wird vom Tiger angefallen, die Schlangenbändigerin von der Schlange gebissen oder erdrosselt. Es ist dies der Moment, den das Publikum am meisten fürchtet und dem es dennoch zugleich entgegenfiebert, der Moment, dem seine tiefsten Ängste ebenso wie seine Faszination und sensationsgierige Schaulust gelten. Bei diesen Spektakeln geht es weniger um eine Verwandlung der Akteure oder gar der Zuschauer als um die Demonstration der ungewöhnlichen körperlichen und mentalen Kräfte der Artisten, die das Publikum in Staunen und Verwunderung versetzen soll – in Affekte also, von denen offensichtlich auch die Zuschauer Abramovićs ergriffen wurden.
Für die Transformation der Zuschauer in Akteure, die zweite Auffälligkeit der eingangs geschilderten Performance, lassen sich ebenfalls Beispiele aus unterschiedlichen kulturellen Bereichen anführen. Ein in unserem Zusammenhang besonders interessantes Beispiel stellen Strafrituale der frühen Neuzeit dar. Wie Richard van Dülmen gezeigt hat, drängten sich nach vollzogener Hinrichtung die Zuschauer an den Leichnam des Hingerichteten, um seinen Leib, sein Blut, seine Glieder oder auch den tödlichen Strick zu berühren. Von einer solchen Berührung erhofften sie sich die Heilung von bestimmten Krankheiten und ganz allgemein eine Garantie für ihr eigenes leibliches Wohlergehen, für ihre körperliche Unversehrtheit und Integrität.5 Die Transformation des Zuschauers in einen Akteur wurde in der Hoffnung auf eine anhaltende Veränderung des eigenen Körpers vollzogen. Sie hatte also eine grundsätzlich andere Stoßrichtung als die Transformation, die der Zuschauer in Abramovićs Performance durchlief. Denn ihm ging es nicht um das eigene körperliche Wohlergehen, sondern um das der Künstlerin. Mit den Handlungen, die ihn in einen Akteur verwandelten, mit der Berührung der Performerin zielte er auf ihre körperliche Integrität, die es zu schützen galt. Sie waren Folge einer ethischen Entscheidung, die auf einen anderen, nämlich die Künstlerin, gerichtet war.
In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich auch prinzipiell von den Handlungen, mit denen sich in futuristischen serate, Dada-Soiréen und ›Besichtigungstouren‹ der Surrealisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Zuschauer in Akteure verwandelten. Denn hier wurden die Zuschauer durch gezielt verabreichte Schocks zu ihren Handlungen provoziert. Die Transformation des Zuschauers in einen Akteur folgte mit einem gewissen Automatismus aus den Vorgaben der Inszenierung; sie war weit davon entfernt, als Resultat einer bewußten Entscheidung des betreffenden Zuschauers vollzogen zu werden. Dies läßt sich unschwer aus Berichten über derartige Veranstaltungen schließen, aber auch aus den Manifesten der Künstler. In seinem Manifest Das Varietétheater (1913) macht Filippo Tommaso Marinetti zum Beispiel folgende Vorschläge zur Provokation der Zuschauer:
Man muß die Überraschung und die Notwendigkeit zu handeln unter die Zuschauer des Parketts, der Logen und der Galerie tragen. Hier nur ein paar Vorschläge: auf ein paar Sessel wird Leim geschmiert, damit die Zuschauer – Herr oder Dame – kleben bleiben und so die allgemeine Heiterkeit erregen [...]. Ein und derselbe Platz wird an zehn Personen verkauft, was Gedrängel, Gezänk und Streit zur Folge hat. – Herren und Damen, von denen man weiß, daß sie leicht verrückt, reizbar oder exzentrisch sind, erhalten kostenlose Plätze, damit sie mit obszönen Gesten, Kneifen der Damen oder anderem Unfug Durcheinander verursachen. – Die Sessel werden mit Juck-, Niespulver usw. bestreut.6
Es handelte sich hier also um ein künstlerisches Spektakel, bei dem die Zuschauer allein durch die Kraft des Schocks, die Stärke der Provokation in Akteure verwandelt wurden, denen die anderen Zuschauer und die Veranstalter bei ihren Aktionen verärgert, erregt, belustigt, voll Häme oder auch anders gestimmt zusahen. Auch bei Abramovićs Performance wird die Transformation einzelner Zuschauer in Akteure bei den anderen Zuschauern widersprüchliche Emotionen ausgelöst haben: Scham, weil man selbst zu feige war, einzugreifen, oder auch Ärger oder gar Wut darüber, daß die Performance vorzeitig beendet wurde und man nicht beobachten konnte, wie weit die Künstlerin in ihrer Selbstfolterung noch zu gehen bereit war, oder auch positive Gefühle wie Erleichterung und Zufriedenheit, daß sich endlich jemand entschied, der Qual – der Performerin und höchstwahrscheinlich auch derjenigen der Zuschauer7 – ein Ende zu bereiten.
Wie auch immer die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im einzelnen zu beurteilen sein mögen, es läßt sich nicht übersehen, daß Abramovićs Performance Züge sowohl von Ritualen als auch von Spektakeln aufwies, daß sie permanent zwischen Ritual- und Spektakelhaftigkeit oszillierte. Wie ein Ritual8 bewirkte sie eine Transformation der Künstlerin und einzelner Zuschauer – ohne daß dies allerdings wie häufig bei Ritualen zu einem öffentlich anerkannten Status- und Identitätswandel geführt hätte –, und wie ein Spektakel löste sie bei den Zuschauern Staunen und Entsetzen aus, versetzte ihnen Schocks und verführte sie zum Voyeurismus.
Eine solche Performance entzieht sich dem Zugriff der überlieferten ästhetischen Theorien. Sie widersetzt sich hartnäckig dem Anspruch einer hermeneutischen Ästhetik, die darauf zielt, das Kunstwerk zu verstehen. Denn hier geht es weniger um das Verstehen der Handlungen, welche die Künstlerin vollzog, als um die Erfahrungen, die sie dabei machte und die sie bei den Zuschauern hervorrief, kurz: um die Transformation der an der Performance Beteiligten.
Das heißt nicht, daß es für die Zuschauer nichts zu interpretieren gegeben hätte, daß die Objekte, welche verwendet, und die Handlungen, die an und mit ihnen vollzogen wurden, sich nicht als Zeichen hätten deuten lassen. Der fünfzackige Stern zum Beispiel konnte höchst unterschiedliche mythische, religiöse, kulturhistorische und politische Kontexte aufrufen – nicht zuletzt auch als feststehendes Symbol für ein sozialistisches Jugoslawien interpretiert werden. Als die Künstlerin ihre Photographie mit einem fünfzackigen Stern umrahmte und sich später einen fünfzackigen Stern in den Bauch ritzte, mag der Zuschauer diese Handlungen als Zeichen für die Unentrinnbarkeit des Staates gedeutet haben, der den einzelnen mit seinen Gesetzen, Verordnungen und seinen Unrechtstaten umzingelt, als Zeichen für die Gewalt, die dem Individuum vom Staat angetan wird und sich in seinen Leib einschreibt. Als die Performerin am mit weißer Tischdecke gedeckten Tisch mit Silberlöffel und Kristallglas hantierte, könnte der Zuschauer dies als eine alltägliche Handlung in einer bürgerlichen Umgebung wahrgenommen haben – wobei der übermäßige Genuß von Honig und Wein für ihn vielleicht auch eine Kritik an der bürgerlich-kapitalistischen Konsum- und Verschwendungsgesellschaft implizierte. Es kann aber auch sein, daß er in diesen Handlungen eine Anspielung auf das Abendmahl sah. In diesem Kontext hätte er dann die Geißelung – die sich in anderen Kontexten auf staatliche Straf- und Folteraktionen oder auch auf sadomasochistische Sexualpraktiken beziehen ließe – wahrscheinlich als Verweis auf die Geißelung Christi und diejenige christlicher Flagellanten interpretiert. Als die Künstlerin sich mit ausgebreiteten Armen auf das Kreuz aus Eis legte, wird der Zuschauer dies wahrscheinlich mit Christi Kreuzigung in einen Zusammenhang gebracht haben. Und die eigene Handlung, mit der er sie vom Kreuz herunterholte, wird er vielleicht gar als Verhütung einer historischen Wiederholung des Opfertodes oder als Wiederholung der Kreuzabnahme verstanden haben. Die Performance insgesamt hätte der Zuschauer als eine Auseinandersetzung mit Gewalt interpretieren können, jener Gewalt, die dem einzelnen vom Staat und im Namen des Staates bzw. der – nicht nur politischen, sondern auch religiösen – Gemeinschaft angetan wird, und der Gewalt, die er sich selbst zuzufügen genötigt sieht. Er hätte sie dann vielleicht als eine Kritik an gesellschaftlichen Zuständen begriffen, die es zulassen, daß der einzelne vom Staat geopfert wird, und die ihn nötigen, sich selbst zu opfern.
Solche Interpretationen, so plausibel sie im nachhinein erscheinen mögen, bleiben jedoch dem Ereignis der Performance inkommensurabel. Auch werden die Zuschauer sich bereits während der Performance auf derartige Deutungsversuche nur begrenzt eingelassen haben. Denn die Handlungen, welche die Performerin durchführte, bedeuteten nicht lediglich »im Übermaß essen und trinken«, »sich einen fünfzackigen Stern in den Bauch ritzen«, »sich geißeln« usf.; sie vollzogen vielmehr genau das, was sie bedeuteten. Sie konstituierten sowohl für die Künstlerin als auch für die Zuschauer, d. h. für alle an der Performance Beteiligten, eine neue, eine eigene Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit wurde von den Zuschauern nun nicht nur gedeutet, sondern zuallererst in ihren Auswirkungen erfahren. Sie bewirkte bei den Zuschauern Staunen, Erschrecken, Entsetzen, Abscheu, Übelkeit, Schwindel, Faszination, Neugier, Mitgefühl, Qual und brachte sie dazu, ihrerseits wirklichkeitskonstituierende Handlungen zu vollziehen. Es ist anzunehmen, daß die Affekte, die ausgelöst wurden und offensichtlich so stark waren, daß sie einzelne Zuschauer zuletzt zum Eingreifen bewegten, bei weitem die Möglichkeiten und Anstrengungen zur Reflexion, zur Konstitution von Bedeutung, zur Interpretation des Geschehens überstiegen. Es ging nicht darum, die Performance zu verstehen, sondern sie zu erfahren und mit den eigenen Erfahrungen, die sich nicht vor Ort durch Reflexion bewältigen ließen, umzugehen.
Die Performance schuf dergestalt eine Situation, in der zwei Relationen neu bestimmt wurden, die für eine hermeneutische ebenso wie für eine semiotische Ästhetik grundlegend sind: erstens die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, Betrachter und Betrachtetem, Zuschauer und Darsteller, und zweitens die Beziehung zwischen Körper- bzw. Materialhaftigkeit und Zeichenhaftigkeit der Elemente, zwischen Signifikant und Signifikat.
Für eine hermeneutische wie für eine semiotische Ästhetik ist eine klare Trennung von Subjekt und Objekt fundamental. Der Künstler, Subjekt (1), schafft das Kunstwerk als ein von ihm ablösbares, fixier- und tradierbares Artefakt, dem unabhängig von seinem Schöpfer eine eigene Existenz zukommt. Dies stellt die Voraussetzung dafür dar, daß ein beliebiger Rezipient, Subjekt (2), es zum Objekt seiner Wahrnehmung und Interpretation machen kann. Das fixier- und tradierbare Artefakt, das Kunstwerk in seinem Objektcharakter, garantiert, daß der Rezipient sich immer wieder mit ihm auseinandersetzen, ständig neue Strukturelemente an ihm entdecken und ihm permanent neue und andere Bedeutungen zusprechen kann.
Diese Möglichkeit wurde von Abramovićs Performance nicht eröffnet. Wie bereits einleitend bemerkt, stellte die Künstlerin kein Artefakt her, sondern bearbeitete und veränderte ihren eigenen Körper vor den Augen der Zuschauer. Anstelle eines Kunstwerks, das eine von ihr und den Rezipienten unabhängige Existenz besitzt, schuf sie ein Ereignis, in das alle Anwesenden involviert waren. Das heißt, auch für die Zuschauer gab es nicht ein von ihnen unabhängiges Objekt, das es immer wieder anders wahrzunehmen und zu deuten galt, sondern vielmehr eine Situation hic et nunc, in die die im selben Raum und zur selben Zeit präsenten Ko-Subjekte gestellt waren. Ihre Handlungen lösten physiologische, affektive, volitionale, energetische und motorische Reaktionen aus, die zu weiteren Handlungen herausforderten. Durch diesen Prozeß wurde die dichotomische Subjekt-Objekt-Relation in ein eher oszillierendes Verhältnis überführt, in dem sich Subjekt- und Objektposition kaum mehr klar bestimmen noch auch deutlich voneinander unterscheiden ließen. Etablierten die Zuschauer, welche die Künstlerin berührten, um sie vom Kreuz aus Eis herunterzuholen, damit eine Beziehung zwischen Ko-Subjekten, oder machte ihre Handlung, die Performerin ohne Aufforderung ihrerseits und ohne ihre ausdrückliche Einwilligung vom Eis zu heben, diese zum Objekt? Oder handelten sie umgekehrt als Marionetten, als Objekte der Künstlerin? Auf diese Fragen gibt es keine klare, eindeutige Antwort.
Die Veränderung der Subjekt-Objekt-Relation steht in einem engen Zusammenhang mit dem Wandel des Verhältnisses von Material- und Zeichenhaftigkeit, Signifikant und Signifikat. Einer hermeneutischen und einer semiotischen Ästhetik gilt alles am Kunstwerk als Zeichen. Daraus darf man nicht den Schluß ziehen, daß sie die Materialität des Kunstwerks übersehen würden. Ganz im Gegenteil findet jedes Detail des Materials große Aufmerksamkeit. Aber alles, was am Material wahrnehmbar ist, wird zum Zeichen erklärt und gedeutet: die Dicke des Pinselauftrags und die spezifische Farbnuance im Gemälde ebenso wie Klang, Reim und Rhythmus im Gedicht. Damit wird jedes Element zum Signifikanten, dem sich Bedeutungen zusprechen lassen. Es gibt nichts im Kunstwerk, das jenseits der Signifikant-Signifikat-Relation existieren würde, wobei demselben Signifikanten die unterschiedlichsten Signifikate zugeordnet werden können.
Zwar war es in Abramovićs Performance dem Zuschauer durchaus möglich, entsprechende Prozesse der Bedeutungskonstitution zu vollziehen und den einzelnen Objekten und Handlungen Bedeutungen beizulegen, wie die oben angeführte potentielle Interpretation eines fiktiven Zuschauers zeigt. Gleichwohl ist es evident, daß die körperlichen Reaktionen der Zuschauer, ausgelöst durch die Wahrnehmung von Abramovićs Handlungen, nicht auf die möglichen Bedeutungen zurückzuführen waren, die sie diesen Handlungen beilegen mochten. Als Abramović sich den Stern in die Haut ritzte, hielten die Zuschauer wohl kaum deshalb den Atem an oder wurde ihnen kaum deswegen übel, weil sie dies als Einschreibung staatlicher Gewalt in den Körper interpretierten, sondern weil sie das Blut fließen sahen und den Schmerz am eigenen Körper imaginierten – weil das Wahrgenommene dergestalt unmittelbar auf den Körper der Zuschauer einwirkte. Die Körper- bzw. Materialhaftigkeit der Handlung dominierte hier also bei weitem ihre Zeichenhaftigkeit. Das heißt, sie ist nicht als körperlicher Überschuß, sozusagen im Sinne eines unerlösten Restes zu begreifen – »ein Erdenrest zu tragen peinlich« –, der nicht in den Bedeutungen aufgeht, die der Handlung beigelegt werden. Sie ist vielmehr jedem Versuch einer Deutung, die über die Selbstreferentialität der Handlung hinausgeht, vorgelagert. Die körperliche Wirkung, welche die Handlung auslöst, scheint hier Priorität zu haben. Die Materialität des Vorgangs wird nicht in einen Zeichenstatus überführt, verschwindet nicht in ihm, sondern ruft eine eigene, nicht aus dem Zeichenstatus resultierende Wirkung hervor. Es mag gerade diese Wirkung sein – das Stocken des Atems oder das Gefühl der Übelkeit –, die eine Reflexion in Gang setzt. Aber diese Reflexion wird sich vielleicht weniger auf mögliche Bedeutungen richten, die sich der Handlung beilegen lassen, als vielmehr auf die Frage, warum diese Handlung eine solche Reaktion ausgelöst hat. Welche Beziehung besteht hier zwischen Wirkung und Bedeutung?
Zum einen scheinen diese Verschiebungen innerhalb der Relationen Subjekt/Objekt und Material- bzw. Körper-/Signifikantenstatus, wie sie Abramovićs Performance Lips of Thomas vornahm, Fühlen, Denken und Handeln in ein neues Verhältnis zueinander zu setzen, das später noch genauer zu untersuchen sein wird. Jedenfalls sind die Zuschauer hier nicht nur als fühlende oder denkende Subjekte zugelassen, sondern auch als handelnde, als Akteure.
Zum anderen lassen diese Verschiebungen auch die traditionelle Unterscheidung in eine Produktions-, eine Werk- und eine Rezeptionsästhetik gerade als eine heuristische Differenzierung fragwürdig, wenn nicht gar obsolet erscheinen. Denn wenn es nicht mehr ein Kunstwerk gibt, das über eine vom Produzenten und Rezipienten unabhängige Existenz verfügt, wenn wir es statt dessen mit einem Ereignis zu tun haben, in das alle – wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß und unterschiedlicher Funktion – involviert sind, »Produktion« und »Rezeption« also in diesem Sinne im selben Raum und zur selben Zeit vollzogen werden, erscheint es höchst problematisch, weiter mit Parametern, Kategorien und Kriterien zu operieren, die in separierenden Produktions-, Werk-und Rezeptionsästhetiken entwickelt wurden. Zumindest müssen sie erneut auf ihre Tauglichkeit hin überprüft werden.
Dies erscheint um so dringlicher, als Lips of Thomas natürlich weder das einzige noch auch das erste Kunstereignis darstellte, in dem die beiden Verhältnisse eine Neubestimmung erfuhren. In den frühen sechziger Jahren setzte in den Künsten der westlichen Kultur generell und unübersehbar eine performative Wende9 ein, die nicht nur in den einzelnen Künsten einen Performativierungsschub erbrachte, sondern auch zur Herausbildung einer neuen Kunstgattung geführt hat, der sogenannten Aktions- und Performancekunst. Die Grenzen zwischen den verschiedenen Künsten wurden immer fließender – sie tendierten zunehmend dazu, Ereignisse statt Werke zu schaffen, und realisierten sich auffallend häufig in Aufführungen.
In der bildenden Kunst überwog bereits bei action painting und body art, später auch in Lichtskulpturen, Videoinstallationen u. ä. der Aufführungscharakter. Entweder präsentierte sich der Künstler selbst vor einem Publikum – nämlich in der Aktion des Malens oder in der Zurschaustellung seines in spezifischer Weise hergerichteten und/oder agierenden Körpers; oder der Betrachter war aufgefordert, sich um die Exponate herumzubewegen und mit ihnen zu interagieren, während andere Besucher zuschauten. Der Besuch einer Ausstellung wurde so häufig zur Teilnahme an einer Aufführung. Häufig ging es darüber hinaus um das Erspüren der besonderen Atmosphäre der verschiedenen Räume, welche die Besucher jeweils umfing.
Es waren vor allem bildende Künstler wie Joseph Beuys, Wolf Vostell, die Fluxus-Gruppe oder die Wiener Aktionisten, welche in den sechziger Jahren die neue Form der Aktions- und Performancekunst kreierten. Seit den frühen sechziger Jahren führte – und führt bis heute – Hermann Nitsch seine Lammzerreißungsaktionen durch, die nicht nur die Akteure, sondern auch die übrigen Teilnehmer in Berührung mit sonst tabuisierten Objekten brachten und ihnen besondere sinnliche Erfahrungen ermöglichten. Immer wieder wurden die Zuschauer in Nitschs Aktionen auch körperlich involviert, ja, wurden selbst zu Akteuren. Sie wurden mit Blut, Kot, Spülwasser und anderen Flüssigkeiten bespritzt und erhielten Gelegenheit, selbst mit ihnen zu plantschen, das Lamm selbst auszuweiden, Fleisch zu essen, Wein zu trinken.10
Ebenfalls in den frühen sechziger Jahren begannen die FLUXUS-Künstler ihre Aktionen. An ihrer dritten Veranstaltung, die unter dem Titel Actions/Agit Pop/De-collage/Happening/Events/ Antiart/L’autrisme/Art total/Refluxus – Festival der neuen Kunst am 20. Juli 1964 – man beachte das Datum – im Auditorium Maximum der Technischen Hochschule Aachen stattfand, waren die FLUXUS-Künstler Eric Andersen, Joseph Beuys, Bazon Brock, Stanley Brouwn, Henning Christiansen, Robert Filliou, Ludwig Gosewitz, Arthur Køpcke, Tomas Schmit, Ben Vautier, Wolf Vostell und Emmett Williams beteiligt. In seiner Aktion Kukei, akopee – Nein!, Braunkreuz, Fettecken, Modellfettecken löste Beuys entweder durch eine majestätische Geste, mit der er einen filzumwickelten Kupferstab waagerecht über sein Haupt hielt, oder durch das Verschütten von Salzsäure (nach Aussagen der Oberstaatsanwaltschaft im Rahmen ihrer Ermittlungen 1964/ 65) einen Tumult aus. Studenten stürmten die Bühne. Einer von ihnen schlug Beuys mehrere Male mit der Faust ins Gesicht, so daß diesem das Blut in Strömen aus der Nase auf sein weißes Hemd floß. Beuys, über und über mit Blut besudelt und weiter aus der Nase blutend, reagierte, indem er aus einer großen Schachtel Schokoladentafeln hervorholte und sie ins Publikum warf. Umgeben von wahnsinnigem Geschrei und tumultartigem Menschengetümmel hielt Beuys mit der linken Hand ein Kruzifix, das er wie beschwörend und bannend hochhob, während er die rechte Hand in die Höhe reckte, als ob er Einhalt gebieten wollte.11 Auch hier ging es um die Aushandlung der Beziehungen zwischen den Beteiligten; auch hier überlagerte der Körper- bzw. Materialstatus den Signifikantenstatus.
In der Musik setzte der Performativierungsschub bereits in den frühen 50er Jahren mit den »Events« und »Pieces« von John Cage ein.12 Hier waren es die unterschiedlichsten Handlungen und Geräusche – gerade auch die von den Zuhörern selbst hervorgebrachten Geräusche –, die zum Laut-Ereignis wurden, während der Musiker – wie zum Beispiel der Pianist David Tudor in 4'33'' (1952) – auf dem Flügel keinen einzigen Ton spielte. In den sechziger Jahren gingen immer mehr Komponisten dazu über, den Instrumentalisten bereits in den Partituren Anweisungen zu geben, welche für die Konzertbesucher sichtbaren Bewegungen sie ausführen sollten. Der (ohnehin immer gegebene) Aufführungscharakter von Konzerten trat zunehmend in den Blick. Davon zeugen u. a. neue von Komponisten geprägte Begriffe wie »szenische Musik« (Karlheinz Stockhausen), »sichtbare Musik« (Dieter Schnebel) oder »instrumentales Theater« (Mauricio Kagel). Damit wurden zugleich neue Beziehungen zwischen Musikern und Zuhörern postuliert.13
In der Literatur läßt sich der Performativierungsschub nicht nur innerliterarisch, z. B. an den sogenannten labyrinthischen Romanen beobachten, die den Leser zum Autor machen, indem sie ihm Materialien anbieten, die er beliebig kombinieren kann.14 Er wird auch in der enormen Zahl von Dichterlesungen manifest, zu denen sich das Publikum versammelt, um der Stimme des Dichters/Schriftstellers zu lauschen, wie zum Beispiel zu Günter Grass’ spektakulärer Lesung aus Der Butt, bei der er von einem Schlagzeuger begleitet wurde (12. Juni 1992 im Hamburger Thalia-Theater). Das Publikum strömt allerdings nicht nur zu Lesungen »lebender Autoren«; ebenso beliebt sind Lesungen aus den Werken längst verstorbener Dichter. Herausragende Beispiele waren Edith Clevers Vortrag der Marquise von O. (1989), Bernhard Minettis Lesung von Märchen der Gebrüder Grimm Bernhard Minetti erzählt Märchen (1990) oder auch die Veranstaltung Homer lesen, welche die Gruppe Angelus Novus 1986 im Wiener Künstlerhaus durchführte. Die Mitglieder der Gruppe lasen abwechselnd die 18 000 Verse der Ilias innerhalb von 22 Stunden ohne Unterbrechung vor. In anderen Räumen waren weitere Exemplare der Ilias ausgelegt; sie luden den beim Klang der vorlesenden Stimme herumwandernden Zuhörer zum eigenen Lesen ein. Die besondere Differenz zwischen Lesen und Zuhören beim Vorlesen von Literatur – zwischen Lesen als Text-Entziffern und »Lesen« als Aufführung – wurde so deutlich markiert. Nicht zuletzt endlich wurde die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf die spezifische Materialität der jeweils vorgetragenen Stimme gelenkt – ihr Timbre, ihr Volumen, ihre Lautstärke u. a., die bei jedem Wechsel der Lesenden unüberhörbar hervortraten. Hier wurde Literatur emphatisch als Aufführung realisiert. Sie gewann Leben durch die Stimmen der physisch anwesenden Vorlesenden und bahnte sich den Weg in die Einbildungskraft der physisch anwesenden Hörer durch den Appell an verschiedene Sinne. Die Stimme fungierte dabei nicht lediglich als Medium für die Übermittlung des Textes. Gerade aufgrund des Wechsels trat sie in ihrer jeweiligen Eigenart deutlich hervor und wirkte unmittelbar – d. h. auch unabhängig von dem, was sie sprach – auf die Zuhörer ein. Darüber hinaus spielte die Aufführung den Zeitfaktor aus: Die lange Zeitspanne von 22 Stunden veränderte nicht nur die Wahrnehmung der Teilnehmer, sie machte ihnen diese Veränderung auch bewußt. Das Verstreichen von Zeit trat als Bedingung von Wahrnehmung und vor allem als Bedingung von Veränderung ins Bewußtsein. Teilnehmer äußerten später die Empfindung, sich im Verlauf dieses Ereignisses verändert zu haben.15
Auch das Theater erfuhr in den sechziger Jahren einen Performativierungsschub. Dabei ging es vor allem um eine Neubestimmung des Verhältnisses von Darstellern und Zuschauern. Auf der ersten »Experimenta« (3.-10. Juni 1966 in Frankfurt am Main) wurde im Frankfurter Theater am Turm Peter Handkes Publikumsbeschimpfung in einer Inszenierung von Claus Peymann uraufgeführt. Hier sollte Theater aus der Beziehung zwischen Akteuren und Zuschauern neu bestimmt werden. Theater sollte sich nicht durch die Darstellung einer »anderen Welt« legitimieren. Es wurde nicht länger als Repräsentation einer fiktiven Welt begriffen, die der Zuschauer beobachten, deuten und verstehen soll, sondern als Herstellung eines besonderen Verhältnisses zwischen Akteuren und Zuschauern. Theater konstituierte sich hier, indem sich etwas zwischen Akteuren und Zuschauern ereignete. Dabei war offensichtlich wesentlich, daß sich etwas zwischen ihnen ereignete, und – zumindest auf den ersten Blick – nicht ganz so wichtig, was sich zwischen ihnen ereignete. Es ging jedenfalls nicht um die Darstellung einer fiktiven Welt, um die Herstellung einer innertheatralen Kommunikation, d. h. einer Kommunikation zwischen dramatischen Figuren, über die erst die externe theatrale Kommunikation, die Kommunikation zwischen Bühne und Publikum, zwischen Darstellern und Zuschauern sich einstellt. Zentral war vielmehr das Verhältnis zwischen Akteuren und Zuschauern. Die Schauspieler entwarfen und testeten diese Beziehung, indem sie die Zuschauer direkt ansprachen, sie als »Tröpfe«, »Flegel«, »Atheisten«, »Liederjahne«, »Strauchritter« attackierten und mit den Bewegungen ihrer Körper spezifische räumliche Relationen zu ihnen herstellten. Die Zuschauer gingen auf sie ein, indem sie ihrerseits mit Handlungen reagierten: mit Beifallklatschen, mit Aufstehen, den Raum Verlassen, Kommentaren, die Bühne Erklimmen, mit den Schauspielern Rangeln u. a. mehr.
Alle Beteiligten scheinen sich darüber einig gewesen zu sein, daß Theater durch eine spezifische Prozeßhaftigkeit charakterisiert ist: durch die Handlungen der Akteure, die darauf zielen, ein bestimmtes Verhältnis zu den Zuschauern herzustellen, und durch die Handlungen der Zuschauer, mit denen diese sich entweder auf die Beziehungsdefinition einlassen, welche die Schauspieler anbieten, oder sie zu modifizieren bzw. sogar durch eine andere zu ersetzen suchen. Es ging also darum, die Beziehungen auszuhandeln, die zwischen den Akteuren und den Zuschauern gelten sollen, und auf diese Weise die Wirklichkeit des Theaters zu konstituieren. Dabei bedeuteten die Handlungen der Schauspieler und der Zuschauer zunächst nichts anderes als das, was sie vollzogen. Sie waren in diesem Sinne selbstreferentiell. Als selbstreferentiell und wirklichkeitskonstituierend können sie, wie alle in den bisher angeführten Beispielen beschriebenen Handlungen, im Sinne Austins »performativ« genannt werden.16
Am Abend der Uraufführung verliefen die Aushandlungsprozesse letztlich konsensuell. Die Zuschauer übernahmen ihrerseits die Rolle von Akteuren, indem sie durch ihre Handlungen und Kommentare den Blick der Schauspieler und der übrigen Zuschauer auf sich lenkten. Entweder verweigerten sie sich weiterem Aushandeln der Beziehungen, indem sie den Raum verließen, oder sie arrangierten sich mit den Schauspielern, indem sie sich auf deren mehrmalige Aufforderung wieder hinsetzten. Am zweiten Abend dagegen kam es zu einem Eklat. Die Zuschauer, die auf die Bühne kletterten und dort »mitspielen« wollten, ließen sich nicht auf anderslautende Verhandlungsangebote von Schauspielern und Regisseur ein. Der Regisseur brach daraufhin die Verhandlungen ab und suchte seine Beziehungsdefinition durchzusetzen, indem er die Zuschauer von der Bühne drängte.17
Was war hier geschehen? Offensichtlich gingen die Zuschauer, welche die Bühne erstürmten, und der Regisseur Claus Peymann von unterschiedlichen Voraussetzungen aus. Peymann handelte nach der Auffassung, daß er einen literarischen Text inszeniert hatte, der die Beziehungen zwischen Schauspielern und Zuschauern thematisiert. Die Möglichkeit, die Aufführung dieses Textes nicht als ein gespieltes, sondern als ein ernstzunehmendes Angebot zu verstehen, die Beziehungen zwischen Akteuren und Zuschauern neu auszuhandeln, folgte für ihn daraus nicht. Entsprechend war er nicht bereit, aus seiner Inszenierung dieses besonderen Textes derartige Konsequenzen zu ziehen. Indem er dieses Werk in Szene setzte, schuf er seiner Meinung nach ein »Werk«, das er den Zuschauern präsentierte. Sie durften ihren Beifall oder ihr Mißfallen an seinem »Werk« durch Klatschen, Zischen, Kommentare o. ä. zum Ausdruck bringen. Aber er sprach ihnen das Recht ab, in sein »Werk« einzugreifen und es durch ihre Handlungen zu verändern. Peymann verstand die Überschreitung der Rampe durch einige Zuschauer als eine Verletzung der von ihm gezogenen Grenzen und als einen Angriff auf den Werkcharakter seiner Inszenierung, der seine Urheberschaft und seine Definitionsmacht in Frage stellte. Letztendlich beharrte er auf der traditionellen Subjekt-Objekt-Beziehung.
Die Zuschauer dagegen zogen aus dem scheinbaren Konsens, daß Theater sich durch die Beziehung zwischen Schauspielern und Zuschauern konstituiert und definiert, den Schluß, daß es sich bei der Aufführung nicht um ein Werk handelte – das daran zu messen ist, wie es den Text »umsetzt« bzw. dabei die theatralen Mittel verwendet –, sondern um ein Ereignis, das auf eine grundsätzliche Neudefinition des Verhältnisses zwischen Schauspielern und Zuschauern zielt und deswegen auch die Möglichkeit zu einem Rollenwechsel eröffnet. Die Aufführung als Ereignis konnte aus ihrer Sicht nur durch die gleichberechtigte Teilnahme der Zuschauer gelingen. Nicht im Vollzug konventionalisierter Handlungen wie Beifallklatschen, Zischen, Kommentieren sollte sich die von der Aufführung postulierte Performativität auf seiten der Zuschauer verwirklichen, sondern in einer tatsächlichen Neubestimmung der Beziehungen, deren Resultat als offen gedacht war, die also auch imstande sein mußte, zu einem Rollenwechsel zu führen.
Während Peymanns Eingreifen aus seiner Sicht die Integrität seines »Werkes« sichern und wiederherstellen sollte, ließ es aus der Sicht der von der Bühne verdrängten Zuschauer die Aufführung als Ereignis scheitern. Im amerikanischen Avantgarde-Theater dagegen, in Julian Becks und Judith Malinas »Living Theatre« (seit The Brig, 1963) oder im »Environmental Theater« Richard Schechners und seiner Performance Group (gegründet 1967) wurde ›audience participation‹ zum Programm erhoben. Die Zuschauer wurden hier nicht nur zur Teilnahme zugelassen, sondern ausdrücklich ermuntert, ja, geradezu zur Berührung der Schauspieler sowie zur gegenseitigen Berührung aufgefordert, um so eine Art von Gemeinschaftsritual zu vollziehen, wie dies vor allem in Paradise Now (Avignon 1968) des Living Theatre und in Dionysus in 69 (New York 1968) der Performance Group der Fall war.18 Die Neubestimmung des Verhältnisses von Akteuren und Zuschauern ging hier jeweils mit einer Verschiebung der Dominanz vom Zeichenstatus der Handlungen und entsprechend den möglichen Bedeutungen, die ihnen beigelegt werden konnten, zu ihrer spezifischen Körperlichkeit und den Wirkungen einher, die sie auf alle Beteiligten ausüben mochten, d. h. den physiologischen, affektiven, energetischen und motorischen Reaktionen der Beteiligten sowie den sinnlichen Erfahrungen von großer Intensität, die sie ermöglichten.
Die seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts von Künstlern, Kunstkritikern, Kunstwissenschaftlern und Philosophen immer wieder proklamierte bzw. beobachtete Entgrenzung der Künste läßt sich also als performative Wende beschreiben. Ob bildende Kunst, Musik, Literatur oder Theater – alle tendieren dazu, sich in und als Aufführungen zu realisieren. Statt Werke zu schaffen, bringen die Künstler zunehmend Ereignisse hervor, in die nicht nur sie selbst, sondern auch die Rezipienten, die Betrachter, Hörer, Zuschauer involviert sind. Damit haben sich die Bedingungen für Kunstproduktion und -rezeption in einem entscheidenden Aspekt geändert. Als Dreh- und Angelpunkt dieser Prozesse fungiert nicht mehr das von seinen Produzenten wie von seinen Rezipienten losgelöste und unabhängig existierende Kunstwerk, das als Objekt aus der kreativen Tätigkeit des Künstlersubjektes hervorgegangen und der Wahrnehmung und Deutung des Rezipientensubjektes anheimgegeben ist. Statt dessen haben wir es mit einem Ereignis zu tun, das durch die Aktion verschiedener Subjekte – der Künstler und der Zuhörer/Zuschauer – gestiftet, in Gang gehalten und beendet wird. Damit verändert sich zugleich das Verhältnis zwischen Material- und Zeichenstatus der in der Aufführung verwendeten Objekte und vollzogenen Handlungen. Der Materialstatus fällt nicht mit dem Signifikantenstatus zusammen, er löst sich vielmehr von ihm ab und beansprucht ein Eigenleben. Das heißt, die unmittelbare Wirkung der Objekte und Handlungen ist nicht von den Bedeutungen abhängig, die man ihnen beilegen kann, sondern geschieht durchaus unabhängig von ihnen, teilweise noch vor, in jedem Fall aber jenseits von jedem Versuch einer Bedeutungsbeilegung. Als Ereignisse, die über diese besonderen Eigenarten verfügen, eröffnen die Aufführungen der verschiedenen Künste allen Beteiligten – d. h. Künstlern und Zuschauern – die Möglichkeit, in ihrem Verlauf Transformationen zu erfahren – sich zu verwandeln.
Der performativen Wende in den Künsten läßt sich mit den überlieferten ästhetischen Theorien kaum angemessen beikommen – auch wenn diese in mancher Hinsicht durchaus weiter auf sie anwendbar bleiben. Das entscheidende Moment dieser Wende jedoch, den Wechsel vom Werk und den mit ihm gesetzten Relationen von Subjekt vs. Objekt und Material- vs. Zeichenstatus zum Ereignis, vermögen sie nicht zu erfassen. Um es in seiner besonderen Eigenart in den Blick nehmen, untersuchen und erläutern zu können, bedarf es der Entwicklung einer neuen Ästhetik: einer Ästhetik des Performativen.
1 Eine Ausnahme bildet Antonin Artaud. Denn es war nicht die Bühne, auf der er seine Vorstellungen von einem Theater der Grausamkeit verwirklichte, einem Theater als Pest, welches Tod oder Heilung bringt, sondern sein eigener durch Drogen und die Behandlung mit Elektroschocks geschundener Körper.
2 Jeanne Ancelet-Hustache, »Les ›Vitae sororum‹ d’Unterlinden. Edition critique du manuscrit 508 de la bibliothèque de Colmar«, in: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge (1930), S. 317- 509, S. 340 f. Ich verdanke dies Beispiel Niklaus Largiers Lob der Peitsche. Eine Kulturgeschichte der Erregung, München 2001, S. 29 f.
3 Ancelet-Hustache, »Les ›Vitae sororum‹ d’Unterlinden«, S. 341, zit. nach Largier, Lob der Peitsche, S. 30.
4 Vgl. dazu E. Bertaud, Discipline: Dictionnaire de spiritualité 3, Paris 1957, wo ausgeführt wird, daß die Selbstgeißelung, wenn sie unter Bedingungen praktiziert wird, die maßvoll sind, »denen, die sie praktizieren«, erlaubt, »sich in Demut dem Leiden Christi während seiner Geißelung anzunähern. [...] Die Praktik der Geißelung gehört keineswegs zur primitiven monasti Dictionnaire de spiritualité 3, Paris 1957, wo ausgeführt wird, daß die Selbstgeißelung, wenn sie unter Bedingungen praktiziert wird, die maßvoll sind, »denen, die sie praktizieren«, erlaubt, »sich in Demut dem Leiden Christi während seiner Geißelung anzunähern. [...] Die Praktik der Geißelung gehört keineswegs zur primitiven monastischen Spiritualität oder zum frühen Christentum, für die die eigentlichen Bußübungen Fasten, Keuschheit und Wachen im Gebet waren. Sie muß deshalb als eine achtenswerte Übung gesehen werden, da sie seit ihrer Verbreitung von Heiligen geübt wurde und heute zu den Grundbestandteilen des religiösen Lebens gehört.« (S. 1310), zit. nach Largier 2001, Lob der Peitsche, S. 40.
5 Vgl. hierzu Richard van Dülmen, Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Strafrituale der frühen Neuzeit. München 1988, vor allem S. 161 ff.
6 Filippo Tommaso Marinetti, »Das Varietétheater«, in: Umbro Apollonio, Der Futurismus. Manifeste und Dokumente einer künstlerischen Revolution. 1909 -1918, Köln 1972, S. 175 f.
7 Darauf eben zielt die Performancekünstlerin Rachel Rosenthal ab, wenn sie feststellt: »In performance art, the audience, from its role as sadist, subtly becomes the victim. It is forced to endure the artist’s plight emphatically or to examine its own response of voyeurism and pleasure, or smugness and superiority. [...] In any case, the performer holds the reins. [...] The audience usually ›gives up‹ before the artist.« Rachel Rosenthal, »Performance and the Masochist Tradition«, in: High Performance, Winter 1981/2, S. 24.
8 Zum Begriff des Rituals vgl. das sechste Kapitel, Abschnitt 3: Liminalität und Transformation.
9 Zum Begriff des Performativen, wie er hier zugrunde gelegt wird, vgl. das zweite Kapitel.
10 Vgl. hierzu Erika Fischer-Lichte, »Verwandlung als ästhetische Kategorie. Zur Entwicklung einer neuen Ästhetik des Performativen«, in: dies. et al. (Hrsg.), Theater seit den sechziger Jahren, Tübingen/Basel 1998, S. 21- 91, vor allem S. 25 ff.
11 Vgl. hierzu Uwe M. Schneede, Joseph Beuys – Die Aktionen. Kommentiertes Werkverzeichnis mit fotografischer Dokumentation, Ostfildern-Ruit 1994, vor allem S. 42 - 67.
12 Vgl. zum Untitled Event, das 1952 im Black Mountain College stattfand, Erika Fischer-Lichte, »Grenzgänge und Tauschhandel. Auf dem Wege zu einer performativen Kultur«, in: dies. et al. (Hrsg.), Theater seit den sechziger Jahren, Tübingen/Basel 1998, S. 1- 20.
13 Vgl. hierzu Christa Brüstle, »Performance/Performativität in der neuen Musik«, in: Erika Fischer-Lichte und Christoph Wulf (Hrsg.), Theorien des Performativen (= Paragrana, Bd. 10, H. 1), Berlin 2001, S. 271- 283.
14 Vgl. hierzu Monika Schmitz-Emans, »Labyrinthbücher als Spielanleitungen«, in: Erika Fischer-Lichte und Gertrud Lehnert (Hrsg.), [(v)er]SPIEL[en] Felder – Figuren – Regeln (= Paragrana Bd. 11, H. 1), Berlin 2002, S. 179 - 207.
15 Vgl. dazu Reiner Steinweg, »Ein ›Theater der Zukunft‹. Über die Arbeit von Angelus Novus am Beispiel von Brecht und Homer«, in: Falter, Ausgabe 23, 1986.
16 Vgl. hierzu das zweite Kapitel.
17 Vgl. dazu Henning Rischbieter, »EXPERIMENTA. Theater und Publikum neu definiert«, in: Theater heute 6, Juli 1966, S. 8 -17.
18 Vgl. hierzu Julian Beck, The Life of the Theatre, San Francisco 1972; ders. und Julia Malina, Paradise Now, New York 1971; Richard Schechner, Environmental Theater, New York 1973; ders., Dionysus in 69, New York 1970.
Zweites KapitelBegriffsklärungen
1. Der Begriff des Performativen
Der Begriff »performativ« wurde von John L. Austin geprägt. Er führte ihn in den Vorlesungen, die er 1955 an der Harvard Universität unter dem Titel How to do things with Words hielt, in die Sprachphilosophie ein. Die Prägung des Begriffs fällt also ungefähr in dieselbe Zeit, in der ich die performative Wende in den Künsten lokalisiert habe. Während Austin in früheren Arbeiten versuchsweise den Terminus »performatorisch (performatory)« verwendet hatte, entschied er sich nun für den Ausdruck »performativ«, weil er »kürzer, nicht so häßlich, leichter zu handhaben und traditioneller gebildet ist.«1 In seinem ein Jahr später entstandenen Aufsatz »Performative Äußerungen« schreibt er über seine Neuschöpfung: »Es ist durchaus verzeihlich, nicht zu wissen, was das Wort performativ bedeutet. Es ist ein neues Wort und ein garstiges Wort, und vielleicht hat es auch keine sonderlich großartige Bedeutung. Eines spricht jedenfalls für dieses Wort, nämlich daß es nicht tief klingt.«2 Er leitete den Ausdruck vom Verb »to perform«, »vollziehen« ab: »man ›vollzieht‹ Handlungen«.3
Austin bedurfte seines Neologismus, weil er eine für die Sprachphilosophie revolutionäre Entdeckung gemacht hatte – die Entdeckung, daß sprachliche Äußerungen nicht nur dem Zweck dienen, einen Sachverhalt zu beschreiben oder eine Tatsache zu behaupten, sondern daß mit ihnen auch Handlungen vollzogen werden, daß es also außer konstativen auch performative Äußerungen gibt. Die Eigenart dieser zweiten Art von Äußerungen erläutert er unter Bezug auf die sogenannten ursprünglichen Performativa. Wenn jemand beim Wurf der Flasche gegen einen Schiffsrumpf den Satz äußert: »Ich taufe dieses Schiff auf den Namen ›Queen Elizabeth‹« oder der Standesbeamte nach der Bekundung beider Partner, daß sie miteinander die Ehe eingehen wollen, den Satz spricht: »Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau«, so ist mit diesen Sätzen nicht ein bereits bestehender Sachverhalt beschrieben – weswegen sie auch nicht als »wahr/richtig« oder als »falsch« klassifiziert werden können. Vielmehr wird mit diesen Äußerungen ein neuer Sachverhalt geschaffen: Das Schiff trägt von nun an den Namen ›Queen Elizabeth‹, und Frau X und Herr Y sind von nun an ein Ehepaar. Das Aussprechen dieser Sätze hat die Welt verändert. Denn die Sätze sagen nicht nur etwas, sondern sie vollziehen genau die Handlung, von der sie sprechen. Das heißt, sie sind selbstreferentiell, insofern sie das bedeuten, was sie tun, und sie sind wirklichkeitskonstituierend, indem sie die soziale Wirklichkeit herstellen, von der sie sprechen. Es sind diese beiden Merkmale, die performative Äußerungen charakterisieren. Was Sprecher von Sprachen intuitiv immer schon gewußt und praktiziert haben, wurde hier für die Sprachphilosophie zum ersten Mal formuliert: daß Sprechen eine weltverändernde Kraft entbinden und Transformationen bewirken kann.
Zwar handelt es sich in den zitierten Fällen um formelhaftes Sprechen. Aber allein die Anwendung der richtigen Formel garantiert noch nicht das Gelingen der Äußerung als einer performativen. Dazu müssen eine Reihe anderer, nicht sprachlicher Bedingungen erfüllt sein; andernfalls mißglückt sie und bleibt leeres Gerede. Wenn zum Beispiel der Satz »Ich erkläre Sie zu Mann und Frau« weder von einem Standesbeamten noch von einem Priester noch von einer anderen hierzu ausdrücklich autorisierten Person – wie dem Kapitän auf hoher See – ausgesprochen oder in einer Gemeinschaft geäußert wird, die ein anderes Verfahren für die Eheschließung vorsieht, so ist er außerstande, eine Ehe zu stiften.
Bei den Gelingensbedingungen, die erfüllt sein müssen, handelt es sich entsprechend nicht nur um sprachliche, sondern vor allem um institutionelle, um soziale Bedingungen. Die performative Äußerung richtet sich immer an eine Gemeinschaft, die durch die jeweils Anwesenden vertreten wird. Sie bedeutet in diesem Sinne die Aufführung eines sozialen Aktes. Mit ihr wird die Eheschließung nicht nur ausgeführt (vollzogen), sondern zugleich auch aufgeführt.
Im weiteren Verlauf seiner Vorlesungen läßt Austin allerdings den einleitend aufgebauten Gegensatz von Konstativa und Performativa kollabieren und schlägt statt dessen eine Dreiteilung in lokutionäre, illokutionäre und perlokutionäre Akte vor. Damit will er den Nachweis führen, daß Sprechen immer Handeln ist – weswegen auch Feststellungen glücken oder mißglücken und performative Äußerungen wahr oder falsch sein können.4 So läßt Austin die von ihm getroffene Unterscheidung zwischen performativ und konstativ mißglücken. Wie Sibylle Krämer gezeigt hat, kann die Inszenierung dieses Scheiterns durch Austin als ein Exempel begriffen werden, mit dem »die Anfälligkeit aller Kriterien und das Ausgesetztsein aller definitiven Begriffe für die Unentscheidbarkeiten, die Unwägbarkeiten und Vieldeutigkeiten, die mit dem wirklichen Leben verbunden sind«,5 demonstriert wird. Damit lenkt Austin den Blick darauf, daß es gerade das Performative ist, welches eine Dynamik in Gang setzt, »die dazu führt, das dichotomische begriffliche Schema als ganzes zu destabilisieren«.6
Dieser Aspekt ist für eine Ästhetik des Performativen von besonderem Interesse. Denn wie sich an den einleitend angeführten Performances, Aktionen und anderen Aufführungen gezeigt hat, sind es gerade dichotomische Begriffspaare wie Subjekt/Objekt oder Signifikant/Signifikat, die hier ihre Polarität und Trennschärfe verlieren, in Bewegung geraten und zu oszillieren beginnen. Auch wenn Austin – aus guten Gründen – das dichotomische Begriffspaar konstativ/performativ zum Scheitern bringt, läßt dies doch keineswegs die Definition fragwürdig werden, die er unter Bezug auf die ursprünglichen Performativa vom Begriff des Performativen gegeben hat: nämlich daß dieser (Sprech-)Handlungen meint, die selbstreferentiell und wirklichkeitskonstituierend sind und als solche aufgrund vor allem institutioneller und sozialer Bedingungen glücken oder mißglücken können (wobei ihr Scheitern für Austin offensichtlich den attraktiveren Fall darstellte, wie seine ausführlich und detailliert abgehandelte Lehre von den Unglücksfällen suggeriert). Als weiteres Merkmal könnte man daher die Fähigkeit des Performativen anführen, dichotomische Begriffsbildungen zu destabilisieren, ja zum Kollabieren zu bringen.
Austin verwendet den Begriff des Performativen ausschließlich im Zusammenhang mit Sprechhandlungen. Nun schließt seine Definition des Begriffs keineswegs aus, ihn auch auf körperliche Handlungen anzuwenden, wie sie in Lips of Thomas vollzogen wurden. Im Gegenteil, eine solche Anwendung drängt sich geradezu auf. Denn wie ich gezeigt habe, handelt es sich hier in der Tat um Handlungen, die selbstreferentiell sind und Wirklichkeit konstituieren (was Handlungen letztlich immer tun) und dadurch imstande sind, eine – wie auch immer geartete – Transformation der Künstlerin und der Zuschauer herbeizuführen. Aber wie verhält es sich hier mit dem Kriterium des Glückens oder Scheiterns? Ganz offensichtlich hat die Künstlerin wirklich zu viel Honig und Wein zu sich genommen, sich mit Rasierklinge und Peitsche tatsächlich verletzt. Ebenso offensichtlich setzten die Zuschauer Abramovićs Qual ein Ende, als sie die Performerin von dem Kreuz aus Eisblöcken herunterholten. Aber war damit die Performance gelungen oder gescheitert? Was sind die institutionellen Bedingungen, deren Erfüllung oder Nichterfüllung uns berechtigt, die Aufführung als »geglückt« oder als »mißlungen« zu bewerten?
Da es sich hier um eine künstlerische Performance handelt, läßt sich zunächst an die Bedingungen denken, welche die Institution Kunst setzt. Der Ort der Aufführung, eine Kunstgalerie, weist ausdrücklich auf die Institution Kunst hin, die hier als Rahmen fungiert, innerhalb dessen die Aufführung von allen Beteiligten vollzogen wird. Aber was folgt daraus? Was sind zu Beginn der siebziger Jahre die mit der Institution Kunst gesetzten Bedingungen – zu einem Zeitpunkt also, als eine Neubestimmung und Umstrukturierung der Institution Kunst intern ebenso wie von ihren Rändern her gerade eingesetzt hatte und nun mit Macht vorangetrieben wurde? Die institutionellen Bedingungen, mit denen wir es hier zu tun haben, sind offenkundig keineswegs so klar und unstrittig wie bei der Eheschließung oder der Taufe. Aus der Institution Kunst lassen sich jedenfalls kaum Kriterien ableiten, nach denen sich begründet entscheiden ließe, ob das Eingreifen einzelner Zuschauer als Gelingen oder als Scheitern der Performance zu bewerten ist.
Damit jedoch nicht genug. Denn die Performance fand nicht nur in einem von der Institution Kunst gesetzten Rahmen statt. Wie ich gezeigt habe, wies sie sowohl Züge eines Rituals als auch eines Spektakels auf. Es erhebt sich die Frage, wieweit damit auch eine Transformation der Rahmen »Ritual« und »Spektakel« in eine künstlerische Performance stattfand. In welcher Hinsicht sind diese miteinander sowie mit dem Rahmen »Kunst« kollidierenden Rahmen bei der Frage nach dem Gelingen oder Scheitern zu berücksichtigen?7
Jedenfalls ist evident, daß sich Austins Liste von Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine performative Äußerung glükken kann,8 kaum auf eine Ästhetik des Performativen übertragen läßt. Denn wie Lips of Thomas erhellt, ist hier ein wichtiger Faktor gerade das Spiel mit den verschiedenen Rahmen und deren Kollision, dem für die Transformation der Beteiligten eine wichtige Bedeutung zukommt. Ob die Performance aufgrund dieser Transformation als geglückt oder als gescheitert anzusehen ist, wer wollte sich anmaßen, dies zu entscheiden? Die Frage nach Gelingen oder Verunglücken scheint – zumindest in dieser Form – falsch gestellt. Das heißt, der Begriff des Performativen wird im Kontext einer Ästhetik des Performativen einer Modifizierung bedürfen.
Während der Begriff des Performativen in seiner Ursprungsdisziplin, der Sprachphilosophie, mit der Ausarbeitung der Sprechakttheorie – und das heißt mit der Verbreitung der Überzeugung von Sprechen als Handeln – an Prominenz verlor, erlebte er in den neunziger Jahren in Kulturphilosophie und Kulturtheorie eine zweite Karriere. Bis in die späten achtziger Jahre hinein herrschte in den Kulturwissenschaften ein Verständnis von Kultur vor, wie es in der Erklärungsmetapher »Kultur als Text« zum Ausdruck kommt. Einzelne kulturelle Phänomene ebenso wie ganze Kulturen wurden als ein strukturierter Zusammenhang von Zeichen begriffen, denen bestimmte Bedeutungen zuzuschreiben sind. Die verschiedensten Versuche zur Beschreibung und Deutung von Kultur wurden entsprechend als »Lektüren« bezeichnet. Die Aufgabe der Kulturwissenschaften bestand nach diesem Verständnis von Kultur vor allem darin, Texte, bevorzugt solche in fremden, fast unverständlichen Sprachen, zu entziffern und zu deuten oder bekannte Texte auf mögliche Subtexte hin zu lesen und sie so im Lektüreprozeß zu dekonstruieren.
In den neunziger Jahren bahnte sich ein Wechsel der Forschungsperspektiven an. Nun traten die bisher weitgehend übersehenen performativen Züge von Kultur in den Blick, die eine eigenständige Weise der (praktischen) Bezugnahme auf bereits existierende oder für möglich gehaltene Wirklichkeiten begründen und den erzeugten kulturellen Handlungen und Ereignissen einen spezifischen, vom traditionellen Text-Modell nicht erfaßten Wirklichkeitscharakter verleihen. Die Metapher von »Kultur als Performance« begann ihren Aufstieg. Damit wurde zugleich eine Rekonzeptualisierung des Begriffs des Performativen notwendig, die ganz explizit körperliche Handlungen einschließt.
Ohne sich ausdrücklich auf Austin zu berufen, führte Judith Butler in ihrem 1988 entstandenen Aufsatz »Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory«9 den Begriff des Performativen in die Kulturphilosophie ein. In dieser Arbeit soll der Nachweis geführt werden, daß Geschlechtsidentität (gender) – wie Identität überhaupt – nicht vorgängig, d. h. ontologisch oder biologisch gegeben ist, sondern das Ergebnis spezifischer kultureller Konstitutionsleistungen darstellt: »In this sense, gender is in no way a stable identity or locus of agency from which various acts proceed; rather, it is [...] an identity instituted through a stylized repetition of acts.«10 Diese Akte nennt Butler »performativ«, »where ›performative‹ itself carries the double-meaning of ›dramatic‹ and ›non-referential‹«.11 Auch wenn diese Definition des Begriffs auf den ersten Blick erheblich von derjenigen Austins abzuweichen scheint, minimieren sich die Differenzen bei genauerem Hinsehen. Sie sind vor allem dem Sachverhalt geschuldet, daß Butler den Begriff hier nicht auf Sprechakte, sondern insbesondere auf körperliche Handlungen anwendet.
Die performativen Akte (als körperliche Handlungen) sind insofern als ›non-referential‹ zu begreifen, als sie sich nicht auf etwas Vorgegebenes, Inneres, eine Substanz oder gar ein Wesen beziehen, das sie ausdrücken sollen: Jene feste, stabile Identität, die sie ausdrücken könnten, gibt es nicht. Expressivität stellt in diesem Sinne den diametralen Gegensatz zu Performativität dar. Die körperlichen Handlungen, die als performativ bezeichnet werden, bringen keine vorgängig gegebene Identität zum Ausdruck, vielmehr bringen sie Identität als ihre Bedeutung allererst hervor.
Auch der Terminus ›dramatic‹ zielt auf diesen Prozeß der Erzeugung: »By dramatic I mean [...] that the body is not merely matter but a continual and incessant materializing of possibilities. One is not simply a body, but, in some very key sense, one does one’s body [...].«12 Das heißt, auch der Körper in seiner je besonderen Materialität ist das Ergebnis einer Wiederholung bestimmter Gesten und Bewegungen; es sind diese Handlungen, die den Körper als einen individuell, geschlechtlich, ethnisch, kulturell markierten überhaupt erst hervorbringen. Identität – als körperliche und soziale Wirklichkeit – wird also stets durch performative Akte konstituiert. ›Performativ‹ meint in diesem Sinne durchaus wie bei Austin ›wirklichkeitskonstituierend‹ und ›selbstreferentiell‹.
Die Verlagerung des Fokus von Sprechakten auf körperliche Handlungen hat allerdings durchaus Konsequenzen, die einen wichtigen Unterschied in der Begriffsbestimmung zwischen Austin und Butler begründen. Während Austin das Kriterium »glücken/mißglücken« stark macht und entsprechend nach den funktionalen Gelingensbedingungen fragt – was uns im Zusammenhang mit Abramovićs Performance vor grundlegende Schwierigkeiten gestellt hat –, fragt Butler nach den phänomenalen Verkörperungsbedingungen.
Unter Berufung auf Merleau-Ponty, der den Körper nicht nur als eine historische Idee begreift, sondern auch als ein Repertoire von Möglichkeiten, die kontinuierlich zu verwirklichen sind, d. h. als »an active process of embodying certain cultural and historical possibilities«,13 erläutert Butler den Prozeß der performativen Erzeugung von Identität als einen Prozeß von Verkörperung (embodiment). Sie bestimmt ihn entsprechend als »a manner of doing, dramatizing and reproducing a historical situation«.14 Durch die stilisierte Wiederholung performativer Akte werden bestimmte historisch-kulturelle Möglichkeiten verkörpert und auf diese Weise sowohl der Körper als historisch-kulturell markierter wie auch Identität allererst erzeugt.