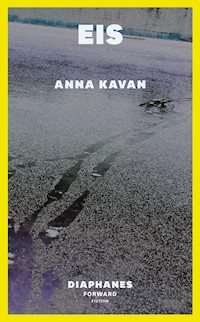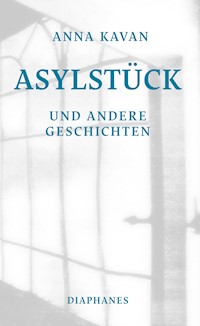
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gleißende Gefühle inmitten von Trug und Entfremdung, taghelle Gedanken angesichts des verordneten Wahns, luzide Fluchtträume aus dunklen Klinikwelten: Die vor dem Hintergrund eigener Psychatrieerfahrungen verfassten Geschichten Anna Kavans lesen sich wie Kriegsreportagen aus dem Innenleben der modernen Seele.
Kavans hohe Imaginationskunst steht neben der eines Franz Kafka oder Maurice Blanchot, ihre Literatur für einen so unerbittlichen wie empfindsamen Blick auf eine »condition feminine« unter patriarchalischen Verhältnissen.
Diese erste unter dem selbstgewählten neuen Namen publizierte Textsammlung markiert eine tiefreichende Wendung im Werk der großen Autorin, entfaltet sie doch erstmals jenen »halluzinatorischen Realismus«, für den sie heute so berühmt ist und der ihre Literatur bis in unsere Gegenwart leuchten lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
ASYLSTÜCK
UND ANDERE GESCHICHTEN
ANNA KAVAN
ASYLSTÜCK
UND ANDERE GESCHICHTEN
AUS DEM ENGLISCHEN VON HELMA SCHLEIF
DIAPHANES
Originalausgabe: Asylum Piece and Other Stories
© The Estate of Anna Kavan, 1940
1. Auflage 2022
© DIAPHANES, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-0358-0524-6
Satz und Layout: 2edit, Zürich
Druck: Steinmeier, Deiningen
www.diaphanes.net
INHALT
Das Muttermal
Hinauf in die Welt
Der Feind
Eine andere Situation
Die Vögel
Klage erheben
Nur ein Fehlschlag unter vielen
Die Vorladung
Bei Nacht
Eine unerfreuliche Erinnerung
Maschinen im Kopf
Asylstück I
Asylstück II
Asylstück III
Asylstück IV
Asylstück V
Asylstück VI
Asylstück VII
Asylstück VIII
Ende in Sicht
Es gibt kein Ende
Nachwort
DAS MUTTERMAL
Als ich vierzehn Jahre alt war, musste mein Vater aus gesundheitlichen Gründen für ein Jahr ins Ausland gehen. Es wurde beschlossen, dass meine Mutter ihn begleiten sollte, und so wurde unser Zuhause vorübergehend aufgegeben und ich in ein kleines Internat auf dem Land geschickt.
An dieser Schule lernte ich ein Mädchen namens H kennen. Ich verwende absichtlich das Wort »kennenlernen« statt »sich anfreunden«, da zwischen uns, obwohl sie mich in all der Zeit dort stets interessierte, keine wirkliche Freundschaft entstand.
Bereits beim Abendessen an meinem ersten Tag in der Schule wurde ich auf H aufmerksam. Ich saß neben einem anderen neuen Mädchen an der langen Tafel, fühlte mich fremd und schutzlos und hatte etwas Heimweh in dieser lärmigen Umgebung, die sich so sehr von der umfriedeten, intimen Atmosphäre unterschied, in der ich mein bisheriges Leben verbracht hatte. Ich schaute in die jungen Gesichter dieser noch unbekannten Mitschülerinnen, von denen einige zu Freundinnen, andere zu Feindinnen werden sollten. Eines dieser Gesichter zog mich unwiderstehlich in seinen Bann.
H saß auf der anderen Seite des Tischs, mir fast unmittelbar gegenüber. Inmitten so vieler braunhaariger Köpfe stach allein schon ihr heller Schopf auffallend hervor. Es war ein Herbstabend, neblig und kalt, und der Raum war nicht besonders gut beleuchtet. Ich hatte den Eindruck, als bündele sich das spärliche Licht im Speisesaal über ihr, als belebe und erneuere es sich, während es ihr blondes Haar umspielte. Im Rückblick ahne ich, dass sie schön gewesen sein muss; doch Einzelheiten ihrer Erscheinung entziehen sich beharrlich meiner Erinnerung, ich weiß nur noch, welchen Eindruck ihr markantes Gesicht auf mich machte, das weder fröhlich noch melancholisch war, doch auffallend apart und ausdrucksstark, mit dem Blick einer Person, die sich in ihr Schicksal fügt. Diese Sätze mögen in Zusammenhang mit einem Schulmädchen, das nur wenige Monate älter war als ich, unpassend klingen; und natürlich habe ich damals nicht so über sie gedacht. Es sind eher kumulierte Eindrücke, keine flüchtigen Erinnerungen, die ich hier vermitteln möchte. Damals sah ich nur ein blondes Mädchen, etwas älter als ich, das, meinen Blick erhaschend, zweifellos dachte, ich bedürfe einer Ermutigung, und mich über den Tisch hinweg anlächelte.
Ich erinnere mich, dass ich ihren Blick mit einem gewissen Neid erwiderte. Damals schien mir, sie habe alles, was mir als Neuling fehlte – Erfolg, Beliebtheit, einen festen Platz in der Schulwelt. Später merkte ich, dass dies keineswegs so war. Ein sonderbarer Schatten schien über allem zu liegen, was sie tat. Ich verstand allmählich, dass dieser schwer zu beschreibende Schatten untrennbar zu ihrem ungewöhnlich glanzvollen Erscheinungsbild gehörte.
Wie das eigentümliche Empfinden des Vakuums beschreiben, das sie umgab? Obwohl sie nicht unbeliebt war, hatte sie keine engen Freundinnen; und obwohl sie im Unterricht als auch beim Sport zu den Besten zählte, hinderte sie stets irgendein Missgeschick daran, Höchstleistungen zu vollbringen. Dieses Schicksal schien sie fraglos zu akzeptieren, fast könnte man meinen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Nie hörte ich sie über das Pech klagen, das ihr widerfuhr und sie beständig jeder Belohnung beraubte.
Und doch war sie bestimmt weder gleichgültig noch ahnungslos.
Ich erinnere mich sehr genau an ein Ereignis gegen Ende meiner Schulzeit. In einem der Korridore gab es eine filzbespannte Aushangtafel, an der, zwischen anderen Bekanntmachungen, ein großes Blatt Papier befestigt war, mit unseren Namen und den Noten, die jede von uns allwöchentlich erhielt. H stand vor dieser Liste, ganz allein, und betrachtete sie mit einem Ausdruck, den ich nicht verstand, einem Ausdruck nicht des Ärgers oder Bedauerns, sondern, so schien es mir, der Resignation gepaart mit Furcht. Als ich diesen Blick sah, überwältigte mich eine Woge leidenschaftlichen und unerklärlichen Mitgefühls; eine angesichts der Umstände gänzlich unangemessene Zuneigung, die mir zu meinem Erstaunen die Tränen in die Augen trieb.
»Lass mich dir helfen …, lass mich etwas tun«, hörte ich mich flehen, so unartikuliert, als stünde mein eigenes Schicksal auf dem Spiel.
Statt einer Antwort krempelte H einen Ärmel hoch und deutete stumm auf einen Fleck auf ihrem Oberarm. Es war ein Muttermal, schwach sichtbar wie mit verblasster Tinte gezeichnet, das auf den ersten Blick nur ein feines Netz aus Adern unter der Haut zu sein schien. Doch als ich es näher betrachtete, sah ich, dass es einem Medaillon ähnelte, einem mit scharfen Spitzen versehenen Kreis, der eine winzige, sehr weiche und zarte Form in sich barg – vielleicht eine Rose.
»Hast du das schon einmal irgendwo gesehen?«, fragte sie; und es kam mir in den Sinn, dass sie hoffte, auch ich trüge ein ähnliches Mal.
War es Enttäuschung, Verlegenheit oder Verzweiflung, die sich auf ihrem Gesicht spiegelte, als ich bedauernd den Kopf schüttelte? Ich weiß nur, dass sie aus dem Korridor stürmte und mich für den Rest der Schulzeit zu meiden schien und wir uns nie wieder allein begegneten.
Die Jahre vergingen, und obwohl ich von H nie mehr etwas hörte, konnte ich sie nie wirklich vergessen. Hin und wieder, so ein- oder zweimal im Jahr, wenn ich im Zug saß, auf einen Termin wartete oder mich morgens anzog, dachte ich an sie, gepaart mit einem eigentümlichen Unbehagen, einer Art mentaler Beklemmung, die ich so schnell wie möglich zu vertreiben suchte.
Eines Sommers bereiste ich ein fremdes Land und musste wegen einer Fahrplanänderung der Bahn in einer am See gelegenen Kleinstadt den Zug wechseln. Da ich drei Stunden warten musste, verließ ich den Bahnhof und ging durch die Straßen. Es war ein Nachmittag im August, sehr heiß und schwül, und bedrohliche Gewitterwolken zogen über den hohen Bergen auf. Zuerst wollte ich auf der Suche nach Abkühlung zum See hinuntergehen, aber der unheilvolle Anblick des stehenden, lavafarbenen Gewässers stieß mich ab und ich beschloss stattdessen, das Schloss zu besuchen, das Wahrzeichen des Ortes.
Diese alte Festung, am höchsten Punkt der Stadt erbaut, war vom Bahnhofsvorplatz aus gut sichtbar. Es schien, als müsste ich nur einer der steilen, in diese Richtung weisenden Straßen folgen, um sie in ein paar Minuten zu erreichen. Aber meine Augen müssen mich hinsichtlich der Entfernung getäuscht haben, denn es zeigte sich, dass es ein ziemlich langer Spaziergang war. Als ich schweißgebadet, müde und unerklärlich deprimiert an den großen, nagelbeschlagenen Toren ankam, zögerte ich hineinzugehen, aber eine Gruppe von Touristen war im Begriff einzutreten, und ich ließ mich vom Führer überreden, mich ihnen anzuschließen.
Am Bahnhof hatte man mir gesagt, dass das Gebäude heute als Museum diene, und so war ich überrascht, als ich bewaffnete Soldaten sah, die im Innenhof Wache hielten. Auf meine Frage hin erklärte mir der Fremdenführer, dass ein Teil des Schlosses nach wie vor als Gefängnis für eine bestimmte Art von Straftätern diene. Ich versuchte, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, da ich noch nie von diesen Spezialgefängnissen gehört hatte; höflich hörte mir der Führer zu, gab aber keine Antwort. Auch die anderen Touristen schienen meine Neugierde zu missbilligen. Ich gab nach und verstummte. Gemeinsam marschierten wir in eine große Halle und betrachteten die dunklen, mit unheildrohenden Reliefs versehenen Steinmauern.
Während wir von einer düsteren Kammer zur nächsten gingen, wünschte ich mir zusehends, nicht Teil dieser Expedition zu sein. Die Steinfußböden ermüdeten meine Füße, die bedrohlichen Mauern und die schweren, vergitterten Türen trübten meine Stimmung; ich aber hatte die Vorstellung, dass es unmöglich war, einfach umzukehren, dass niemand dieses Areal verlassen durfte und wir warten mussten, bis unser Führer uns wieder ins Freie führte.
Wir besichtigten gerade eine Ausstellung mittelalterlicher Waffen, als ich eine kleine Tür erspähte, halb verdeckt von einer Rüstung. Ich weiß nicht mehr, ob es Wagemut war, ein plötzliches Verlangen nach frischer Luft oder nur Neugierde, die mich veranlasste, hinter die massive Ritterrüstung zu treten und die Türklinke auszuprobieren. Zu meinem Erstaunen war die Tür unverschlossen. Sie ließ sich ganz leicht öffnen, und ich schlüpfte hindurch. Die anderen, ganz in den Vortrag des Führers vertieft, schenkten mir keinerlei Beachtung.
Ich befand mich nun in einem geschlossenen, gefliesten Raum, zu klein, um als Hof bezeichnet zu werden, zum Himmel hin offen, aber durch felsartige Mauern so blockiert, dass kein Sonnenlicht hineindrang und die bleierne Luft sich verbraucht und schwül anfühlte. Da es mir hier so wenig gefiel wie im Inneren des Schlosses, wollte ich mich gerade wieder zurück auf den Weg zu der öden Besichtigungstour begeben, als mich etwas veranlasste, auf den Boden zu blicken. Ich stand, so jedenfalls schien es mir, vor einem niedrigen Gitter, vermutlich eine Luftschleuse, die mir ungefähr bis zur Wade reichte. Bei genauerem Hinsehen sah ich, dass es in Wirklichkeit ein niedriges, vergittertes Fenster war, das zu einer unterirdischen Zelle gehörte. Eine Bewegung hinter den Gitterstäben hatte mein Augenmerk erregt. Ich kniete nieder und spähte durch das Unkraut, das aus den Ritzen zwischen den großen Steinplatten gewachsen war.
Zunächst konnte ich nichts sehen, es hätte auch ein schwarzer Keller sein können, in den ich starrte. Doch bald gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit und ich konnte unterhalb des Gitters eine Art Palette erkennen, auf der eine verhüllte Gestalt lag. Ich war mir nicht sicher, ob die dort wie aufgebahrt liegende Person ein Mann oder eine Frau war, doch ich glaubte, den trüben Widerschein blonden Haares zu erkennen und bald darauf einen Arm, nicht dicker als ein Knochen, der sich kraftlos hob, als reckte er sich dem Licht entgegen. War es Einbildung oder sah ich wirklich auf dem fast durchscheinenden Fleisch einen blassen Fleck, kreisförmig und gezähnt die Form einer Rose umhüllend?
Nie wird mich der Horror dieses Augenblicks verlassen. Ich öffnete den Mund, aber sekundenlang war ich außerstande, auch nur einen Laut von mir zu geben. Als ich dann der Gefangenen etwas zurufen wollte, erschienen Soldaten und zerrten mich fort. Was sie sagten, klang grob und drohend, sie schubsten mich und verdrehten mir die Arme, als sie mich zu ihrem vorgesetzten Offizier brachten. Man befahl mir, meinen Pass vorzuzeigen, und ich wurde einem Verhör unterzogen, bei dem ich radebrechend begann, in der fremden Sprache Auskunft zu geben über das, was ich gesehen hatte. Doch dann sah ich die Revolver, die Gummiknüppel, die gleichgültigen, einfältigen Gesichter der jungen Soldaten, den unnahbaren Offizier in seiner gegürteten Tunika; ich dachte an die massiven Mauern, die Gitterstäbe, und mein Mut verließ mich. Was hätte ich denn schon bewirken können, ich, eine unbedeutende Ausländerin, eine Frau, angesichts einer so furchterregenden und fest etablierten Macht? Und was würde es der Gefangenen helfen, wenn man mich inhaftierte?
Endlich, nach langem Verhör, durfte ich gehen. Zwei Wachen eskortierten mich zum Bahnhof und warteten auf dem Bahnsteig, bis der Zug mich fortbrachte. Was hätte ich sonst tun können? Es war so dunkel in der unterirdischen Zelle: Ich kann nur beten, dass meine Augen mich getäuscht haben.
HINAUF IN DIE WELT
In den tiefliegenden Straßen nahe des Flusses, wo ich lebe, herrscht den ganzen Winter über Nebel. Wenn ich nachts zu Bett gehe, ist es so kalt, dass mir das Kissen an der Wange gefriert. Seit langer Zeit bin ich einsam, ohne Wärme und unglücklich. Seit Monaten habe ich die Sonne nicht mehr gesehen. Plötzlich, eines Morgens, wird mir alles zu viel. Wie es scheint, kann ich die Kälte, die Einsamkeit, den ewigen Nebel nicht länger ertragen – nein, nicht einmal für eine weitere Stunde –, und so beschließe ich, meine Wohltäter aufzusuchen und sie um Hilfe zu bitten. Es ist ein verzweifelter Entschluss, doch nachdem ich ihn einmal gefasst habe, bin ich voller Optimismus. Vielleicht mache ich mir vorsätzlich falsche Hoffnungen, indem ich mein bestes Kleid anziehe und mich sorgfältig schminke.
Im letzten Moment, gerade als ich mich auf den Weg machen will, fällt mir ein, dass ich besser ein Geschenk mitnehmen sollte. Ich habe kein Geld, um ein Geschenk zu kaufen, das so großartiger Menschen würdig ist: Gibt es etwas im Haus, das passen könnte? In Panik eile ich von Zimmer zu Zimmer, als erwartete ich, einen wertvollen Gegenstand zu entdecken, dessen Existenz ich die ganze Zeit, die ich hier lebe, übersehen habe. Aber natürlich gibt es nichts Passendes. Ein paar Äpfel im Küchenregal fallen mir ins Auge, deren Bäckchen selbst in diesem düsteren Halbdunkel gelb und rot leuchten. Eilig hole ich ein Tuch und poliere vier der gelbsten Äpfel, bis sie glänzen. Dann lege ich einen kleinen Korb mit frischem Papier aus, lege die Äpfel hinein und mache mich auf den Weg. Unterwegs sage ich mir, dass das schlichte Obst vielleicht auch Gaumen erfreut, die sich allzu sehr an den Geschmack von Treibhaus-Pfirsichen und -Trauben gewöhnt haben.
Bald befinde ich mich in einem Aufzug, der mich nach oben katapultiert. Ein Diener in weißen Strümpfen und lila Kniebundhosen führt mich in einen prächtigen Raum. Hier ist man über dem Nebel, die Sonne scheint draußen vor den mit zarten Tüllgardinen verhüllten Fenstern, und, falls sie nicht scheint, macht das keinen Unterschied, denn der ganze Raum ist mit verborgenen Lichtquellen künstlich erhellt. Auf dem Boden liegt ein Teppich weicher als Moos, es gibt Sessel und mit feinem Brokat gepolsterte ausladende Sofas, schöne Blumenarrangements in Vasen, die wie Muscheln oder antike Urnen geformt sind.
Meine Wohltäter sind nicht anwesend, und ich habe es nicht eilig, sie zu treffen. Ich freue mich einfach, in diesem warmen Raum mit seiner sonnigen, betörend nach Blumen duftenden Luft zu sein; fast erwartet man, Schmetterlinge umherflattern zu sehen.
Nach der nebligen Düsternis, an die ich mich gewöhnt habe, fühle ich mich wie in den Sommer versetzt, ins Paradies.
Schon bald erscheint mein Wohltäter. Er ist groß und gutaussehend, wie es sich für einen so wichtigen Mann gehört. Alles an seiner Erscheinung ist perfekt: Seine Schuhe glänzen wie Kastanien, sein Hemd ist aus feinster Seide, er trägt eine rote Nelke im Knopfloch und in seiner Brusttasche steckt ein Tüchlein mit einem von frommen Frauen gestickten Monogramm. Er begrüßt mich mit ausgesuchter Höflichkeit, und wir sitzen eine Weile zusammen und plaudern über allgemeine Themen. Er spricht mit mir auf Augenhöhe. Ich gerate in Hochstimmung angesichts eines solch vielversprechenden Anfangs. Bestimmt wird sich alles zum Guten wenden.
Die Tür geht auf und meine Wohltäterin tritt ein. Wir erheben uns beide, um sie zu begrüßen. Sie trägt ein tiefblaues Samtkleid, und auf ihrem Hut thront ein kleiner Vogel, so lebendig und kostbar wie ein Juwel. Um den Hals trägt sie Perlen und Diamanten an ihren glatten Händen. Sie wendet sich mir mit angestrengter Heiterkeit zu und lächelt mit schmalen, aufeinandergepressten Lippen. Zögernd überreiche ich ihr mein bescheidenes Geschenk, das sie gnädig annimmt und dann zur Seite legt. Meine Hochstimmung beginnt zu schwinden. Wir lassen uns wieder auf unseren gepolsterten Sitzen nieder und setzen die höfliche Konversation einige Minuten lang fort. Dann entsteht eine Pause. Mir ist klar, dass das Vorgeplänkel nun vorbei und es an der Zeit ist, den Grund meines Besuches darzulegen.
»Ich erstarre vor Kälte und Einsamkeit da unten im Nebel!«, bricht es aus mir hervor, mit einer Stimme, die in höchster Not zu stammeln beginnt: »Seien Sie doch bitte so nett und lassen Sie mich ein wenig an Ihrem Sonnenschein und Ihrer Wärme teilhaben. Ich werde Ihnen nicht zur Last fallen.«
Meine Wohltäter schauen einander an. Ein Blick tiefsten Einverständnisses wandert von einem zum andern. Ich verstehe nicht, was dieser Blick bedeutet, doch er macht mich unruhig.
Es scheint, als hätten sie mein Gesuch bereits bedacht und sich darüber verständigt.
Mein Wohltäter lehnt sich in seinem Sessel zurück und legt die Spitzen seiner langen Finger aneinander. Seine Manschettenknöpfe glitzern, sein Haar glänzt wie Seide.
»Wir müssen diese Frage objektiv betrachten«, hebt er an. Seine Stimme klingt vernünftig, unparteiisch, und ich schöpfe erneut Hoffnung. Aber als er weiterspricht, merke ich, dass der Anflug von Rücksichtnahme, der mich so positiv beeindruckte, in Wirklichkeit nur Bestandteil seines vollendeten Benehmens ist und nicht vertrauenswürdiger als die Blume in seinem Knopfloch.
»Glaube nicht, dass ich dich anklage«, sagt er, »oder mich zum Richter über dich erhebe, aber du musst zugeben, dass dein Verhalten uns gegenüber in der Vergangenheit alles andere als zufriedenstellend war.«
Er schaut wieder zu meiner Wohltäterin, die mit dem Kopf nickt. Der kleine Vogel an ihrem Hut scheint mir aus leuchtenden, blinden Augen zuzuzwinkern.
»Ja«, sagt sie, »du hast uns mit deinem schlechten Benehmen viel Kummer und Sorge bereitet. Nie hast du uns zu Rate gezogen oder uns nach unseren Wünschen gefragt, sondern bist stur deinen eigenen Weg gegangen. Nur wenn du in Schwierigkeiten bist, kommst du hierher und bittest uns, dass wir uns um dich kümmern.«
»Aber Sie verstehen nicht«, rufe ich und schäme mich der Tränen, die mir in die Augen steigen. »Diesmal geht es um Leben und Tod. Lassen Sie die Vergangenheit jetzt bitte ruhen; es tut mir leid, wenn ich Sie verletzt haben sollte, aber Sie haben alles, und Sie können es sich leisten, großzügig zu sein. Das kostet Sie doch nicht viel. Wenn Sie bloß wüssten, wie sehr ich mich danach sehne, wieder in der Sonne zu leben!«
Mir rutscht das Herz in die Hose, als ich mich so sprechen höre. Ich bin völlig verzweifelt, weil ich begreife, dass keiner meiner Zuhörer meinen Appell versteht. Ich bezweifle, dass sie mir überhaupt zuhören. Sie wissen nicht, wie Nebel ist; für sie ist das nur ein Wort. Sie wissen nicht, was es bedeutet, traurig und allein in einem kalten Raum zu sein, den die Sonne nie bescheint.
»Wir wollen nicht zu hart mit dir ins Gericht gehen«, sagt mein Wohltäter und schlägt die Knie übereinander. »Niemand wird uns nachsagen können, wir hätten dich nicht mit Geduld und Nachsicht behandelt. Wir werden unser Bestes tun, um zu vergessen und zu vergeben. Du aber musst deinerseits versprechen, dass du dich um einen Neuanfang bemühst, mit der Vergangenheit brichst und dein rebellisches Verhalten aufgibst.«
Er redet weiter, aber nun bin ich diejenige, die nicht mehr zuhört. Ich habe genug gehört, um hoffnungslos enttäuscht zu sein. Es macht keinen Sinn, auf Menschen zuzugehen, die absolut unzugänglich sind, die keinerlei Mitgefühl mit mir haben. Ich komme zu ihnen, mit allerletzter Kraft, liefere mich ihrer Gnade aus, und alles, was sie mir leeren Herzens bieten, ist eine Gardinenpredigt. Ich seufze und knöpfe den Mantel auf, den auszuziehen mich niemand aufgefordert hat und in dem mir nun unangenehm warm ist. Traurig lasse ich meine Augen durch den prächtigen Raum schweifen, in dessen goldener, blumiger Atmosphäre Schmetterlinge umherschwirren könnten. Durch einen Tränenschleier hindurch erkenne ich meine gelben Äpfel, die achtlos in einer Ecke hinter einer riesigen Schachtel mit Likörpralinen liegen. Ich bereue, sie hierher gebracht zu haben, wo sie überhaupt nicht gewürdigt werden. Vielleicht werden der Kammerdiener oder die Kammerzofe in einen hineinbeißen, bevor sie sie in die Mülltonne werfen.
»Du musst dir fest vornehmen, deine Pflicht uns gegenüber zu erfüllen«, sagt mein Wohltäter. »Du musst dich anstrengen, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Vor allem aber musst du Dankbarkeit gegenüber deiner Wohltäterin zeigen, dir ihre Vergebung verdienen und dich ihrer Großzügigkeit würdig erweisen.«
»Und wo soll ich bei alledem ein wenig Wärme finden?«, rufe ich verzweifelt. Wie unpassend diese Worte in diesen heiteren Mauern doch klingen, und wie verächtlich die anspruchsvollen Blumen ihre Köpfe schütteln.
Ich weiß nun, dass ich meine letzte Chance vertan habe. Es hat keinen Sinn, auch nur einen Moment länger zu warten, also stehe ich auf und verlasse fluchtartig den Raum. Und schon saust der Aufzug mit mir hinab, trägt mich hinunter auf die kalte, neblige Straße, wo ich hingehöre.