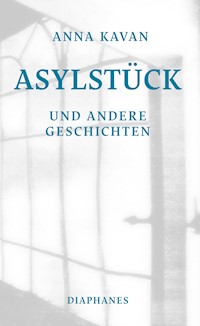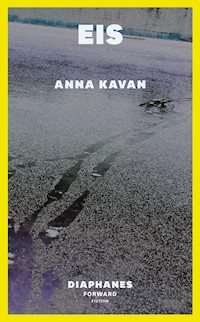
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»In meinem eigenen Land konnte mir nichts zustoßen, und dennoch wuchs meine Unruhe, je weiter ich fuhr. Die Wirklichkeit war für mich immer eine unbekannte Größe gewesen«, konstatiert der männliche Erzähler in Anna Kavans Eis zu Beginn seines taumelnden Berichts, während er einer ihm gläsern erscheinenden Frau hinterherjagt und sie in die unendliche Wüste einer postapokalyptischen Eislandschaft treibt. Während die zeitlose Handlung zwischen extrem lebensfeindlicher Realität, fieberhafter Halluzination und brutalen Traumgebilden im gleißenden Licht verschwimmt, schiebt sich der Text wie übereinanderknirschende Eisschollen immer tiefer in das Leserhirn.
Ob endzeitliche Science-Fiction-Story, Allegorie einer lebenslangen Heroinsucht, ob Verarbeitung persönlicher Traumata oder Zeugnis zutiefst entfremdeten Weltbezugs – wie auch immer die Kritik das Buch zu fassen versuchte: Kavans kristalline Prosa zeugt von der zugleich unendlich leeren wie überkomplexen Wirklichkeit eines inneren Kontinents weiblicher Empfindungen von seltener Dimension.
Mit dem 1967 kurz vor ihrem Tod publizierten Eis liegt nun erstmals das bekannteste und erfolgreichste Buch dieser Ausnahmeautorin auf Deutsch vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Eis
Anna Kavan Eis
Aus dem Englischen übersetzt von Silvia Morawetz und Werner Schmitz
diaphanes
Eins
Ich hatte mich verfahren, es dämmerte bereits, ich war seit Stunden unterwegs, und mein Tank war praktisch leer. Im Dunkeln in diesen einsamen Bergen gestrandet zu sein war eine beängstigende Vorstellung, daher war ich froh, als ich ein Schild sah, und rollte im Leerlauf hinab zu einer Tankstelle. Als ich ein Fenster öffnete und mit dem Tankwart sprach, war die Außenluft so kalt, dass ich den Mantelkragen hochschlug. Er füllte den Tank und räsonierte über das Wetter. »Wüsste nicht, dass es in dem Monat jemals so kalt war. Laut Vorhersage steht uns eine richtig schlimme Frostperiode bevor.« Ich habe den größten Teil meines Lebens im Ausland verbracht, als Söldner oder bei der Erforschung ferner Gegenden, aber obwohl ich gerade aus den Tropen zurückgekehrt war und Frost mir nicht viel sagte, war ich doch betroffen vom unheilverkündenden Ton seiner Worte. Ich hatte es eilig und fragte ihn nach dem Weg zu dem Dorf, in das ich wollte. »Das finden Sie in der Dunkelheit nicht, es liegt weit ab vom Schuss. Und die Straßen im Bergland sind gefährlich, wenn sie vereist sind.« Das sollte wohl heißen, nur ein Narr würde bei den derzeitigen Bedingungen weiterfahren. Ich ärgerte mich und fiel ihm mitten in seiner Wegbeschreibung ins Wort, bezahlte und fuhr davon, ohne auf seine mir nachgerufene letzte Warnung − »Geben Sie auf das Eis acht!« – zu hören.
Es war inzwischen sehr dunkel geworden, und ich hatte mich bald noch heilloser verirrt. Ich wusste, ich hätte auf den Mann hören sollen und wünschte mir gleichzeitig, überhaupt nicht mit ihm gesprochen zu haben. Aus irgendeinem Grund hatten seine Bemerkungen mich verunsichert; sie kamen mir vor wie ein schlechtes Omen für die ganze Reise, und ich bereute allmählich, dass ich überhaupt aufgebrochen war.
Ich hatte von Anfang an Bedenken wegen der Fahrt gehabt. Ich war erst am Vortag angekommen und hätte eigentlich in der Stadt ein paar Dinge regeln sollen, statt Freunde auf dem Land zu besuchen. Ich verstand ihn selber nicht, meinen Drang, das Mädchen zu sehen, das mir in der ganzen Zeit, die ich fort war, im Kopf herumgespukt hatte, auch wenn sie nicht der Grund für meine Rückkehr war. Ich war zurückgekommen, um Gerüchten von einer rätselhaften drohenden Katastrophe in diesem Teil der Welt auf den Grund zu gehen. Doch kaum angekommen, wurde das Mädchen zur fixen Idee, ich konnte nur an sie denken und hatte das Gefühl, sie sofort sehen zu müssen; nichts anderes war wichtig. Das war natürlich vollkommen irrational, genau wie meine momentane Beklommenheit. In meinem eigenen Land konnte mir nichts zustoßen, doch meine Unruhe wuchs, je weiter ich fuhr.
Die Wirklichkeit war für mich immer eine unbekannte Größe gewesen. Das war gelegentlich verstörend. So hatte ich das Mädchen und ihren Mann schon einmal besucht und hatte die friedliche, offenbar wohlhabende ländliche Gegend rings um ihr Haus in lebhafter Erinnerung behalten. Diese Erinnerung aber verblasste jetzt zusehends, büßte ihre Realität ein, wurde immer fraglicher und unbestimmter, denn kein Mensch begegnete mir an der Straße, ich kam zu keinem Dorf, sah nirgendwo Lichter. Der Himmel war schwarz, noch schwärzer ragten die ungepflegten Hecken davor auf, und wenn die Scheinwerfer ab und zu Gebäude neben der Straße streiften, waren auch diese ausnahmslos schwarz, anscheinend unbewohnt und lagen mehr oder weniger in Trümmern. Es war, als wäre der ganze Landstrich während meiner Abwesenheit verwüstet worden.
Allmählich fragte ich mich, ob ich sie in dem allgemeinen Chaos jemals finden würde. Es sah nicht danach aus, dass es nach der unerklärlichen Katastrophe, die Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und Farmen zerstört hatte, hier wieder geregeltes Leben gegeben hatte. Soweit ich es überblickte, war kein Versuch unternommen worden, zur Normalität zurückzukehren. Kein Wiederaufbau, keine Bewirtschaftung des Landes, keine Tiere auf den Feldern. Die Straße war in miserablem Zustand, in den Gräben unter den vernachlässigten Hecken wucherte dichtes Unkraut, die gesamte Gegend wirkte wüst und menschenleer.
Eine Handvoll weißer Steinchen traf die Windschutzscheibe, ich fuhr zusammen. Ich hatte so lange keinen Winter im Norden mehr erlebt, dass ich das Phänomen nicht gleich einordnen konnte. Aus Hagel wurde schon bald Schnee, was die Sicht weiter einschränkte und das Fahren zusätzlich erschwerte. Es war bitterkalt, und mir ging auf, dass zwischen dieser Tatsache und meinem zunehmenden Unbehagen ein Zusammenhang bestand. Der Mann an der Tankstelle hatte gesagt, so eine Kälte habe er um die Jahreszeit noch nie erlebt, und auch nach meinem Eindruck war es viel zu früh für Eis und Schnee. Plötzlich empfand ich solche Furcht, dass ich umkehren und zur Stadt zurückfahren wollte. Die Straße war jedoch zu schmal, und ich war gezwungen, ihren endlosen Windungen bergauf und bergab in der leblosen Dunkelheit zu folgen. Die Straße wurde immer schlechter, steiler und glatter. Die ungewohnte Kälte verursachte mir Kopfschmerzen, und ich starrte mit zusammengekniffenen Augen hinaus, um vereisten Stellen auszuweichen, wo der Wagen ins Rutschen geriet. Wenn das Scheinwerferlicht über Ruinen am Straßenrand strich, überraschte mich der kurze Anblick jedes Mal und verschwand, bevor ich mir sicher war, ob ich das wirklich gesehen hatte.
Auf den Hecken erblühte ein unirdisches Weiß. An einer Lücke erhaschte ich einen Blick hindurch. Für einen Augenblick erfassten meine Scheinwerfer, als wären es Suchlaternen, den nackten Körper des Mädchens, schmal wie der eines Kindes, elfenbeinweiß vor dem toten Schneeweiß, ihr Haar hell wie gesponnenes Glas. Sie sah nicht in meine Richtung. Regungslos fixierte sie die Wände, die langsam auf sie zurückten, ein glasiger, glitzernder Wall aus festem Eis, in dessen Mitte sie sich befand. Blitze zuckten von den Eisklippen hoch über ihrem Kopf herab; unten hatten die äußersten Ränder des Eises sie bereits erreicht, sie bewegungsunfähig gemacht, sich fest wie Beton über ihren Füßen und Knöcheln geschlossen. Ich sah das Eis höher steigen, ihre Knie und Schenkel bedecken, sah ihren offenen Mund, ein schwarzes Loch in dem weißen Gesicht, hörte den dünnen, gequälten Schrei. Mitleid empfand ich für sie keins, es bereitete mir im Gegenteil eine unbeschreibliche Lust, sie leiden zu sehen. Meine Härte war mir zwar selber nicht recht, aber so war es nun mal. Sie war das Produkt verschiedener Faktoren, aber die konnten nicht als mildernde Umstände gelten.
Einmal war ich ganz betört von ihr gewesen, hatte sie heiraten wollen. Paradoxerweise wollte ich sie damals vor der Härte der Welt beschützen, die sie mit ihrer Schüchternheit und Zartheit geradezu auf sich zog. Sie war überempfindlich, hochnervös, hatte Angst vor Menschen und vor dem Leben; ihre Persönlichkeit war von einer sadistischen Mutter, die sie in einem Zustand permanenter Angst und Unterwerfung hielt, geschädigt worden. Zuerst musste ich ihr Vertrauen gewinnen, war ihr gegenüber deshalb stets behutsam und darauf bedacht, meine Gefühle im Zaum zu halten. Sie war so dünn, dass ich fürchtete, ihr wehzutun, wenn ich sie beim Tanzen an mich gedrückt hielt. Ihre deutlich sichtbaren Knochen wirkten zerbrechlich; besonders faszinierten mich ihre vorstehenden Handgelenke. Ihr Haar war erstaunlich, silbrig weiß wie bei einem Albino, und funkelte im Mondlicht wie vom Mond beschienenes Buntglas. Ich behandelte sie, als wäre sie aus Glas; zuweilen wirkte sie geradezu unwirklich. Nach und nach verlor sie die Furcht vor mir und zeigte eine kindliche Zuneigung, blieb aber scheu und schwer zugänglich. Ich glaubte, ihr bewiesen zu haben, dass man mir vertrauen konnte, und begnügte mich mit Warten. Sie war offenbar kurz davor, mich zu akzeptieren, bei ihrer Unreife war die Aufrichtigkeit ihrer Gefühle allerdings schwer einzuschätzen. Ihre Zuneigung war vielleicht nicht vollends geheuchelt, auch wenn sie mich plötzlich für den Mann verließ, mit dem sie jetzt verheiratet war.
Das alles war längst Geschichte. Die Folgen der traumatischen Erfahrung aber waren Schlaflosigkeit und anhaltende Kopfschmerzen. Die mir verschriebenen Medikamente erzeugten grauenhafte Träume, in denen sie stets als das hilflose Opfer figurierte, ihr zarter Körper zerschrammt und wund. Diese Träume beschränkten sich nicht auf den Schlaf, und eine betrübliche Nebenwirkung war, dass ich inzwischen Vergnügen daran fand.
Die Sicht hatte sich verbessert, die Nacht war nicht weniger dunkel, aber es hatte aufgehört zu schneien. Oben auf einer steilen Anhöhe machte ich die Überreste eines Forts aus. Es war kaum mehr davon übrig als der Turm, die Anlage war wie ausgeweidet, leere Fensterlöcher klafften wie offene schwarze Münder. Das Fort kam mir entfernt bekannt vor, wie ein entstelltes Bild von etwas, an das ich mich vage erinnerte. Ich meinte es zu kennen, es bereits einmal gesehen zu haben, war mir jedoch nicht sicher, denn ich war nur im Sommer hier gewesen, als alles anders aussah.
Als ich die Einladung des Mannes damals annahm, hatte ich den Verdacht, er habe sie nicht ohne Hintergedanken ausgesprochen. Er war Maler, kein ernsthafter, nur ein Dilettant, einer von denen, die immer viel Geld haben, ohne irgendeine Arbeit zu tun. Vielleicht hatte er private Einkünfte, ich verdächtigte ihn aber, nicht das zu sein, was er vorgab. Die Herzlichkeit, mit der ich empfangen wurde, überraschte mich, er hätte sich nicht freundlicher geben können. Dennoch war ich auf der Hut.
Das Mädchen sprach wenig, stand neben ihm und sah mich durch lange Wimpern hindurch mit großen Augen von der Seite an. Ihre Gegenwart übte eine starke Wirkung auf mich aus, auch wenn ich nicht recht verstand, wodurch. Ich fand es schwierig, mit den beiden ins Gespräch zu kommen. Das Haus stand mitten in einem Buchenwald, so dicht umgeben von hohen Bäumen, dass es schien, als befänden wir uns in Wirklichkeit in ihren Wipfeln und als brächen sich Wellen von grünem Laub vor den Fenstern. Ich musste an eine fast ausgestorbene Art von großen singenden Lemuren denken, die Indris, die in den Baumwipfeln einer fernen tropischen Insel leben. Das sanftmütige, anhängliche Wesen und die sonderbar melodischen Stimmen dieser beinahe legendären Tiere hatten mich zutiefst beeindruckt, und ich begann, von ihnen zu erzählen, ganz selbstvergessen vor Begeisterung über meinen Gegenstand. Er schien interessiert. Sie sagte nichts und verließ uns bald, um nach dem Mittagessen zu sehen. Als sie gegangen war, wurde die Unterhaltung gleich ungezwungener.
Es war Hochsommer und sehr heiß, die Blätter direkt vor den Fenstern raschelten angenehm kühl. Der Mann war nach wie vor freundlich. Ich hatte ihn wohl falsch eingeschätzt und begann mich meines Misstrauens zu schämen. Er sei froh über meinen Besuch, sagte er und kam dann auf das Mädchen zu sprechen. »Sie ist schrecklich schüchtern und nervös, es tut ihr gut, jemanden aus der Welt da draußen zu Gesicht zu bekommen. Sie ist hier zu viel allein.« Unweigerlich fragte ich mich, wie viel er über mich wusste, was sie ihm erzählt hatte. In der Defensive zu bleiben schien reichlich albern, aber trotz seiner Liebenswürdigkeit reagierte ich verhalten auf ihn.
Ich blieb ein paar Tage bei ihnen. Sie ging mir aus dem Weg. Ich sah sie nur, wenn er ebenfalls dabei war. Die heiße Witterung hielt an. Sie trug sehr schlichte kurze, dünne Kleider, die Schultern und Arme unbedeckt ließen, keine Strümpfe, Kindersandalen. Ihr Haar flirrte im Sonnenlicht. Ich wusste, ich würde nie vergessen, wie sie aussah. Ich nahm eine deutliche Veränderung an ihr wahr, ein stark gestiegenes Selbstvertrauen. Sie lächelte häufiger, und einmal hörte ich sie sogar im Garten singen. Als der Mann ihren Namen rief, kam sie gleich angerannt. Es war das erste Mal, dass ich sie glücklich sah. Nur im Gespräch mit mir wirkte sie noch gehemmt. Gegen Ende meines Besuchs wollte er wissen, ob ich mit ihr allein gesprochen hätte. Ich verneinte. Er erwiderte: »Sprechen Sie mit ihr, bevor Sie abreisen. Sie macht sich Sorgen wegen früher, sie befürchtet, sie hätte Sie unglücklich gemacht.« Er wusste also Bescheid. Sie hatte ihm offenbar alles erzählt, was es zu erzählen gab. Viel war es ja nicht. Aber ich wollte mit ihm nicht über früher sprechen und antwortete ausweichend. Er wechselte taktvoll das Thema, kam aber später noch einmal darauf zurück. »Ich wünschte, Sie würden sie beruhigen. Ich werde eine Gelegenheit herbeiführen, bei der Sie unter vier Augen mit ihr sprechen können.« Ich hatte keine Ahnung, wie er das bewerkstelligen wollte, da der kommende Tag der letzte war, den ich bei ihnen verbrachte. Ich sollte am späten Nachmittag abreisen.
An jenem Vormittag war es so heiß wie noch nie. Gewitter lag in der Luft. Schon zur Frühstückszeit war die Hitze drückend. Zu meiner Überraschung schlugen sie einen Ausflug vor. Ich durfte nicht wegfahren, bevor ich nicht ein bestimmtes schönes Fleckchen in der Nähe gesehen hatte. Es fiel der Name eines Bergs, von dem aus man eine berühmte Aussicht hatte, ich hatte bereits von ihm gehört. Als ich meine Abreise erwähnte, wurde mir gesagt, es sei nur eine kurze Fahrt, von der wir so bald zurückkämen, dass ich noch genug Zeit zum Packen hätte. Sie wollten von ihrem Vorhaben nicht abweichen, merkte ich und willigte ein.
Wir nahmen ein Picknick für einen Lunch bei den Ruinen eines alten Forts mit, das aus fernen Zeiten stammte, als man feindliche Übergriffe fürchtete. Die Straße endete tief im Wald. Wir ließen das Auto stehen und gingen zu Fuß weiter. Ich wollte mich in der stetig zunehmenden Hitze nicht hetzen lassen, fiel zurück und setzte mich, als ich das Ende des Waldes erblickte, in den Schatten. Er kam zurück und zog mich hoch. »Kommen Sie weiter! Sie werden sehen, der Aufstieg lohnt sich.« Mit seiner Begeisterung trieb er mich über einen steil ansteigenden, besonnten Hang zum Gipfel, wo ich die Aussicht gebührend bewunderte. Noch immer nicht zufrieden, bestand er darauf, dass ich sie oben von der Ruine sehen müsse. Er war in einer merkwürdigen Verfassung, reizbar, fast fiebrig. Durch Staub und Dämmer folgte ich ihm über eine in den Turm gehauene Treppe nach oben; seine massige Gestalt ließ das Licht nicht durch, ich konnte nichts sehen und hätte mir bei einer fehlenden Stufe den Hals brechen können. Oben auf dem Turm war keine Brüstung, wir standen auf Schutt, nichts zwischen uns und dem Sturz in die Tiefe, und er wies mit ausholenden Armbewegungen auf verschiedene Details in der umgebenden Landschaft hin. »Dieser Turm ist seit Jahrhunderten ein Wahrzeichen. Von hier aus sieht man den ganzen Gebirgszug. Dort hinten ist das Meer. Das ist der Turm der Kathedrale. Die blaue Linie dahinter ist die Flussmündung.«
Mich fesselten eher Einzelheiten in der Nähe: Steinhaufen, Drahtrollen, Betonblöcke und anderes Material zur Bewältigung der bevorstehenden Katastrophe. Ich hoffte, etwas zu entdecken, was mir Aufschluss über die Art der erwarteten Krise gab, trat näher an den Rand und sah in die ungeschützte Tiefe vor meinen Füßen hinab.
»Vorsicht!«, mahnte er lachend. »Hier kann man leicht ausgleiten oder das Gleichgewicht verlieren. Die perfekte Stelle für einen Mord, denke ich immer.« Sein Lachen klang so merkwürdig, dass ich mich nach ihm umdrehte. »Angenommen, ich gäbe Ihnen einen kleinen Schubs… so etwa« – ich wich gerade noch rechtzeitig zurück, trat aber daneben und stolperte, taumelte auf einen bröckelnden Vorsprung über der Tiefe zu. Sein lachendes Gesicht war über mir, schwarz vor dem Hintergrund des heißen Himmels. »Ihr Sturz wäre ein Unfall gewesen, nicht? Keine Zeugen. Nur mein Wort für das, was passiert war. Schauen Sie, wie unsicher Sie auf den Füßen stehen. Die Höhe macht Ihnen wohl zu schaffen.« Als wir wieder unten angelangt waren, schwitzte ich, meine Kleider waren mit Staub bedeckt.
Das Mädchen hatte das Essen auf dem Gras im Schatten eines alten Walnussbaums ausgebreitet. Wie üblich sprach sie wenig. Ich war nicht traurig darüber, dass mein Besuch zu Ende ging; es lag zu viel Spannung in der Luft, ihre Nähe war zu verstörend. Wir aßen, und ich warf zwischendurch immer wieder flüchtige Blicke auf sie, auf das silbern leuchtende Haar, die blasse, fast durchscheinende Haut, die vorstehenden, zerbrechlichen Handgelenke. Bei ihrem Ehemann hatte sich die Hochstimmung gelegt. Missmutig griff er nach einem Zeichenblock und schlenderte davon. Ich verstand seine Launen nicht. Schwere Wolken erschienen in der Ferne, ich spürte die Feuchtigkeit in der Luft und wusste, es würde bald ein Gewitter geben. Meine Jacke lag neben mir im Gras, ich faltete sie zu einem Kissen, lehnte es gegen den Baumstamm und bettete den Kopf darauf. Das Mädchen hatte sich auf dem Grasstreifen direkt unter mir ausgestreckt, die Hände über der Stirn verschränkt zum Schutz vor der grellen Sonne. Sie lag ganz ruhig da, ohne zu sprechen, die Arme erhoben, wodurch die etwas rauen, dunkleren Flecken der rasierten Achseln offenlagen, auf denen Schweißtröpfchen glitzerten wie Raureif. Das dünne Fähnchen, das sie trug, zeichnete die schwachen Kurven ihres Körpers nach; sie trug nichts darunter, wie ich sah.
Ein Stückchen weiter hangabwärts kauerte sie vor mir, ihre Haut nicht ganz so weiß wie der Schnee. Große Eisklippen rückten von allen Seiten näher. Das Licht glomm, ein kaltes, mattes Eislicht, das keine Schatten warf. Keine Sonne, kein Schatten, kein Leben, Todeskälte. Wir befanden uns in der Mitte des enger werdenden Kreises. Ich musste sie retten. »Komm hier rauf – schnell!«, rief ich. Sie drehte den Kopf, rührte sich aber nicht vom Fleck, ihr Haar schimmerte in dem trüben Licht wie angelaufenes Silber. Ich ging zu ihr hinunter, sagte: »Hab nicht so viel Angst. Ich rette dich, versprochen. Wir müssen auf den Turm hinauf.« Sie verstand anscheinend nicht, hörte es vielleicht nicht im Dröhnen und Poltern des herannahenden Eises. Ich bekam sie zu fassen, zog sie den Hang herauf; das war leicht, sie wog fast nichts. Vor der Ruine blieb ich stehen, hielt sie mit einem Arm, sah mich um und begriff, dass es sinnlos war, noch weiter nach oben zu wollen. Der Turm würde einstürzen; er würde zusammenfallen und unter Tausenden Tonnen Eis zu Staub zermahlen werden. Die Kälte verbrannte mir die Lungen, so nahe war das Eis. Sie zitterte heftig, ihre Schultern waren bereits froststarr; ich drückte sie enger an mich, umschlang sie fest mit beiden Armen.
Uns blieb nur wenig Zeit, aber zumindest würden wir dasselbe Ende erleiden. Das Eis hatte den Wald bereits verschlungen, die letzten Baumreihen barsten. Ihr silbernes Haar berührte meinen Mund, sie schmiegte sich an mich. Ein abgeknickter Baumstamm tanzte hoch oben am Himmel, Dutzende Meter hinaufgeschleudert beim Aufprall des Eises. Es blitzte, alles zitterte und bebte. Mein Koffer lag halb gepackt offen auf dem Bett. Die Fenster meines Zimmers standen noch weit offen, die Vorhänge wallten in den Raum. Draußen wogten die Baumwipfel, der Himmel hatte sich verfinstert. Regen sah ich keinen, doch der rollende Donner hallte nach, und als ich hinausschaute, fuhr abermals ein Blitz herab. Die Temperatur war seit dem Vormittag um mehrere Grad gefallen. Ich beeilte mich, die Jacke anzuziehen und das Fenster zu schließen.
Letztendlich war ich doch der richtigen Straße gefolgt. Anfangs verlief sie wie ein Tunnel zwischen ungestutzten Hecken, die über ihr zusammenwuchsen, schlängelte sich dann durch den Buchenwald und endete schließlich vor dem Haus. Licht war keines zu sehen. Der Ort wirkte verlassen, unbewohnt wie die anderen, an denen ich vorbeigekommen war. Ich drückte ein paarmal auf die Hupe und wartete. Es war spät, vielleicht waren sie schon im Bett. Wenn sie da war, musste ich sie sehen, nur darum ging es. Nach geraumer Zeit kam der Mann und ließ mich ein. Diesmal war er nicht erfreut, mich zu sehen, was verständlich war, falls ich ihn aufgeweckt hatte. Er trug anscheinend einen Morgenmantel.
Das Haus hatte keinen Strom. Er ging voraus, leuchtete mit einer Taschenlampe. Ich ließ den Mantel an, obwohl das Kaminfeuer im Wohnzimmer ein wenig Wärme abstrahlte. Er war, erkannte ich überrascht im Lichtschein, während meiner Zeit im Ausland stark gealtert. Er sah gedrungener aus, strenger, brutaler; der gewinnende Ausdruck war verschwunden. Es war kein Morgenmantel, was er trug, sondern der lange Überzieher einer Uniform, der ihn fremd erscheinen ließ. Mein altes Misstrauen meldete sich wieder; hier war jemand, der sich die Katastrophe zunutze machte, bevor sie überhaupt eingetreten war. Seine Miene wirkte nicht freundlich. Ich bat um Entschuldigung für meine späte Ankunft und erklärte, ich hätte mich verfahren. Er war dabei, sich zu betrinken. Flaschen und Gläser standen auf einem kleinen Tischchen. »Na dann, auf Ihr Kommen.« Es war nichts Herzliches an seinem Gebaren und seinem Ton, in dem ein höhnischer Beiklang lag, der mir neu war. Er schenkte mir ein Glas ein und setzte sich, den langen Überzieher über die Knie gebreitet. Ich wollte sehen, ob seine Tasche sich beulte, ob ein Griff vorstand, unter dem Mantel zeichnete sich aber nichts dergleichen ab. Wir saßen beieinander und tranken. Ich erzählte von meinen Reisen und wartete auf das Erscheinen des Mädchens. Nichts deutete auf ihre Anwesenheit hin, aus dem Haus erklang kein Laut. Er erwähnte sie nicht, und seine hämische Miene sagte mir, dass er es mit Absicht unterließ. Der Raum, den ich als einladend in Erinnerung hatte, wirkte jetzt heruntergekommen und schmutzig. Putz war von der Decke gefallen, die Wände hatten tiefe Risse wie von einer Druckwelle und schwarze Flecken, an denen Regen eingedrungen war und mit ihm die Verwüstung außerhalb. Als ich meine Ungeduld nicht länger bezähmen konnte, fragte ich, wie es ihr ging. »Sie stirbt.« Er grinste boshaft bei meinem Ausruf. »Wie wir alle.« Es war seine Vorstellung von einem Witz auf meine Kosten. Ich begriff, dass er unsere Begegnung verhindern wollte.
Ich musste sie sehen, unbedingt. Ich sagte: »Ich gehe jetzt und lasse Sie in Frieden. Aber könnten Sie mir vorher etwas zu essen geben? Ich habe seit Mittag nichts gegessen.« Er ging hinaus und rief in herrischem, grobem Ton, sie solle Essen bringen. Die Zerstörung draußen war ansteckend und hatte alles infiziert, auch ihre Beziehung und das Aussehen des Zimmers. Sie brachte ein Tablett mit Brot und Butter und eine Schinkenplatte, und ich betrachtete sie genau, ob sie sich äußerlich ebenfalls verändert hatte. Sie sah lediglich schmaler aus als je zuvor, und noch durchsichtiger. Sie war vollkommen still und wirkte verängstigt, in sich gekehrt, wie zu der Zeit, als ich sie kennengelernt hatte. Ich hätte zu gern Fragen gestellt und mit ihr allein gesprochen, hatte aber keine Gelegenheit dazu. Der Mann behielt uns die ganze Zeit im Blick, während er weitertrank. Der Alkohol machte ihn aggressiv; er wurde zornig, als ich ein weiteres Glas ablehnte, und wollte unbedingt einen Streit mit mir anzetteln. Ich hätte gehen sollen, das war mir klar, aber mein Kopf tat höllisch weh und mir war jede körperliche Regung zu viel. Ich presste unablässig die Hand auf die Augen und die Stirn. Das Mädchen bemerkte es offenbar, denn sie verließ für einen Augenblick den Raum, hatte beim Wiederkommen etwas in der Hand und flüsterte: »Ein Aspirin für deinen Kopf.« Woraufhin er prompt schrie wie ein Tyrann: »Was flüsterst du ihm da zu?« Berührt von ihrer Sorge um mich, hätte ich gern mehr für sie getan als mich bloß bedankt, sein Blick war jedoch so finster und grimmig, dass ich mich zum Gehen erhob.
Er begleitete mich nicht zur Tür. An Wänden und Möbeln entlang tastete ich mich durch die Dunkelheit und sah mich, als ich die Tür öffnete, bleich schimmerndem Schnee gegenüber. Es war so kalt, dass ich mich hastig im Auto einschloss und die Heizung einschaltete. Als ich die Augen vom Armaturenbrett hob, rief sie leise etwas, wovon ich nur die Worte »versprochen« und »nicht vergessen« verstand. Ich schaltete die Scheinwerfer ein, sah sie in der Tür stehen, die dünnen Arme über der Brust verschränkt. Ihr Gesicht trug den gewohnten Opferausdruck, natürlich psychisch bedingt und Ergebnis der Beschädigungen, die sie als Kind erfahren hatte; an der außerordentlich zarten weißen Haut um Augen und Mund erkannte ich einen Anflug von Verletzungen. Auf gewisse Weise fand ich das wahnsinnig anziehend. Ich hatte es kaum richtig gesehen, da setzte sich das Auto in Bewegung; ich hatte automatisch den Anlasser betätigt und nicht damit gerechnet, dass er in der eisigen Kälte funktionierte. Im selben Moment, ich nahm es als optische Täuschung, verlängerte sich das schwarze Innere des Hauses zu einem schwarzen Arm und einer schwarzen Hand, die hervorschoss und sie so heftig mit sich riss, dass ihr entsetztes weißes Gesicht in Stücke zersprang und sie ins Dunkel taumelte.
Ich kam über den Niedergang ihrer Beziehung nicht hinweg. Als sie glücklich war, hatte ich mich losgesagt, war von der Bildfläche verschwunden. Jetzt fühlte ich mich hineingezogen, wieder mit ihr verbunden.
ZWEI
Mir kam zu Ohren, das Mädchen habe plötzlich sein Zuhause verlassen. Niemand wusste, wo sie war. Der Ehemann glaubte, sie sei ins Ausland gegangen. Es war nur eine Vermutung, Kenntnis davon hatte er nicht. Ich war beunruhigt und stellte endlose Fragen, die aber nichts Konkretes erbrachten. »Ich weiß nicht mehr als Sie. Sie ist einfach verschwunden, sie hat ja das Recht zu gehen, wenn sie das möchte – sie ist frei, weiß und einundzwanzig.« Er schlug einen scherzhaften Ton an, und ich wusste nicht, ob er die Wahrheit sagte. Die Polizei ging nicht von einem Verbrechen aus. Es gab keinen Grund zu der Annahme, dass ihr etwas zugestoßen oder dass sie nicht aus freien Stücken weggegangen war. Sie war alt genug zu wissen, was sie wollte. Leute verschwanden ständig; Hunderte liefen von zu Hause weg und wurden nie wieder gesehen, viele davon unglücklich verheiratete Frauen. Ihre Ehe, hieß es, sei ebenfalls in die Brüche gegangen. Sicherlich ging es ihr jetzt besser, und sie wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Weitergehende Erkundungen waren nicht gern gesehen und schufen noch mehr Probleme.
Diese Sichtweise kam ihnen gelegen, befreite sie sie doch davon, etwas zu unternehmen. Doch ich schloss mich ihr nicht an. Seit frühester Kindheit hatte man ihr Gehorsam eingetrichtert, ihre Eigenständigkeit durch systematische Unterdrückung untergraben. Ich traute ihr nicht zu, dass sie aus eigenem Antrieb einen so drastischen Schritt unternahm, vermutete Druck von außen. Ich hätte zu gern mit jemandem gesprochen, der sie gut kannte, doch sie schien keine engen Freunde zu haben.
Der Ehemann kam in geheimnisvollen Geschäften in die Stadt, und ich lud ihn zum Mittagessen in meinen Club ein. Wir verbrachten zwei Stunden zusammen, doch zum Schluss war ich keinen Deut schlauer. Er nahm die Angelegenheit nach wie vor auf die leichte Schulter und sagte, er sei froh, dass sie weg war. »Ihr neurotisches Benehmen hat mich verrückt gemacht. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Zu einem Psychiater wollte sie nicht gehen. Schließlich hat sie mich ohne ein Wort sitzenlassen. Ohne Erklärung. Knall auf Fall.« Er sprach, als sei er der Geschädigte. »Sie ist ohne Rücksicht auf mich ihrer Wege gegangen, deshalb mache ich mir um sie keine Sorgen. Sie kommt nicht wieder zurück, das steht fest.« Solange er nicht zu Hause war, nutzte ich die Gelegenheit, fuhr dorthin und ging die Sachen in ihrem Zimmer durch, fand aber nichts, was mir einen Anhaltspunkt geliefert hätte. Nur die übliche Ansammlung von billigem Plunder: ein Porzellanvogel, eine unechte Perlenkette, kaputt, Schnappschüsse in einer alten Pralinenschachtel. Ein Foto, auf dem ein See ihr Gesicht und ihr glänzendes Haar perfekt spiegelte, steckte ich mir in die Brieftasche.
Egal wie, ich musste sie finden, daran hatte sich nichts geändert. Ich empfand dasselbe zwanghafte Bedürfnis, das mich bei meiner Rückkehr getrieben hatte, sofort aufs Land fahren. Es gab keinen rationalen Grund dafür, ich konnte es mir nicht erklären. Es war wie eine Sucht und musste gestillt werden.
Meine eigenen Belange stellte ich zurück. Von nun an war es meine Aufgabe, sie zu finden. Nichts anderes war wichtig. Gewisse Informationsquellen waren immer noch zugänglich: Friseure. Schalterbeamte, die über den Erwerb von Fahrkarten Buch führten. Randexistenzen. Ich begab mich an die Orte, die solche Menschen frequentierten, lungerte vor Spielautomaten herum, bis sich eine Gelegenheit zum Reden fand. Geld war hilfreich. Intuition ebenfalls. Kein Anhaltspunkt war zu dürftig, als dass ich ihm nicht nachgegangen wäre. Angesichts der nahenden Katastrophe war es noch dringender, sie schnell zu finden. Ich bekam sie nicht aus dem Kopf. Ich hatte nicht alles gesehen, woran ich mich im Zusammenhang mit ihr erinnerte. Bei meinem ersten Besuch war ich in ihrem Wohnzimmer gewesen, hatte von den Indris gesprochen, meinem Lieblingsthema. Der Mann hörte mir zu. Sie ging hin und her und richtete die Blumen. Spontan äußerte ich, sie ähnelten den Lemuren, beide so freundlich und einnehmend, und auch sie lebten hier glücklich in den Bäumen. Er lachte. Sie schaute erschrocken und lief durch die Terrassentür ins Freie, das silberne Haar hinter ihr her wehend, die nackten Beine bleich blitzend. Der verschwiegene schattige Garten mit seiner Abgeschiedenheit und Stille war eine angenehm kühle Zuflucht in der Sommerhitze. Dann war es mit einem Mal unnatürlich kalt, furchtbar kalt. Das dichte Laubwerk ringsum wurde zu einer Gefängnismauer, einem undurchdringlichen Ring aus grünem Eis, der von allen Seiten auf sie zudrängte; kurz bevor er sich schloss, fing ich das angsterfüllte Funkeln ihrer Augen auf.
An Wintertagen war sie im Atelier, saß ihm nackt Modell, die Arme in einer anmutigen Pose erhoben. Diese Haltung über einen nennenswerten Zeitraum einzunehmen dürfte enorm anstrengend gewesen sein, und ich fragte mich, wie sie es schaffte, so stillzusitzen, bis ich die Schnüre sah, mit denen sie an Händen und Füßen gefesselt war. Im Raum war es kalt. Eine dicke Frostschicht überzog die Fensterscheiben, und Schnee türmte sich außen auf dem Fenstersims. Er trug den langen Uniformmantel. Sie bibberte. Als sie fragte: »Darf ich mal eine Pause machen?«, zitterte ihre Stimme jämmerlich. Er zog ein finsteres Gesicht und sah auf die Uhr, bevor er die Palette niederlegte. »In Ordnung. Das genügt vorläufig. Du kannst dich anziehen.« Er band sie los. Die Schnüre hatten böse dunkelrote Striemen auf dem weißen Fleisch hinterlassen. Ihre Bewegungen waren langsam und ungelenk von der Kälte, sie hantierte umständlich mit Knöpfen und Trägern. Das schien ihn zu verärgern, und er wandte sich mit gereizter Miene abrupt von ihr ab. Sie sah immer wieder nervös zu ihm hinüber, ihr Mund zuckte, ihre Hände hörten nicht auf zu zittern.