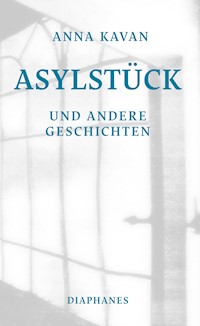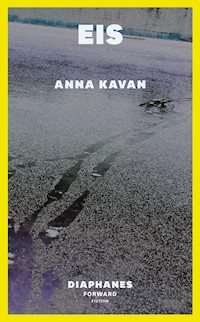12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diaphanes
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Literatur
- Sprache: Deutsch
Anna Kavans autobiographischer Roman erzählt von einer im kolonialen Burma in einer Ehe gefangenen Frau, deren Mann, ein britischer Offizier und Trinker, zum Zeitvertreib Ratten mit seinem Tennisschläger tötet. Es sind die klagenden Wer bist du? Wer bist du?-Rufe der Vögel in den Tamarindenbäumen, die das durchdringend-monotone Thema von Isolation und innerem Exil vorgeben, der Suche nach Identität und Befreiung aber auch einen Ausweg weisen.
Zwischen existenzieller Ernüchterung und poetischem Widerstand gelingt es Anna Kavan, mit ihrer halluzinativen Prosa eine mehr als reale Innenwelt zu entwerfen, deren kristalline Schärfe noch die sie umgebende Hitze gefriert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
WER BIST DU?
ANNA KAVAN
WER BIST DU?
AUS DEM ENGLISCHEN VON HELMA SCHLEIF
DIAPHANES
Originalausgabe: Who Are You?
© The Estate of Anna Kavan, 1963.
Die vorliegende Übersetzung erschien erstmals 1984 im März Verlag
1. Auflage 2021
© DIAPHANES, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-0358-0505-5
Satz und Layout: 2edit, Zürich
Druck: Steinmeier, Deiningen
www.diaphanes.net
INHALTSVERZEICHNIS
DER RATTENKÖNIG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DER BLAUE SCHAL
1
2
3
NACHBEMERKUNG
LITERATUR
DER RATTENKÖNIG
1
Unablässig wiederholt der tropische Vogel in den Tamarinden hinter dem Haus seinen monotonen Ruf, der aus den drei ewig gleichen fragenden Lauten besteht: Wer-bist-du? Wer-bist-du? Wer-bist-du? Durchdringend laut und schrill bohrt sich der anhaltende Gesang wie das aufreizende Gekreisch einer Maschine, die sich nicht abstellen lässt, durch das Trommelfell.
Wie ein Echo erschallt von fern ein Ruf, der die unbeantwortete Frage anderen Artgenossen übermittelt, bis Hunderte oder Tausende ihresgleichen in ihn einstimmen. Die anhaltenden Rufe kommen von überall her, aus allen Richtungen, von nah und fern. Manche sind lauter als andere oder länger; aber alle haben den gleichen gefühllosen und aufreizenden mechanischen Klang – sie drücken weder Furcht, Liebe, Aggression noch sonst etwas aus, so als hätten sie nur den einen Zweck: den, der sie hört, verrückt zu machen. Das Unerträglichste daran ist die unablässige Wiederholung einer Frage, auf die niemand eine Antwort weiß.
Wie vermutlich auch in einer anderen Dimension, die sich dem Lauschenden manchmal im Fieberwahn offenbart … bis zum alptraumhaften Höhepunkt … wenn plötzlich alles aufhört …
2
Die Tamarinden, alt und mächtig, weder richtig belaubt noch ganz kahl, ragen hoch über dem Haus auf und erzeugen in dieser Gluthitze die trügerische Hoffnung auf ein bisschen Schatten. Doch ihr spärliches Laub und ihre dünnen krummen Zweige werfen nur ein wirres Schattennetz, das keinen Schutz vor der Sonne bietet. Die riesigen Bäume dienen offenbar vor allem als Sammelplatz für die vielen Fiebervögel, die seit dem Morgengrauen unentwegt ihre Frage ausrufen.
Die Sonne steht jetzt tief am Himmel. Ihr blendender Glanz verfängt sich in den Wipfeln der Bäume, die unmerklich miteinander verschmelzen, sodass die Vögel in dem gleißenden Licht und dem Gewirr der verästelten Zweige unsichtbar werden. Zu sehen ist einzig ihr feines spinnwebartiges Geflecht, betupft mit kleinen, welk aussehenden Blättern von undefinierbarer Farbe.
Obwohl erst vor ein paar Jahren erbaut, zeigt das Haus bereits Spuren des fortschreitenden Verfalls; das liegt am tropischen Klima und den Ratten und Termiten. Es wirkt ein wenig heruntergekommen mit seinem gemauerten Erdgeschoss und dem aus gebeiztem Holz errichteten Obergeschoss, das sich unter der erdrückenden Hitze zu ducken scheint; die dünnen Wände ächzen, das Gebälk, von der Sonne ausgebleicht, hat sich verzogen. Einige Bananenstauden wachsen so dicht am Haus, dass sie fast die Mauern berühren und ihre langen schmalen Blätter in die unverglasten Fenster wogen, solange die Fliegengitter nicht geschlossen sind oder die hölzernen Fensterläden, von denen manche so schadhaft sind, dass sie krumm und schief in den Scharnieren hängen.
Ein viereckiges Vordach in der Mitte des Hauses wirft seinen Schatten über den Vordereingang und das Auto, das dort steht. Auf dem flachen Dach ist ein Geländer angebracht wie bei einer Veranda, obwohl es sich für diesen Zweck nicht eignet, weil man sich dort wegen der prallen Sonne tagsüber nicht aufhalten kann. Vom Dach aus überblickt man die Straße, eine staubige unbefestigte Piste mit zwei tiefen Fahrrinnen, von den Rädern der Ochsenkarren gegraben, die hier hauptsächlich passieren.
Das kahle bräunliche Land zwischen Haus und Straße ist eigentlich ein Garten, obwohl dort außer einer hohen schäbigen Palme in der Mitte nichts wächst. Ihre Blattkrone wiegt sich mit einem klatschenden, fast metallischen Geräusch in den gelegentlich aufkommenden heißen Winden; die unteren toten Zweige aber, die längst hätten entfernt werden müssen, hängen als unansehnliche faulende Fetzen rings um den Stamm. Jenseits der Straße erstreckt sich ein verwirrend unübersichtliches Terrain, von dem sich das Auge keinen klaren Eindruck zu verschaffen vermag. Hier trifft die Ebene mit steinigen, strauchüberwucherten Bergen zusammen, dazwischen schieben sich die Ausläufer des Dschungels wie Keile. Eine Anzahl hoher Waldbäume, von armdicken Lianen überwuchert, bildet rechts vom Haus unvermutet eine schwarze Schatteninsel, die leider nicht bis ans Haus reicht. Links ist ein Sumpfgebiet voller Schlangen und Blutegel, verborgen unter den hellgrünen tellergroßen Blättern der fleischigen Pflanzen, die in dem trügerischen Morast gedeihen.
Als die Sonne untergeht, verströmt der Himmel ein Licht, in dem die Wipfel der Bäume hinter dem Haus, von der gleißenden Helle des Tages befreit, sich auf einmal in ihrer ganzen verästelten Struktur deutlich abzeichnen. Jetzt müsste es möglich sein, die Fiebervögel zu sehen, die endlich verstummt sind. Doch sie bleiben unsichtbar, sei es, weil sie sich nicht regen und darum in dem Gewirr der Zweige nicht auszumachen sind oder weil sie sich bereits zu anderen Ruheplätzen aufgemacht haben.
Aber weitaus verwunderlicher als ihre Unsichtbarkeit oder Abwesenheit ist das abrupte Verstummen der aufreizenden Rufe. Die eintönige Frage ohne Antwort hat sich mit dem Gefüge des Tages verwoben und hinterlässt selbst jetzt noch ein stummes Echo, das wie eine dunkle Kakophonie in der Seele nachhallt.
3
Das Tageslicht schwindet in genau sechs Minuten. Nur ein fahler violetter Fleck ist noch zu sehen, der die westliche Himmelsrichtung kennzeichnet. Ein Stern nach dem andern steigt funkelnd auf. Die Frösche im Sumpf haben ein Konzert angestimmt, das zunehmend lauter wird, einen endlosen vielstimmigen Chor aus quakenden, glucksenden und bellenden Tönen, der von Zeit zu Zeit einem Höhepunkt zusteuert, welcher in einem kontrapunktisch gesetzten, erstaunlich tiefen, rauhen krötenartigen Schrei gipfelt, lauter als alles andere, nach dem der Zyklus wieder von neuem beginnt.
Der Mond ist noch nicht aufgegangen. Nur das fahle, gespenstische Licht der Sterne schwebt über dem Sumpf. Das Haus ist mehr zu hören als zu sehen; sein Gebälk knarrt und kracht wie Pistolenschüsse, als die Luft abkühlt und das Gefüge sich zusammenzieht. Ein bleistiftdünnes Bündel waagrechter heller Linien kennzeichnet die Position der Fenster. Zwei davon, länger als die anderen, führen auf das verandaähnliche Flachdach. Ein junges Mädchen tritt heraus und nähert sich dem Geländer – man sieht darum nicht ihre ganze Gestalt, als sie sich dagegen lehnt, sondern sieht sie nur, von unten aus betrachtet, bis zur Hüfte. Und das Licht, das aus dem Innern des Hauses dringt, ist nicht hell genug, um die Farbe ihres Kleides erkennen zu lassen, aber vermutlich ist es weiß.
Sie hebt beide Hände, lüpft einen Moment lang ihr Haar, um ihren Nacken zu kühlen, lässt es dann herabfallen und lehnt sich wieder gegen das Geländer. Reglos steht sie da, ein wenig vorgebeugt, als suche sie unten auf dem Boden etwas zu erkennen, doch das ist unmöglich angesichts des undurchdringlichen Dunkels. Ihr Haar ist nicht dunkler als das Kleid und fällt beinah schulterlang herab. Das Spektakel, das die Frösche veranstalten, übertönt nicht den aufreizenden Ruf des Fiebervogels, der sich in ihrem Kopf eingenistet hat. Dieser anhaltende Reiz vermag sich in der Dunkelheit, wo nichts vom anderen zu unterscheiden ist, mit allem zu verbinden. Er verschmilzt mit der Hitze, mit dem Gequake der Frösche, mit dem Gebimmel und flackernden Lichtschein einer Laterne, die das Vorbeifahren einer Ochsenkarre signalisieren, mit dem Singsang der Kutscher, der sie vor den Dämonen des Sumpfes schützen soll; die Wagenlenker sind in der Dunkelheit nicht zu erkennen.
Das Mädchen rührt sich nicht vom Fleck und dreht sich auch nicht um, als ein würdevoller barfüßiger Diener mit weißem Turban und grauem Bart am Fenster erscheint. Sie hört ihn, zeigt aber keine Reaktion. Nachdem er sie eine Weile mit undurchdringlicher Miene gemustert hat, zieht er sich lautlos zurück, nicht ohne einen missbilligenden Blick auf sie und die offenen Fenster zu werfen, durch die unablässig Schwärme von Moskitos und andere Insekten hereinströmen, angezogen von dem Licht im Innern.
In immer dichteren Wolken tanzen sie um die nackte Glühbirne, die der weiße tellerförmige Lampenschirm nicht verbirgt, so dicht, dass sich das Licht verdunkelt. Als einzelne sind sie im Fluge ebenso wenig zu erkennen wie im Tode, und ihre versengten, noch krampfhaft zuckenden Körper torkeln auf der Tischplatte umher und fallen schließlich über den Rand hinab auf die nackten glanzlosen Bodendielen. Hier bleiben sie liegen im kreisrunden Schatten des Tisches, ein paar versuchen mit letzter Kraft, mit verstümmelten Beinen, versengten Flügeln und Fühlern sich noch einige Zentimeter weiterzuschleppen, bevor sie ein letztes Mal zucken und zu Abfall werden.
4
Umsorgt von dem missbilligend dreinblickenden Diener nimmt der Ehemann im Zimmer sein Dinner ein. Das Mädchen ist auf dem Dach geblieben, wo es kühler ist. Es geschieht in letzter Zeit nicht selten, dass sie den Mahlzeiten fernbleibt. Seit die Hitze eingesetzt hatte, verspürte sie keinen Appetit mehr. Sie ist noch nicht lange im Land, und ihr Körper hat sich noch nicht an das ungesunde tropische Klima gewöhnt. Im übrigen haben sie nicht viel miteinander gemein; sie sind zwar erst seit einem Jahr verheiratet, doch keiner von beiden fühlt sich in der Gesellschaft des anderen wohl.
Mit eigentümlicher, schier unerschütterlicher Überzeugung glaubt der Mann an seine Überlegenheit. Immer hat er die Menschen seiner Umgebung mit Arroganz, Hochmut und seinem jähzornigen Temperament eingeschüchtert und gepeinigt. Als Junge terrorisierte er mit seinen Wutanfällen die ganze Familie. Bekam er nicht, was er wollte, warf er sich auf den Boden und brüllte so lange wie am Spieß, bis er im Gesicht blau anlief. Daran hat sich seither nicht viel geändert. Jeder fürchtet seine Wutanfälle. Er braucht bloß mit den Zähnen zu knirschen, und alle fallen vor ihm auf die Knie.
Seine Frau ist die Einzige, die sich ihm nicht unterwirft, was ihn natürlich wütend macht. Es gibt noch mehr, was er ihr übelnimmt: dass sie z.B. keine Dame der Gesellschaft ist, geschweige denn eine tüchtige Hausfrau. Tatsächlich hat sie für häusliche und gesellige Dinge so wenig übrig wie er für intellektuelle Beschäftigung und versucht so gut wie nie, ihren zahlreichen Dienstboten unterschiedlichster Rassenzugehörigkeit Befehle zu erteilen. Manche, die schon vor ihrer Heirat in seinen Diensten waren, lehnen ihre Anwesenheit ab und nehmen die anderen gegen sie ein, um ihr Versagen noch offenkundiger zu machen.
Der Mann im Esszimmer ist sich all dessen wohl bewusst, besonders aber der Bedeutung der Tatsache, dass ihm das Dinner nicht vom Butler serviert wird, sondern von seinem eigenen Diener. Der strenge asketische graubärtige Mohammedaner ist von Anfang an bei ihm, seitdem er als junger Mann zum ersten Mal hierherkam. Natürlich hat der Mann jetzt eine viel höhere Stellung als damals, doch er ist unzufrieden, weil sie nicht noch höher ist, und glaubt sich ungerecht behandelt, zurückgesetzt statt befördert. Er ist sich nicht bewusst, in welchem Maße seine Arroganz und Misslaunigkeit seiner Karriere schaden.
Sein Diener hat eine privilegierte Stellung im Hause inne, nicht nur weil er länger als alle anderen bei ihm ist, sondern auch weil seine Aufgabe, die Sorge um die persönlichen Belange seines Herrn, eine gewisse Vertrautheit mit sich bringt, wie seine Gegenwart jetzt zeigt. Er weiß, dass nicht alles zum besten steht zwischen seinem Herrn und der jungen Frau, die ihre häuslichen Pflichten, von denen sein Wohl abhängt, vernachlässigt und wieder mal die Fenster offen stehen lässt, sodass das Haus voller Moskitos ist. Er bedient ihn, um ihm seine Sympathie zu zeigen, und bemüht sich, ihre Versäumnisse auszugleichen: jedenfalls will er das dem anderen Mann glauben machen. Er geht nicht heim, obwohl er Feierabend hat, um sich von seiner eigenen Frau, einer, die sich unterwirft, verwöhnen zu lassen.
Es stimmt, dass sein Herr ihm vertraut, vielleicht mehr, als ihm bewusst ist. Der Mann würde am liebsten nur Mohammedaner beschäftigen, die erscheinen ihm vertrauenswürdiger als die Einheimischen; er verzichtet darauf nur, weil die Regierungspolitik eine derartige Diskriminierung nicht duldet. Er mag die Landesbewohner nicht, die er für launisch, verantwortungslos und unmoralisch hält und deren Sinnenfreude seinen Puritanismus verletzt. Er bemüht sich stets, die Einheimischen korrekt zu behandeln, doch diese spüren seine feindselige Haltung. Und da sie ein fröhliches Naturell haben und die Weißen ihnen mehr oder minder gleichgültig sind, drückt sich ihre Feindseligkeit in Spott aus. Sie nennen ihn Mr. Dog Head, Hundekopf – warum, das ist nicht auf Anhieb zu verstehen.
Aggressiv und anmaßend in Gebaren und Erscheinung, wirkt er durch seine Arroganz größer als er in Wirklichkeit ist; mager, muskulös, zäh und knochig, mit hellblauen Augen, die aufflackern können wie Feuerwerk. Sein kurzgeschnittenes Haar, dessen rötlicher Farbton durch die tropische Sonne heller geworden ist, umschmiegt seinen Schädel wie ein kurzhaariger Pelz. Auch seine Arme sind von ähnlich pelzigem Bewuchs, der seinen ganzen Körper zu bedecken scheint. Er trägt weder Krawatte noch Jacke, doch sein Hemd ist makellos, und jetzt zum Dinner trägt er statt der Shorts, die er tagsüber anhat, eine weiße Hose.
Er isst schnell wie jemand, der seinen Zug nicht verpassen darf. Wohl befördert er die Bissen geräuschlos und gesittet zum Mund, doch es scheint, als schlösse sich der Kiefer mit einem Schnappen, und während er kaut, sammelt er mit Messer und Gabel bereits den nächsten Happen ein. Indes wäre es gewiss übertrieben zu behaupten, dass die Gier, mit der er alles verschlingt, was auf dem Teller ist, ihm irgendeine Ähnlichkeit mit einem hungrigen Hund verliehe.
Moskitos schwärmen ins Zimmer. Ihr Eindringen lässt sich nicht verhindern, da es keine richtigen Türen im Haus gibt, sondern nur Schwingtüren, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann. Mohammed Dirwaza Khan hat draußen zwei Boys postiert und ihnen befohlen, ein Netz von Wand zu Wand hochzuhalten. Doch ihre Arme schmerzen, und weil sie diese Extraarbeit als Schikane empfinden, beginnen sie zu murren, was den scharfen Ohren des Essers nicht verborgen bleibt.
Er fühlt die Augen seines Dieners auf sich ruhen, der bereits Anstalten macht, sie handgreiflich zur Ordnung zu rufen, und schüttelt unmerklich den Kopf. Er hat sein Mahl inzwischen beendet, schiebt den Teller zurück und steht auf, ohne das rosarote Konfekt, das zum Dessert gereicht wird als traditionelles Zugeständnis an die vermeintliche Naschsucht seiner Frau, auch nur eines Blickes zu würdigen – er rührt es nie an. Beim Hinausgehen lächelt er dem Mohammedaner zu, seine Zähne blitzen kurz auf; große, starke weiße Zähne, die eher an einen Tiger als an einen Hund erinnern.
Während des Mahls hat er mit dem Diener kein Wort gewechselt. Da er noch immer schweigt und ihm nur im Vorbeigehen zulächelt, fällt es schwer zu sagen, warum er ihm jetzt mehr entgegenzubringen scheint als das übliche Wohlwollen – ja fast eine Art Vertrautheit – oder inwiefern sein Lächeln über das Erlaubte hinausgeht oder gegen die Norm verstößt oder unschicklich erscheint.
Der solcherart Angelächelte nimmt die kleine Regelverletzung – wenn sie das ist – dankbar zur Kenntnis. Es unterstreicht die Vollkommenheit seines Verhaltens, dass er sie lediglich mit einem leichten Kopfneigen quittiert, ohne im mindesten die gebotene Korrektheit oder Diskretion außer acht zu lassen. Tatsächlich sähe ein Dritter keinen Unterschied zwischen diesem Gruß und der Verbeugung, die er stets macht, wenn sein Herr, aus einem Zimmer kommend, an ihm vorbeigeht.
Gleichwohl befriedigt es ihn, dass er seine Freizeit nicht umsonst geopfert hat. Und künftig wird er das andere Personal noch mehr seinem gestrengen Reglement unterwerfen wegen des neu erstarkten Zusammengehörigkeitsgefühls, das er mit dem Mann verspürt, der soeben an ihm vorbeiging.
5
Drei Zimmer gibt es im Obergeschoss des Hauses: eins in der Mitte, zu dem die Treppe hinaufführt, und auf jeder Seite ein Schlafzimmer. Auch die Schlafzimmer haben nur Schwingtüren, die oben und unten jeweils ein oder zwei Fuß offen sind. Das verandaähnliche Flachdach ist vom mittleren Zimmer aus erreichbar, in dem sich ein paar billige Peddigrohrmöbel befinden sowie ein größeres Möbelstück, das offenbar aus einem der Schlafzimmer hier ab gestellt wurde. Es ist ein Kleiderschrank, wie sie ihn im Ortsgefängnis herstellen, aus irgendeinem dunkelroten Holz, das sich stets ein wenig klebrig anfühlt. Auf dem Tisch stehen Flaschen, Gläser und ein Siphon. In der Mitte der Decke dreht sich schwerfällig ein großer Ventilator, der die heiße Luft bewegt. Die Drahtgitter vor den Fenstern sind jetzt geschlossen und scheinen zu verhindern, dass die kühlere Luft, die es draußen vielleicht gibt, hereindringt. Dennoch sitzt das Mädchen so nah wie möglich an einem der Fenster und versucht angestrengt in dem matten Licht einer von der Decke herabbaumelnden Glühbirne zu lesen; sie wagt nicht, die Tischlampe einzuschalten, die mehr Hitze als Licht verbreitet.
Mr. Dog Head, in einer Hand eine zusammengerollte Zeitung, in der anderen eine Fliegenklatsche aus Draht, streicht an den Wänden entlang und macht systematisch Jagd auf Moskitos. Es sind so viele, die hier umherschwirren, dass ihr Sirren sogar noch das Brummen des Ventilators übertönt.