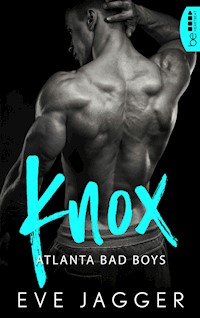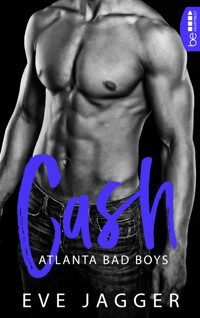3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sexy Bastard-Reihe
- Sprache: Deutsch
Sexy. Selbstbewusst. Hart.
Ryder Cole ist der König des Atlanta Nachtlebens - und der einzige Mann, der dafür sorgt, dass ich meine Vergangenheit vergesse.
Ich laufe vor Geheimnissen davon, die mich zerstören könnten - in meinem Leben ist einfach kein Platz für jemanden wie ihn: viel zu großspurig und höllisch sexy. Ich sollte mich von ihm fernhalten, aber meine Vernunft verabschiedet sich, sobald er nur in meine Richtung schaut. Und wenn er mich berührt ...
Aber was passiert, wenn die Vergangenheit mich einholt und all die Dinge, vor denen ich mich jahrelang versteckt habe, uns wieder auseinanderreißen? Ich kann nicht ewig davonlaufen, und Ryder bekommt immer, was er will ...
Der heiße Auftakt der "Atlanta Bad Boys"-Reihe. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Der nächste Bad Boy wartet schon - "Cash" erscheint im Dezember.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
KAPITEL 1 RYDER
KAPITEL 2 RYDER
KAPITEL 3 CASSIE
KAPITEL 4 CASSIE
KAPITEL 5 CASSIE
KAPITEL 6 CASSIE
KAPITEL 7 CASSIE
KAPITEL 8 RYDER
KAPITEL 9 CASSIE
KAPITEL 10 CASSIE
KAPITEL 11 CASSIE
KAPITEL 12 RYDER
KAPITEL 13 CASSIE
KAPITEL 14 CASSIE
KAPITEL 15 CASSIE
KAPITEL 16 RYDER
KAPITEL 17 CASSIE
KAPITEL 18 CASSIE
KAPITEL 19 CASSIE
KAPITEL 20 CASSIE
KAPITEL 21 CASSIE
KAPITEL 22 CASSIE
KAPITEL 23 CASSIE
KAPITEL 24 RYDER
KAPITEL 25 CASSIE
KAPITEL 26 CASSIE
KAPITEL 27 CASSIE
KAPITEL 28 CASSIE
KAPITEL 29 CASSIE
Über dieses Buch
Ryder Cole ist der König des Atlanta Nachtlebens – und der einzige Mann, der dafür sorgt, dass ich meine Vergangenheit vergesse.
Ich laufe vor Geheimnissen davon, die mich zerstören könnten – in meinem Leben ist einfach kein Platz für jemanden wie ihn: viel zu großspurig und höllisch sexy. Ich sollte mich von ihm fernhalten, aber meine Vernunft verabschiedet sich, sobald er nur in meine Richtung schaut. Und wenn er mich berührt …
Aber was passiert, wenn die Vergangenheit mich einholt und all die Dinge, vor denen ich mich jahrelang versteckt habe, uns wieder auseinanderreißen? Ich kann nicht ewig davonlaufen, und Ryder bekommt immer, was er will …
Über die Autorin
Eve Jagger wurde in Georgia geboren und liebte schon früh das Schreiben. Doch erst seit einigen Jahren widmet sie sich vollkommen ihren Geschichten. In den USA wurde sie als USA-Today-Bestsellerautorin bekannt durch ihre Sexy-Bastard-Reihe, die jetzt auch auf Deutsch veröffentlicht wird.
Sie ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrem Mann im Süden der USA, wo sie sich für weitere heiße Geschichten inspirieren lässt.
EVE JAGGER
ATLANTA BAD BOYS
Hard
Aus dem Amerikanischenvon Michael Krug
beHEARTBEAT
Deutsche Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2015 by Eve Jagger
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Hard«
Published by arrangement with Bookcase Literary Agency and Rebecca Friedman Literary Agency.
The moral rights of the author have been asserted.
Die Persönlichkeitsrechte des Autors wurden gewahrt.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anita Hirtreiter
Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de nach einer Vorlage von Jennifer Watson – Social Butterfly PR
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6218-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Dieses Buch ist dem echten Ryder gewidmet.
KAPITEL 1RYDER
Es gibt auf der Welt zwei Gerüche, die ich mehr liebe als alle anderen: den einer Frau, ehe ich Sex mit ihr habe, und den dieses Lagerhauses unmittelbar vor einem Kampf. Natürlich besteht zwischen den beiden ein Unterschied. Nichts geht über eine nackte feuchte wartende Frau, deren Haut einen vor Schweiß salzigen, zugleich jedoch süßen Duft verströmt, als schwömme man durch ein Meer von Rosen. Der Mief im Lagerhaus ist weit weniger angenehm. Durch die Rückstände der letzten Runde ausgeschlagener Zähne, grün und blau geschlagener Gesichter und schmerzender Knochen wirkt die Luft schwer, schmutzig, stickig, ein wenig wie der Geruch von frischer Erde. Aber beides ist erregend, unberechenbar und weckt in mir den Wunsch zu explodieren.
Sogar damals vor ein paar Jahren, als ich selbst im Ring stand, um Hiebe in die Rippen einzustecken und die Knöchel gegen jemandes Wangenknochen krachen zu lassen, hat mich der Geruch dieses Ortes immer berauscht. Sich einem Kerl zu stellen, dessen einzige Absicht in den nächsten Minuten darin besteht, einen zur Aufgabe zu prügeln, ist so furchteinflößend, wie es klingt. Und so erregend. Die Parameter bei Kämpfen mit bloßen Fäusten sind: kein Shirt, keine Schuhe und ein großes Problem, das einem direkt gegenübersteht. Um mich zu beruhigen, musste ich allerdings nur die Luft dieses Lagerhauses tief einatmen, die Moleküle in meine Lunge, in meinen Blutkreislauf dringen lassen, und ich gewann jeden Kampf.
Ich gewinne immer.
Heute Abend, nachdem Crutcher gegen Miller einen Überraschungserfolg gelandet hat, was für mich zweifelsohne einen fetten Gewinn bedeutet, teilt mir Tyler mit, dass irgendein junger Bursche, der mit zehntausend Dollar in der Kreide steht, verschwunden ist. Ich erwidere darauf, dass er sich irren muss.
»Bei Jamie McEntire würde ich nie einen solchen Schuldenstand auflaufen lassen«, erkläre ich Tyler. »Ich habe ihn schon gesehen. Dem würde ich keine zehn Dollar geben, geschweige denn zehntausend.«
Als ich die Veranstaltung der Fight Night vor zwei Jahren übernommen habe, musste ich erst ein wenig das Chaos beseitigen, das mir mein Vorgänger hinterlassen hatte. Es gibt keine fünf- oder gar sechsstelligen Schulden mehr von Leuten, die wir nicht kennen, und jemand, der sich öfter als einmal um die Zahlung gedrückt hat, bekommt keinen Kredit. Wir mögen ein Betrieb sein, der im Untergrund arbeitet, trotzdem haben wir Standards. Ebenso eine Kleiderordnung: Stöckelschuhe für Frauen, Hemden für Männer, und unsere Kundschaft gehört zu der Sorte, die gern eine Menge Geld für beides ausgibt. Wir haben Sicherheitspersonal. Der Barkeeper ruft einem ein Taxi, wenn man zu betrunken zum Fahren ist. Ich führe ein strenges Regiment. Das sieht sogar die Polizei so. Deshalb behelligt sie mich auch nicht. Manchmal wagt sogar ein Cop einen Versuch im Ring.
Tyler zuckt mit den Schultern. »Hat sich nach und nach angesammelt. Verluste bei ein paar Kämpfen, Darlehen, um die Schulden abzudecken«, entgegnet er. »Ich überbringe ja höchst ungern schlechte Neuigkeiten, aber ich habe es zweimal überprüft. Die Summe stimmt.«
»Fick mich«, fluche ich, und eine Blondine in High Heels und einem so engen Kleid, dass sie wohl den ganzen Abend kaum geatmet haben kann, dreht sich uns zu. Sie mustert mich mit hochgezogenen Augenbrauen und lächelt mich gleichzeitig an, als hätte sie Lust, mich beim Wort zu nehmen.
Und so, wie sie mit den Lippen die Öffnung der Bierflasche umschließt, ohne den Blickkontakt mit mir abzubrechen, hätte ich meinerseits nicht übel Lust, es zuzulassen.
Tylers Stimme lenkt meine Aufmerksamkeit jäh zurück zum anstehenden Problem. »Also, was willst du tun?«, fragt er mich. »Er hat sein Haus als Sicherheit angeboten.«
Ich schüttle den Kopf. »Wir sind hier keine Tauschbörse.«
Nur, weil ich einen illegalen Kampf- und Wettring betreibe, glauben die Menschen manchmal, ich wäre unredlich, würde nicht auf ordentliche Buchführung achten oder wäre einfach nur dämlich. Daher versuchen sie gelegentlich, mich über den Tisch zu ziehen. Sie denken, ich würde es nicht merken, wenn sie ein wenig Bares abzweigen oder nicht in voller Höhe oder überhaupt nicht bezahlen. Sie halten mich für einen Kerl, der zu Geld gekommen ist, indem er Fremde windelweich geprügelt hat, während Partygirls und ihre Begleiter Wetten platzierten. Nur Muskeln, kein Hirn. Aber damit liegen sie falsch.
Im Ring macht es mir nichts aus, unterschätzt zu werden. Hat mir sogar oft geholfen zu gewinnen. Manche Zuschauer meinen, jemand wie ich – groß, muskelbepackt, breitschultrig – kann nicht wendig genug sein, um einem rechten Haken auszuweichen. Also wetten sie gegen mich. Ihnen ist nicht klar, dass diese Muskeln nicht nur zum Angeben vor den weiblichen Vertretern der Menge dienen – obwohl es mir nie etwas ausgemacht hat, wenn Frauen Notiz davon nahmen. Die harten, definierten Oberarme bedeuten, man ist stark, und durch den Waschbrettbauch ist man zudem schnell. Was alles in allem dazu geführt hat, dass mein Bankkonto prall gefüllt wurde.
Doch als Boss außerhalb des Rings geht es nicht an, dass mich die Leute nicht ernst nehmen. Die Armani-Anzüge, die ich in Fight Nights trage, sehen zwar verdammt gut an mir aus, sind aber nicht billig. Leihe ich also jemandem Geld, erwarte ich, dass ich es zurückbekomme, wenn es mir per Handschlag versprochen wurde. Das ist nur fair. Immerhin habe ich einen Ruf zu verteidigen, ganz zu schweigen von einer Karriere als legitimer Geschäftsmann – mir gehören zwei der angesagtesten Nachtklubs von Atlanta, eine Cocktailbar und das Altitude, eine Kneipe, die ich zusammen mit einigen Freunden betreibe. Ich bin nach oben gekommen, indem ich wie ein Schmetterling durch den Ring geflogen bin, doch außerhalb des Rings halte ich mich an der Spitze, weil ich auch stechen kann wie eine Wespe.
Und Jamie McEntire wird demnächst erfahren, was das bedeutet.
»Weißt du, wo das Haus dieses Burschen ist?«, frage ich und klopfe Tyler auf die Schulter. Er nickt. »Gut«, brumme ich, »du fährst. Schnapp dir Valero und sag ihm, dass wir zu einem Besuch aufbrechen, sobald die Leute hier raus sind.«
Tyler geht, und die Frau in dem enganliegenden Kleid mit der beneidenswerten Bierflasche nähert sich mir. Ihr Ausschnitt ist so tief, wie ihr Rock kurz ist. »Jemand sollte dir den Mund ausspülen«, meint sie.
»Tut mir leid, wenn ich dein Zartgefühl gekränkt habe«, gebe ich lächelnd zurück. Ich meine, wir sind hier bei einem Bare-Knuckle-Fight im Untergrund. Fick mich dürfte wohl kaum das Anstößigste sein, was sie heute Nacht zu hören bekommt.
»Überhaupt nicht«, stellt sie klar. »Ich mag Männer, die versaut reden.« Sie trinkt einen Schluck aus der Flasche und hält sie mir anschließend hin. »Willst du auch etwas?«
Ich glaube nicht, dass sie nur das Bier meint.
Über ihre Schulter sichte ich in der Menge hinter ihr einen Typen in einem adretten grauen Anzug. Er steht mit ein paar anderen Leuten zusammen, aber seine Aufmerksamkeit gilt eindeutig der Frau. Er beobachtet sie. Ich drücke die Flasche mit dem Zeigefinger zu ihr zurück. »Mit wem bist du hier?«
»Mit niemand Besonderem«, antwortet sie und tritt einen Schritt auf mich zu. »Hast du Lust auf Gesellschaft?«
Frauen. Sie riechen gut, sie sehen gut aus, sie schmecken gut, trotzdem können sie so verdammt übel für einen sein.
Ich bin selbst schon der Typ im grauen Anzug gewesen. Sogar in den Schatten der Lagerhalle kann ich den Ausdruck in seinem Gesicht deuten, die zu Schlitzen verengten Augen, die leicht hängenden Mundwinkel. Er ist jemand, der weiß: Nur weil er diese junge Frau heute Nacht ausführt, bedeutet das noch lange nicht, dass er auch derjenige sein wird, der sie mit nach Hause nimmt. Als ich noch gekämpft habe, hat meine damalige feste Freundin die Stunden, in denen ich Kerlen die Rübe weichgeklopft habe, dazu genutzt, sich mit anderen zwischen den Laken zu vergnügen. Sie hat sogar mit einigen meiner Gegner geschlafen, die ich trotzdem besiegt habe, aber dennoch … Keine Ahnung, ob sie sich bloß gelangweilt hat oder ob sie grundsätzlich falsch war – ob sie mich zu wenig oder sich selbst zu viel geliebt hat oder beides. Jedenfalls habe ich Beziehungen abgeschworen, seit wir uns vor zwei Jahren getrennt haben. Mein Motto lautet: rein und raus. Auf jede erdenkliche Weise.
Die junge Frau in dem hautengen Kleid steht also vor mir. Sie hat genau die richtige Größe, um auf dem Vordersitz meines Audi auf meinem Schoß zu reiten, was in der Regel der perfekte Abschluss für eine Nacht wäre.
Doch ich kann Unaufrichtigkeit auf den Tod nicht ausstehen, nicht mal bei einem One-Night-Stand. Wie ich schon sagte: Ich habe gewisse Standards.
»Ist dafür nicht dein Date da?«, frage ich und nicke in Richtung des Kerls mit dem grauen Anzug, der inzwischen in der Nähe der Ausgangstür steht, wo die ersten Leute bereits gehen. Mittlerweile muss es nach zwei Uhr nachts sein – an einem Wochentag, was bedeutet, dass die meisten dieser Menschen in sechs Stunden im Büro einstempeln müssen. Adrenalinjunkies bei Nacht, leitende Entscheidungsträger am Tag. Das gilt für einen Großteil unseres Publikums. Und auch, wenn ich selbst mit dieser Art eines starren, konventionellen Lebensstils nichts anfangen kann, ist das Geld dieser Leute so gut wie das aller anderen. Vermutlich schätzen sie die Kämpfe sogar noch mehr als andere, da Bare-Knuckle-Fights so weit von der Welt der Fortune-500-Unternehmen oder Großkanzleien entfernt sind, für die sie arbeiten.
Sie schaut zu dem Typen im grauen Anzug, dann zurück zu mir. »Er ist ganz in Ordnung«, räumt sie ein. Ihr hübscher Mund lächelt breiter. In der Düsternis der Lagerhalle schimmern ihre Zähne wie weiße Steine. »Aber du bist Ryder Cole.« Zart streicht sie mit der Hand über meinen Arm. »Und ich bin bereit.«
Mein Bizeps will meiner Absicht, mich zu benehmen, in den Rücken fallen. Er zieht sich unwillkürlich zusammen, als ihre Finger auf meinem Anzugärmel verharren. »Bereit wofür?«
»Alles, was du willst.«
Ich beuge mich näher zu ihr. »Ich will, dass du ein braves Mädchen bist, mit dem Kerl nach Hause gehst, der dich hergebracht hat, und ihm das Hirn rausvögelst«, sage ich zu ihr. »Aber du kannst dabei gern an mich denken.«
Damit gehe ich zu Tyler, der an der Tür wartet. Das Sicherheitspersonal wird abschließen. Wir haben Geschäftliches zu regeln.
KAPITEL 2RYDER
»Bist du sicher, dass es hier ist?«, frage ich, als Tyler seinen Honda Civic in der Einfahrt eines zweigeschossigen Ziegelsteinhauses parkt. Auf der Veranda steht eine Schaukel. Gestutzte Hecken. Gemähtes Gras. Sieht eher nach einem Haus aus, in dem Eltern leben, nicht ein Mittzwanziger, der zu dämlich ist, um sein Wort zu halten, und zu arm, um seine Schulden zu begleichen. Weder drinnen noch draußen brennen Lichter. Vielleicht bezahlt Jamie seine Stromrechnungen auch nicht.
»Es ist hier«, antwortet Tyler und zieht den Reißverschluss seiner Lederjacke zu. »Valero hat’s bestätigt.« Mit dem Daumen zeigt er nach hinten auf einen meiner Leute für alles Mögliche – Sicherheit, Vollstreckung, Informationsbeschaffung. Gewissenermaßen ein Universalgenie. Valero sitzt auf der Rückbank. Sein Kopf streift die Decke des Wagens – ein Honda Civic ist kein ideales Gefährt für einen ehemaligen Lineback der Falcons –, trotzdem gelingt es ihm zu nicken.
»Tja, worauf warten wir dann noch?«, frage ich. »Gehen wir Guten Tag sagen.«
Abgesehen vom leisen Zirpen der Sommergrillen herrscht auf der Straße Stille, die Valero mit einem Klopfen an der Eingangstür unterbricht. Gleichzeitig versucht er, den Knauf zu drehen, falls Jamie beim Abschließen genauso säumig ist wie beim Zahlen seiner Schulden. Aber es kommt niemand an die Tür, und der Knauf lässt sich nicht drehen. Tyler geht zur Seite des Hauses und verschwindet um die Ecke der um das Gebäude verlaufenden Veranda, während Valero auf den Klingelknopf drückt. Wir hören kein Läuten von drinnen.
Tyler taucht wieder auf. »Da drüben«, sagt er. Wir folgen ihm zur Seite des Hauses, wo er eine Tür gefunden hat. »Die vorne ist wahrscheinlich zu massiv, was meint ihr?«, sagt er. »Außerdem ist an der hier kein Bolzenschloss.« Er legt den Kopf schief und sieht mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ich weiß, welche Frage er damit andeutet.
Es ist so: Ich bin im Großen und Ganzen ein netter Kerl in einer nicht allzu netten Branche. Aber etwas lernt man als Kämpfer: Wenn jemand einmal zuschlägt, gibt es immer auch einen Nachschlag. Man muss bereit sein zurückzuschlagen. Zu tun, was nötig ist, um sich zu verteidigen.
Und wie es so schön heißt: Angriff ist die beste Verteidigung.
»Je eher wir drin sind, desto eher sind wir wieder weg.« Damit weiche ich beiseite, um Valero genug Platz zu geben, als er mit dem Fuß ausholt. Mit der Anmut und Präzision des Falcons-Spielers, der er mal war, tritt er die Tür ein, die nach innen ins Haus aufschwingt – was leiser abläuft, als man meinen möchte. Wie wenn ein Glas auf einen Hartholzboden fällt, aber nicht zerbricht. Die Tür hängt schief, weil zwei der drei Angeln im Eimer sind, und wir betreten einen Raum, der nach der Küche aussieht.
Unsere Augen passen sich an die Dunkelheit an. Ich hoffe, der Junge hilft uns dabei, die Sache auf die sanfte Tour zu klären, indem er einfach runterkommt, um nachzusehen, was der Radau soll, und uns nicht dazu zwingt, ihn aus dem Bett zu zerren, einen Duschvorhang beiseitezureißen, hinter dem er sich wie eine Figur in einem schlechten Film versteckt, oder ihn die Straße entlang zu verfolgen. Keine Ahnung, wo genau wir sind, aber es kommt mir wie ein anständiges Viertel vor, und ich bin sicher, die Familien nebenan würden es zu schätzen wissen, wenn sich Jamie unseren Forderungen fügt. Würde mir zutiefst widerstreben, wenn sie aufwachen, weil er aus einem Fenster im ersten Stock flieht. Oder von Valero durch eines hinausgeworfen wird.
Einen Herzschlag lang warten wir in der Küche, doch es taucht niemand auf. Also auf die harte Tour. Und es ist nicht gelogen, wenn ich sage, es betrübt mich, dass es dazu kommt – Türen aufzubrechen und Leute aufzumischen, erinnert mich zu sehr an mein altes Leben, denn ich habe so hart dafür gearbeitet, dieses Leben hinter mir zu lassen. Allerdings kann ich es mir schlichtweg nicht leisten, einfach zu vergeben und zu vergessen. Nicht in dieser Branche.
»Gehen wir«, sage ich und steuere auf die Diele zu. Ich winke Valero ins Wohnzimmer, um mit der Durchsuchung im Erdgeschoss zu beginnen, während Tyler mir über die Treppe nach oben folgt. Der Teppich auf den Stufen dämpft die Geräusche unserer Schritte.
Den Flur im ersten Stock säumen mehrere Türen, aber nur die ganz am Ende ist geschlossen. Ich steuere geradewegs darauf zu, während Tyler systematisch Lichter einschaltet und sicherheitshalber auch die offenen Räume überprüft – ein Badezimmer hier, einen Wandschrank da, ein Gästezimmer samt Bett mit Häkeldecke, die wohl von Oma McEntire stammen muss. Jammerschade, dass sie ihrem Enkel nicht beigebracht hat, kein degenerierter Spieler zu werden.
Ich lege das Ohr an die geschlossene Tür und höre die leisen Bewegungen eines arglos Schlafenden, dem eine große Überraschung bevorsteht.
Der Knauf verursacht kaum ein Geräusch, als ich ihn drehe. Die Umrisse des Bettes sind im Mondlicht, das durch die Jalousien dringt, vage erkennbar. Ich kann eine Gestalt ausmachen, die eingerollt zwischen den Laken liegt: Jamie, der den letzten friedlichen Schlummer genießt, den er eine Zeit lang haben wird. Auch wenn er es noch nicht weiß.
Ich schalte die Nachttischlampe ein. »Raus aus den Federn, Arschloch«, sage ich, beuge mich über Jamies Kopf und lasse eine Dosis des alten Ryder von früher raushängen.
Unsanft reiße ich die Decke weg. Zum Vorschein kommt eine junge Frau in einem schwarzen Slip. Die Seitenbänder sind verdreht und knapp unter ihre Hüfte geschoben. Ein weißes, so fadenscheiniges T-Shirt, dass es beinah durchsichtig ist, spannt sich über ihre Brüste und reicht ihr gerade mal bis knapp über den Bauchnabel. Sogar an ihrem zierlichen Körper wirkt es winzig.
Eine heiße schlaftrunkene Blondine.
Nicht Jamie McEntire.
Worüber ich mich allerdings nicht beklage.
KAPITEL 3CASSIE
Ich hatte wieder von England geträumt, und ausnahmsweise war es beinah angenehm. Richtig erholsamer Schlaf. Nicht der übliche Albtraum, der mich sonst immer heimsucht, wenn sich das Vereinte Königreich in mein Unterbewusstsein einschleicht.
Vielleicht, weil mein Unterbewusstsein gewusst hat, dass in meinem Haus ein echter Albtraum abläuft, der gerade direkt neben meinem Bett steht.
Als ich aufgewacht bin, dachte ich zuerst, ich hätte vielleicht durch den Jetlag eine Halluzination – als würde mein benebelter Verstand zwar in Wirklichkeit Jamie sehen, ihn mir aber als jemand anderen vorgaukeln. Die Stimme habe ich nicht erkannt, doch ich bin so lange von britischen Akzenten umgeben gewesen – manch einer würde vielleicht sagen, ich bin regelrecht darin ertrunken –, dass alle Amerikaner mittlerweile fast fremd für mich klingen. Unvertraut.
Trotzdem finde ich es beunruhigend, diejenige zu sein, die sich im eigenen Haus orientierungslos fühlt, während dieser Fremde völlig ungerührt wirkt. Eher noch erfreut. Belustigt.
Was vielleicht an meinem alten T-Shirt von der University of West Alabama liegt, dem mit Luie, dem Tiger als Zeichentrickfigur auf der Brust. Oder daran, dass ich keine Hose anhabe. Ich muss in Zukunft wirklich daran denken, vollständige Pyjamas zu tragen. Man muss ja Eindringlinge nicht unbedingt auf Ideen bringen, die sie nicht bereits haben.
Wer immer er sein mag, er ist groß. Oder vielleicht wirkt er auch nur dadurch so, wie sich sein blaues Jackett über die breiten Schultern spannt. Ein Hemd und genug Knöpfe offen, um eine definierte Brust erahnen zu lassen. Keine Krawatte. Ein Verbrecher, der es leger mag. Aber sein entspannter Look hilft nicht dabei, den rasenden Puls meines verängstigten Herzens zu verlangsamen oder meine flache Atmung zu normalisieren.
Er lässt meine lavendelfarbene Decke fallen und mustert mich wie ein Raubtier seine gefangene Beute. »Wo ist Jamie?«
Ich rutsche zum gegenüberliegenden Rand des Bettes zurück. »Rühr mich verdammt noch mal nicht an. Du bleibst besser, wo du bist«, warne ich ihn und bemühe mich, das verängstigte Zittern in meiner Stimme zu kontrollieren, während sich mein Verstand überschlägt und nach etwas sucht, das ich als Waffe benutzen könnte – eine alte Nagelfeile auf dem Nachttisch, ein Briefbeschwerer. Dann wäre da noch die Nachttischlampe, neben der er steht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er sie mir nicht einfach so reichen wird, ganz gleich, wie nett ich ihn auch darum bitte. Ich habe dieses Zimmer leergeräumt, als ich vor zwei Jahren nach Europa gegangen bin. Schließlich hätte ich nie gedacht, dass ich zurückkommen würde. Und ich habe ganz sicher keinen Baseballschläger griffbereit unter dem Bett gelassen. Wobei ich im Augenblick sogar schon mit einem Fanghandschuh zufrieden wäre. Damit könnte ich dem Fremden wenigstens eins über die fein geschnittenen Gesichtszüge verpassen.
Als ich aufstehe, schnappe ich mir das Einzige in Reichweite: ein Kissen. Wie einen Schild halte ich es vor mich.
Er schaut finster drein. »Ich will dir nichts tun«, beteuert er. Als er die Arme vor der Brust verschränkt, rutschen die Ärmel seines Jacketts und seines Hemds ein Stück nach oben und offenbaren Tätowierungen, die am Handgelenk enden.
»Wer, verdammt noch mal, bist du, und was, verdammt noch mal, machst du hier?« Meine Stimme klingt tiefer als üblich. Meine Hände sind ruhig, obwohl ich das Gefühl habe, dass heiße Lava brodelnd durch meine Adern fließt wie durch einen Vulkan, der jeden Moment ausbrechen kann.
Wenn ich die Wahl zwischen Kampf oder Flucht habe, entscheide ich mich für Ersteres. Denn als ich London heute Morgen verlassen habe, war das Thema Flucht für mich endgültig durch.
Mit drei langen Schritten überquere ich das Bett und ramme ihm das Kissen mit aller Kraft ins Gesicht, halte es fest, will ihn im Stehen ersticken oder ihm zumindest so die Orientierung rauben wie er davor mir.
Er stolpert einen Schritt zurück, dann jedoch gelingt es ihm, mich um die Taille zu fassen und mich über die Schulter zu werfen. Er entwaffnet mich dabei, nimmt mir das Kissen ab. Es fällt zu Boden, als er mich zur Wand trägt, wo er mich auf die Füße stellt und meine Schultern packt, sie gegen die Mauer drückt. Sein Griff ist kräftig, doch zugleich irgendwie sanft, als versuche er, mich zwar zu fixieren, aber mir nicht wehzutun. Ich spüre den glatten Stoff seiner Anzughose an der nackten Haut, als er die Beine so spreizt, dass sich seine Schuhe rittlings zu beiden Seiten meiner bloßen Füße befinden.
»Du machst ja heute Nacht ganz schön Schulden in der Fluchkasse«, wirft er mir vor. »Ein bisschen wie dein Freund. Nur sind seine Schulden höher als ein paar Vierteldollarmünzen.«
»Wovon laberst du da?«, will ich wissen. Was immer gerade vor sich geht, ich weigere mich, diesen Kerl glauben zu lassen, ich hätte Angst. Ich sehe auf, begegne seinem Blick. Seine Augen sind tiefblau, die Schattierung eines Saphirs. Stechend, hätte ich vielleicht unter anderen Umständen gesagt – Umständen, in denen ich gewusst hätte, was zum Teufel vor sich geht.
»Hast du ihn, Ryde?« Eine andere männliche Stimme aus dem Gang.
»Wir kommen hier klar«, antwortet er. »Geh du mit Valero schon mal zum Auto.«
Ich sehe wieder meinen Geiselnehmer an. »Solltest du nicht mit ihnen gehen?«, schlage ich vor. »Der Trick mit dem Clownsauto ist nur dann lustig, wenn alle Clowns drin sind.«
Er rührt sich nicht. »Aber wir sind doch gerade dabei, uns kennenzulernen.« Seine harte Brust drückt gegen mich, und ich kann seinen Herzschlag fühlen – ruhig und gleichmäßig. Als wäre er völlig entspannt.
Wenigstens einer von uns.
»Also, wie heißt du, Tiger-Lady?«, fragt er. Sein Mund lächelt verhalten, als er den Blick nach unten zu meinem T-Shirt senkt.
»Sag mir lieber, wie du heißt.« Keine Angst zeigen, Cassie.Ruhig, cool, gefasst bleiben.
Er lässt meine Schultern los, stützt die Hände stattdessen links und rechts von mir an die Wand, sperrt mich zwischen seinen Armen ein. »Ladys first.«
»Grobian vor Schönheit«, kontere ich und klimpere mit den Wimpern, um keinen Zweifel daran zu lassen, wer von uns was ist.
»Ryder«, verrät er mir. »Freut mich, dich kennenzulernen.«
»Normalerweise«, kläre ich ihn auf, »werde ich dafür zumindest zum Essen ausgeführt.«
»Du hast ja ziemlich hohe Erwartungen«, kommentiert er. »Und du bist?«
»Nicht geneigt, dir auch nur einen Scheißdreck zu sagen.«
»Jammerschade. Denn ich muss wissen, wo Jamie McEntire steckt«, erwidert Ryder. »Obwohl es mir durchaus gefällt, wenn eine Frau zu ihrem Mann hält.«
Ich verenge die Augen zu Schlitzen. »Ich halte zu meinem Bruder.«
Ryder neigt den Kopf zurück und verdaut die Information. Offensichtlich ist er zu beschäftigt damit gewesen, den harten Kerl zu mimen, um Nachforschungen anzustellen. »Das ergibt schon mehr Sinn«, meint er. »Ich habe schon angefangen, mich zu fragen, wie ein Penner wie er eine Frau wie dich auf Dauer halten kann.« Er mustert mich. »Schade, dass er dich nicht auch als Pfand angeboten hat«, fügt er hinzu. »Auf den Handel hätte ich mich vielleicht eingelassen.«
Pfand. Das ist kein Wort, das je etwas Gutes verheißt.
Oh Jamie. Was hast du jetzt wieder angestellt?
»Pfand wofür?«
»Für die Schulden, die er bei mir hat«, antwortet er. »Zehn Riesen. Plus Zinsen. Und da er nicht bar zahlen kann, hat er angeboten, stattdessen mit seinem Haus zu löhnen.«
Ich schüttle den Kopf. Meine Muskeln spannen sich an, und ich höre meinen Herzschlag in den Ohren, der nun, wo Zorn in mir aufsteigt, zusätzlich rast. Echt jetzt, Jamie? »Nein, das kann er nicht«, sage ich lauter als beabsichtigt.
»Hat er aber schon.«
»Du verstehst das nicht«, fahre ich fort, »es gehört auch mir. Du kannst es dir nicht nehmen.«
Ryder gibt einen tadelnden Laut von sich und legt die Hände auf meine Oberarme. »Ich nehme mir, was immer ich will, Tiger-Lady.«
»Ist das eine Drohung?«
Er neigt mir das Gesicht zu. »Es ist ein Versprechen.« Sein Mund ist mir so nah, dass er mich beißen oder küssen könnte.
Ohne mich freizugeben, lehnt er sich ein Stück zurück und lässt den Blick über meinen gesamten Körper wandern. »Weißt du«, meint er, »so angezogen solltest du nicht schlafen. Da könnte man glatt auf falsche Gedanken kommen.«
»Das wird dich jetzt vielleicht überraschen, aber wenn normalerweise jemand vorbeikommt, kündigt sich derjenige an, damit ich mich zuerst anziehen kann.«
»Was, wenn mitten in der Nacht ein Feuer ausbricht?«, gibt er zu bedenken.
»Ich würde sagen, dann bekommen die Feuerwehrleute eine gute Show geboten.«
Er zieht die Augenbrauen hoch. »Dürfte ihnen schwerfallen, sich darauf zu konzentrieren, dich zu retten.«
Ich sehe ihm fest in die Augen. »Ich kann mich selber retten.«
»Ich wette, das kannst du«, pflichtet er mir bei. »Da ich nur davon ausgehen kann, dass du das gesamte Hirn in der Familie geerbt hast: Wenn du deinem Bruder erzählst, dass ich vorbeigekommen bin, um mir mein Geld zu holen – und ich bekomme mein Geld immer–, dann achte darauf, langsam zu reden, damit er dich versteht.« Er stößt sich von mir ab.
»Willst du schon gehen?«, frage ich sarkastisch. »Aber wir sind doch gerade dabei, uns kennenzulernen.« Ich verschränke die Arme vor der Brust und starre ihn finster an. Klar, gegenüber diesem Kerl lasse ich die Taffe raushängen, kontere jeden Haken, den er bei diesem albernen verbalen Schlagabtausch austeilt, doch in Wirklichkeit sieht es so aus: Ganz gleich, was er glaubt, tun zu können, ich werde dieses Haus niemals aufgeben. Koste es, was es wolle.
»Es ist spät«, meint er schließlich, geht zum Bett, streicht die Laken glatt und zieht sie dann zur Seite, als erwarte er von mir hineinzukriechen. »Ich will dich nicht auslaugen.«
Immer noch mit verschränkten Armen lege ich den Kopf schief. »Das könntest du gar nicht, selbst wenn du’s versuchst«, halte ich dagegen, um sicherzustellen, dass er keine Sekunde lang denkt, er hätte die Oberhand.
»Ist das eine Drohung?«, fragt Ryder.
Ich setze mich auf die Bettkante, schlage die Beine in seine Richtung übereinander, lehne mich zurück und stütze mich auf die Hände, als wäre ich völlig entspannt. »Es ist ein Versprechen.« Ich lege in meine Worte, was ich an Einschüchterung und Bedrohlichkeit zusammenkratzen kann, aber er zeigt sich davon unbeeindruckt.
Er kommt näher, beugt sich mir zu und legt die Hände zu beiden Seiten an meine Hüften. »Versprich mir noch etwas«, fordert er mich auf. Seine Lippen streifen beinah mein Ohr. Die Nähe wirkt aufreizend, als würde er mich gleich küssen. »Wenn du das nächste Mal versuchst, mich zu ersticken, dann benutz kein Kissen, sondern deine Schenkel. Das wäre für uns beide eine wesentlich angenehmere Erfahrung.«
Damit geht er, und ich stoße den Atem aus. Mir war nicht einmal bewusst, dass ich ihn angehalten habe.
Schäumend vor Wut lasse ich mich aufs Bett fallen und lausche auf das Verstummen von Ryders Schritten oder das Schließen einer Tür – falls er überhaupt durch eine Tür hereingekommen ist. Ich habe zwar darauf geachtet, alles abzusperren, bevor ich zu Bett gegangen bin, aber etwas sagt mir, dass sich dieser Mann von einem Schloss nicht abschrecken lässt. Er kommt mir eher wie jemand vor, der immer einen Weg findet, wenn er will.
Ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich weiß nicht, wo zum Geier sich Jamie versteckt. Und ich weiß nicht, wieso um alles in der Welt er sich Tausende Dollar von einem heißen Schlägertyp in einem teuren Anzug pumpt.
Verdammt noch mal, Jamie.
Einem heißen Schlägertyp in einem teuren Anzug mitbreiten sexy Schultern, großen, starken Händen und der vollkommensten Kieferpartie, die ich je gesehen habe.
Das sind die Dinge, die ich weiß.
Willkommen daheim, Cassie.
KAPITEL 4CASSIE
Im Heimwerkermarkt, einer Filiale von Home Depot, stehen gefühlte tausend Türen zur Auswahl, also dürfte ich höchstens ungefähr ein Jahr brauchen, um einen Ersatz für die Tür zu finden, die Ryder und seine Handlanger letzte Nacht eingetreten haben. Wenigstens ist der Verkäufer in dieser Abteilung irgendwie süß. Man freut sich ja schon über Kleinigkeiten.
Das Durchsehen all dieser modernen Türen ist ein wenig so, als versuche man, am Strand das schönste Sandkorn zu finden. Aber unser Haus ist dreißig Jahre alt, also könnte man zumindest positiv sehen, dass ich es mit der neuen Tür ein wenig aufmotzen werde. Unsere Mutter hat das Haus Jamie und mir vor ungefähr vier Jahren überschrieben, ein paar Jahre, nachdem unser Vater an einem Herzinfarkt gestorben war. Sie hatten das Haus kurz nach ihrer Hochzeit gekauft, unmittelbar nachdem es gebaut worden war. Unsere Eltern waren die Ersten, die je darin gewohnt haben, und ich glaube, ohne Pa hat Ma den Ort oder sich selbst darin nicht richtig wiedererkannt.
Sie ist bei Jamie geblieben, bis er die Highschool abgeschlossen hatte. Im Sommer, bevor er mit dem College anfing – demselben Sommer, in dem ich mit dem College fertig wurde –, hat sich Ma nach Florida versetzen lassen und dort von vorn angefangen. Letztes Jahr hat sie einen Mann namens Bill geheiratet. Sie haben sich ein Häuschen in Fußnähe zum Atlantik gekauft, und wenn ich heute mit ihr telefoniere, klingt sie wieder ziemlich glücklich. Ich wünschte, ich hätte für die Hochzeit nach Hause fliegen können, aber es war nie einfach, aus England wegzukommen.
Nicht mal gestern, als ich das Land für immer verlassen habe.
Der süße Verkäufer, der laut seinem Namensschild Danny heißt, hat dunkle, zu einem Fake-Iro gestylte Haare. Über einem weißen T-Shirt mit V-Ausschnitt spannt sich die übliche orangefarbene Schürze von Home Depot über seine breite Brust. »Suchen Sie nach etwas, das besonders gut hängt?«, fragt er mich.
Tut das nicht jede Frau? Ich widerstehe dem Drang, es auszusprechen, zucke stattdessen mit den Schultern und lächle. »Ich habe irgendwie gehofft, da könnten Sie mich beraten.«
Danny erklärt mir den Unterschied zwischen herkömmlichen und vormontierten Türen, und wir gelangen zu dem Schluss, dass ich Letzteres brauche, da die Angeln der alten Tür im Eimer sind – wenngleich ich Danny nicht erkläre, wie es dazu gekommen ist. Ich bin noch keine vierundzwanzig Stunden in der Stadt, und schon belüge ich jemanden, um Jamie zu decken.
Manche Dinge ändern sich nie.
Danny führt mich zu den vormontierten Türen, und ich sehe mir die schier endlosen Möglichkeiten durch. Es ist irgendwie komisch, Türen so aus dem Kontext gerissen zu sehen, in einem Umfeld, in dem sie nirgendwohin führen. Und gleichzeitig zu wissen, dass letztlich jede davon gekauft und benutzt wird. Diese könnte zur Eingangstür von jemandes Elternhaus werden, und derjenige würde sich für immer an sie erinnern. Und jene wird vielleicht zur Hintertür, die immer quietscht, wenn man sich nachts hinauszuschleichen versucht. Schon eigenartig, wie die Dinge von belanglos oder unbekannt zu bedeutend werden können – mit nur einem Kauf, einer Entscheidung, einer Begegnung in einer Nacht mit dem einen richtigen Menschen. Oder dem Falschen.
Was soll ich sagen? Home Depot kehrt meine existentialistische Seite in mir hervor.
Außerdem werde ich leicht philosophisch, wenn ich müde bin, und ich habe immer noch Jetlag. Doch obwohl die Zeitzone von Atlanta ungefähr einen halben Schlafzyklus hinter London ist und ich von dem Reisetag mehr als geschlaucht bin, konnte ich in der Nacht nicht mehr einschlafen, nachdem Ryder gegangen war. Zuerst habe ich überlegt, die Polizei zu rufen und Anzeige wegen Einbruchs und Belästigung zu erstatten. Ja, Officer, er war ungefähr eins achtundachtzig mit hundert Kilo reiner Muskelmasse und einem verführerischen Lächeln. Aber dann kam mir der Gedanke, dass ich vielleicht zuerst mit Jamie reden und Einzelheiten aus ihm herauskitzeln sollte, um genauer in Erfahrung zu bringen, mit wem er es da zu tun hat.
Mit wem wir es da zu tun haben, sollte ich wohl eher sagen. Denn mit Schwierigkeiten ist das so eine Sache: Man kann locker ganz für sich reinstolpern, wieder rauszukommen klappt allerdings nur selten im Alleingang. Ich schätze, dafür sind große Schwestern da.
Nur dürfte es schwierig werden, Jamie weiter zu beschützen, solange ich keine Ahnung habe, wo er steckt. Gestern nach Hause zu kommen, war zwar ein gewissermaßen übereilter Schritt von mir, aber kaum hatte ich das Flugticket gekauft, habe ich Jamie eine E-Mail geschickt, um ihn wissen zu lassen, dass ich auf dem Weg zurück in die USA war. Und zu meiner großen Überraschung schrieb er mir tatsächlich zurück und meinte: Cool! Ich habe eigentlich nicht erwartet, dass er mich am Flughafen abholen würde oder so – ich meine, wir reden hier von jemandem, dessen Lösung bei überfälligen Leihvideos früher darin bestanden hat, darauf zu warten, dass der Filmverleih pleiteging. Trotzdem dachte ich, er würde zumindest zu Hause sein oder zum Abendessen kommen – wenigstens irgendwas. Immerhin haben wir uns seit zwei Jahren nicht mehr gesehen – seit ich nach England gezogen bin nicht mehr.
Aber ich schätze, nach meiner Begegnung mit Ryder dürfte klar sein, warum Jamie darauf verzichtet hat, eine Begrüßungsparty für mich zu schmeißen. Seit heute Morgen habe ich ihn ungefähr ein Dutzend Mal angerufen. Ich lande jedes Mal in der Mailbox: Yo, hier Jamie, was geht? Meld mich später. Vor ungefähr sechs Anrufen habe ich aufgehört, Nachrichten zu hinterlassen. Bei den letzten Malen habe ich sogar angefangen, Dinge zu sagen wie: Hier ist deine Schwester, Cassie McEntire. Vielleicht erinnerst du dich an mich, wir sind zusammen aufgewachsen. Wir haben früher im selben Flur gewohnt.
Nur für den Fall, dass er meine Stimme bei dem Teil der Nachricht nicht erkennt, die da lautet: Ruf mich an, denn falls dich die Kerle, denen du Geld schuldest, vor mir finden, kannst du vielleicht nicht mehr laufen, wenn ich dich das nächste Mal sehe.
Ich entscheide mich für eine Tür – weiß, makellos und, am wichtigsten, robust. Aber etwas fehlt daran.
»Können Sie darin ein Bolzenschloss einbauen?«, frage ich Danny.
Tritt jemand meine Tür einmal ein, soll er sich was schämen. Passiert es zweimal, muss ich mich schämen.
Und ich habe genug davon, mich schämen zu müssen.
***
»Cass?«
Als ich Jamies Stimme höre, lasse ich beinah mein neues Mobiltelefon – Merke: Handy, nicht Mobiltelefon. Du bist nicht mehr in England, Cass – in die Waschmaschine fallen. Seine Stimme klingt zugleich vertraut und fremd. Wie ein Geist, der durch ein Haus spukt, den man aber nie wirklich gesehen hat. Nachdem die Leute von Home Depot am Nachmittag die neue Tür installiert hatten, bin ich mit dem zehn Jahre alten Hyundai, den Ma zurückgelassen hat, zum Apple Store, zum Supermarkt und zu Target gefahren, wo ich mir Flipflops gekauft habe, die ersten in zwei Jahren, weil mir vage im Hinterkopf die Idee herumspukt, diesen Sommer zum Laniersee zu fahren. Ich war so mit den Besorgungen beschäftigt, dass ich gar nicht an meinen Bruder gedacht habe.
Und natürlich ruft Jamie ausgerechnet in dem Moment an. Wenn ich am wenigsten damit rechne. Wenn ich am wenigsten darauf vorbereitet bin.
Den ganzen Tag lang habe ich mir den Vortrag der großen Schwester ausgemalt, den ich ihm halten wollte, wenn ich endlich mit ihm reden könnte. Darüber, wie gefährlich das Spiel ist, auf das er sich mit Ryder eingelassen hat. Über die kaputte Tür. Über Verantwortung. Darüber, ob Ma Bescheid weiß, und darüber, was Pa davon halten würde.
Aber alles, was ich nun herausbringe, ist: »Wo zum Teufel steckst du?«
»Mach dich locker, Schwesterherz«, antwortet er. Typisch Jamie. Seine Lebensphilosophie war schon immer: Sich Sorgen zu machen ist grundsätzlich eine Überreaktion. Es gibt keine Situation, in der er Besorgnis für gerechtfertigt hält. Als wir Teenager waren, dachte ich, er sei vielleicht mutiger als ich. Während meiner Highschool-Zeit habe ich hin und wieder über die Stränge geschlagen, habe mich ein-, zweimal mit meiner Freundin Savannah raus und lange nach dem Zapfenstreich wieder nach Hause geschlichen. Doch insgesamt habe ich nie besonders gegen die Regeln verstoßen. Ich meine, ich habe einen Abschluss in Buchhaltung, um Himmels willen – ich steh gewissermaßen drauf, mich an die Regeln zu halten.
Aber ganz gleich, wie hoch das Risiko war oder wie oft Jamie erwischt wurde, wenn er diesen Joint rauchen oder von jenem Dach springen oder jenes Auto kurzschließen wollte – das er doch ohnehin wieder zurückbringen wollte, ganz ehrlich, wozu also der große Aufstand? –, dann tat er es in Gottes Namen einfach.
Heute, mit sechsundzwanzig, ist mir klar: Was ich früher für seinen Mut gehalten habe, war in Wirklichkeit nur eine Mischung von dreister Dummheit und fast schon Zwanghaftigkeit, die Geduld meiner Eltern bis zur Belastungsgrenze auszureizen.
Und heute macht er dasselbe mit meiner Geduld.
»Dein Freund Ryder hat mir erzählt, dass du Geldprobleme hast«, sage ich.
»Bin schon dabei, das zu klären«, behauptet Jamie. »Alles gut. Ich habe einen Plan.«
»Einen anderen, als das Haus wegzugeben?«
Schweigen.
»Hör mal, Cassie, ich weiß schon, dass du in letzter Zeit mit dem Umzug und so bestimmt viel um die Ohren gehabt hast, und mir tut’s echt leid, dass du in die Sache mit reingezogen worden bist, klar?«, sagt er. »Aber du musst dich da raushalten.«
»Nein. Du musst mir sagen, was los ist, Jamie. Ich verdiene es, das zu wissen. Denn wenn wir dein Mitgefühl mal beiseitelassen: Ich stecke jetzt mit drin.«
»Wenn ich dir was sage, dann macht dich das …« Er verstummt. »Wie heißt noch das Wort, nach dem ich suche?«
»Mitverantwortlich?« Kein Wunder, dass er darauf nicht kommt – alles, was mit Verantwortung zu tun hat, ist nicht gerade seine Stärke.
»Ja. Schätze schon«, meint er. »Wie eine Komplizin oder so ähnlich.«