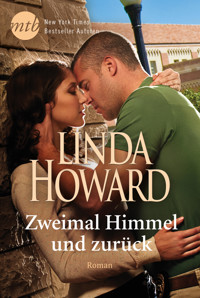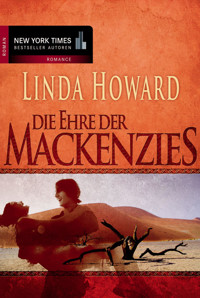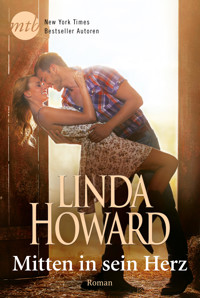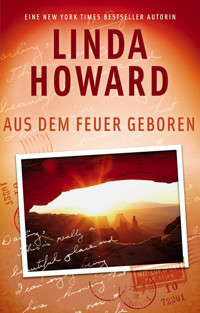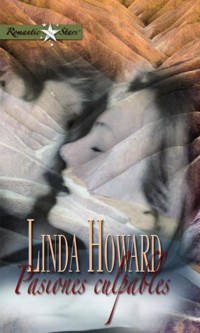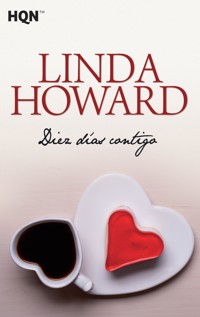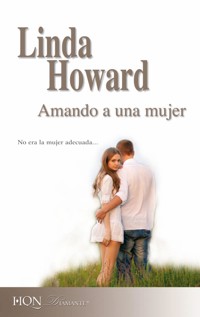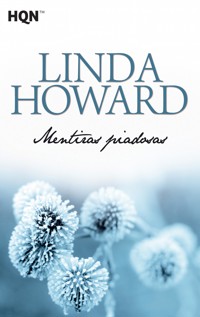5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romance trifft Spannung - Die besten Romane von Linda Howard bei beHEARTBEAT
- Sprache: Deutsch
Er ist der einzige, der sie beschützen kann ...
Daisy Minor hat ihr eintöniges Leben als unscheinbare Bibliothekarin satt. An ihrem vierungsdreißigsten Geburtstag beschließt sie, endlich bei ihrer Mutter auszuziehen und ihr Leben von nun an in vollen Zügen zu genießen. Als sie daraufhin nach einem Clubbesuch eines Abends noch spät unterwegs ist, wird sie Zeugin eines Verbrechens. Und plötzlich schwebt Daisy selbst in großer Gefahr - denn der Täter hat es nun auf sie abgesehen. Der einzige, der sie jetzt noch beschützen kann, ist der charismatische Polizeichef Jack Russo. Der fühlt sich sofort zu der jungen Frau hingezogen. Aber kann er verhindern, dass Daisy etwas Schreckliches zustößt?
Jetzt erstmals als eBook. Weitere Titel von Linda Howard bei beHEARTBEAT u. a. "Mordgeflüster", "Heiße Spur", "Ein tödlicher Verehrer".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin:
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Epilog
Danksagung
Weitere Titel der Autorin:
Die Doppelgängerin
Mordgeflüster
Heiße Spur
Mitternachtsmorde
Ein gefährlicher Liebhaber
Ein tödlicher Verehrer
Über dieses Buch
Daisy Minor hat ihr eintöniges Leben als unscheinbare Bibliothekarin satt. An ihrem vierungsdreißigsten Geburtstag beschließt sie, endlich bei ihrer Mutter auszuziehen und ihr Leben von nun an in vollen Zügen zu genießen. Als sie daraufhin nach einem Clubbesuch eines Abends noch spät unterwegs ist, wird sie Zeugin eines Verbrechens. Und plötzlich schwebt Daisy selbst in großer Gefahr – denn der Täter hat es nun auf sie abgesehen. Der einzige, der sie jetzt noch beschützen kann, ist der charismatische Polizeichef Jack Russo. Der fühlt sich sofort zu der jungen Frau hingezogen. Aber kann er verhindern, dass Daisy etwas Schreckliches zustößt?
Über die Autorin
Linda Howard gehört zu den erfolgreichsten Liebesromanautorinnen weltweit. Sie hat über 25 Romane geschrieben, die sich inzwischen millionenfach verkauft haben. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Sie wohnt mit ihrem Mann und fünf Kindern in Alabama.
Linda Howard
Auch Engel mögen’s heiß
Aus dem Amerikanischen von Christoph Göhler
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2001 by Linda Howington
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Open Season«
Originalverlag: Pocket Books, New York
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a Division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 2003 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Verlag: Wilhelm Goldmann Verlag, München
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © choness/gettyimages; BlueSkyImage/shutterstock
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-6978-6
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Carmela umklammerte nervös ihre Jutetasche, in der sie ihr Kleid zum Wechseln, etwas Wasser und das kleine Lebensmittelpäckchen aufbewahrte, das sie sich für die Reise nach Norden, über die Grenze, zusammengespart hatte. Orlando hatte ihr eingeschärft, dass sie bis zu ihrer Ankunft in Los Angeles nicht anhalten könnten, weder zum Essen noch zum Trinken oder überhaupt. Sie hockte eingesperrt im Laderaum eines klapprigen Lasters, der so schaukelte und schwankte, dass sie hin- und her geschleudert wurde, wenn sie auch nur eine Sekunde vergaß, sich in ihre Ecke zu pressen und ihre Beine halb gegrätscht in den Boden zu stemmen, wodurch allerdings jede Aussicht auf Schlaf zunichte gemacht wurde, weil sie, sobald sie ihre Muskeln auch nur ein bisschen entspannte, über die ungehobelte Holzpritsche des Laderaums purzelte.
Carmela war vor Angst wie gelähmt, aber dennoch zu allem entschlossen. Als Enrique vor zwei Jahren weggegangen war, hatte er ihr versprochen, sie nachkommen zu lassen. Stattdessen hatte er eine Amerikanerin geheiratet, nur damit er nie wieder abgeschoben werden könnte, während Carmela allein zurückgeblieben war, mit zertrampelten Träumen und einem in Fetzen gerissenen Stolz. In Mexiko hielt sie nichts mehr; wenn Enrique in Amerika heiraten konnte, konnte sie das auch! Und sie würde sich einen reichen Amerikaner angeln! Schließlich war sie bildhübsch; das sagten alle. Wenn sie dann erst mit ihrem reichen Norteamericano verheiratet war, würde sie Enrique aufspüren und ihm eine lange Nase machen, bis er zutiefst bereute, dass er sie so belogen und betrogen hatte.
Sie hatte große Träume, doch im Moment fühlte sie sich winzig klein, so durchgerüttelt auf der Ladefläche eines Lasters, der über eine Schlaglochpiste dahindonnerte. Sie hörte Metall krachen, als Orlando den Gang wechselte, und gleich darauf einen leisen Schmerzensschrei, als eines der anderen Mädchen gegen die Seitenverkleidung knallte. Außer ihr waren es noch drei Mädchen, alle so jung wie sie, alle voller Hoffnung auf ein besseres Leben als jenes, das sie in Mexiko zurückgelassen hatten. Sie hatten sich nicht miteinander bekannt gemacht, eigentlich hatten sie kaum ein Wort gewechselt. Alle vier malten sich heimlich die Gefahren aus, die ihnen drohten, und waren traurig und aufgekratzt zugleich: traurig, weil sie so viel zurückgelassen hatten, und aufgekratzt, weil ein besseres Leben auf sie wartete. Alles war besser als nichts, und im Moment hatte Carmela überhaupt nichts.
Sie dachte an ihre Mutter, die vor sieben Monaten gestorben war, dahingerafft von lebenslanger mühseliger Arbeit und zu vielen Kindern. »Lass Enrique bloß nicht zwischen deine Beine«, hatte ihre Mutter immer wieder gepredigt. »Nicht bevor du seine Frau bist. Sonst heiratet er dich nicht mehr, und dann sitzt du mit deinem Baby da, während er sich ein anderes hübsches Mädel sucht.« Tja, sie hatte Enrique nicht zwischen ihre Beine gelassen, und er hatte sich trotzdem ein anderes Mädchen gesucht. Wenigstens war sie nicht mit einem Kind sitzen geblieben.
Trotzdem hatte sie verstanden, was ihre Mutter gemeint hatte: Werde nicht so wie ich. Ihre Mutter hatte sich für Carmela etwas Besseres gewünscht, als ihr selbst vergönnt gewesen war. Carmela sollte nicht wie sie vorzeitig altern und ständig ein Baby auf dem Arm und ein zweites im Bauch herumschleppen müssen, bis sie schließlich mit noch nicht einmal vierzig Jahren starb.
Carmela war siebzehn. Mit siebzehn hatte ihre Mutter bereits zwei Kinder gehabt. Enrique hatte nie begriffen, warum Carmela so großen Wert darauf legte, unberührt zu bleiben; auf ihre beharrliche Weigerung, mit ihm ins Bett zu gehen, hatte er abwechselnd grimmig und mürrisch reagiert. Vielleicht war die Frau, die er in Amerika geheiratet hatte, ja zu mehr bereit gewesen. Wenn er nur darauf aus gewesen war, hatte er sie sowieso nie wirklich geliebt, grollte Carmela. Sollte er doch zur Hölle fahren! Sie würde sich nicht das Leben versauen, indem sie einem ... Vollidioten nachtrauerte!
Sie versuchte, sich bei Laune zu halten, indem sie sich immer wieder vorsagte, dass in Amerika alles besser werden würde; alle meinten, dass es in Los Angeles mehr Jobs als Menschen gäbe, dass dort jeder ein eigenes Auto und einen Fernseher besäße. Vielleicht würde sie sogar beim Film landen und berühmt werden. Alle sagten, dass sie hübsch war, also war das durchaus möglich. Tatsache war jedoch, dass sie erst siebzehn und allein war und schreckliche Angst hatte.
Eines der anderen Mädchen murmelte irgendetwas, wobei die Worte vom Dröhnen des Motors übertönt wurden, nicht aber das Drängen in ihrer Stimme. In diesem Augenblick begriff Carmela, dass die drei Mädchen genauso verängstigt waren wie sie. Sie war also nicht ganz allein; den Übrigen ging es nicht anders als ihr. Das war zwar keine große Hilfe, aber Carmela fühlte sich sofort mutiger.
Sich mit einer Hand an der Verkleidung festhaltend, weil der Laster in diesem Moment von einer Spurrille zur nächsten schaukelte, schlitterte sie über das ungeschliffene Holz der Ladefläche, bis sie nahe genug war, um die Worte des Mädchens zu verstehen. Inzwischen war es Tag, und durch die Ritzen im Aufbau fiel so viel Licht, dass Carmela die Gesichter der Mädchen erkennen konnte. »Was ist denn?«, fragte sie.
Das Mädchen rang die Hände in dem verwaschenen Stoff ihres Rockes. »Ich muss mal«, flüsterte sie mit vor Scham bebender Stimme.
»Das müssen wir alle«, antwortete Carmela mitfühlend. Auch ihre Blase war so voll, dass es schon wehtat. Sie hatte das Gefühl nach Kräften ignoriert, weil sie so lange wie möglich hinauszögern wollte, wozu sie irgendwann gezwungen sein würden.
Dem Mädchen rollten Tränen über die Wangen. »Ich muss aber jetzt.«
Carmela drehte sich Hilfe suchend um, doch die beiden anderen wirkten genauso ratlos wie das weinende Mädchen. »Dann bringen wir es eben hinter uns«, beschloss sie, weil sie die Einzige zu sein schien, die fähig war, einen solchen Entschluss zu fassen. »Erst mal suchen wir uns eine Stelle aus ... dort.« Sie deutete auf die Ecke rechts hinten. »Da ist ein Spalt, durch den es ablaufen kann. Wir machen alle dorthin.«
Das Mädchen wischte sich die Tränen vom Gesicht. »Und wenn wir groß müssen?«
»Ich hoffe, dass wir vorher ankommen.« Jetzt, wo die Sonne aufgegangen war, stieg die Temperatur im Laster spürbar an. Es war Hochsommer; falls Orlando nicht anhielt und sie hinausließ, würde die Hitze sie irgendwann umbringen. Er hatte ihnen erklärt, dass sie nicht anhalten würden, bis sie ihr Ziel erreicht hätten, folglich mussten sie bald in Los Angeles ankommen. Sie hatte Orlando nur die Hälfte des üblichen Soldes gezahlt; wenn siestereben würde, müsste er die andere Hälfte abschreiben. Normalerweise musste der volle Preis entrichtet werden, bevor der Coyote jemanden über die Grenze schmuggelte, aber weil sie so hübsch sei, hatte Orlando gesagt, würde er bei ihr eine Ausnahme machen.
Die anderen Mädchen sahen genauso gut aus, begriff sie. Womöglich hatte er bei allen eine Ausnahme gemacht.
Weil der Wagen so schaukelte, brauchten sie ihre vereinten Kräfte, um sich zu erleichtern. Carmela organisierte das Unternehmen. Der Reihe nach, sie selbst als Letzte, gingen sie in der betreffenden Ecke in die Hocke, während sich die anderen Mädchen gegen die Verkleidung des Laderaumes stemmten, um der Vierten Halt zu geben. Endlich sanken sie erschöpft, aber spürbar erleichtert auf der Ladefläche nieder und ruhten sich aus.
Plötzlich, nach einem letzten heftigen Schlag, rollte der Laster ganz ruhig. Sie befanden sich auf einem Highway, erkannte Carmela. Einem Highway! Bestimmt wären sie bald in Los Angeles.
Doch die Vormittagsstunden schleppten sich dahin, während die Hitze im Wagen immer unerträglicher wurde. Carmela gab sich Mühe, möglichst flach zu atmen, doch die anderen Mädchen hechelten, als könnten sie sich abkühlen, indem sie besonders viel Luft in ihre Lungen pumpten. Da diese Luft heiß war, erschien das nicht besonders logisch. Wenigstens würden sie, so wie sie schwitzten, nicht so bald wieder auf die Toilette müssen.
Carmela wartete, so lange sie konnte, weil sie keine Ahnung hatte, wie weit sie noch fahren würden, doch schließlich hielt sie den Durst nicht mehr aus und zog die kleine Wasserflasche aus ihrer Leinentasche. »Ich habe noch Wasser«, sagte sie. »Es ist nicht viel, wir müssen gerecht teilen.« Sie sah allen nacheinander in die Augen. »Wenn eine von euch mehr als einen Schluck nimmt, bevor sie die Flasche weitergibt, kriegt sie eine geknallt. Also nur einen kleinen Schluck.«
Unter ihrem grimmigen, finsteren Blick nahm jedes der Mädchen gehorsam einen kleinen Schluck und reichte anschließend die Flasche weiter. Irgendwie hatte Carmela dadurch, dass sie das Austreten organisiert hatte, die Rolle der Anführerin übernommen, und obwohl sie nicht besonders groß war, respektierten die anderen sie aufgrund ihrer Willenskraft. Als die Flasche bei ihr ankam, nahm Carmela ebenfalls einen kleinen Schluck und ließ sie anschließend noch einmal kreisen. Nachdem alle zwei Schluck genommen hatten, verschloss Carmela die Flasche wieder und stopfte sie zurück in ihre Tasche. »Ich weiß, dass es nicht viel ist«, sagte sie. »Aber ich habe kaum noch Wasser, und wir müssen eventuell noch länger damit auskommen.«
Der Vorrat reichte höchstens noch für zwei Schluck pro Mädchen. Das war nicht viel, vor allem wenn sie jede Stunde durchs Schwitzen wesentlich mehr Wasser verloren. Vielleicht reichte es ja aus, um ihnen das Leben zu retten. Warum hatte eigentlich keines der anderen Mädchen daran gedacht, etwas zu essen oder zu trinken mitzunehmen, überlegte sie wütend und kämpfte dann ihren Ärger nieder. Womöglich hatten sie einfach nichts, was sie mitnehmen konnten. So arm Carmela auch war, es hatte stets Menschen gegeben, die noch weniger besaßen als sie. Sie musste freundlich bleiben, in ihren Taten und in ihren Gedanken.
Der Laster wurde langsamer, wie am Motorengeräusch zu erkennen war. Mit hoffnungsvoll leuchtenden Augen sahen sie sich an.
Wenig später bog der Wagen vom Highway ab und hielt an. Der Motor wurde zwar nicht abgestellt, doch sie hörten, wie Orlando ausstieg und die Tür zuknallte. Schnell schnappte Carmela ihre Tasche und stand auf; da er gesagt hatte, sie würden auf gar keinen Fall anhalten, bevor sie Los Angeles erreicht hätten, mussten sie wohl am Ziel sein. Allerdings hatte sie sich die Stadt lauter vorgestellt; im Moment hörte sie nichts als das Grollen des Lastwagenmotors.
Eine Kette rasselte, gleich darauf wurde das Rolltor des Lastwagens in den Schienen nach oben geschoben, und dann wurden sie von grellem Sonnenlicht geblendet, während ihnen ein Schwall heißer und gleichzeitig erfrischender Luft entgegenschlug. Orlando war nur ein schwarzer Schatten, der sich vor dem grellen Weiß abzeichnete. Die Augen abschirmend, stolperten die Mädchen nach hinten zur Ladeklappe und kletterten unbeholfen hinunter.
Nachdem Carmelas Augen sich an die Sonne gewöhnt hatten, schaute sie sich um, weil sie erwartete ... Sie wusste nicht genau, was sie erwartet hatte, aber zumindest eine große Stadt. Hier jedoch gab es nichts als den Himmel und die Sonne und überall Gestrüpp und vom Wind zusammengetragene sandiggraue Erdverwehungen. Mit fragend aufgerissenen Augen sah sie Orlando an.
»Weiter kann ich euch nicht bringen«, war seine Antwort. »Im Laster wird es zu heiß; ihr würdet darin krepieren. Mein Freund bringt euch an euer Ziel. Sein Wagen hat eine Klimaanlage.«
Eine Klimaanlage! Zwar hatten in Carmelas kleinem Dorf einige Auserwählte ein Automobil gefahren, aber eine Klimaanlage hatte keiner von ihnen besessen. Der alte Vasquez hatte ihr voller Stolz die Hebel auf dem Armaturenbrett vorgeführt, über die einst kalte Luft aus den Lüftungsschlitzen gekommen war, aber die Anlage hatte schon längst den Geist aufgegeben, sodass Carmela nie wirklich Luft aus einer Klimaanlage gespürt hatte. Immerhin wusste sie, dass es so etwas gab. Und jetzt würde sie in einem Auto mit Klimaanlage fahren! Der alte Vasquez würde vor Neid platzen, wenn er das wüsste.
Ein großer, schlanker Mann in Jeans und einem karierten Hemd kam hinter dem Laster hervor und auf sie zu. Er trug vier Flaschen Wasser im Arm, die er an die Mädchen verteilte. Das Wasser war so kalt, dass die Flaschen mit Kondenströpfchen überzogen waren. Die Mädchen tranken das Wasser in großen Schlucken, während der Mann sich mit Orlando auf Englisch unterhielt, das keines der vier Mädchen sprach.
»Das ist Mitchell«, stellte Orlando ihn schließlich vor. »Ihr tut einfach, was er euch sagt. Er spricht genug Spanisch, dass ihr verstehen könnt, was er von euch will. Wenn ihr nicht gehorcht, findet euch die amerikanische Polizei und steckt euch ins Gefängnis, und dann kommt ihr nie wieder raus. Habt ihr verstanden?«
Alle nickten ernst. Dann wurden sie flugs in den Camper-Aufsatz auf Mitchells großem blauem Pick-up verladen. Auf der Wagenpritsche lagen zwei zerknüllte Schlafsäcke, außerdem gab es einen kleinen Hocker mit einem Loch, der sich bei näherem Hinsehen als Toilette herausstellte. Zum Stehen war der Camper-Aufsatz zu niedrig; sie konnten nur liegen oder sitzen, aber nach der schlaflos verbrachten Nacht war ihnen das egal. Kühle Luft und Musik, eine ungemein beruhigend wirkende Kombination, strömten durch das geöffnete Heckfenster der Fahrerkabine in den Aufsatz. Kaum hatten sie die beiden Schlafsäcke ausgebreitet, sodass sich alle hinlegen konnten, waren die vier Mädchen eingeschlafen.
Sie hätte nicht gedacht, dass es so irrsinnig weit nach Los Angeles sein würde, dachte Carmela zwei Tage später. Sie hielt es kaum mehr in dem Camper-Aufsatz aus, wo sie sich praktisch nicht bewegen und nicht aufstehen konnte. Sie dehnte ihre Muskeln, um sie so geschmeidig wie möglich zu halten, aber eigentlich wollte sie nur noch laufen. Sie war von klein auf ein lebhaftes Mädchen gewesen, und die Enge, selbst wenn sie unvermeidlich war, trieb sie zum Wahnsinn.
Sie bekamen regelmäßig zu essen und Wasser zu trinken. Waschen hatten sie sich hingegen nicht können, weshalb alle ekelhaft rochen. Hin und wieder machte Mitchell auf einem verlassenen Parkplatz Rast und klappte die Heckklappe des Campers hoch, um die verbrauchte Luft hinauszulassen, doch blieb die Luft dauernd muffig, und das Gefühl von Frische hielt nie lang vor.
Bei ihren heimlichen Blicken durch das Heckfenster des Pick-ups hatte Carmela verfolgt, wie die menschenleere Wüste allmählich in flaches Weideland überging. Dann waren immer öfter Waldgebiete aufgetaucht, und heute, während des letzten Tages, waren sie durch Bergland gefahren: üppig, grün, sanft gewellt. Es gab Weiden, auf denen Rinder grasten, malerische Täler und dunkelgrüne Flüsse. Die Luft schmeckte fett und feucht und roch nach tausend verschiedenen Bäumen und Blumen. Und Autos! Es gab hier mehr Autos, als sie in ihrem ganzen bisherigen Leben gesehen hatte. Sie waren durch eine Stadt gefahren, die ihr riesengroß vorgekommen war, doch als sie Mitchell gefragt hatte, ob das Los Angeles sei, hatte er erwidert, nein, dies sei Memphis. Sie seien noch weit von Los Angeles entfernt.
Amerika war wirklich unglaublich groß, dachte Carmela, wenn sie nach ihrer tagelangen Fahrt nach wie vor Los Angeles noch nicht erreicht hatten!
Am späten Abend des zweiten Tages hielten sie endlich an. Als Mitchell die Heckklappe des Campers öffnete und sie ins Freie ließ, konnten sie sich kaum auf den Beinen halten, so lange hatten sie in der Enge gekauert. Er hatte direkt vor einem überlangen Wohnwagen angehalten; Carmela drehte sich um und hielt nach etwas Ausschau, das auf die Nähe einer Großstadt hindeuten würde, doch sie schienen weit weg von jeder Siedlung entfernt zu sein. Über ihnen funkelten die Sterne, und die Nachtluft vibrierte vom Zirpen der Insekten und den Rufen der Vögel. Mitchell sperrte die Tür des Wohnwagens auf und ließ die vier Mädchen eintreten, die beim Anblick der luxuriösen Ausstattung allesamt leise aufseufzten. Es gab Polstermöbel, eine atemberaubende Küche mit rätselhaften, noch nie gesehenen Gerätschaften, und ein Bad, wie sie es in ihren kühnsten Träumen nicht erwartet hätten. Mitchell sagte, dass sie alle baden sollten, und überreichte jeder von ihnen ein lockeres Gewand aus dünnem Stoff, das über den Kopf gezogen wurde. Es würde ihnen gehören, erklärte er dazu.
Sie waren fassungslos über so viel Freundlichkeit und außer sich vor Freude über die neuen Kleider. Carmela strich mit der Hand über den Stoff, der sich glatt und leicht anfühlte. Ihr Kleid war einfach wunderschön: weiß und überall mit kleinen roten Blumen bedruckt.
Sie badeten nacheinander in warmem Wasser, das aus der Wand spritzte, und wuschen sich mit Seife, die nach Parfüm roch. Für die Haare gab es eine besondere Seife, eine flüssige Seife, die zu einem Schaumgebirge aufquoll. Und es gab für jede von ihnen eine eigene Bürste für die Zähne! Als Carmela schließlich als Letzte aus dem Bad trat, weil die anderen Mädchen am Ende ihrer Kräfte zu sein schienen, war sie sauberer als je zuvor in ihrem Leben. Die duftende und cremige Seife hatte sie so bezaubert, dass sie zweimal gebadet und zweimal die Haare gewaschen hatte. Irgendwann war kein warmes Wasser mehr aus der Spritze gekommen – inzwischen floss nur noch kaltes Wasser nach –, doch das war ihr egal gewesen. Es war so angenehm, wieder sauber zu sein.
Sie war barfuß und hatte keine Unterwäsche zum Anziehen, weil ihre Sachen vollkommen verschmutzt waren, aber sie zog ihr sauberes neues Kleid an und drehte ihr feuchtes Haar im Nacken zu einem Knoten hoch. Im Spiegel sah sie ein hübsches Mädchen mit glatter brauner Haut, dunkel schimmernden Augen und einem vollen roten Mund, nicht zu vergleichen mit der verdreckten Gestalt, die ihr noch vor wenigen Minuten entgegen gestarrt hatte.
Die übrigen Mädchen lagen schon in tiefem Schlummer im Schlafzimmer, unter die Decken gekuschelt und in so kalter Luft, dass sich die Härchen an Carmelas Armen aufstellten. Sie machte noch einen Abstecher in den Wohnbereich, um Mitchell eine gute Nacht zu wünschen und ihm für alles zu danken. Im Fernseher lief ein amerikanisches Baseballspiel. Er sah auf, lächelte und deutete auf zwei mit Eis und einer dunklen Flüssigkeit gefüllte Gläser, die auf dem Tisch standen. »Ich habe dir was zu trinken gemacht«, sagte er, oder sagte er vermutlich, weil sein Spanisch wirklich kaum zu verstehen war. Er hob eines der Gläser hoch und nahm einen Schluck. »Coca-Cola.«
Ah, das verstand sie! Sie nahm das Glas, auf das er deutete, und trank die kalte, süße, beißende Cola. Das kitzelnde Gefühl hinten in der Kehle war einfach wunderbar. Mitchell klopfte einladend auf das Sofa, darum setzte sie sich, allerdings ans andere Ende, so wie ihre Mutter es ihr beigebracht hatte. Auch wenn sie todmüde war, würde sie ihm ein paar Minuten Gesellschaft leisten, aus reiner Höflichkeit und weil sie ihm wirklich dankbar war. Ein netter Mann, dachte sie, mit süßen, leicht traurigen braunen Augen.
Er gab ihr ein paar Nüsse zum Knabbern, und plötzlich lechzte sie nach dem salzigen Geschmack, so als müsste ihr Körper das Salz ersetzen, das sie während des ersten Teils der Reise ausgeschwitzt hatte. Als sie danach noch mehr Coca-Cola brauchte, stand er auf und holte ihr noch eine. Eine seltsame Erfahrung, sich von einem Mann etwas bringen zu lassen, aber eventuell war das in Amerika so üblich. Vielleicht bedienten hier ja die Männer ihre Frauen. In diesem Fall bereute sie nur, dass sie nicht schon früher gekommen war!
Die Müdigkeit überwältigte sie. Sie musste gähnen und entschuldigte sich sofort dafür, aber er lachte nur und meinte, das sei in Ordnung so. Irgendwie überstieg es ihre Kräfte, die Augen offen und den Kopf gerade zu halten. Immer wieder kippte ihr Kopf nach vorn, immer wieder riss sie ihn hoch, bis ihr irgendwann die Halsmuskeln nicht mehr gehorchen wollten und sie spürte, wie sie, statt den Kopf zu heben, langsam zur Seite glitt. Mitchell war sofort zur Stelle, half ihr, sich auszustrecken, bettete ihren Kopf auf das Kissen und hob ihre Beine auf das Sofa. Er streichelte sie immer noch an den Beinen, erkannte sie verschwommen, und sie versuchte ihm zu erklären, dass er damit aufhören sollte, doch kein einziges Wort wollte mehr über ihre Zunge kommen. Und dann berührte er sie zwischen den Beinen, wo noch niemand sie berührt hatte.
Nein, dachte sie.
Und dann wurde alles schwarz, und sie dachte überhaupt nichts mehr.
1
»Daisy! Das Frühstück ist fertig!«
Die Stimme ihrer Mutter stieg jodelnd die Treppe herauf, in genau demselben Tonfall wie fast jeden Morgen, seit Daisy in die Schule gekommen war und Tag für Tag aus dem Bett gerissen werden musste.
Doch statt aus dem Bett zu springen, blieb Daisy Ann Minor liegen und lauschte dem Regen, der gleichmäßig auf das Dach trommelte und am Gesims herabtropfte. Es war der Morgen ihres vierunddreißigsten Geburtstages, und sie hatte nicht die geringste Lust aufzustehen. Trübsinn, trostlos wie der Regen draußen, drückte sie in die Kissen. Sie war vierunddreißig Jahre alt, und dieser besondere Tag versprach nichts, worauf sie sich hätte freuen können.
Der Regen war nicht einmal ein ordentliches Gewitter voller Dramatik und akustischer Effekte, was ihr vielleicht noch gefallen hätte. O nein, es war einfach nur Regen, langweilig und trist. Der graue Tag spiegelte ihre Stimmung wider. Während sie so im Bett lag und die Tropfen am Schlafzimmerfenster herabrinnen sah, legte sich die Erkenntnis, dass ihr Geburtstag unabwendbar über sie hereingebrochen war, schwer und klamm wie eine nasse Wolldecke über sie. Ihr ganzes Leben lang war sie stets brav gewesen, und was hatte es ihr gebracht? Rein gar nichts.
Sie musste der Wahrheit ins Gesicht sehen, so unattraktiv die auch war.
Sie war vierunddreißig Jahre alt geworden, ohne je verheiratet oder auch nur verlobt gewesen zu sein. Sie hatte nicht eine einzige heiße Affäre erlebt – nicht einmal eine lauwarme. Die kurze Liebelei im College, auf die sie sich hauptsächlich eingelassen hatte, weil das dort so üblich war und sie nicht abseits stehen wollte, konnte man guten Gewissens nicht als Beziehung bezeichnen. Stattdessen lebte sie mit zwei Witwen zusammen, ihrer Mutter und ihrer Tante. Ihr letztes Rendezvous hatte sie am 13. September 1993 gehabt, mit Wally, dem Neffen von Tante Joellas bester Freundin – und zwar, weil der seit mindestens 1988 mit keiner Frau mehr ausgegangen war. Das war vielleicht ein heißes Date gewesen: eine Verabredung gnadenhalber zwischen einer Hoffnungslosen und einem absoluten Fehlzünder. Zu ihrer immensen Erleichterung hatte Wally nicht einmal den Versuch unternommen, sie zu küssen. Es war der langweiligste Abend ihres Lebens gewesen.
Langweilig. Das Wort traf sie mit unerwarteter Wucht. Sie hatte das bedrückende Gefühl, genau zu wissen, wie die Antwort ausfallen würde, falls jemand sie mit einem einzigen Wort beschreiben sollte. Ihre Kleidung war unauffällig – und langweilig. Ihr Haar war langweilig, ihr Gesicht war langweilig, ihr ganzes Leben war langweilig. Sie war eine vierunddreißigjährige, provinzielle, praktisch ungeküsste altjüngferliche Bibliothekarin, die, was ihren aufregenden Lebenswandel anging, genauso gut vierundachtzig hätte sein können.
Daisy lenkte ihren Blick vom Fenster auf die Zimmerdecke; sie war einfach zu deprimiert, um aufzustehen und nach unten zu gehen, wo ihre Mutter und Tante Joella ihr zum Geburtstag gratulieren würden und wo sie lächeln und Freude heucheln müsste. Natürlich würde sie irgendwann aufstehen müssen; schließlich hatte sie bis um neun in der Arbeit zu sein. Doch sie schaffte es einfach nicht, noch nicht.
Gestern Abend hatte sie sich genau wie jeden Abend die Sachen zurechtgelegt, die sie am nächsten Tag anziehen würde. Sie brauchte nicht einmal auf den Stuhl zu schauen, um den marineblauen Rock vor sich zu sehen, der ihr ein paar Zentimeter übers Knie ging und damit zu lang und zu kurz war, um modern oder schmeichelhaft zu wirken, oder um die weiße kurzärmlige Bluse vor Augen zu haben. Selbst unter größten Mühen hätte sie es kaum geschafft, ein weniger aufregendes Ensemble zusammenzustellen – aber andererseits brauchte sie sich nicht abzumühen; ihr Schrank war voll mit solchen Sachen.
Unversehens schämte sie sich für ihr mangelndes Stilgefühl. Zumindest an ihrem Geburtstag sollte eine Frau doch ein bisschen heißer aussehen als sonst, oder? Doch dafür würde sie einkaufen gehen müssen, denn das Wort heiß passte auf kein einziges Stück in ihrer Garderobe. Nicht einmal beim Schminken konnte sie sich heute besondere Mühe geben, weil ihr gesamtes Make-up aus einem einzigen Lippenstift in einem fast unsichtbaren Farbton namens »Blush« bestand. Die meiste Zeit trug sie ihn sowieso nicht auf. Wozu auch? Eine Frau, die keinen Anlass hatte, ihre Beine zu rasieren, brauchte auch keinen Lippenstift aufzulegen. Wie um alles in der Welt hatte sie sich eigentlich in diese Sackgasse manövriert?
Finster setzte sie sich im Bett auf und starrte quer durch ihr winziges Zimmer in den Spiegel über der Kommode. Das mausbraune, schnittlauchlockige Haar hing ihr ins Gesicht, bis sie es beiseite strich, um die hoffnungslose Existenz im Spiegel genauer in Augenschein nehmen zu können.
Was sie sah, gefiel ihr ganz und gar nicht. Wie ein trübseliger Haufen hockte sie da, mit hängenden Schultern und in ihren blauen Seersucker-Schlafanzug gehüllt, der ihr eine Nummer zu groß war. Der Schlafanzug war ein Weihnachtsgeschenk von ihrer Mutter, die es ins Mark getroffen hätte, wenn Daisy ihn umgetauscht hätte. Im Rückblick fühlte Daisy sich ins Mark getroffen, weil sie so offensichtlich eine Frau war, der man einen Seersucker-Schlafanzug schenkte. Seersucker, Herrgott noch mal! Es sagte eine Menge über sie aus, dass sie eine Seersucker-Schlafanzug-Frau war. Keine sexy Negligés für sie, Gott bewahre! Für sie tat es auch ein Seersucker-Schlafanzug.
Und warum auch nicht? Ihr Haar war fad, ihr Gesicht war fad, sie war fad.
Es war einfach nicht zu leugnen: Sie war langweilig, sie war vierunddreißig, und ihre biologische Uhr tickte. Nein, sie tickte nicht nur, sie zählte unerbittlich Daisys Countdown herunter: zehn ... neun ... acht ...
Sie steckte bis zum Hals im Schlamassel.
Dabei hatte sie vom Leben immer nur eines gewollt ... ein Leben. Ein ganz normales, gewöhnliches Leben. Mit Mann, Kind und einem eigenen Haus. Und sie wollte SEX. Heißen, glitschigen, stöhnenden, Am-helllichten-Nachmittag-nacktherumwälz-Sex. Ihre Brüste sollten nicht nur dazu da sein, den BH-Fabrikanten ein Auskommen zu sichern. Sie hatte nämlich hübsche Brüste, wie sie fand: feste, hervorragende, hübsche C-Körbchen-Brüste, von denen kein Mensch außer ihr etwas ahnte, weil niemand sie je zu Gesicht bekam oder gar würdigte. Ein Trauerspiel.
Noch trauriger war jedoch, dass sie nichts von dem bekommen würde, was sie sich ersehnte. Langweiligen, mausgrauen, faden altjüngferlichen Bibliothekarinnen blieb es verwehrt, dass jemand ihre Brüste bewunderte und pries. Sie würde einfach immer älter werden, immer fader und langweiliger, und ihre Brüste würden immer schlaffer werden, bis Daisy eines Tages sterben würde, ohne je am helllichten Nachmittag rittlings auf einem nackten Mann gesessen zu haben – es sei denn, etwas Einschneidendes würde passieren ... zum Beispiel ein Wunder.
Daisy ließ sich aufs Kissen zurückfallen und starrte von Neuem die Decke an. Ein Wunder? Vielleicht sollte sie lieber darauf hoffen, dass der Blitz einschlüge.
Sie wartete voller Spannung, doch es gab keinen Knall und auch keinen gleißenden Lichtblitz. Anscheinend konnte sie nicht mit Hilfe von »ganz oben« rechnen. Verzweiflung presste ihren Magen zusammen. Na gut, dann blieb nur noch sie selbst. Schließlich half der Herr am liebsten jenen, die sich selber halfen. Sie musste etwas unternehmen. Nur was?
Aus der tiefen Schwärze ihrer Verzweiflung ersprühte ein Funken der Erleuchtung und brach sich in Form einer Eingebung Bahn: Sie musste aufhören, ein braves Mädchen zu sein.
Ihr Magen krampfte sich zusammen, und ihr Herz begann zu hämmern. Unwillkürlich ging ihr Atem schneller. Das hatte der Herr doch bestimmt nicht im Sinn gehabt, als Er/Sie/Es beschloss, die Angelegenheit in ihre Hände zu legen. Nicht nur, dass es eine ausgesprochen un-Herr-gemäße Idee war, sondern ... sie wusste auch nicht, wie sie das anstellen sollte. Sie war ihr ganzes Leben lang brav gewesen; sämtliche Regeln und Vorschriften hatten sich tief in ihre DNA eingegraben. Aufhören, ein braves Mädchen zu sein? Was für eine wahnwitzige Idee. Die Logik diktierte, dass Daisy, wenn sie kein braves Mädchen mehr sein wollte, zum bösen Mädchen werden musste. Und das widerstrebte ihr zutiefst. Böse Mädchen rauchten, tranken, tanzten in irgendwelchen Bars und zogen durch fremde Betten. Das mit dem Tanzen mochte ja noch angehen – irgendwie sagte ihr die Vorstellung zu –, aber Rauchen kam gar nicht in Frage, Alkohol schmeckte ihr nicht, und was den Zug durch die Betten anging – ausgeschlossen. Das wäre geradezu wahnwitzig blöd.
Aber – aber die bösen Mädchen schnappen uns alle Männer weg!, jaulte ihr Unterbewusstsein auf, angetrieben von der unerbittlich tickenden inneren Uhr.
»Nicht alle«, widersprach sie laut. Sie kannte viele brave Mädchen, die geheiratet und Kinder bekommen hatten: all ihre Freundinnen, um genau zu sein, sowie ihre jüngere Schwester Beth. Es war also durchaus möglich. Leider schienen diese Frauen all jene Männer mit Beschlag belegt zu haben, die überhaupt an braven Mädchen interessiert waren.
Und wer blieb übrig?
Männer, die an bösen Mädchen interessiert waren, ganz genau.
Das Ziehen in ihrer Magengrube hatte sich in ein definitiv mulmiges Gefühl verwandelt. Wollte sie überhaupt einen Mann, der böse Mädchen liebte?
Und ob!, heulten ihre Hormone, jedem vernünftigen Gedanken verschlossen. Sie handelten unter einem biologischen Imperativ, für sie zählte nichts anderes mehr.
Sie hingegen war eine denkende Frau. Sie wollte ganz eindeutig keinen Mann, der mehr Zeit in irgendwelchen Bars und Kaschemmen verbrachte als in der Arbeit oder zu Hause. Sie wollte ganz entschieden keinen Kerl, der mit jeder Straßenhure ins Bett stieg.
Aber ein Mann mit Erfahrung ... Nun ja, das war etwas anderes. Ein Mann mit Erfahrung hatte so ein gewisses Etwas, so einen gewissen Blick, einen ganz bestimmten Gang, und alles zusammen bewirkte, dass sie eine Gänsehaut bekam, wenn sie sich vorstellte, so einen Mann ganz für sich allein zu haben. Er mochte ja ein ganz gewöhnlicher Kerl mit einem ganz gewöhnlichen Leben sein, aber er konnte doch trotzdem dieses gewisse boshafte Leuchten in den Augen haben, oder?
Natürlich konnte er. Und genau so einen Mann wollte sie, und sie weigerte sich zu glauben, dass da draußen keiner mehr für sie übrig sein sollte.
Noch einmal setzte sich Daisy auf, um die Frau im Spiegel abzumustern. Wenn sich ihre Wünsche jemals erfüllen sollten, dann musste sie zur Tat schreiten. Sie musste etwas unternehmen. Die Zeit zerrann ihr zwischen den Fingern.
Also gut, zum bösen Mädchen zu werden stand nicht zur Debatte.
Aber wenn sie sich nun den Anschein eines bösen Mädchens geben würde? Oder wenigstens den eines Party-Girls? Genau, das klang schon viel besser: ein Party-Girl. Eine Frau, die gern lachte, die sich gern amüsierte, die flirtete und tanzte und kurze Röcke trug – das würde sie noch zuwege bringen. Vielleicht.
Hoffentlich.
»Daisy!« Wieder hallte das Gejodel ihrer Mutter die Treppe herauf. Diesmal klang ihre Stimme bedeutungsschwanger, so als wüsste sie etwas, was Daisy noch nicht wusste – so als hätte Daisy je im Leben ihren eigenen Geburtstag vergessen können. »Du kommst noch zu spä-hät!«
Daisy war noch nie in ihrem Leben zu spät zur Arbeit gekommen. Sie seufzte. Ein normaler Mensch mit einem normalen Leben kam mindestens einmal im Jahr zu spät zur Arbeit, oder? Ihre makellose Personalakte in der Bibliothek war lediglich ein weiterer Hinweis darauf, wie verkorkst sie war.
»Bin schon auf!«, brüllte sie zurück, was nicht ganz gelogen war. Immerhin hatte sie sich aufgesetzt, auch wenn sie noch nicht aufgestanden war.
Ihr Blick fiel auf den trübseligen Haufen im Spiegel, und ihre Augen begannen zornig zu sprühen. »Nie wieder werde ich Seersucker tragen!«, gelobte sie. Na gut, es war kein so dramatischer Schwur wie der von Scarlett O’Hara, nie wieder Hunger zu leiden, doch es war ihr mindestens genauso ernst.
Wie sollte sie es nur anstellen, ein böses Mädchen – nein, ein Party-Girl, der Unterschied war ganz wesentlich – zu werden, überlegte sie, während sie sich den verhassten Seersucker-Schlafanzug vom Leib zerrte, ihn zusammenknüllte und trotzig in den Papierkorb stopfte. Einen Moment lang zögerte sie – was würde sie heute Abend im Bett anziehen? –, zwang sich aber, den Schlafanzug im Müll zu belassen. Bei dem Gedanken an ihre übrigen Schlafanzüge – Seersucker für den Sommer, Flanell für den Winter –, erblühte in ihr der wilde Wunsch, nackt zu schlafen. Genauso würde doch ein Party-Girl schlafen, oder? Und es war nicht falsch, nackt zu schlafen. Sie konnte sich nicht entsinnen, dass Reverend Bridges je darüber gepredigt hätte, was man im Bett tragen und nicht tragen sollte.
Duschen musste sie nicht, weil sie zu den Menschen gehörte, die abends badeten. Ihrer Überzeugung nach teilte sich die Menschheit in zwei Gruppen: Abendduscher und Morgenduscher. Wahrscheinlich bildete sich die letztere Gruppe etwas darauf ein, dass sie den Tag frisch und blitzblank begannen. Sie hingegen konnte sich nicht mit der Vorstellung anfreunden, unter eine Decke zu kriechen, in der sich schon am Vortag Staub, Bazillen und tote Hautzellen angesammelt hatten. Die einzige Abhilfe dagegen wäre gewesen, täglich die Bettwäsche zu wechseln. Auch wenn es einige Zwanghafte geben mochte, die das taten, so gehörte sie gewiss nicht dazu. Die Bettwäsche einmal wöchentlich zu wechseln reichte ihr völlig, und das bedeutete, dass sie sauber sein wollte, wenn sie ins Bett ging. Außerdem sparte das abendliche Duschen Zeit am Morgen.
Als würde sie je in Zeitnot geraten, schoss es ihr düster durch den Kopf.
Sie betrachtete sich ausgiebig im Spiegel über dem Waschbecken im Bad, der ihr bestätigte, was sie bereits im Spiegel über der Kommode gesehen hatte. Ihr Haar war matt und formlos und ohne jede Fasson. Es war zwar gesund, doch schlaff und ohne Körper. Sie zog eine lange braune Strähne vor die Augen und untersuchte sie. Die Haare waren nicht goldbraun, auch nicht rotbraun oder auch nur satt schokoladebraun. Sie waren einfach bloß braun, ungefähr wie Schlamm. Vielleicht konnte sie irgendwas auftragen, das dem Haar etwas mehr Schwung, etwas mehr Pep verliehe. Es gab weiß Gott Abermilliarden Flaschen und Tuben und Sprays in der Kosmetikabteilung des Wal-Mart am Highway. Aber der war fünfzehn Meilen entfernt, weshalb sie gewöhnlich einfach eine Flasche Shampoo aus dem Supermarkt an der Ecke mitnahm. Sie hatte sowieso keine Ahnung, wozu die Mittel in den Abermilliarden Flaschen und Tuben gut sein sollten.
Aber das ließ sich schließlich in Erfahrung bringen, oder? Wozu war sie denn Bibliothekarin? Sie war die Königin der Recherche. Die Geheimnisse der Welt lagen all jenen offen zu Tage, die wussten, wo und wie sie graben mussten. Was sollte an Haaren besonders schwer sein?
Okay. Die Haare kamen ganz oben auf ihre Verbesserungsliste. Daisy kehrte in ihr Zimmer zurück und holte Stift und Block aus ihrer Handtasche. Dann notierte sie ganz oben auf einer Seite eine Eins und direkt daneben HAARE. Darunter kritzelte sie schnell MAKE-UP und darunter KLEIDER.
So, befand sie zufrieden. Schon war der Entwurf für das zukünftige Party-Girl fertig.
Wieder im Bad angekommen, wusch sie sich hastig das Gesicht und tat dann etwas, was sie sonst praktisch nie machte. Sie öffnete das Glas mit Oil of Olaz, das Tante Joella ihr letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt hatte, und massierte Feuchtigkeitscreme in ihr Gesicht. Auch wenn es nichts nutzte, so war es doch ein angenehmes Gefühl, beschloss sie. Als sie damit fertig war, fand sie, dass ihr Gesicht glatter und ein bisschen farbiger aussah. Natürlich, alles, was mit Fett eingeschmiert wurde, wirkte glatter, und das viele Massieren hatte ihr selbstverständlich die Wangen gerötet, aber irgendwo musste sie ja schließlich anfangen.
Und jetzt?
Nichts jetzt, sie war schon wieder fertig. Mehr konnte sie nicht tun, denn sie besaß keine weiteren Mittelchen, keine mysteriösen, sexy kleinen Döschen mit Farbe, keine dunklen Stifte, mit denen sich andere Frauen die Augen nachzogen und die Lider dunkel färbten. Lippenstift konnte sie noch auftragen, aber wozu sollte das gut sein? Er hatte praktisch die gleiche Farbe wie ihre Lippen; dass sie ihn aufgetragen hatte, konnte sie lediglich feststellen, wenn sie mit der Zunge über ihre Lippen fuhr und ihn schmeckte. Er schmeckte leicht nach Kaugummi, genau wie damals in der Junior High – »O nein!«, stöhnte sie laut auf. Sie hatte die Lippenstiftfarbe seit der Junior High School nicht mehr gewechselt.
»Du bist eine Trantüte«, erklärte sie ihrem Spiegelbild, und diesmal klang sie wütend. Mit kosmetischen Veränderungen allein wäre die Sache nicht getan.
Hier waren einschneidende Maßnahmen gefordert.
Als Daisy die Treppe herunterkam, standen bereits zwei farbenfroh verhüllte Päckchen auf dem Küchentisch. Ihre Mutter hatte Daisys Lieblingsfrühstück zubereitet, Pfannkuchen mit Pekannüssen; neben dem Teller wartete eine leicht dampfende Tasse Kaffee, was darauf hinwies, dass ihre Mutter Daisys Kaffee erst eingeschenkt hatte, als sie ihre Tochter auf der Treppe gehört hatte. Tränen standen Daisy in den Augen, sobald sie ihre Mutter und Tante ansah; die beiden waren wirklich die nettesten Menschen auf der ganzen Welt. Daisy liebte beide über alles.
»Alles Gute zum Geburtstag!«, jubilierten die zwei und strahlten sie an.
»Danke.« Sie rang sich ein Lächeln ab. Auf das vereinte Drängen der beiden alten Damen hin setzte sie sich auf ihren Stammplatz und öffnete unverzüglich beide Päckchen. Bitte, lieber Gott, bloß kein Seersucker, flehte sie insgeheim, indes sie das weiße Papier vom Geschenk ihrer Mutter abschälte. Sie fürchtete sich beinahe vor dem Auspacken, weil sie Angst hatte, ihre Miene nicht beherrschen zu können, wenn es tatsächlich Seersucker wäre – oder Flanell. Flanell wäre fast genauso schlimm.
Es war ... puh, wenigstens kein Seersucker. Die Erleichterung machte sich in einem winzigen Seufzer Luft. Dann zog sie das Gewand aus der Packung und hielt es vor sich hin. »Ein Bademantel«, erklärte ihre Mutter, als könnte Daisy das nicht mit eigenen Augen erkennen.
»Wirklich ... wirklich hübsch«, sagte Daisy, der schon wieder Tränen in die Augen schossen, weil der Bademantel tatsächlich hübsch war – nun ja, zumindest hübscher, als sie befürchtet hatte. Er war aus reiner Baumwolle, aber er hatte einen hübschen Rosaton und war an Kragen und Ärmeln mit dezenten Spitzen besetzt.
»Ich habe mir gedacht, du brauchst ein bisschen was Hübsches«, verkündete ihre Mutter mit gefalteten Händen.
»Hier«, mischte sich Tante Joella ein und schob Daisy die zweite Schachtel zu. »Mach schon, sonst werden deine Pfannkuchen kalt.«
»Danke, Mama«, sagte Daisy, während sie gehorsam die zweite Schachtel öffnete und einen Blick auf den Inhalt wagte. Auch hier kein Seersucker. Sie betastete den Stoff und strich sanft mit den Fingerspitzen über die kühlen, glatten Fasern.
»Echte Seide«, vermeldete Tante Joella stolz, als Daisy den langen Unterrock aus der Verpackung zog. »Marilyn Monroe hat so einen mal in einem Film getragen.«
Der Unterrock sah aus wie aus den vierziger Jahren, gleichzeitig keusch und sexy, so wie etwas, das kesse junge Frauen damals als Partykleid trugen. Daisy sah sich im Geist an einer Frisierkommode sitzen und ihr Haar kämmen, in nichts als diesen Unterrock gehüllt; ein großer Mann tauchte hinter ihr auf und legte die Hand auf ihre nackte Schulter. Sie ließ den Kopf in den Nacken fallen und lächelte ihn an, während er langsam die Hand unter die Seide schob, ihre Brust umfasste und sich zu einem Kuss herunterbeugte ...
»Und, was denkst du?«, fragte Tante Joella und riss Daisy damit abrupt aus ihren Tagträumen.
»Es ist bezaubernd.« Eine der Tränen, die Daisy so mühsam zurückgehalten hatte, entkam ihr und rollte über ihre Wange. »Ihr seid beide so süß –«
»So süß auch wieder nicht«, fiel Tante Joella ihr ins Wort, wobei sie stirnrunzelnd den Lauf der Träne verfolgte. »Warum weinst du?«
»Hast du irgendwas?« Ihre Mutter beugte sich über den Tisch und tätschelte Daisys Hand.
Daisy atmete tief durch. »Nein, nein. Oder doch. Ich – ich hatte eben eine Epiphanie.«
Tante Joella, die mit einer rasiermesserscharfen Zunge gesegnet war, sah sie aus zusammengekniffenen Augen an. »Mann, ich wette, das schmerzt.«
»Jo.« Nach einem tadelnden Blick auf ihre Schwester nahm Daisys Mutter deren Hände. »Erzähl uns, was dich bedrückt, mein Herzchen.«
Daisy atmete tief ein, um ihren gesamten Mut zusammenzunehmen und gleichzeitig alle weiteren Tränen zu unterdrücken. »Ich will heiraten.«
Die beiden Schwestern blinzelten, schauten sich erst gegenseitig und dann wieder Daisy an. »Aber das ist ja wunderbar«, meinte ihre Mutter. »Wen denn?«
»Genau da liegt das Problem«, seufzte Daisy. »Niemand will mich heiraten.« Dann half alles Durchatmen nichts mehr, und sie musste ihr Gesicht in den Händen vergraben, damit man ihr nicht ansah, wie die verräterischen Tränen aus ihren Augen leckten.
Aus dem einsetzenden Schweigen schloss sie, dass die beiden Schwestern wieder einander ansahen und auf typisch schwesterliche Weise wortlos miteinander kommunizierten.
Schließlich räusperte sich ihre Mutter. »Ich bin nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Beziehst du dich mit dieser Bemerkung auf jemand Bestimmten?«
Ihre gute Mutter – sie war mit Leib und Seele Lehrerin. Sie war der einzige Mensch, den Daisy kannte, der so einen Satz ohne jede Ironie sagen konnte – abgesehen möglicherweise von Daisy selbst. Selbst in der größten Aufregung sprach ihre Mutter präzise und grammatikalisch einwandfrei.
Daisy schüttelte den Kopf und wischte die Tränen ab, um den beiden wieder ins Gesicht sehen zu können. »Nein, es geht hier nicht um unerwiderte Liebe. Aber ich will heiraten und Kinder bekommen, bevor ich dafür zu alt bin. Das kann ich nur erreichen, wenn ich einige tiefgreifende Veränderungen vornehme.«
»Was für tiefgreifende Veränderungen?«, hakte Tante Jo misstrauisch ein.
»Guckt mich doch mal an!« Daisy fuhr mit den Händen an ihrem Körper herab. »Ich bin eine langweilige graue Maus. Wer schaut mich schon an? Nicht einmal der arme Wally Herndon war an mir interessiert. Ich werde einige tief greifende Veränderungen an mir vornehmen müssen.«
Sie atmete tief ein. »Ich muss mich mehr rausputzen. Ich muss die Männer dazu kriegen, dass sie mich beachten. Ich muss ausgehen und mich mit männlichen Singles treffen, in einer Disco oder einer Bar zum Beispiel.« Sie verstummte, Widerspruch erwartend, doch die einzige Antwort bestand in Schweigen. Darum atmete sie noch einmal tief durch und platzte mit der letzten großen Attacke heraus: »Ich brauche eine eigene Wohnung.« Dann wartete sie ab.
Wieder wechselten die beiden Schwestern einen Blick. Der Moment dehnte sich in die Länge – und Daisys Nerven dehnten sich mit. Was sollte sie tun, wenn die beiden erbitterten Protest einlegten? Würde sie standhaft bleiben können? Das Problem war, dass sie die beiden Frauen liebte und sie glücklich sehen wollte; sie wollte nicht, dass sie sich aufregten oder für sie schämten.
Beide betrachteten sie mit einem breiten Lächeln.
»Also, das wurde ja auch Zeit«, sagte Tante Jo.
»Wir helfen dir«, strahlte ihre Mutter.
2
Wie ferngesteuert fuhr Daisy zur Arbeit. Zum Glück brauchte sie keine Stoppschilder und nur eine einzige Ampel zu beachten: einer der Vorzüge des Kleinstadtlebens. Sie wohnte nur fünf Straßen von der Bücherei entfernt und ging, um die Umwelt zu schonen, bei schönem Wetter oft zu Fuß zur Arbeit, doch heute regnete es in Strömen, und im Sommer siegte die Hitze ohnehin regelmäßig über ihr schlechtes Gewissen.
In ihrem Kopf überschlugen sich die unterschiedlichsten Ideen, darum legte sie, noch ehe sie ihre Handtasche in der untersten Schublade des Schreibtisches verstaut hatte, sich ein Blatt Papier zurecht, auf dem sie die zu erledigenden Punkte notieren wollte, um sie stets vor Augen zu haben. Ihre Mutter und Tante Jo hatten, ganz aus dem Häuschen vor Begeisterung, zahllose Vorschläge gemacht, doch nach sorgfältigen Erwägungen waren alle übereingekommen, dass Daisy erst einmal die wichtigsten Punkte angehen sollte. Sie verfügte über ein beruhigendes finanzielles Polster, weil sie mit ihrer Mutter und Tante Jo zusammenwohnte, die meisten Ausgaben mit ihnen teilte – nicht dass die Kosten für Lebensmittel und Sonstiges schwindelnde Höhen erreicht hätten – und das Haus längst schuldenfrei war. Ihr Auto war ein acht Jahre alter Ford, den sie innerhalb von drei Jahren abbezahlt hatte, sodass sie seit fünf Jahren nicht einmal Raten für ihr Auto abgeknapst hatte. Natürlich war der Verdienst einer Kleinstadt-Bibliothekarin nicht berauschend, obwohl sie sogar Bibliotheksleiterin war, ein reiner Ehrentitel ohne große Befugnisse, weil nur der Bürgermeister Einstellungen und Kündigungen vornehmen durfte; im Grunde durfte sie vor allem entscheiden, welche Titel die Bücherei mit ihrem wenig beeindruckenden Etat erwarb. Aber wenn eine Frau Jahr für Jahr mindestens die Hälfte und manchmal noch mehr ihres Gehaltes zurücklegte, dann ergab das, selbst wenn das Gehalt nicht atemberaubend war, eine ganz ordentliche Summe. Sie hatte sogar in Aktien zu investieren begonnen, nachdem sie sich im Internet sorgfältig über einige ausgewählte Firmen kundig gemacht hatte. Dabei hatte sie, wie sie selbst fand, ganz gut abgeschnitten. Nicht dass die Haie an der Wall Street neidisch auf sie geworden wären, aber sie war durchaus stolz auf die Ernte ihrer Anstrengungen.
Kurz und gut, sie konnte sich mühelos eine eigene Wohnung leisten. Nur dass in Hillsboro, Alabama, nicht viele Wohnungen zu vermieten waren. Natürlich könnte sie in eine größere Stadt ziehen, nach Scottsboro oder Fort Payne, aber eigentlich wollte sie am Ort bleiben. Ihre Schwester war schon nach Huntsville gezogen, was mit einer Stunde Fahrt nicht wirklich weit entfernt, aber trotz alledem nicht das Gleiche war, wie in derselben Stadt zu wohnen. Außerdem hatte Temple Nolan, der Bürgermeister, die Manie, ausschließlich Einheimische im öffentlichen Dienst zu beschäftigen, eine Politik, die Daisy prinzipiell befürwortete. Sie konnte ihn kaum bitten, in ihrem Fall eine Ausnahme zu machen. Folglich würde sie hier in Hillsboro eine Wohnung finden müssen.
Die Lokalpresse bestand in Hillsboro aus einem dünnen, freitags erscheinenden Wochenblatt, dessen letzte Ausgabe noch auf ihrem Schreibtisch lag. Sie schlug die Anzeigenseite auf – genau eine Seite – und überflog die Kolumnen. Dabei erfuhr sie, dass in der Vine Street eine gescheckte Katze zugelaufen war und dass Mrs. Washburn jemanden suchte, der ihr bei der Pflege ihres achtundneunzig Jahre alten Schwiegervaters half, welchem es gefiel, sich zu den unmöglichsten Zeiten seiner Kleider zu entledigen, zum Beispiel in Anwesenheit wildfremder Menschen. Zu vermieten, zu vermieten ... Schließlich erfasste ihr Blick die winzige Rubrik und hatte schon im nächsten Moment die Anzeigen durchforstet. Es waren insgesamt acht, mehr als sie erwartet hätte.
Eine Adresse war ihr vertraut und schied auf der Stelle aus; es handelte sich um ein Dachgeschosszimmer in Beulah Wilsons Haus: Die ganze Stadt wusste, dass Beulah nach Gutdünken die Privatsphäre ihrer Mieter verletzte, in ihren Zimmern herumschnüffelte wie ein Drogenspürhund auf der Suche nach einer Tonne Kokain und anschließend mit ihrem Damenkränzchen sämtliche Funde durchhechelte. Auf diese Weise hatte die ganze Stadt erfahren, dass Miss Mavis Dixon eine Schachtel mit alten Playgirls besaß, wobei Miss Mavis allerdings so unbeliebt und eine solche Außenseiterin im Ort war, dass sie einem männlichen Genital ohnehin nicht näher kommen würde als auf einem Foto.
Auf gar keinen Fall würde Daisy je zu Beulah Wilson ziehen.
Blieben noch sieben Angebote.
»Vine Street«, murmelte sie, während sie das zweite Inserat las. Bestimmt handelte es sich um die kleine Einliegerwohnung über der vom Haus abgetrennten Garage bei den Simmonsens. Hm, gar nicht so übel. Die Miete war äußerst moderat, es war eine gute Gegend, und sie bliebe ungestört, weil die verwitwete Edith Simmons arthritische Knie hatte und nie im Leben die Treppe hochkommen würde. Alle Welt wusste, dass sie eine Putzfrau eingestellt hatte, weil sie sich so schlecht bücken konnte.
Daisy kreiste die Anzeige ein und überflog anschließend die übrigen Angebote. Es gab noch zwei unmöblierte Apartments drüben am Highway, aber die waren teuer und hässlich. Daisy wollte beide nicht ausschließen, aber nur falls Mrs. Simmons ihre Einliegerwohnung bereits vermietet hatte. Des Weiteren wurde ein Haus in der Lassiter Street vermietet, wobei die Adresse ihr allerdings nichts sagte. Sie rotierte auf ihrem Drehstuhl, um auf dem Stadtplan die Lassiter Street ausfindig zu machen, und strich das Angebot sofort von der Liste, weil das Haus in einem üblen Viertel stand. Wie übel, wusste sie nicht genau, aber sie ging davon aus, dass auch in Hillsboro das Verbrechen sein Unwesen trieb.
Die übrigen drei Angebote waren ebenfalls wenig verlockend. So war die eine Hälfte eines Doppelhauses zu vermieten, die regelmäßig frei wurde, weil in der anderen Hälfte die überall verrufene Familie Farris hauste, deren Geschrei und Gefluche niemand lange ertrug. Das zweite Haus lag zu weit entfernt, schon beinahe in Fort Payne. Zu guter Letzt wurde noch ein Mobile Home angeboten, das ebenfalls in einer zwielichtigen Gegend aufgebockt war.
Schnell tippte sie die Nummer von Mrs. Simmons ein, in der Hoffnung, dass die Wohnung noch nicht vermietet war, denn immerhin war die Zeitung schon vier Tage alt.
Das Telefon läutete eine halbe Ewigkeit, aber Mrs. Simmons brauchte halt ewig, um vom Fleck zu kommen, darum übte Daisy sich in Geduld. Ihr Sohn Varney hatte seiner Mutter ein schnurloses Telefon geschenkt, damit sie es ständig bei sich tragen konnte und nirgendwohin eilen musste, falls sie angerufen wurde, doch Mrs. Simmons war ein Gewohnheitsmensch und hatte es lästig gefunden, den ganzen Tag ein Telefon mit sich herumzuschleppen, weshalb sie es versehentlich in die Toilette fallen ließ und es auf diese Weise aus dem Verkehr zog. Mrs. Simmons stöpselte ihr altes Schnurtelefon wieder ein, und Varney war klug genug, ihr kein weiteres schnurloses Telefon zum Ertränken zu schenken.
»Hallo?« Mrs. Simmons’ Stimme knirschte wie ihre Knie.
»Hallo, Mrs. Simmons. Hier spricht Daisy Minor. Wie geht es Ihnen?«
»Danke, gut, Schatz. Der Regen steckt mir in den Knochen, aber die Pflanzen brauchen ihn, darum darf ich mich nicht beklagen. Wie geht es Ihrer Mama und Ihrer Tante Joella?«
»Auch gut, danke. Sie kochen gerade Tomaten und Okra aus unserem Garten ein.«
»Ich komme kaum mehr zum Einkochen«, knarzte Mrs. Simmons. »Letztes Jahr hat mir Timmie«, Timmie war Varneys Frau, »ein paar Birnen gebracht, und wir haben Birnenkompott eingemacht, aber ich versuche nicht mal mehr, meinen Garten zu bestellen. Da spielen meine alten Knie einfach nicht mehr mit.«
»Vielleicht sollten Sie sich ein künstliches Kniegelenk einsetzen lassen«, schlug Daisy vor. Sie fühlte sich zu dieser Bemerkung verpflichtet, obwohl sie wusste, dass Varney und Timmie diesen Vorschlag seit Jahren vorbrachten, ohne irgendwas zu bewirken.
»Ach, Unfug, Mertis Bainbridge hat sich die Knie operieren lassen, und sie meint, sie würde das kein zweites Mal durchmachen wollen. Sie hatte nichts als Ärger damit.«
Mertis Bainbridge war eine stadtbekannte Hypochonderin und eine Miesmacherin obendrein. Wenn ihr jemand ein Auto geschenkt hätte, hätte sie sich darüber beschwert, dass sie das Benzin zahlen musste. Daisy verkniff sich jedoch eine entsprechende Bemerkung, weil Mertis eine gute Freundin von Mrs. Simmons war.
»Die Menschen sind verschieden«, meinte sie diplomatisch. »Sie sind wesentlich robuster als Mertis, darum würde es bei Ihnen vielleicht mehr bringen.« Mrs. Simmons hörte gern, wie stark sie war und wie tapfer sie ihre Schmerzen ertrug.
»Na ja, ich werd’s mir überlegen.«
Was eine glatte Lüge war, aber damit hatte Daisy der gebotenen Höflichkeit Genüge getan; jetzt konnte sie zum eigentlichen Anlass ihres Anrufes übergehen. »Eigentlich rufe ich an, weil ich mich nach der Wohnung über Ihrer Garage erkundigen wollte. Ist die schon vermietet?«
»Noch nicht, Schätzchen. Kennen Sie jemanden, der sich dafür interessieren könnte?«
»Ich interessiere mich selbst dafür. Wären Sie einverstanden, wenn ich vorbeikäme und sie mir anschauen würde?«
»Ich denke doch. Ich will nur kurz Ihre Mutter anrufen. Dann melde ich mich gleich zurück. Sie sind doch in der Arbeit, oder?«
Daisy blinzelte. Hatte sie gerade tatsächlich gehört, was sie gehört zu haben meinte? »Verzeihung?«, hakte sie höflich nach. »Wieso wollen Sie erst meine Mutter anrufen?«
»Natürlich um mich zu erkundigen, ob sie damit einverstanden ist, Schätzchen. Ich kann Ihnen doch nicht ohne die Einwilligung Ihrer Mutter meine Wohnung vermieten.«
Die Worte brannten wie Ohrfeigen. »Die Einwilligung meiner Mutter?«, krächzte sie. »Ich bin vierunddreißig Jahre. Ich brauche nicht die Einwilligung meiner Mutter, wenn ich umziehen will.«
»Auch wenn Sie mit ihr gestritten haben, möchte ich Evelyn nicht derart verletzen.«
»Wir haben uns nicht gestritten«, protestierte Daisy. Die Kehle war ihr so eng geworden, dass sie kaum einen Ton herausbrachte. Mein Gott, hielt man sie im Ort für so verkorkst, dass man sie ohne die Einwilligung ihrer Mutter keinen Schritt tun ließ? Kein Wunder, dass kein Mann mit ihr ausgehen wollte! Ihre Scham vermischte sich mit wachsendem Zorn darüber, dass Mrs. Simmons keinen Gedanken daran verschwendete, ob sie Daisy beleidigte. »Andererseits, Mrs. Simmons, ist die Wohnung vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Entschuldigen Sie die Störung.« Das war zwar unhöflich, doch ausnahmsweise legte sie ohne die übliche Verabschiedung auf. Wahrscheinlich würde Mrs. Simmons nun all ihren Freundinnen schildern, wie rüde Daisy gewesen war und dass sie sich mit ihrer Mutter gestritten hatte, doch das war nicht zu ändern. Und auch wenn Mrs. Simmons nicht ihr Zimmer durchwühlen würde, so würde sie doch ganz gewiss ihr Kommen und Gehen überwachen und sich verpflichtet fühlen, ihrer Mutter Rapport zu erstatten. Nicht dass Daisy beabsichtigte, etwas Böses zu tun, aber dennoch ...!
Das Schamgefühl fraß noch an ihr. War dies das Bild, das ihre Freunde und Bekannte von ihr hatten – das eines Menschen, der nicht in der Lage war, eine eigene Entscheidung zu fällen? Sie hatte sich immer für eine intelligente, verantwortungsbewusste, selbstständige Frau gehalten, doch Mrs. Simmons, die Daisy von frühester Kindheit an kannte, sah das offenbar anders!
Dieser Schritt kam viel, viel zu spät. Sie hätte ihn vor zehn Jahren tun sollen. Damals wäre es kinderleicht gewesen, ihr Image zu ändern. Jetzt kam es ihr so vor, als bräuchte sie ein Bundesgesetz – und ein Einwilligungsschreiben ihrer Mutter –, um das Bild zu verändern, das ihre Mitmenschen von ihr hatten.
Sicher war es besser, wenn sie nicht in Mrs. Simmons’ Apartment wohnte. Dort wäre sie zwar nicht mehr im Haus ihrer Mutter, richtig, aber nach wie vor unter »Beobachtung«. Wenn sie tatsächlich etwas ändern wollte, musste sie den Anschein vollkommener Unabhängigkeit erwecken.
Die Apartments in der Wohnanlage am Highway erschienen ihr von Minute zu Minute attraktiver.
Sie wählte die Telefonnummer in der Anzeige. Wieder läutete das Telefon eine Ewigkeit. Sie fragte sich, ob der Verwalter wohl ebenfalls arthritische Knie hatte.
»Hallo?«, meldete sich eine verschlafene Männerstimme.
»Verzeihung, habe ich Sie geweckt?« Daisys Blick fiel auf die Uhr über ihrem Schreibtisch; zehn nach neun. Was für ein Verwalter war um diese Zeit noch im Bett?
»Schon okay.«
»Ich rufe wegen der freien Wohnungen an –«
»Tut mir Leid. Die letzte wurde gestern vermietet.« Sprach’s und legte auf.
Verdammt.
Frustriert starrte sie auf die Zeitung. Somit blieben nur noch das Haus an der Lassiter Avenue, die Doppelhaushälfte neben den Farrises und das Mobile Home am Stadtrand. Die Doppelhaushälfte kam absolut nicht in Frage.
Sie konnte jetzt keinen Rückzieher machen; sonst würde sie nie wieder in den Spiegel schauen könne. Sie musste die Sache durchziehen. Vielleicht waren das Mobile Home oder das Haus in der Lassiter Avenue gar nicht so übel. Eine heruntergekommene Gegend machte ihr nichts aus, solange sie nicht wirklich gefährlich war, solange dort keine Dealer an den Ecken herumlungerten oder nachts geschossen wurde.
Sie war ziemlich sicher, dass sie es erfahren hätte, wenn in Hillsboro geschossen worden wäre, am Tag oder in der Nacht.
Das diskrete Glöckchen über der Tür schlug an, weil jemand in die Bücherei gekommen war. Daisy stand auf und strich ihren Rock glatt, auch wenn das kaum eine sichtbare Veränderung bewirkte. Bis Mittag arbeitete sie allein, weil vormittags nur selten jemand in die Bücherei kam. Der größte Andrang herrschte am Nachmittag, nach Schulschluss, mit Ausnahme des Sommers natürlich. Doch auch da kamen die meisten Besucher nachmittags, eventuell weil sie während der relativ kühlen Vormittagsstunden mit anderen Erledigungen beschäftigt waren. Kendra Owens begann um zwölf zu arbeiten und blieb bis zur Schließung um einundzwanzig Uhr, und von siebzehn bis einundzwanzig Uhr kam Shannon Ivey, die Teilzeit arbeitete, sodass Kendra abends nie allein war. Die Einzige, die länger allein Dienst hatte, war Daisy, aber sie trug wohl auch die größte Verantwortung.
»Ist da wer?«, dröhnte eine tiefe Stimme, noch ehe Daisy aus ihrem kleinen Kabuff hinter der Verbuchungstheke treten konnte.
Empört, dass jemand in einer Bücherei herumbrüllte, selbst wenn momentan keine anderen Besucher da waren, trat Daisy eilig zwei Schritte vor. Als sie sah, wer da hereingekommen war, blickte sie kurz an sich herab und antwortete dann knapp: »Ja, natürlich. Sie brauchen deswegen nicht gleich zu schreien.«
Auf der anderen Seite der verkratzten hölzernen Verbuchungstheke stand, sichtlich ungeduldig, der Polizeichef Jack Russo. Daisy kannte ihn vom Sehen, hatte aber noch nie mit ihm gesprochen und wünschte sich, ihr wäre das auch jetzt erspart geblieben. Ehrlich gesagt hielt sie nicht allzu große Stücke auf den Mann, den Bürgermeister Nolan zum Polizeichef erkoren hatte. Etwas an ihm bereitete ihr Unbehagen, auch wenn sie nicht zu sagen vermochte, was das war. Warum hatte der Bürgermeister nicht jemanden aus dem Ort ausgewählt, jemanden, der schon länger bei der Polizei war? Chief Russo mischte sich nicht unter die Einheimischen, und soweit sie das nach einigen Gemeindeversammlungen beurteilen konnte, ließ er gerne mal die Muskeln spielen. Einen Rüpel nicht zu mögen, war nicht schwer.
»Wenn ich jemanden gesehen hätte, hätte ich auch nicht brüllen müssen«, blaffte er.
»Wenn niemand hier gewesen wäre, wäre die Tür nicht offen gewesen«, blaffte sie zurück.
Patt.