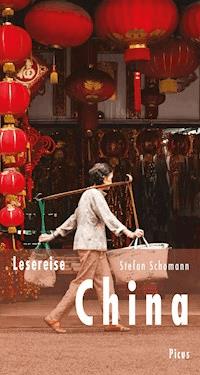19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Pferdegeschichte ist Menschheitsgeschichte.« Den Urwildpferden auf der Spur Eine atemberaubende Reportage über die selten gewordenen Przewalski-Pferde, die leidenschaftlicher, informierter und schöner nicht geschrieben sein könnte. Als Stefan Schomann im Tierpark Hellabrunn dem clownesken Blick eines ockerfarbenen Pferds mit Bürstenmähne für immer verfällt, wie soll er da begreifen, eine ausgestorbene Art zu betrachten? Das letzte freilebende Urwildpferd wurde in den 1960er Jahren gesichtet. In seiner Heimat, der Steppe am Nordrand der Wüste Gobi, wo es schlicht Tachi hieß. Nur etwa 30 Tiere überlebten, über den Globus verstreut und in Gefangenschaft. Doch mittlerweile existieren Auswilderungsprogramme, die Tachi aus aller Welt wieder in ihren ursprünglichen Lebensraum zurückführen. Schomann erzählt ihre Geschichte, die im Grunde auch unsere ist. Das Pferd war die erste Muse des Menschen, inspirierte ihn schon vor Jahrtausenden zu künstlerischen Schöpfungen. Seine Zähmung revolutionierte Handel, Transport und Kriegsführung. Für die Wildpferde aber war es der Anfang vom Ende. Doch haben die Tachi Spuren hinterlassen und Schomann folgt ihnen: ins Auswilderungsgebiet Gobi B; in auf keiner Karte verzeichnete Orte sowie Zeit- und Raumvorstellungen auflösende Landschaften. Er lässt sich von prähistorischer Höhlenmalerei verzaubern und kommentiert schwungvoll wie in einem Gespräch unter Freunden die Weltliteratur sowie Reiseberichte berühmter Naturforscher wie Humboldt oder Brehm.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Stefan Schomann
Auf der Suche nach den wilden Pferden
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Stefan Schomann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Stefan Schomann
Stefan Schomann, 1962 in München geboren, arbeitet als freier Schriftsteller. Seine Reportagen, Portraits und Feuilletons erscheinen u.a. in GEO, Stern, ZEIT und der FR. Seine Bücher behandeln China, die Geschichte des Roten Kreuzes und zuletzt das Reisen zu Pferd, wofür er 2019 mit dem »Eisernen Gustav« ausgezeichnet worden ist. Schomann ist Kulturbotschafter der chinesischen Geschichtenerzähler und Ehrenbürger des Dorfes Ma Jie. Er lebt in Berlin und Peking.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Sie waren fast schon vom Erdboden verschwunden, doch nun feiern sie ein bewegendes Comeback: die Przewalskipferde, in ihrer mongolischen Heimat auch Tachi genannt. Stefan Schomann erzählt ihre Geschichte, die im Grunde auch unsere ist. Das Pferd war die erste Muse und der letzte Sklave des Menschen. Schon vor Jahrzehntausenden inspirierte es ihn zu künstlerischen Schöpfungen. Seine späte Zähmung revolutionierte dann Transport, Handel und Kriegsführung. Doch für die Wildpferde bedeutete sie den Anfang ihres Endes. Kein einziges überlebte in Freiheit, selbst das Wissen um sie ging verloren.
Schomann legt die Spuren der Tachi wieder frei und folgt ihnen bis in die Gobi, in auf keiner Karte verzeichnete Orte, in die Zeit- und Raumvorstellungen auflösende Welt der Steppe. Die sowohl Europa wie auch China stets verkannt haben – obwohl gerade sie es ist, die die beiden Erdteile zusammenspannt. Die Pferde aber wissen darum.
Ihr Schicksal mutet an wie eine Fabel, und ist doch reine und mitunter bittere Wirklichkeit. Eine exemplarische Geschichte, wie der Mensch die Schöpfung oft genug zugrunde richtet, wie er ihr aber auch Rettung bringen und Zukunft schenken kann.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Verlag Galiani Berlin
© 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen, Berlin
Covermotiv: © mauritius images / Tierfotoagentur / m.blue-shadow
Lektorat: Henry Riechers
ISBN978-3-462-32160-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Widmung
Der letzte Augenzeuge
Urwelt im Isartal
Die Pferde von Lascaux
Waldgeister
Das Kontinuum
Im Irgendwo-da-Land
Die apokalyptischen Reiter
Eine sinistre Wüste
Das Phantom der Steppe
Ein Geschenk für den Oberst
Noahs Arche in der Steppe
Orlik und Orlitza
An Bord der Arche
Viva Eurasia!
Das blaue Akkordeon
From Chernobyl with Love
Losung
Geisterbeschwörung
Bildteil
Bildnachweis
Danksagung
»Das asiatische Urwildpferd, dieses vielleicht interessanteste aller Säugetiere.«
~ Brehms Tierleben ~
Andentaucher †, Asiatischer Strauß †, Auerochse †, Balearengämse †, Berberlöwe †, Brillenkormoran †, Dodo †, Europäischer Wildesel †, Felsengebirgsschrecke †, Goldkröte †, Guam-Flughund †, Heidehuhn †, Jangtse-Delphin †, Javatiger †, Kaiserspecht †, Kalifornischer Tapir †, Karolinasittich †, Kawekaweau-Gecko †, Labradorente †, Maorikrähe †, Madeira-Kohlweißling †, Mammut †, Moa †, Mondnagelkänguru †, Nördlicher Darwinsfrosch †, Quagga †, Raubkärpfling †, Riesenalk †, Riesenfaultier †, Schomburgk-Hirsch †, Stellersche Seekuh †, Südchinesischer Tiger †, Türkisara †, Wandertaube †, Westkamel †, Wollnashorn †, Wolterstorff-Molch †, Xerces-Bläuling †, Zwergbaumratte †
Der letzte Augenzeuge
Das Dorf heißt Biidsch; Nyamsuren ist der Schweißer. Wenn er ein Wasserrohr flickt oder die Karosserie eines dieser alten, unverwüstlichen russischen Lastwagen, dann stieben die Funken wie Goldregen auf den sandigen Velours der Steppe. Anders als die meisten seiner Nachbarn betreibt er ein Handwerk, fast alle Übrigen sind Hirten. Zudem zeichnet er sich dadurch aus, dass er, Nyamsuren Muchar, der wohl letzte Augenzeuge ist, der die Tachi, die Wildpferde der dsungarischen Gobi, im Westen als Przewalskipferde geläufig, vor ihrer Ausrottung noch gesehen hat. Er kann beeiden, dass sie hier einst heimisch waren.
Biidsch wird je nach verwendeter Umschrift auch Bij oder Byj buchstabiert; ausgesprochen wird es etwa wie das englische »beach«. Was zu kuriosen Missverständnissen führt, zu semantischen Luftspiegelungen, wenn jemand ausgerechnet hier, in der meerfernsten Region der Erde, etwa kurzerhand vorschlägt: »Let’s go to beach!« Verwundert es doch schon, dass hier überhaupt etwas ist und nicht nichts. Abgesehen von drei Grenzstationen bildet Biidsch den letzten mongolischen Außenposten am Nordrand der Gobi.
Es war im Winter 1967/68, erinnert sich Nyamsuren, unten in den Tachin Schar Naruu, den Gelben Tachi-Bergen an der Grenze zu China. Er reibt sich unwillkürlich die Hände, als müsse er sie selbst jetzt noch vor dem Erfrieren bewahren. »Statt Handschuhen hatten wir nur unsere Ärmel«, erklärt er. »Aber so kannst du kein Kamel lenken; das geht nur mit bloßen Händen.« Dreizehn Jahre war er damals, als er mit seinem Großvater auf die Jagd zog. »Er wollte mich anlernen, mich überhaupt ins Leben einführen. Auch die Kälte war ein Lehrmeister.« Vom Winterlager, wo die Familie mit ihren Schafen, Ziegen und Kamelen stand, ritten sie noch vor Sonnenaufgang in die Berge. Im letzten Licht des Tages näherten sie sich schließlich einem Wasserloch, krochen hinauf auf den Kamm und spähten hinab in die mit Schilf und Büschen bestandene Oase, deren Boden mit saftigem, fast stechend leuchtendem Grün ausgepolstert war, während sich hinter ihnen nur bleiches Geröll und ein paar uralte Felsen erstreckten.
Sie pirschten auf Kulane. Diese großen mongolischen Halbesel, auch Dschiggetai genannt, sehen Pferden ähnlicher als Eseln. Doch als zwei Dutzend von ihnen zur Tränke kamen, erfasste Nyamsuren sofort, dass einer aus der Art schlug. »Tachi!«, staunte der Großvater. Und flüsterte dem Enkel zu, dass diese wilden Pferde früher die Steppe bevölkert hätten, nun aber fast gänzlich verschwunden seien. »Schau es dir gut an, wahrscheinlich siehst du nie wieder eines.« Es war eine goldbraune Stute, kräftig und wachsam. Äußerlich unterschied sie sich nur leicht von den zahmen Pferden, die er kannte. Und doch war sie von anderem Schlag, war schroffer und struppiger, mit einem klobigen Kopf, an dem die Augen fast schon bei den Ohren saßen, mit schwarzer Bürstenmähne, hellem Bauch und Streifen an den Läufen. Der Umstand, dass sie sich den Kulanen angeschlossen hatte, deutete darauf hin, dass sie vereinsamt war. So fand sie Schutz im Kollektiv der Herde, und Gesellschaft dazu.
Aus Verwunderung über diese Erscheinung, beteuert Nyamsuren, hätte der Großvater damals nicht geschossen. Drei Jahre später habe sein Schwager noch einmal eine alleinstehende Stute gesichtet; möglicherweise handelte es sich um dasselbe Tier. Danach sah man nie wieder auch nur die Spur eines Wildpferdes.
Bis 1992 eine kapitale Antonow über Biidsch kreiste und, in Ermangelung einer Landebahn, einfach auf der planen Steppe aufsetzte, einen Sandsturm im Schlepptau.
Es wäre tröstlich, ließe sich die Geschichte von Mensch und Pferd als die Geschichte einer Begegnung erzählen, gar als Märchen vom gelben Pferd. Doch sie taugt allenfalls zum Schauermärchen. Gewiss, die Menschheit erfuhr durch dieses Tier tatsächlich einen märchenhaften Aufstieg, seine Zähmung revolutionierte Transport, Handel und Kriegsführung. Bis zur Erfindung der Dampfmaschine war es der wichtigste Dynamo der Zivilisation. Für die Wildpferde aber bedeutete die Domestikation den Anfang ihres Endes. Kein einziger Vertreter dieser Untergattung überlebte in Freiheit, selbst das Wissen um sie ging verloren. So blieb etwa vom Tarpan, dem osteuropäischen Wildpferd, das Ende des 19. Jahrhunderts vom Erdboden verschwand, kein einziges Fell erhalten, von einer tauglichen Fotografie nicht zu reden. Vom Schicksal der zwischen Ural und Altai beheimateten Wildpferde wissen wir noch viel weniger, obwohl – oder gerade weil – wahrscheinlich aus ebendieser Gruppe die Hauspferde hervorgingen. Wir wissen eigentlich nur, dass auch diese Stammform ausgestorben ist. Einzig der fernöstlichsten Spielart, den Tachi eben, war ein etwas gnädigeres Geschick beschieden. In der notdürftigen englischen Umschrift firmieren sie auch als Takhi. Der Singular lautet auf Mongolisch eigentlich Tach, und auch im Plural ist das ›i‹ am Ende kaum zu vernehmen. Doch hat sich im Westen das zutraulichere Tachi für die Ein- wie für die Mehrzahl eingebürgert. Auch mein erstes Pferd, und zugleich mein erster Freund, ein lebhafter, aber stets anstelliger Schecke, auf Rollen montiert und mit dem obligaten Knopf im Ohr, hörte nicht auf den Namen Blitz, sondern auf Blitzi.
Ursprünglich waren die Tachi bis nach Sibirien und in die Mandschurei hinein verbreitet; am Ende vermochten sie sich jedoch nur in jener Region südlich des Altai-Gebirges zu halten, die man die Dsungarei oder auch Dschungarei nennt. Die Mongolen, Kirgisen, Kasachen wussten immer um die wilden Steppenpferde; sie haben sie gejagt und als Weide- und Wasserkonkurrenten bis in die Wüste hinein verdrängt. Auch chinesische Nachschlagewerke unterscheiden eindeutig zwischen Haus- und Wildpferden; die älteste Erwähnung reicht dreitausend Jahre zurück. Im Westen dagegen hatte man bis zu ihrer Entdeckung durch Nikolai Michailowitsch Przewalski 1879 keine Kenntnis von ihnen. Klammer auf: Die korrekte deutsche Transkription lautete eigentlich Prschewalski. Einer Laune der Naturkunde in Gestalt von Iwan Semjonowitsch Poljakow, Konservator am Zoologischen Museum der Akademie der Wissenschaften zu Sankt Petersburg, ist es jedoch zuzuschreiben, dass mit der wissenschaftlichen Bezeichnung die polnische Schreibweise um die Welt ging. Als Taxonom von Berufs wegen Spezialist für Abstammungsfragen, wollte Poljakow der polnischen Herkunft des Entdeckers die Ehre geben, auch wenn diesem selbst als glühendem russischem Patrioten gar nicht daran gelegen war. In Wirklichkeit war sein Urgroßvater ein Kosake gewesen, der auf Seiten polnisch-litauischer Truppen gegen Russland gekämpft und seinen Namen polonisiert hatte. Schon der Großvater hatte diesen Seitenwechsel dann wieder rückgängig gemacht. Um nicht ständig springen zu müssen, verwende ich durchgängig die polnische Schreibweise mit dem charakteristischen ›rz‹, die zugleich die zoologische Nomenklatur bildet. Es wird wie ein weiches ›sch‹ gesprochen. Allein die ungarische Literatur buchstabiert ihn jedoch auf siebenundsechzig verschiedene Weisen. Mögen auch noch so viele Geschöpfe Innerasiens seinen Namen tragen, von der Rose bis zum Rhododendron, vom Wildyak bis zum Gecko und von der Gazelle bis zum Lemming, unsterblich gemacht hat ihn allein das Pferd. Es ist eine seltsame Sache mit dem Nachruhm. Bei Richthofen, einem anderen großen Asienforscher, könnte man meinen, dass von all seinen Werken nur das Zauberwort von der Seidenstraße auf uns gekommen ist. Von Przewalski blieb nur das Pferd. Klammer zu.
Im Westen also hatte man bis zu seiner Entdeckung keine Kenntnis von ihnen. »Es ist völlig rätselhaft«, wunderte sich der ungarische Archäozoologe Sándor Bökönyi, »wie ein Säugetier von so großen Körpermaßen den Zoologen so lange unbekannt bleiben konnte«. Das einzige Großwild ähnlichen Kalibers, das noch länger unsichtbar blieb, war das Okapi. Es lebt freilich auch vorzüglich getarnt im zentralafrikanischen Urwald. Die Tachi dagegen stehen in der Steppe wie auf dem Präsentierteller. Doch das Offensichtliche kann ein probates Versteck sein. Besonders dann, wenn die, die sich eigentlich damit befassen sollten, nie ernsthaft Ausschau danach halten. So auch im Fall einer weiteren Art wilder Pferde, die ähnlich spät zur Kenntnis genommen wurde wie die Tachi, ausgerechnet die größte von allen: das Grévyzebra. Man entdeckte es dort, wo niemand nach ihm gesucht hatte: im Pariser Zoo.
Die Steppe ist der Hinterhof Eurasiens. Und doch hält gerade sie diese beiden Sphären zusammen. Man könnte elftausend Kilometer weit von Wien bis Wladiwostok reiten und müsste dabei weder zufüttern noch nennenswerte Erhebungen überwinden. Die Dsungarei wiederum ist der entlegenste Teil dieses Korridors, a gap in the map. Ob von Paris, Petersburg oder Peking aus, sie gilt allen gleichermaßen als Synonym für Unzugänglichkeit. Dabei zeigt bereits ein flüchtiger Blick auf den Globus, dass sie ausgesprochen mittig liegt, im Herzen dieser ebenso unförmigen wie unmäßigen Landmasse, die es von der Fläche her als Einzige mit den Ozeanen aufnehmen kann. Schon Alexander von Humboldt verortete in der Dsungarei den Mittelpunkt des Doppelkontinents, und er setzte alles daran, ihm so nah wie möglich zu kommen. Ein solch erhabenes Gebiet konnte gar nicht unbedeutend sein. So wie es in jeder Familie verkannte Verwandtschaft gibt, so birgt jedes Land, jede Stadt, jedes Haus solch unbestimmte, missachtete Winkel. Bis jemand ausgerechnet dort einen Schatz findet, oder einen Freund, oder ein gelbes Pferd. Und so spielt dieses Buch mitten am Rande, im Zentrum der Peripherie. Es ist ein Versuch in eurasischer Heimatkunde, mit dem Pferd als Leittier.
Die frappierend späte »Entdeckung« der Wildpferde durch westliche Forscher glich einem naturkundlichen Krimi. Damit wurde das Schicksal dieser Art allerdings fast schon besiegelt. Zwar hatte sie es geschafft, von der Domestikation verschont zu bleiben, doch nun stellten ihr neben den einheimischen Jägern auch noch westliche Museen, Zoologische Gärten und Wildtierhändler nach. Da die scheuen Tachi sich nicht fangen ließen, metzelten die Häscher ganze Herden nieder, nur um der Fohlen habhaft zu werden. Zugleich gelangte die örtliche Bevölkerung im Zuge fortwährender Kriege und Unruhen an immer bessere Waffen, und entlang der Grenze trieben mal Räuber und mal Soldaten ihr Unwesen, meist beides in Personalunion. Während der neun Jahrzehnte, die zwischen der Entdeckung der Tachi und ihrer Ausrottung verstrichen, haben, angefangen mit Przewalski, höchstens zehn westliche Reisende sie überhaupt in Freiheit zu Gesicht bekommen. Dagegen ist das Einhorn ein Allerweltstier.
Einige wenige Exemplare jedoch, ebenjene unter furchtbaren Verlusten gefangenen Fohlen, überlebten in verschiedenen Tiergärten und einem Reservat in der ukrainischen Steppe. Ein paar weitsichtigen Privatpersonen und Institutionen ist es zu verdanken, dass die Nachfahren dieser wenigen Tiere dreizehn Pferdegenerationen später wieder in ihrer angestammten Heimat, den Randgebieten der Gobi in China und der Mongolei, ausgewildert werden konnten. Doch noch immer zählen sie mit rund neunhundert freilebenden Exemplaren zu den seltensten Großtieren überhaupt. Der Pandabär, Inbegriff der bedrohten Tierwelt, bringt es auf immerhin zweitausend Exemplare. Und so fällt dieses eurasische Epos denn in ein rares Genre: eine Tragödie mit glücklichem Ausgang.
Die Antonow kreiste über Biidsch wie ein mythischer Vogel, der einen Schatz bringt. Hunderte Schaulustige waren aus nah und fern herbeigekommen, selbst Verwandtschaft aus der Hauptstadt. Wobei nah und fern in der Gobi unwirksame Kategorien darstellen. Alles kann nah oder fern sein, oder nah und fern zugleich. »Die Ferne, die man erreicht«, spricht Lao Tse, »ist nicht die wahre Ferne.« Auch drei Tage Fahrt aus Ulaanbaatar (russisch Ulan-Bator) sind nicht wirklich weit, zum einen, weil nichts dazwischenliegt, zum anderen, weil die Zeit keine Macht über die Gobi besitzt. Sie hat dort weder Zutritt noch Gültigkeit.
In diesem eigentümlichen Zwischenreich, in dem Raum und Zeit außer Kraft gesetzt scheinen, erlebten Przewalskis Pferde ihre Wiedergeburt. Kräftige Helfer wuchteten sechs forstgrüne Kisten aus dem Bauch des Flugzeugs. Ein Schreinermeister aus dem Alpenvorland hatte sie maßgezimmert; für ihn eine reizvolle Abwechslung zwischen Särgen, Kommoden und Wandtäfelungen für Wirtshäuser. Für Nyamsuren bargen sie Himmelsgaben aus einer anderen Welt. Mit klopfendem Herzen näherte er sich den Kisten. Innen blieb es ruhig. Schließlich trat er heran, bückte sich, bückte sich noch etwas mehr, spähte durch die Futterluke, steckte seine Hand hinein und stupste das Tier an der Schnauze. »Tachi!«
Urwelt im Isartal
»Ich könnte mich noch weiter über die Tugenden dieses Volkes (der Houyhnhnms, die wir bei uns Pferde nennen) auslassen; doch da ich binnen kurzem ein eigenes Buch über dieses Thema zu veröffentlichen gedenke, so verweise ich den Leser darauf.«
~ Jonathan Swift, Gullivers Reisen
Als Nyamsuren mit seinem Großvater das letzte Przewalskipferd in freier Wildbahn erspähte, sah ich mein erstes im Münchner Tierpark Hellabrunn. Lange Jahre blieb er der einzige Zoo, den ich kannte, und so glaubte ich, dass Wildpferde eben zum tiergärtnerischen Kanon gehörten, nicht anders als Pinguine, Tiger und Giraffen. Doch damals verfügte allenfalls ein Dutzend Zoos weltweit über diese Tiere, mit kaum mehr als hundert Exemplaren. Hellabrunn beherbergte die größte und selbstverständlich schönste, originalgetreueste Herde. Es war eine Münchner Spezialität, ein zoologisches Schmankerl, das Lebenswerk von Heinz Heck, der den Tierpark zu dieser Zeit noch führte.
Der Besuch dort war jedes Mal ein Feiertag für mich. Denn er verhieß eine Weltreise. Bereits in den zwanziger Jahren hatte Heck Hellabrunn als Geo-Zoo angelegt, gegliedert nach Erdteilen und Lebensräumen und nicht, wie bis dahin üblich, als eine begehbare Systematik nach Art der zoologischen Sammlungen und Lehrbücher: hier alle Katzen, dort alle Unpaarhufer, dort alle Vögel. Hellabrunn dagegen versammelte die Tiere in »geographischen Bildern«, Wohngemeinschaften, die ihren natürlichen Habitaten nachgebildet waren. So behauste die Südamerika-Anlage Wasserschweine, Pampashasen, Ameisenbären und Nandus; nur die Jaguare blieben außen vor. Der Gang zu Känguru und Emu ersetzte eine Weltumsegelung, der Anblick der Zebras, Gnus und Antilopen geriet zur Stippvisite in der Serengeti, und der Abstieg ins Souterrain des Aquariums glich einem Tauchgang in die Tiefsee.
Zusammen mit den Wisenten sowie den rückgezüchteten Auerochsen und Tarpanen bildeten die Przewalskipferde das Herzstück des »Urwildparks«. Dort kam zur Weltumrundung noch eine Zeitreise hinzu, auf der einst heimische, doch längst verschwundene oder gar ausgestorbene Großtiere wieder lebendig wurden. Hellabrunn nahm Jurassic Park vorweg. Und wäre dort nicht mittlerweile eine Kontinentalverschiebung im Gange – der Parkteil Afrika wandert in den bisherigen Parkteil Europa –, ich fände die Anlage noch heute mit verbundenen Augen. Eine Pirsch auf verschlungenen Wegen, deren beständige Krümmung allein schon Abenteuer verhieß, ein Defilee über allerhand Brücken und Inseln hinweg, vorbei am Wisent, vorbei am Wolf, untermalt von den blechernen Rufen der Kormorane und Gänse, welche die Gehege als freilebende Beigaben bereicherten.
Die Przewalskipferde verfügten über eine der größten Außenanlagen, eine Lichtung in der Waldwildnis, eine Reminiszenz an die Gobi. Das Schönste war ihre Farbe. Ein sattes blondes Steppengelb, leicht glänzend dank einem Hauch von Goldocker, akzentuiert zum einen durch das Weiß von Bauch und Maul und zum anderen durch das Schwarz von Schweif und Mähne. Zehn, zwölf Tiere bevölkerten die Anlage, ein Hengst mit mehreren Stuten, dazwischen ein paar Fohlen und Jährlinge. Die meiste Zeit grasten sie vor sich hin und hatten so gar nichts Wildes, Feuriges an sich. Manchmal trottete eines hinüber zum Unterstand. Hin und wieder aber kam Bewegung in die Herde, und dann preschten zwei, drei Tiere um die freistehenden Birken herum, als spielten sie Fangermanndl. Doch sie repetierten einfach zwischendurch ihre Rangordnung. Noch trugen einige, als ein Versprechen auf gelingende Integration, kernbayrische Namen wie Rochus, Rasso oder Sigi. Wobei der Zeitgeist bereits umschwenkte, so dass nun Roger, Rovina und Sirikit zum Zuge kamen.
Wenn es im Herzen Europas eine Landschaft gibt, die auf exotische Waldwildnis einzustimmen vermag, die vorgeburtliche Umschlossenheit gewährt und amphibische Labyrinthe birgt, so sind es die Isarauen um München. Ein Mato Grosso im Alpenvorland. Hellabrunn liegt an einem Altarm, eingefasst von steilen Ufern. Unten in der Senke führte die Pforte hinein in ein geheimnisvolles Reich. Auch jedes einzelne Tier dort barg ein Geheimnis; nie konnte ich genug bekommen von all der rätselhaften Schönheit und Andersartigkeit, die hier versammelt war. Doch auch ohne den Zoo bilden die Isarauen ein bedeutendes Habitat. Hier leben, noch im Stadtgebiet, Uhu und Eisvogel, Ringelnatter und Kreuzotter, Prachtlibelle und Schillerfalter. Im Fluss tummeln sich Urviecher wie der Biber oder der Huchen, ein dreißig Kilo schwerer Salmonide. Vor einigen Jahren kreuzte gar ein Pelikan stoisch vor der Praterinsel, just vis-à-vis des Bayerischen Landtags. Handelte es sich um einen weiteren Vorboten des Klimawandels? Sieh da! Sieh da, Timotheus! Zwar stellte sich heraus, dass er einem Tiroler Zoo entfleucht war, doch auch ihm waren die Isarauen höchst einladend erschienen. Thomas Manns ungewohnte Liebeserklärung an sie gilt bis heute: »Das ist kein Wald und kein Park, das ist ein Zaubergarten.«
Auch die Isar selbst ist Wildnis: Isaria, die Reißende – ein Sturzbach vom Kaliber eines Stroms. Im Stadtgebiet war sie freilich durch Befestigungen und Stauwehre gehörig domestiziert und an die Kandare genommen worden. Doch inzwischen hat München diesen letzten deutschen Wildfluss zurückgewonnen. Wildnis hat Konjunktur. Aus ödem Gerinne wurden wieder weite Schleifen, aus reizlosen Überflutungsflächen artenreiche Biotope. Im Herzen der Stadt bildete die urbane Feuchtsavanne des Englischen Gartens seit je den Inbegriff bajuwarischer Lebensart. Und dann war da noch die Pupplinger Au: ein berüchtigtes, zugleich verstörendes und verlockendes Nacktbaderevier, verteilt über zahllose Kiesbänke und abgeschirmt von Erlen, Weiden, Tamarisken. Eine Landschaft im Fluss. Beständig verlagert die Isar hier ihr Geschiebe und sucht sich neue Wege im alten Bett. Nach einem Hochwasser findet sich ein Strommast schon mal am linken statt am rechten Ufer wieder. Klopfenden Herzens betraten wir Kinder diese Urlandschaft, in der eingeengte Städter ihre Auswilderung betrieben. Wir aber pirschten auf die eigentlichen Attraktionen der Au – Smaragdeidechsen, Schwalbenschwänze, Grünspechte. Und einmal sogar auf einen Schwarzstorch auf der Durchreise.
Herbert Riehl-Heyse schrieb dem Reporter ins Stammbuch, er sei, wie jeder Mensch, dazu verpflichtet, seine Mythen einzuholen. Wer dies eines Tages vollbringt, kreuzt seinen eigenen Weg. So begegnet der fast Sechzigjährige dem gerade mal Sechsjährigen wieder. Zwei und derselbe. Für ein paar kostbare Stunden und Tage offenbarte Hellabrunn damals die Welt. Später, erheblich später, doch ein jegliches hat seine Zeit, bei den Bären in der jakutischen Taiga etwa, oder bei den Urwaldriesen am Ufer des Ubangi, oder bei den Walrossen, die auf Eisschollen durch eine frankophone Arktis trieben, später dann also, bei den wogenden Bisonherden in Süd-Dakota, oder den Pelikanen auf den großen Balkanseen, die sich keineswegs verflogen hatten, sondern seit Jahrzehntausenden dort heimisch waren, oder damals, im schwerelosen Taumel an den Riffen vor Celebes – da war die Welt wie Hellabrunn. Man konnte sogar, nun schon für kostbare Tage und Wochen, mitten darin übernachten und vernahm dann das Heulen der Wölfe im winterlichen Yellowstone, lauschte dem Dschungel am Río Pastaza, wo es in allen Tonlagen zirpte und trällerte und gluckste und klopfte, weit opulenter noch als in der Pupplinger Au, verfiel schließlich dem Sirenengesang der letzten Gibbons in den Bergen von Yunnan, einem fordernden Flehen hoch in den Wipfeln, und spürte einmal auch die Erde erzittern, als die Nilpferde am Manyara-See sich zwischen den Zelten hindurch in die Büsche schlugen.
Auch Tarpane, Wisente und Auerochsen verfügten in Hellabrunn über geräumige Gehege, der Urwildpark bildete einen Kontinent für sich. Mit diesem Projekt haben Heinz Heck und sein Bruder Lutz Zoogeschichte geschrieben, und Zoologiegeschichte dazu. An der Rettungszucht der Wisente und der Przewalskipferde waren beide maßgeblich beteiligt. Die letzten freilebenden Wisente im Urwald von Białowieża in Russisch-Polen waren während des Ersten Weltkriegs aufgerieben worden. Danach ergab eine weltweite Inventur, dass nur mehr sechsundfünfzig Exemplare von Europas größtem verbliebenen Säugetier in Gefangenschaft lebten. Alle heutigen Wisente stammen von zwölf dieser Gründertiere ab. Bei den Tachi war die Lage ähnlich kritisch, auch wenn hier noch eine ungewisse, doch schon damals verschwindend geringe Zahl in freier Wildbahn lebte. Die älteste Herde in menschlicher Obhut, die in Askania Nova in der Ukraine, ging im Zweiten Weltkrieg zugrunde. Etwa dreißig weitere Tiere befanden sich, über die halbe Erde verstreut, in Zoologischen Gärten und Wildgehegen. Ohnehin stammen alle heutigen Przewalskipferde von nur zwölf Gründertieren ab. Als dreizehnte kam dann noch Orlitza II, die berühmte Orlitza II hinzu, eine später gefangene Nachzüglerin.
In jenen Jahren wurde die Öffentlichkeit sich der Gefahr des unwiderruflichen Aussterbens zahlreicher Arten bewusst. »Es ist eines der erschütterndsten Kapitel in der Geschichte unserer Tage«, bekannte Lutz Heck, damals Zoodirektor in Berlin und als Doktor der Philosophie der effektvollste Stilist des Hauses Heck, »wie eine ganze, lebensstarke Tierart weggewischt wird vom Erdboden, ausgelöscht fast, einzig durch die Unvernunft der Menschen, ihre Habgier, ihren Ehrgeiz, ihre blinde Zerstörungswut, und wie ebendiese Menschheit, auf einmal zur Besinnung gekommen, die letzten Trümmer ihres Vernichtungswerkes zusammensucht und wieder wachsen läßt in planvollem Schutz.« Das Rettende wuchs also auch. Gemeinsam mit Gleichgesinnten zwischen Rotterdam und Warschau, Cincinnati und Adelaide machten die Hecks sich daran, eine neue Arche zu zimmern, »um diese Letzten ihrer Art vor dem völligen Untergang zu bewahren«. Darin bestärkte sie ein Sensationserfolg mit anderen Urtieren: Nach mehreren Anläufen glückte in München die erste Geburt eines Afrikanischen Elefanten in Gefangenschaft. Ein Langzeitprojekt, erfolgte sie doch nach Elefantenart beinahe zwei Jahre nach der Paarung. 1939 zeigte Hellabrunn auch noch den ersten Pandabären in Europa.
Allmählich begannen die Zoologischen Gärten sich zu ehrgeizigen Zucht-Häusern zu entwickeln. Bis dahin war es ihnen vor allem um das Tier als Schaustück zu tun gewesen, nicht um die Reproduktion, geschweige denn die Arterhaltung. Bei Bedarf ließen sie einfach neue Exemplare aus einer vermeintlich unerschöpflichen Natur fangen. Tote Affen wurden durch neue Importe ersetzt. Auch waren die Bedingungen in den meisten Zoos nicht so, dass die Tiere auf Vermehrung erpicht gewesen wären.
Freilich stieß die Idee des Artenschutzes damals wie heute oft genug auf Achselzucken. Lutz Heck pflegte zu erwidern: »Was bringt es ein, wenn einige Wisente unter Bäumen stehen und grasen? Was hat man von ihnen? Nichts, nichts hat man von ihnen als die Freude an ihrem Dasein.« Einem Dasein, dessen voller Wert sich spätestens dann offenbart, wenn man es seiner Alternative gegenüberstellt, dem Nichts. Ist uns ein Geschöpf erst einmal abhandengekommen, kann keine Macht der Welt es je wiedererlangen.
Oder vielleicht doch? Hat nicht die Wissenschaft gewaltige Fortschritte bei der Entschlüsselung des Erbgutes gemacht? Schicken sich die Alchemisten in den Gen-Laboren nicht schon an, ausgestorbene Arten zu klonen und Mammute oder Riesenalks wiedererstehen zu lassen? In den dreißiger Jahren war die Biotechnologie weniger ausgereift, so dass die Hecks sich konventioneller Verfahren bedienen mussten. Um den ausgerotteten Auerochsen zu reanimieren, verpaarten sie urwüchsige Hausrindrassen: Spanische Kampfstiere und Korsische Kühe, Podolische Steppen- und Schottische Hochlandrinder. Sie warfen sie gleichsam in einen Topf und schufen daraus eine neue, archaisch anmutende Rasse, die auch als »Heckrind« bezeichnet wird. In gleicher Weise kreuzten sie urtümliche Hauspferde sowie Przewalskipferde miteinander, um das entschwundene europäische Wildpferd, den Tarpan, zu doubeln. Die Naturgeschichte ging in Revision. Es war ein utopisches Projekt, eine Züchtung, um alle vorhergehende Züchtung ungeschehen zu machen. Die Zeit sollte umgekehrt, die Domestikation rückwärtsbuchstabiert werden – ein zoologisches Palindrom. Die ersten Exemplare kamen 1932 zur Welt. Den Brüdern wurde später ihre Nähe zum Naziregime und ihr Enthusiasmus für Erbgang und Rasse angekreidet. Doch sie folgten eher dem Zeitgeist als den Ideologen. Ursprünge waren eine Obsession der Epoche. Zur gleichen Zeit machte sich etwa der polnische Tierarzt Tadeusz Vetulani daran, den Tarpan auferstehen zu lassen. Auch er suchte in abgeschiedenen Landstrichen nach Pferden, die dessen Phänotyp möglichst nahekamen. Er fand sie in den Koniks, was nichts anderes als »Pferdchen« bedeutet, robusten Bauernponys aus dem Waldland von Zamość, südöstlich von Lublin, in denen noch viel Wildpferdeblut floss, war doch die letzte bekannte Tarpanherde Anfang des 19. Jahrhunderts darin aufgegangen. Graf Zamoyski hatte ihr in seinem weitläufigen Tierpark Asyl gewährt. Später haben Zamość und seine Wälder noch einmal Kulturgeschichte geschrieben, als Geburtsort von Rosa Luxemburg, deren Vater dort im Holzhandel tätig war. Nicht von ungefähr studierte sie zunächst Biologie. Vetulani siedelte seine knapp vierzig Tiere umfassende Herde dann aber im Urwald von Białowieża an, um auch das Verhaltensrepertoire der Wildpferde wiederzuerwecken. Die weitere Auslese sollte der Natur überlassen bleiben; anders als den Gebrüdern Heck stand ihm mit dem dortigen Nationalpark, der damals noch komplett auf polnischem Territorium lag, eine Landschaft zur Verfügung, durch die noch in historischer Zeit Wildpferde gestreift waren. Der Zweite Weltkrieg machte seine Bemühungen dann weitgehend zunichte.
Später werden wir einem Beispiel begegnen, dass das Konzept der Rückzüchtung auch vor den Hominiden nicht haltmachte. Als Gegenbewegung zur fortschreitenden Entwurzelung der Moderne forschte man damals überall nach Ahnen, Quellen, Mutterschößen. Der zunehmenden Verunsicherung suchte man mit stärkerer Verankerung zu begegnen. Schon in den zwanziger Jahren präsentierte Hellabrunn publikumswirksam die Tierwelt aus »Germaniens Urwäldern«. Diese Rückbesinnung war eine Reaktion auf die Entfremdungen der Moderne, war die notwendige Folge einer Zeit, in der die heimischen Naturräume rapide schwanden. Der Steinbock war aus den Alpen so gut wie verschwunden, und selbst der Rothirsch drohte infolge großflächiger Rodungen und der Expansion von Landwirtschaft, Siedlungs- und Straßenbau auszusterben. Hätte die Jägerschaft sie nicht durchgefüttert, die Restbestände hätten zwei harte Winter in Folge womöglich nicht überstanden.
Schon bei den Auerochsen, seit jeher programmatisch auch »Ur« genannt, hatte es bemerkenswerte Versuche gegeben, die Art zu retten. So hatte Landgraf Wilhelm IV. von Hessen 1571 einen fünfhundert Morgen großen »Thiergarten« anlegen lassen, der Europas Fauna fürsorglich versammelte. Die Ure grasten zu Füßen der Sababurg; die ältesten Eichen dort dürften sich noch an sie erinnern. Auch Hirsche, Gämsen, Bären wurden ausgesetzt, und dazu noch, fast schon im Stile der hagenbeckschen Tier- und Völkerschauen, Elche und Rentiere »nebst einer wilden Lappen-Frau«. Den entschlossensten Versuch, das Aussterben der Wildrinder abzuwenden, unternahm der Herzog von Jaktorow in Polen. Er stellte die Tiere mitsamt ihrem Habitat unter Schutz und heuerte Leibwächter für sie an. So fristeten sie ihr Gnadenbrot, bis 1627 auch die letzte Kuh verendete. In den Wäldern von Zamość, wo später auch der Tarpan seine letzte Bastion hatte, scheinen sie sich noch etwas länger gehalten zu haben, und aus dem Königsberger Tiergarten wurden noch vier Dezennien später einige Exemplare vermeldet. Schließlich aber war Bos primigenius, der Stammvater aller Hausrinder, unwiederbringlich verloren.
Die Hecks verfolgten dann ein mehr als ehrgeiziges Ziel, wollten sie doch nicht nur bedrohte Tierarten vor dem Verschwinden bewahren, sondern sogar verschwundene wiederbeleben. »Es war wie ein Märchen, nur sehr viel aufregender«, bekannte Heinz, der jüngere, zurückhaltendere der Gebrüder. Zugleich wollten sie durch ihre Versuche der »Volksbelehrung« auf die Sprünge helfen, wollten »lebende Denkmäler« der Natur- wie der Kulturgeschichte schaffen. Auch die »Degeneration durch Leistungszucht« war bereits ein Thema. Es war, als hätte jemand einen Tunnel durch die Zeit getrieben, und man spähte fassungslos hindurch ans andere Ende. Wobei auch diese Anschauungswesen beinah wieder ausgestorben wären, denn nur einige Dutzend Auerochsen alias Heckrinder und Tarpane alias Heckpferde überlebten den Zweiten Weltkrieg, wurden doch sowohl der Berliner Zoo wie auch der Münchner Tierpark von Bomben verwüstet.
Parallel zu den Züchtungen in Zoologischen Gärten entstanden Schauanlagen wie das »eiszeitliche Wildgehege« im Neandertal oder der Wisentpark im niedersächsischen Springe. Darüber hinaus setzten die Hecks und andere »Ur-Macher«, wie man sie scherzhaft nannte, verschiedene Großsäuger in Schutzgebieten aus. Mal Wisente, mal Przewalskipferde, mal hecksche Auerochsen, auch mal Elche, und mal alle zusammen. Es war ein Experiment in zwei Richtungen: Wie würde die Wildnis die Zootiere verändern, und wie diese die Wildnis? Der Krieg machte diese frühen Versuche zunichte. Mittlerweile hat indes eine erneute Rückbesinnung auf die »vergessene Megafauna« eingesetzt, auf jene Herden großer Huftiere, die in den Szenarien der Klima- und Vegetationskundler, aber auch im Weltbild vieler Naturschützer oft schlicht nicht vorkommen. Doch die Vorstellung von undurchdringlichen Wäldern als europäischer Urlandschaft ist eine Mär. Nur weil der Mensch die großen Pflanzenfresser derart dezimierte, konnte der Wald sich ungehindert ausbreiten. Keine Naturlandschaft in Europa, auch kein Nationalpark, bietet heute ein authentisches Bild, eben weil so viele Huftiere fehlen; von subversiven Kräften wie dem Biber nicht zu reden. Hingegen vermittelt Hellabrunn mit seinem Mosaik aus Auen, Wiesen und Wald eine durchaus taugliche Vorstellung der einstigen Urlandschaft und präsentiert ihr Tierleben auch in seiner ganzen beglückenden Vielfalt. Prompt löst der Anblick der schwergewichtigen Herden und des halb offenen Waldlandes Wohlbehagen in uns aus. Die Kassenhäuschen denken wir uns einfach weg.
Je mehr Arten auf einen Lebensraum einwirken, desto mannigfaltiger gestalten sie ihn. In zahlreichen Beweidungsprojekten kommen Przewalskipferde, Heckrinder und urtümliche Haustierrassen mittlerweile ganzjährig als ökologische Werkzeuge zum Einsatz. Sie sollen Naturschutzgebiete, Wiesentäler oder aufgegebene Truppenübungsplätze offen halten. Selbst die Todeszone von Tschernobyl ist durch Nachfahren von Orlitza II wiederbelebt worden.
Just zu der Zeit, als die Hecks ihre Urwelten erschufen, stachelten sensationelle Funde prähistorischer Figuren und Felszeichnungen die Phantasie der Öffentlichkeit zusätzlich an. Von der Schwäbischen Alb bis zu den Pyrenäen und von den Lofoten bis zur Ägäis kamen immer mehr davon zum Vorschein. Eine eiszeitliche oder, wie man damals noch zu sagen pflegte, diluviale Menagerie, die Kamele, Strauße, Wisente, Löwen, Nashörner und Mammuts versammelte. Wer diese Ungetüme derart lebensecht darstellen konnte, musste sie selbst noch gesehen haben. Nirgendwo aber wurden derart spektakuläre Bildnisse entdeckt wie bei Lascaux im Südwesten Frankreichs.
Die Pferde von Lascaux
»Es scheint, als wäre die Kunst auf die Welt gekommen wie ein Fohlen, das von Geburt an auf eigenen Beinen stehen kann.«
~ John Berger
Die Hügelkuppe von Lascaux erhebt sich am Eingang zu einem Engpass. Von Norden kommend, hat die Vézère sich hier durch ein Massiv aus Sandstein gebohrt und ein Labyrinth aus Siphonkurven, Steilufern und schroffen Höhen geschaffen. Etwa sechzig prähistorische Stätten reihen sich entlang dieses dreißig Kilometer langen Flussabschnitts im Périgord aneinander. Ein Ballungsraum der Vorgeschichte, dessen Jagd- und Lagerplätze von der Zeit der Neanderthaler bis hinein ins Mittelalter durchgehend genutzt worden sind. Dies mag den stolzen Titel rechtfertigen, den die Region sich gab: das Tal des Menschen.
Im September 1940 durchstöberten vier Jugendliche den Hangwald von Lascaux. Natürlich suchten sie einen Schatz – Urform allen archäologischen Drangs ins Verborgene. Ihr Begleiter, ein Hund namens »Robot«, jagte ein Kaninchen, das in einer Erdspalte verschwand. Sie erwies sich als der verschüttete Eingang zu einer Karstgrotte. Die jungen Leute zwängten sich hindurch und gelangten in einen ovalen Saal vom Volumen einer Dorfkirche. Im Licht ihrer Ölfunzel dämmerten immer mehr Tiergestalten hervor und mit ihnen die Ahnung, etwas Einzigartiges entdeckt zu haben. Seit rund siebzehntausend Jahren prangte hier das größte Felsgemälde der Welt im Untergrund.
Sie schworen einander, das Geheimnis auf ewig zu bewahren. Nach drei Tagen wusste es das ganze Tal. Der Priester Henri Breuil, der mit wahrem Furor alles Urgeschichtliche erforschte, eilte nach Lascaux und erlebte eine Offenbarung. Bald entwickelte sich der Fund zur Touristenattraktion. Doch die Besucher veränderten die empfindliche Atmosphäre in der Höhle, und so musste sie 1963 für die Öffentlichkeit geschlossen werden. Später entstand unweit des Originals eine detailgetreue Attrappe, Lascaux II. Parallel machte eine Wanderausstellung als Lascaux II weltweit die Runde. Doch dann tauchte am Nordrand der Provence eine Rivalin auf. Die Malereien der Grotte Chauvet mögen weniger formvollendet wirken, dafür sind sie doppelt so alt. Unpassenderweise wurde dieses Wunderwerk nach einem der Höhlenkundler benannt, die es 1994 entdeckt haben. Zwei Jahrzehnte später eröffnete nebenan eine Nachbildung, die seither jährlich rund sechshunderttausend Besucher verzeichnet. Das Périgord wollte nachziehen. Mit einem spektakulären Faksimile, das zugleich hypermodern und archaisch anmutet: Lascaux IV. Entworfen wurde es von dem norwegischen Architektenbüro Snøhetta, das auch die Oper in Oslo gestaltet hat. Wie die Originalhöhle, so ist auch ihr Ebenbild als Kultstätte konzipiert. Mit pharaonisch schrägen Wänden, mit viel Beton, dem Fels der Moderne, und mit einem starken Zug ins Horizontale. Die gezackte Silhouette erinnert an eine Fieberkurve; ein Zeitblitz, der in die Gegenwart einschlägt. Ende 2016 eröffnete das Haus im Beisein des letzten noch lebenden Entdeckers, der damals »Robot« nachgestiegen war.
Vor gut zwanzig Jahren hatte ich das Glück, auch das Original besuchen zu können. Wie schon zu Urzeiten gerät der Einstieg zur Initiation. Vorab die Einweisung im Waldhäuschen, wo der Höhlenwart gedanklich in die Unterwelt einführt, um drinnen nur mehr das Nötigste reden zu müssen. Dann die paar Schritte bis an die Pforte, hinter der es siebzehntausend Jahre in die Tiefe geht. Der mit schweren Steinquadern eingefasste und mit einer Stahltür versiegelte Eingang betont den sakralen Charakter des Ortes. Eine Schleppe breiter Stufen führt hinab wie in ein Heiligtum. Mehrere Schleusen sollen Licht und Außenluft fernhalten. Die Schuhsohlen werden in einem Formalinbad desinfiziert, eine chemische Läuterung. Das Pizzicato Aberhunderter von Wassertropfen hängt als Klangvorhang vor der letzten Tür, dahinter herrscht modrige Kühle und Finsternis. Wie im Kino glimmt eine Notbeleuchtung an den Wänden.
Ich hatte mir vorgenommen, einen kühlen Kopf zu bewahren und, falls gar Enttäuschung aufkeimen würde, sie auch zuzulassen. Umsonst – die Wirkung war derart stürmisch und absolut, dass diese Bilderzentrifuge bis heute in der Erinnerung rotiert. Hier haben Meister ihres Fachs Regie geführt. Bei aller Rauschhaftigkeit wirken sowohl die Komposition des Riesenrundgemäldes als auch seine einzelnen Elemente von souveräner Überlegung geprägt. Als Gesamtkunstwerk funktioniert Lascaux noch wie am ersten Tag, wie auch die Farben, das Rot, das Schwarz, das Ocker, an den feuchten Wänden leuchten, als wären die Maler nur mal eben rausgegangen, um frische Luft zu schnappen. Je länger man emporschaut, umso mehr Figuren treten hervor. Ein steinernes Firmament, an dem die Tierkreiszeichen aufgehen. Animal, Anima, Animation. Pferde sind dabei überproportional häufig vertreten. Hirsche und Rentiere wurden weit öfter erlegt, da sie etwas langsamer und, nun ja, auch etwas unbedarfter sind, und weniger wehrhaft dazu. Doch als Motiv tauchen sie nur vereinzelt auf, während Pferde exzessiv gemalt wurden. Mit über dreihundertfünfzig Exemplaren handelt es sich um das mit Abstand populärste Tier in Lascaux, es steht für sechzig Prozent aller Darstellungen. Dieser Anteil hat sich quer durch die Kunstgeschichte kaum verändert; drei von fünf jemals gemalten Tieren dürften Pferde gewesen sein.
In der Höhle kommen sie als Ponyparade auf einem Sims vor, als quirlige Herde, als fallendes oder sich wälzendes Pferd, mal lebensgroß, mal als Fragment. Sowie als »chinesische Pferde«, wie der Abbé Breuil sie taufte, erinnerten sie ihn doch an Grabmalereien, die er in China gesehen hatte. Vor allem aber ähnelten sie frappierend jenen Wildpferden, die Przewalski sechzig Jahre zuvor in der chinesischen Dsungarei entdeckt hatte: die ockergelbe Färbung, die Stehmähne, der schwarze Aalstrich auf dem Rücken, der etwas bullige Körperbau. In wogendem Reigen prescht die wilde Jagd rund um die Kuppel, man glaubt sie schnauben, brüllen, galoppieren zu hören, meint Moschus und Pferdeäpfel zu riechen. Das Fleisch war immer schon im Fels verborgen, die Maler setzten es nur frei. Eine Wölbung geriet zum Fetthöcker eines Wisents, ein Grat zum Widerrist eines Pferdes, ein Loch zum Kuhauge. In diesem Ausgehen von der Materialität des Untergrunds drückt sich eine frappierend moderne Kunstauffassung aus. Ebenso im Nebeneinander verschiedener Maßstäbe und Perspektiven, von figurativer Bestimmtheit und äußerster Abstraktion, in der Stilisierung fast bis zum Logo, im Einsetzen des Kunstwerks in die Natur und in der aktiven Teilnahme der Betrachter. Man könnte die Schöpfer von Lascaux unbesorgt zur nächsten Biennale einladen.
Die letzte Phase der Initiation bildet die Wiedergeburt, die Rückkehr in die Wirklichkeit. Die linde Luft, das Grün, das Licht, all das nimmt man wie in Trance wahr, tief atmend und in gesteigerter Intensität. Doch zugleich wirkt alles hier draußen denkbar unerheblich, oberflächlich eben, und mit einem Mal so sterblich.
Als die Malereien entstanden, herrschte in Südfrankreich ein Klima wie heute in der Mongolei, nur mit kühleren Sommern. Zwischen den Gletschern der Alpen und der Pyrenäen erstreckte sich eine weitläufige Kältesteppe mit opulenter Fauna. Ein paar Kilometer flussabwärts versucht der Wildpark von Le Thot sie in Fleisch und Blut zu präsentieren. In klassisch heckschen Arrangements weiden Wisente, Auerochsen, Steinböcke, Tarpane und Przewalskipferde in weitläufigen Gehegen. Amüsiert berichtet der Tierpfleger, er müsse den Besuchern erst erklären, dass diese Pferde nicht zum Streicheln geschaffen seien, dass sie sich auch mit noch so frischem Gras nicht anlocken ließen, und dass sie nie gezähmt worden sind. Seit der Eröffnung von Lascaux IV hat sich auch hier die Zahl der Besucher verdoppelt, was die Einrichtung eines Wolfsgeheges ermöglichte. Mammuts, Höhlenlöwen und Wollnashörner muss die Phantasie ergänzen.
Sowohl im Wildpark wie in der Nachbildung der Höhle tummeln sich Kinder und Schulklassen. Die steinzeitlichen Bilderbücher finden in ihnen ihr verständigstes Publikum. Im Freiluftatelier von Le Thot pinseln und pusten sie an künstlichen Felsen um die Wette. Kinder besitzen einen privilegierten Zugang zur vorgeschichtlichen Welt. Die Tierwesen sind ihnen nah, die geheimnisvolle Verbindung von Kreatur und Kreativität lebt in ihnen fort.
Mehrere Tage lang streife ich danach durchs Tal. Folge der von Pappeln gesäumten Vézère, wandere über die durchfurchten Plateaus, tausendfältig wie ein Gehirn. Verwunschene Dörfer schmiegen sich an die Klippen, hie und da dräut eine Ritterburg herüber. In den Wiesen blühen Orchideen wie anderswo Unkraut, Schmetterlinge taumeln um sie her. Verstohlen kampiere ich in der Nähe prähistorischer Plätze, zum einen, um den wilden Mann zu spielen, vor allem aber deshalb, weil sie regelmäßig an den schönsten, lauschigsten Ecken liegen. Mit einer schützenden Felswand im Rücken, freiem Blick nach vorne, einer Wasserstelle nahebei, und einem leichten Lüftchen, das die Mücken fortbläst, dazu nicht weit von einer Furt, durch die das Wild ziehen musste. Die reichen Vorkommen von Feuerstein machten das Tal überdies zu einem paläolithischen Industriegebiet. Dieses bevorzugte Muster für Lagerstellen findet sich quer durch Eurasien, und über die eiszeitliche Landbrücke gelangte es mit den ersten Amerikanern bis nach Alaska. Auch Lascaux IV folgt unwillkürlich diesem Archetypus. Es bietet Rückendeckung durch den Hang, Schutz vor Wind und Wetter, weite Sicht sowie ein paar Springbrunnen als sprudelnde Quellen. In den Höhlen selbst haben die Menschen dagegen nie gelebt, sie dienten ihnen nur als Unterstände, Kühlkammern und Kultstätten.
Jede Ausgrabung im »Tal des Menschen« brachte vor allem neue Fragen ans Licht, erhärtete nur ihre eigene Unwahrscheinlichkeit. Nach Zufallsfunden in verschlafenen Dörfern wurden Jahrzehntausende benannt, so das Magdalénien und das Moustérien. Fünf Skelette aus einer Felsnische bei Cro-Magnon gaben gar einem ganzen Menschentyp den Namen, dem ersten mit rundum moderner Anatomie. Einige der frühesten Immigranten Frankreichs, tauchten sie hier vor knapp vierzigtausend Jahren auf. Der Name könnte treffender nicht sein: Cro-Magnon heißt in der hiesigen Mundart schlicht »großes Loch«. Ein leerer Ursprung, ein nutzloses Geheimnis. Der Schoß der Zeit, dem wir entsprungen sind.
Das Périgord würde zu den abgeschiedensten Landstrichen Europas zählen, wäre es nicht in zwei Disziplinen Weltspitze, in der Prähistorie und in der Gastronomie. Beide stehen in Verbindung, gibt doch klassische Jäger- und Sammlerbeute der Küche Kolorit: Nieder- und Federwild, Trüffel, Pilze, Nüsse und Waldfrüchte. Auch Pferde werden vielfach noch verschmaust, gleichberechtigt mit Rind- und Schweinefleisch. Einige Reitbetriebe sind gar dazu übergegangen, jene Tiere, die eingeschläfert oder geschlachtet werden müssen, am Ende selbst zu essen, bevor die Abdecker nur Schuhcreme, Kleister und Hundefutter daraus machen. So haben alle teil am Kreislauf von Werden und Vergehen. In Ländern wie Frankreich, Italien oder Island, die Hippophagie betreiben, in denen also Pferdefleisch verzehrt wird, ist der einstige Charakter als Wildbret noch erkennbar. Und damit der Ursprung unserer Faszination: Pferde waren nicht Freunde, sondern Beute. Wir hatten sie zum Fressen gern. Die Geisterherden an den Wänden von Lascaux waren sowohl Kriegs- wie auch Liebeserklärung an diesen kapitalen Fang.
Neben einer Handvoll prominenter Fundstätten gibt es Dutzende kleinerer Schlupfwinkel im Tal. Die meisten befinden sich in privater Hand. Auch Cap Blanc gehörte lange einer Familie aus der Nachbarschaft, die sich liebevoll darum kümmerte. Mittlerweile hat der Staat es übernommen, prompt geht es merklich spröder zu. Der Faszination tut dies keinen Abbruch. Ein mannshoher horizontaler Spalt birgt einen fast vierzehn Meter langen Fries mit Pferden, die mitsamt Augen, Zähnen, Nüstern, Mähnen und Schweifen aus dem Kalkstein herausgemeißelt wurden. Der Raum davor diente als Basislager. Was uns der röhrende Hirsch im Wohnzimmer, war diesen Leuten die Pferdeherde an der Rückwand ihres Biwaks. Man kann sich unschwer vorstellen, wie die sich überlagernden Figuren im Feuerschein zu tanzen begannen und die Steinwand zur Leinwand wurde.
Eine aparte Kuriosität stellen die blauen Pferde von Villars dar. Sie wurden nicht etwa mit blauer Farbe gemalt, sondern sind hauchdünn von Kalkspat-Ausfällungen überzogen, so dass man glauben könnte, Yves Klein habe seine Hand im Spiel gehabt. Ganz in der Nähe betreibt Laurence Perceval eine Araberzucht; darüber hinaus nutzt sie die Tiere für die therapeutische Arbeit. »Schon C.G. Jung wusste: Pferde bringen uns ins Hier und Jetzt«, erläutert sie. »Zugleich spiegeln sie uns. Unsere Emotionen, unsere Blockaden, unsere Ängste. Und gestatten uns so, zu besseren Menschen zu werden.« In ihren Kursen präsentiert sie opulente Bildbände über vorgeschichtliche Kunst. »Die Felsbilder zeigen, dass diese frühen Menschen nicht nur mit dem Überleben beschäftigt waren, sondern dass sie auch geträumt haben. Pferde hatten etwas Fesselndes, ja Weihevolles für sie. Auch dann, wenn sie sie gegessen haben.« Perceval ist davon überzeugt, dass die Menschen damals anders mit Tieren kommuniziert haben, dass diese Fähigkeit heute aber weitgehend verloren gegangen ist. Das Pferd als Menschenflüsterer: »Tiere können direkte Botschaften an unser Gehirn senden. Etwas Ähnliches haben die Urmenschen vielleicht mit ihren Bildern versucht.«
Eine weitere Pilgerstätte für jeden Pferdefreund bildet die Höhle von Pech Merle, eine Fahrstunde südöstlich. Sie birgt die berühmten »Tigerpferde«, die auf den ersten Blick wie Apfelschimmel wirken. Existierten etwa noch andere Spielarten des Urpferdes? Die Höhle gibt die Antwort. Ähnlich wie in Lascaux waren es auch hier junge Leute, die 1922 den Eingang zu einer verschütteten Grotte fanden. Bewehrt mit Taschenlampen und einem kleinen Seil, entdeckten sie eine der prächtigsten Tropfsteinhöhlen weit und breit. Zwischen den Gesteinstürmen prangten überall Malereien an den Wänden wie in einer unterirdischen Galerie.
Auch hier war es ein Priester, der das schamanische Erbe fortführte. Amédée Lemozi, der örtliche Curé, setzte die besten Detektive auf die Vorgeschichte an, die er in seinem Sprengel finden konnte: die Bauernkinder. Wenn er ihnen allwöchentlich den Katechismus nahebrachte, holte er hinterher seine Sammlung steinzeitlicher Utensilien hervor. Solltet ihr draußen so etwas entdecken, oder gar Zeichnungen an den Felsen, dann gebt mir Bescheid. Auch die Kinder von Pech Merle hatte er so zu ihrem Abenteuer angestiftet. Später bildeten seine Fundstücke den Grundstock für das dortige Museum. Es zeigt die Habe der Cro-Magnon-Menschen, Waffen, Werkzeuge, Kleidung und Schmuck. Pfeil und Bogen sind noch nicht dabei – sie wurden erst nach Ende der Eiszeit entwickelt. Dafür finden sich dreiundzwanzigtausend Jahre alte Nähnadeln aus Wildpferdknochen. Anders als im Fall der Speerschleuder wüssten wir auch heute noch problemlos damit umzugehen.
Über metallische Stufen geht es dann vierzig Meter in die Tiefe. Der Anblick des ersten großen Saales ist buchstäblich traumhaft – eine in den Boden hineinversenkte Kathedrale, die über und über mit Tropfsteinen behangen und bestanden ist, die sich über mehrere Ebenen erstreckt und in weiteren Hallen fortsetzt. Im oberen Teil winden sich die Wurzeln einer Eiche wie ein Rapunzelzopf mitten hindurch. Auch ohne die Malereien wäre dieses Märchenreich eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges. Doch die geringste Spur menschlicher Anwesenheit verwandelt alles. Dafür genügen schon ein paar Felsritzungen; Tiergestalten wirken erst recht elektrisierend. Nicht zu reden von dem zufällig erhalten gebliebenen Fußabdruck, Schuhgröße vierunddreißig, ein Kind wohl, das durch eine Pfütze stapfte. Vollends sprachlos machen die dezidiert hinterlassenen Zeichen, für die ihre Schöpfer jeweils eine Hand an den Fels legten und dann Farbpulver darüberpusteten. Der Abdruck blieb als Negativ erhalten. Der Größe und den Proportionen nach zu urteilen, dürften es Frauenhände gewesen sein. Ähnlich entstanden die zahlreichen Punktierungen, bei denen sie die Farbe direkt auf den Fels gespuckt haben. Diese Bilder haben eine halluzinative Qualität. Als ereignete sich ein Kurzschluss von der Urzeit ins Heute.
In den fünfziger Jahren sorgte André Breton während einer Führung für einen Eklat, als er mit dem Daumen an einem Mammutrüssel rubbelte, angeblich, weil er die Echtheit der Malereien bezweifelte, in jedem Fall aber, um sich wichtig zu machen. Wegen Beschädigung eines Kulturdenkmals wurde er zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, dann jedoch begnadigt. Es entbehrt nicht der Ironie, dass ausgerechnet der Begründer des Surrealismus handgreiflich wurde, als er sich mit diesen meisterhaften Manifestationen des kollektiven Unbewussten konfrontiert sah.
Den Schlussakkord des Rundgangs bildet der Pferdefries, den man schon von Weitem sehen kann. Aus der Nähe wirkt er noch unbegreiflicher. Auch hier haben die Maler oder wohl eher Malerinnen den Untergrund geschickt miteinbezogen. Die Ausbuchtung des Felsens oben rechts hat schon in natura die Form eines Pferdekopfes. Der Stein suggeriert das Tier. Bei den vermeintlichen Tigertupfen handelt es sich wiederum um Punktierungen. Sie finden sich auf dem Fell der Pferde, doch auch rundherum. Mit neunundzwanzigtausend Jahren stellen die beiden Tiere mit das älteste Motiv in Pech Merle dar. Sie stehen leicht versetzt und blicken in die entgegengesetzte Richtung. Eingefasst wird die Szene von drei linken und drei rechten Händen. Sie scheinen das Wild lenken zu wollen. Benutzten die Jäger Magie als Geheimwaffe, versuchten sie die überlegenen Sinne der Pferde mit Übersinnlichem zu kontern? Die Szene wirkt, als seien die Tiere nicht die eigentliche Botschaft, aber deren Träger und Bevollmächtigte. Die Hände halten sie gebieterisch in Schach. Schwer zu sagen, ob sie Abwehr oder Zugriff sind, Gruß oder Warnung, Pointe oder Signatur.
Diese Bilder infizieren ihre Betrachter. Schon die jugendlichen Entdecker berichteten, dass sie anfangs lebhaft von ihnen geträumt hätten. Vielen späteren Besuchern erging es ebenso; selbst bei nüchternen Wissenschaftlern kam das Unbewusste auf Touren. Auch bei mir wirkten die Pferde nächtens nach, als hätte ich eine bewusstseinsverändernde Substanz eingenommen. Offenkundig haben die eiszeitlichen Schamanen einen Zauber gefunden, der auch nach Jahrzehntausenden noch fortwirkt. Meinte Laurence Perceval diese Macht der Bilder, als sie von telepathischen Kräften sprach? Im inneren Untergrund müssen kommunizierende Röhren offen geblieben sein.
So unmittelbar sie auch wirken, so rätselhaft bleibt doch die Absicht dieser Malereien. »Es fragt sich, ob man in diesem Fall schon von Künstlern reden sollte«, meint Jean-Louis Gouraud, den ich zum Abschluss in Paris besuche. Er hat den Diskurs über Pferde in Frankreich geprägt wie kein Zweiter, als Autor wie als Reiter. Eine derartige intellektuelle Instanz fehlt im deutschsprachigen Raum, am ehesten wäre er noch mit Horst Stern zu vergleichen. »Die eigentlichen Intentionen dieser Schöpfer kennen wir nicht«, räumt er ein. »Die haben Kunst gemacht, ohne es zu wissen, ganz wie Jourdain aus Molières Bürger als Edelmann, der seit vierzig Jahren Prosa spricht, ohne sich dessen bewusst zu sein. Aber wir sehen deutlich, dass das Pferd in ihrem Denken eine Sonderstellung einnahm, und dass der Mensch dieses Tier von Anfang an bewundert hat.« Er habe sich oft gefragt, sinniert Gouraud, woher diese Faszination rühre. »Möglicherweise daher, dass Pferde sowohl maskuline als auch feminine Eigenschaften auf sich vereinen. Dass sie Kraft und Überlegenheit ebenso ausstrahlen wie Grazie und Sensibilität.« Diese komplementären Seiten machten sie für uns unentbehrlich: »Erst recht heute, wo wir weit entfernt von der Natur leben. Pferde führen uns zu unseren Instinkten zurück.«
Über unendlich lange Zeiträume blieben diese Jagdszenen unverändert. »Warum ist niemand darauf verfallen, sich mal draufzusetzen?« Die ältesten Pferdedarstellungen der Welt, zugleich mit die ältesten Kunstwerke überhaupt, sind rund fünfunddreißigtausend Jahre alt. Wie etwa das formvollendete Pferdchen aus der Vogelherdhöhle in der Schwäbischen Alb oder die Zeichnungen in der Grotte Chauvet. »Den frühesten Hinweisen auf eine Domestikation aber begegnen wir allenfalls vor sechstausend Jahren. Warum hat das eine halbe Ewigkeit gedauert?«
Im Grunde stellte die Höhlenkunst bereits einen ersten, noch imaginären Akt der Zähmung dar. Für den Kulturphilosophen Georges Bataille wurden diese Tierikonen zu Kronzeugen seiner zwischen Eros und Tod beheimateten Anthropologie. Den Schöpfern von Lascaux bescheinigte er einen »Trieb zum Wunderbaren«. Ihr Werk, schrieb er in seiner fulminanten Monographie über Lascaux, »ist uns so nahe, daß es die Zeit aufzuheben scheint«. Und ebenso den Raum. Quer über den gesamten Doppelkontinent hinweg, von Kastilien bis Kamtschatka, sprechen diese Bilder die gleiche Sprache. André Leroi-Gourhan nannte es »den figurativen Kanon«. Pferde bilden dabei ein bevorzugtes Sujet. Die Künstler der Eiszeit waren die Ersten, die sich der Herausforderung Pferd stellten. Einer Herausforderung, die bis heute anhält und weltweit angenommen wird, wo immer Menschen aus der Begegnung mit diesen Tieren ästhetischen Gefallen und seelische Erhebung schöpfen. Wo sie sich bezaubern lassen von ihrer Schönheit. Ihrer Neugier. Ihrer Schüchternheit. Ihrem Elan. Ihrer Ruhe. Ihrer Stärke. Ihrer Verletzlichkeit. Ihrer Anmut. Ihrer Hoheit.
Wer über Tiere schreibt, oder generell über Natur, wird gern etwas belächelt, gerade in intellektuellen Kreisen. Sie gelten als sentimentales Sujet. Ich bin so frei und lächle zurück. Pferdegeschichte ist Menschheitsgeschichte. Jeder kann die immerwährenden Bilder von Lascaux und Pech Merle in den Kavernen seiner Seele abrufen, sie sind dort hinterlegt. Pferde führen uns zu uns selbst zurück. Wie Sendboten erscheinen sie am Beginn der Kultur und damit der Selbstdomestikation des Homo sapiens. Seither begleiten sie uns beim Übergang in andere Welten oder Zeiten. Bereits die prähistorischen Malereien aber bekunden fühlbar Nostalgie. Sie zeugen von einem Unbehagen in der Natur, der ihre Schöpfer nicht länger gänzlich angehörten. Der Weg zum Menschen gelangte mit diesen bewusst und ein für alle Mal gesetzten Zeichen in eine neue Ära: zu sich selbst. Der Mensch von Lascaux, schrieb Bataille, »schuf aus dem Nichts die Welt der Kunst, mit welcher der Geist beginnt, sich mitzuteilen.« Die Souveränität, mit der dies geschah, wird die Menschheit bis ans Ende der Zeiten in Verwunderung versetzen.
Waldgeister
»Die Melancholien der Geschichte, die aus der Tiefe jener Horizonte aufsteigen, wo sich einst Dinge zugetragen haben, wie man sie sich aus alten Büchern zusammenspinnt.«
~ Gustave Flaubert / Maxime Du Camp, Über Felder und Strände
Vor zehn- bis zwölftausend Jahren lief die vorerst letzte Kaltzeit aus. Die Gletscher wichen zurück, die Wälder rückten vor, die Steppe schrumpfte. Der Meeresspiegel stieg, Nebenmeere wie die Ostsee und das Weiße Meer entstanden. Andere verbanden sich wieder, so das Mittel- und das Schwarze Meer, während die Landbrücke zwischen Sizilien und der Italienischen Halbinsel oder das sogenannte Doggerland zwischen Jütland und den Britischen Inseln überflutet wurden. Europa veränderte sein Antlitz. Alle vorherigen Klimawechsel hatte seine Tierwelt weitgehend unbeschadet überstanden. Es war ihr genug Zeit zur Anpassung geblieben, die einzelnen Spezies waren in höhere Lagen oder wärmere Gefilde gezogen, hatten ihre Ernährung umgestellt und ihr Fell gewechselt. Doch das Ende der letzten Eiszeit überlebten bestürzend viele Arten nicht. Und allem Anschein nach verschwanden daraufhin auch die Jäger, die ihnen derart zugesetzt hatten, dass diese Verluste durch keine biologische Strategie mehr auszugleichen waren.
Homo neanderthalensis war über hunderttausend Jahre hinweg durch Eurasien gezogen, Homo erectus davor noch länger. Obwohl sie kontinuierlich jagten und obwohl das Klima vielfach wechselte, rotteten sie, soweit bekannt, keine Art gänzlich aus. Ihre Waffen und Jagdmethoden waren dafür nicht destruktiv genug; das prekäre Gleichgewicht zwischen Jägern und Beute blieb halbwegs gewahrt, oder, um mit Josef Reichholf zu sprechen, zumindest das »überlebensfähige Ungleichgewicht«. Mit Homo sapiens aber trat ein neuer Akteur auf den Plan. Den täglichen Bedarf dürften auch diese Menschen mit dem Sammeln nahrhafter Bagatellen gedeckt haben, mit Pilzen, Nüssen, Beeren, Knollen, Wurzeln, Insekten, Kleintieren, Vogeleiern und Bienenhonig. Nur dass sich niemand die Mühe machte, den täglichen Steppenbummel auf Felsgemälden zu verewigen. Die Jagd dagegen war Kult, war Orgie, Kriegszug, Verheißung und Verausgabung. Selbst für diese versierteren Wildbeuter führte sie sicher nur mit viel Mühe zum Erfolg, mit List und Tücke und roher Gewalt. Dennoch brachten sie zahlreiche Arten zum endgültigen Verschwinden. Nicht zu reden vom Neanderthaler, der der rabiaten Konkurrenz nicht standzuhalten vermochte.
Die kapitalsten Beutetiere wurden als Erste ausgelöscht, noch vor dem Ende der Eiszeit: Mammute und andere Elefanten, verschiedene Nashörner, Steppenbison und Riesenhirsch. Tabula rasa. Auf Mittelmeerinseln wie Zypern, Kreta oder Sardinien überlebten Zwergformen von Elefant und Flusspferd einige Jahrtausende länger. Doch als der moderne Mensch auch diese Rückzugsräume erreichte, war ihr Schicksal besiegelt, wobei letzte Bestände möglicherweise bis in die Antike hinein überdauerten.
Warum gerade die stärksten Säugetiere? Sie hatten kaum Feinde zu fürchten, zumindest nicht, wenn sie ausgewachsen waren. Entsprechend gering waren ihre Fluchtreflexe. Ein Mammutbulle wird sich mit aller ihm zur Verfügung stehenden Kraft und sechs Tonnen Kampfgewicht gegen seine Angreifer zur Wehr setzen. Aber er stellt sich ihnen, er nimmt nicht Reißaus. Oder wenn, dann erst, wenn es zu spät ist. Aus Sicht der Jäger handelte es sich einerseits um eine riskante, andererseits jedoch um eine leichte Beute. Man brauchte sie nicht stundenlang zu verfolgen, nur damit sie am Ende doch entwischte. Und sie versprach Unmengen an Fleisch, dazu wertvolle Rohstoffe wie Felle, Sehnen, Knochen und Elfenbein.
Wie aber haben die Steinzeitmenschen Pferde zur Strecke gebracht? Die Fluchttiere par excellence? Sie in offenem Gelände zu erlegen, ohne Deckung und nur mit Wurfwaffen, scheint fast aussichtslos. Dazu brauchte es auf jeden Fall größere Gruppen mit einem fast schon militärischen Organisationsgrad. Reisende, die Anfang des 20. Jahrhunderts in der Dsungarei noch Przewalskipferde sichteten, berichteten von einer Fluchtdistanz von vierhundert Metern. Damals wurde das Wild bereits zu Pferd und mit Feuerwaffen gejagt. Die paläolithischen Jäger aber verfügten nur über Speere, später auch über Speerschleudern mit höherer Reichweite und Durchschlagskraft. Die ältesten erhaltenen Exemplare datieren achtzehntausend Jahre zurück; einige sind mit Pferdefiguren verziert. Sie stammen aus dem Périgord, ebenjener Region, deren Felswände auch die höchste Dichte an Tierdarstellungen aufweisen. Diese Bilder und die an sie gebundenen Rituale stärkten die Motivation der Gruppe und förderten die Teamarbeit. Und doch scheinen all diese Errungenschaften nicht hinreichend, die verheerenden Erfolge der eiszeitlichen Jäger begreiflich zu machen.
Am ehesten wären sie dadurch zu erklären, dass sie Verbündete hatten. Der große Unbekannte ist der Wolf. Oder womöglich auch schon der Hund oder etwaige Übergangsformen.
Dass Fleischfresser von den Jagdzügen anderer Fleischfresser zu profitieren suchen, gehört zu ihrem Metier. Oft jagt der Stärkere dem Schwächeren den Fang ab, der Adler dem Bussard, die Hyäne dem Geparden. Die letzten Wildbeutergruppen in den afrikanischen Savannen machen Raubtieren immer wieder deren Beute streitig. Ein kühnes Unterfangen, doch wenn die Menschen in der Übermacht sind, ziehen die Löwen sich zähnefletschend von ihrem Riss zurück. »Es kommt drauf an, wer mehr Hunger hat«, erklärte mir einmal ein Dorobo-Jäger in Tansania, der manches Mal solch waghalsigen Mundraub betrieben hatte. Auch der umgekehrte Fall kann vorkommen, wenn ein einzelner Mann seine Beute nicht gegen ein hungriges Hyänenrudel zu verteidigen vermag. Doch auch ohne direkte Konfrontation lohnt es sich, die Konkurrenz im Auge zu behalten. Versetzt die Hatz eine Herde in Panik, können versprengte Tiere eine leichtere Beute werden. Wölfe haben die Pirschgänge der Steinzeitmenschen sicher aufmerksam verfolgt, und umgekehrt genauso, jeweils in der Hoffnung, dass auch für sie etwas abfallen könnte. Von dieser wechselseitigen Beobachtung wäre es kein allzu großer Schritt mehr zur vorsätzlichen Kooperation. Die Dorobo etwa betreiben ein Joint Venture mit dem Honiganzeiger, einem unscheinbaren Vogel, der sie, seinem Namen getreu, zu verborgenen Bienennestern führt, indem er aufgeregt zwitschernd von Baum zu Baum fliegt, um schließlich als Belohnung seinen Teil der Waben zu erhalten.
Bis vor Kurzem galten knapp fünfzehntausend Jahre alte Hundeknochen wie die aus Oberkassel bei Bonn als die ältesten Nachweise der Haustierwerdung. In den letzten Jahren aber sorgten Schädelfunde für Schlagzeilen, die anatomisch und genetisch als Zwischenwesen anzusehen wären, nicht mehr Wolf und noch nicht Hund. Sie sind gut doppelt so alt und kamen an verschiedenen Stellen Eurasiens zutage, von den Ardennen bis in den Altai. Mit diesen angriffslustigen Wolfs-Hunden könnten die Eiszeitmenschen eine Jagdgemeinschaft zum beiderseitigen Vorteil eingegangen sein. Damit hätten sie lebende Waffen zur Verfügung gehabt. Für ihre Beutetiere wären die Folgen fatal gewesen. Pflanzenfresser zu zähmen, hätte für Jäger und Sammler dagegen wenig Vorteile gebracht, jedoch beträchtliche Nachteile, hätten sie sie doch beständig gegen Raubtiere verteidigen müssen. Ein an menschliche Nähe gewöhnter Fleischfresser dagegen würde ihnen aus freien Stücken folgen, und er bräuchte auch keinen Schutz vor anderen Räubern. Das wäre allemal einen Versuch wert.
Die Felsbilder werden gern als ein Beginn angesehen, als eine erste Morgenröte von Kultur. Doch die Jagd selbst war bereits Kultur, war Lebensart, Naturwissenschaft, Unterricht, Sport, Kunst und magische Praxis. Gegen Ende der Eiszeit aber wurden, in gespenstischer Reduktion, kaum mehr Tiere abgebildet, nur noch abstrakte Zeichen und Figuren. Die Animationen verlöschen, und mit ihnen auch ihre Urheber. Dafür finden sich an den Lagerplätzen haufenweise Muscheln und Schnecken, die als Nahrung dienen mussten, weil die Wildbestände überjagt waren.
Stünde uns eine Zeitmaschine zur Verfügung, so könnten wir damit umstandslos siebzehntausend Jahre überspringen und nach Lascaux wallfahren. Oder gar vierzigtausend Jahre zurück bis zu den Mammutjägern auf der Schwäbischen Alb, die mit die ältesten Plastiken der Menschheit gefertigt haben, und die ältesten Musikinstrumente dazu, Flöten aus Vogelknochen und Elfenbein. Dank der Hinterlassenschaft der eiszeitlichen Künstler wüssten wir genau, welche Plätze wir ansteuern müssten und würden meist auf Anhieb fündig. Die zeitlichen Koordinaten bräuchten gar nicht besonders präzise zu sein; viele Stätten sind, wie etwa die berühmte Höhle von Altamira, über Jahrtausende hinweg aufgesucht worden. Bei flackerndem Feuerschein haben Generationen von Zeichnern immer neue Tiermotive an die Wände geworfen.
Auch wenn wir unseren Fahrstuhl durch die Zeit für deutlich kürzere Strecken nutzen würden, sagen wir fünftausend Jahre zurück, böte sich uns eine reiche Auswahl an attraktiven Zielen. Wir könnten die Steinkreise von Stonehenge und Callanish besuchen, die Dolmengräber in der Bretagne, die Megalithtempel auf Malta oder eine Reihe anderer kultureller Zentren der Jungsteinzeit. Doch es gibt eine ominöse Zwischenphase, vom Ende der Eiszeit bis zum Beginn des Ackerbaus in Europa, rund elftausend bis sechstausend Jahre zurück – da wüssten wir nicht recht, wohin. Es gäbe kaum definierte Ziele, und wir würden selbst nach eingehender Suche keine Menschenseele antreffen. Und auch kein Großwild mehr, bestenfalls Rentiere oder Rehe. Diese lange, lange Übergangsphase wird als Mittelsteinzeit oder Mesolithikum bezeichnet. Es wäre möglich, dass West- und Mitteleuropa damals zeitweise entvölkert waren, und dass erst Einwanderer aus Kleinasien und Südosteuropa diese Räume wieder besiedelten. Sie führten dann bereits Nutztiere mit sich – erst Schaf und Ziege, später auch Rind und Schwein –, sie betrieben Ackerbau, beherrschten die Metallverarbeitung und den Bootsbau. Diese nebulöse Epoche erscheint wahrhaftig als »graue Vorzeit«. Wo sind die großen Herden geblieben? Warum sind die Big Five als Erste verschwunden, Großwild wie Elefanten, Rhinozerosse oder Höhlenlöwen? Was geschah mit den Cro-Magnon-Menschen? Warum schufen sie keine Felsbilder mehr? Auf den Urknall der Zivilisation folgte ein stummes Zeitalter.
U