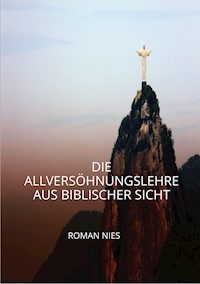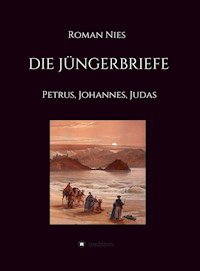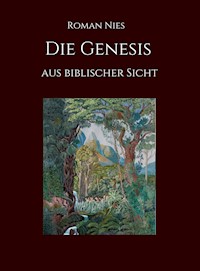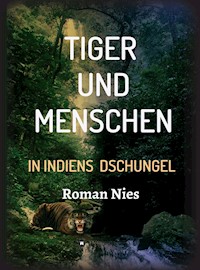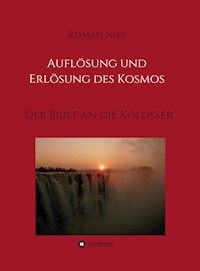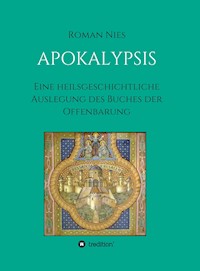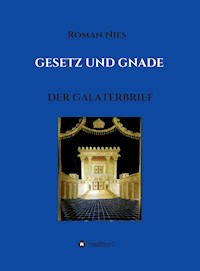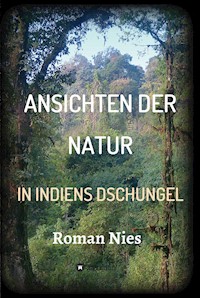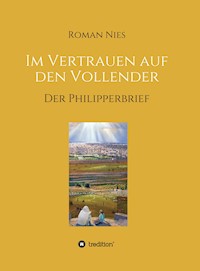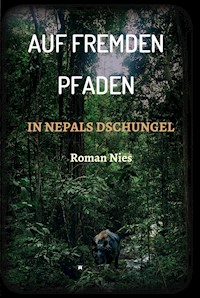
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Dschungel Nepals waren zu früheren Zeiten die Zielorte der Weisen und Seher des indischen Subkontinents. Sie vermögen auch heute noch die Waldbesucher zu inspirieren, wenn sie sich auf das Abenteuer einlassen, die Gegend, die eines der letzten Rückzugsgebiete des indischen Nashorns und vieler seltener Tierarten ist, zu erkunden. Der Autor hat dieses Gebiet bereist und dabei eigentümliche Entdeckungen gemacht. Er begegnet verschiedenen Welten zwischen Naturhaftigkeit und menschlicher Gesellschaft, Tradition und Moderne. Der Urwald erweist sich als mystischer Ort mit tiefen Seelenblicken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Roman Nies
Auf fremden Pfaden
In Nepals Dschungel
© 2020 Roman Nies
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-01962-1
Hardcover:
978-3-347-01963-8
e-Book:
978-3-347-01964-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
1. Kapitel
Zu den Nashörnern
In der menschlichen Gesellschaft ersteht die Liebe für Vergnügen und Begierden. Lasst deshalb jemand, der die Trennung von alledem hasst, weil sie doch einmal kommen muss, alleine gehen wie ein Rhinozeros
aus dem Sutta Nipatta
Ich sehnte mich nach dem Dschungel mit seinen freundlichen Tigern und Elefanten und vielleicht auch Nashörnern zurück!
Und schon bald nach meiner Ankunft in Delhi kümmerte ich mich darum, mein Sehnen zu konkreter Vorfreude umzuwandeln. Die Worte aus dem Sutta Nipatta stammen von Buddha. Sein Geburtsort Lumbini liegt unweit von Chitwan. Das Gebiet, in dem er lebte und zeitlebens nie verließ, war damals vor zweieinhalb tausend Jahren voller Nashörner. Doch das hat Buddha nicht daran gehindert Rhinos als Einzelgänger zu bezeichnen.
Der Royal Chitwan Nationalpark liegt weit abgelegen von geteerten Straßen. Man erreicht Sauraha, das Dorf am Eingang zum Park auch im Sommer nur mit einem geländegängigen Wagen. Das einzige Fahrzeug, das einen sonst noch zum Park hinbringt, ist der Ochsenkarren.
Die „Ochsen“ sind in Indien und Nepal meistens Büffel. Ich habe in Chitwan bei meinem ersten Besuch kein anderes Fahrzeug gesehen als eines, das von Büffeln gezogen wurde, abgesehen natürlich von Fahrrädern. Touristen und Ranger wurden auf Elefanten befördert, jedenfalls im Ostteil des Parks. Erst ab Mitte der achtziger Jahre nahm die Motorisierung des Parks, nicht zuletzt wegen des zunehmenden Tourismus-Betriebs, spürbar zu.
Das ist eben jene Zeit der beginnenden Kommerzialisierung des Parks. Von dem Provinznest Tandi Bazar bis Sauhara geht es über brückenlose Flüsschen, Tümpel und Felder hinweg bis zum Dorf Sauhara, wo sich der Parkeingang und die Touristenlodges befinden.
Nicht nur, dass es keine Straßen gibt. Auch Strom steht nur in Notfällen, wenn ein Generator eingeschaltet wird, zur Verfügung.
Beinahe könnte man glauben, Chitwan ist ein Nationalpark, bar jeder touristischer Interessen. Aber das ist keinesfalls so! Der Park bietet eine besondere Attraktion: Nashörner! Ungefähr 400 Stück davon, dazu eine einzigartige Flusslandschaft, fernab von kommerzieller massenmenschlicher Beeinträchtigung!
Und Büffel! Es ist ein unvergessliches Erlebnis entspannt auf einem Karren zu liegen und von ihnen durch die Flusslandschaft des Terai gezogen zu werden! Auf Büffelkarren wird man zum Philosophen erzogen! Und nicht zu einem Nihilisten! Die gemächlich dahintrottenden Tiere kennen ihren Weg und kümmern sich nicht um die Sorgen, die am Wegesrand liegen, denn sie lassen respektlos eine Art Dung fallen – man könnte es auch kürzer und profaner ausdrücken!
Man ist ja auch morgens unterwegs, wenn die Sonne noch nicht die rastlosen Gemüter zusätzlich erhitzt, das klare Licht sich noch im Tau bricht, wenn der Pessimismus noch nicht Zeit hatte, aufzustehen, wenn man an die Lethargie noch keine Gedanken verschwendet hat, denn sie braucht zu ihrer Entfaltung die nachmittägliche physische Erschöpfung.
Und der Karren rollt über einen holprigen Untergrund, denn man ist ja im Lande, wo man Straßen nur in Krisenzeiten baut. Und das Rütteln erschüttert Müßig-Gang und Sitz-Fleisch, so dass man lächelt, und der Geist wird befreit von seinen körperlichen Fesseln, wenn dieser Leib nur Wohlsein meldet!
Und man richtet seine Blicke himmelwärts, wo sich im blauen Firmament die Schwalben zwitschernd vergnügen, und man denkt, mit dem Rücken auf der Erde liegen, kann auch erhebend sein. Es muss nicht immer das Fliegen, das eine große Langsamkeit stets mit Absturz bestraft. Und der Blick erfreut sich am fruchtbaren Boden, der Pflanzenpracht und den Mädchen, die im Wasser baden und mit aufgelösten Haaren um sich spritzen, und den Buben, die tanzen und winken. Heho! Was für eine armselige Landschaft: ohne WC und Dieselgenerator, ohne Ampere und Volt und ohne Bedürfnisse, außer denen, die man sich ohne Mühe stillen lässt. Ein Königreich für zwei Büffel, Karren, Zubehör und Drumherum!
Aber wir, mein Büffelkarren und ich, und der Büffeltreiber, fuhren nicht drumherum, sondern mittendurch. Mir gefiel die Idee, täglich hin- und her zu pendeln, wenn es in Sauhara keine Unterbringungsmöglichkeit gab,- mit dem Büffelkarren natürlich! Das idealste aller Fortbewegungsmittel! Das ist das Lebensziel des Büffels: einen Karren zu ziehen, auf dem Philosophen liegen!
Es war die angenehmste Fahrt, die ich je mitmachte. Es war erholsam, so langsam vorwärts zu kommen, mit einer Reisegeschwindigkeit von acht Kilometer in der Stunde. Sie war für eine Entdeckungs- und zugleich Erholungsreise angemessen. Wir überquerten manches Flüsschen und manche Senke, die mit klarem Badewasser gefüllt war. Der wohlgestaltete Körperbau der jungen Frauen, die ausreichend bekleidet badeten und dabei ungeniert lachten, hätte eine nicht zu oberflächliche Betrachtungsweise verdient, wenn man sich rein künstlerischen Studien gewidmet hätte. Aber so galt es nur, festzustellen, alles war schön anzusehen und fügte sich ins harmonische Ganze. Da gab es niemand, der sich über die großzügigen Offenbarungen der Natur wunderte, die einen dazu aufrufen, dass man sich an höherer Stelle dafür bedankt, dass man in der Lage ist, sie wahrzunehmen und richtig zu gewichten. Was für ein wunderbarer Universalgelehrter, der sich diese Dinge zuerst ausdachte, ehe er sie schuf und ihnen Leben einhauchte! Ein hoch auf ein aufregendes, aber nicht zu anstrengendes Leben! Ein Leben, das man, sollte es zu hochtrabend werden, an einen Büffelkarren anspannen würde.
Einmal blieben meine Büffel sogar im Wasser stehen und nahmen ein paar Schluck zu sich, während ich mit einigen Teraibewohnern Grüße austauschte. Das war eine einfache Übung. Aber es war großartig. Alle waren froh und glücklich, auch meine Büffel – daran gibt es keine Zweifel. Wer Büffel und einen Karren hat, den er sie ziehen lässt, und sich daraufsetzt, der lernt, dass Büffel glücklich sein können. Ist es nicht irgendwie beruhigend, das zu wissen? Die Tiere haben ihre Mühen in der Welt der Menschen, aber manchmal dürfen sie auch ihren Spaß haben!
Es wird immer wieder behauptet, Büffel seien dumme Tiere. Vielleicht ist man darauf gekommen, weil sie ihre menschlichen Herren ein Leben lang dienen, ohne Lohn zu verlangen. Dabei wollen sie vielleicht nur den Menschen vorleben, was Treue ist, einfache, lebenserleichternde Treue. Büffel wissen nicht, was Treue ist, sie tun es einfach. Der Mensch weiß, was Treue ist und tut es nicht. Wissen ist manchmal Ohnmacht, weil Wissen allein nie Macht sein kann!
Unter Menschen ist Treue weniger verbreitet als Dummheit. Man sagt, wenn man nachts eine Laterne zu nahe bei den Köpfen der Tiere hält, ziehen sie den Karren nicht weiter, weil sie annehmen, sie seien schon zu Hause. Man hängt das Licht also hinten hin. In Wirklichkeit mögen es die Büffel nicht, vom Licht geblendet zu werden. Außerdem spüren sie instinktiv, dass vom Licht Gefahr ausgeht. In den meisten Fällen ist die Lichtquelle eine Petroleumlampe, die, wenn sie zerbricht, den Tieren das Fell verbrennt. Da der Fahrer nachts oft schläft oder vor sich hindöst, müssen die Büffel auf den Weg Acht geben, eventuellen Hindernissen aus dem Weg gehen und Gefahren rechtzeitig erkennen. Das tun sie in der Regel so vorbildlich, dass das Gefährt auch ohne Steuerung zu Hause ankommt. Die Büffel bleiben einfach stehen oder kitzeln den Fahrer mit der Schwanzquaste, wenn dieser nicht hintenübergekippt ist, und er weiß, dass er zu Hause ist, auch wenn er eine Flasche Toddy oder Arak getrunken hat.
Büffel und Sikhs sind mir angenehm. Sie haben meist eine stoische Ruhe. Maghi, mein Büffeltreiber, war kein Sikh, sondern ein durch und durch echter Tharu-Nepalese wie er selber wiederholt und mit Stolz bekräftigte. Eigentlich war es untypisch, dass ich ihn unter den vielen Bewerbern in Tandi Bazaar ausgewählt hatte. Entgegen meinen sonstigen Gepflogenheiten hatte ich mich von einem der lautesten Schlepper überreden lassen, mich nach Sauraha chauffieren zu lassen. Aber ich hatte den Eindruck, dass er Witz hatte. Und außerdem passte er zu seinen Büffeln.
Ein typischer südasiatischer Zug ist es, entweder dem anderen immer recht zu geben und dann doch hinterrücks zuwider zu handeln, oder nicht zu widersprechen und mit aller Selbstverständlichkeit als sei es so abgemacht, trotzdem zu handeln wie es einem gefällt. Wird aber eine Rückmeldung eines anders lautenden Ansinnens unvermeidlich, dann wird es nur durch eine kurze Negation zum Ausdruck gebracht, die den asiatischen Customer nicht weiter stört, hingegen manchen Europäer schon zur Weißglut gebracht hat.
Manchmal kostet es einige Mühen, alle Schlepper und Hawker abzuschütteln, ehe man seine eigenen Wege gehen kann. Ich hätte die acht Kilometer nach Sauhara auch zu Fuß gehen können. Wie sich aber herausstellte, gab es keinen erkennbaren Weg in irgendeine Richtung. Ich war auf jeden Fall auf die Hilfe von Einheimischen angewiesen, um Sauhara überhaupt zu finden.
Meine ablehnende Haltung war Maghis Verhandlungsgrundlage. Und das ging so:
„You cannot follow me, can You follow me?“ sagte ich.
„You are right, yes, I follow!“ bekam ich zur Antwort.
„No! I mean: can you follow me that You cannot follow me?“
„Yes! Yes! Sure!“
„No! You cannot!“
„There is no question about it!“
„So you won’t?“
„I won’t leave you alone, yes!“
„No!“
„You will be satisfied, no doubt!“
Verhandle mit einem Asiaten, es ist unerheblich, ob er deine Sprache versteht oder nicht. Wie gesagt, ich bestieg schließlich den Karren von Maghi und damit hatte ich nicht die schlechteste Wahl getroffen wie ein Blick auf die Fuhrwerke der anderen bestätigte!
„I am great Shikari Guide!“ sagte der sehr schmächtige Maghi in seinem strahlend weißen Gewand.
„If You want You can shoot buffalo, tiger, elephant. I show You rhino, slothbear, no matter my friend, I tie bait, I make machan, no problem, You come and shoot, very easy, with camera, I am very experienced, I know Jungle very well, You will see…“
Natürlich war er ein Aufschneider und Witzereißer. Ich sagte ihm, ich wünschte mir, dass seine Buffalo nicht so leichtsinnig wären wie er Versprechungen gab.
„You no trust me?“ spielte er den Enttäuschten.
Ich sagte ihm, dass ich seine Ausführungen für leicht übertrieben hielt. Ich wäre schon zufrieden, wenn er mich ohne Achsenbruch nach Sauraha bringen würde.
„I find good hotel, no problem! You will see, fine hotel, shower, hot water, very cheap, my friend!“
Ich hätte gerne ein Hotel ohne heißes Wasser gehabt, denn des Rätsel Lösung für diesen extra Service kannte ich bereits. Die Wassertanks befinden sich auf den Dächern, wo die Tageshitze das Wasser erwärmt. Wenn man nachmittags aus dem Dschungel kommt und sich auf eine Abkühlung freuen würde, gibt es heißes Wasser, jede Menge für den Nachmittagstee für ein ganzes Gurkha Regiment mit Bärenfellmützen. In Chitwan sind die Tage heiß und die Nächte kalt. Demzufolge kühlt das Wasser in den Tanks ab und morgens hat man, nachdem man frierend aus dem Bett gestiegen ist, eine kalte Dusche! Aber nur, wenn man will. Meist will man nicht.
Maghi hatte meine Skepsis bemerkt. Er war ein intelligenter Bursche. Ich würde ihn noch zu fragen haben, warum er nicht in die Stadt ging, um einen anspruchsvolleren Beruf zu erlernen. Sich mit Touristen abgeben zu müssen, sei doch für einen „Inder“ keine Dauerlösung.
Der „Inder“ war mir herausgerutscht, er elektrisierte Maghi förmlich. Er sei auf dem Lande aufgewachsen, sagte er, und fühle sich dort heimisch. Touristen seien interessanten Menschen und es mache großen Spaß ihnen als Guide zu dienen. Diese Antwort gab mir zu denken. War ich doch selber ein Städteflüchter, der einen Beruf in freier Natur den meisten anderen vorziehen würde.
Ich hatte mit Maghi doch die richtige Wahl getroffen. Als Guide hatte ich ihn allerdings nicht vorgesehen, obwohl er beteuerte, ein guter Guide zu sein. Er zog einen Stapel Visitenkarten hervor. Er hatte schon Touristen aus aller Herren Länder „betreut“.
„I speak five language“, sagte er, „and Nepali!“
Ich sollte vor allem nicht Nepal mit Indien vergleichen, bat er mich. „Totally different!“ Damit hatte er gar nicht so unrecht. Nepalesen hatten in der Tat Vorzüge, die ich an Indern im Allgemeinen schmerzlich vermisst hatte. Ich kann aber nicht sagen, dass ich deshalb die Inder weniger schätze. Wo viel Schatten ist …
„Wenn ich schon sehe wie du gekleidet bist“, sagte ich zu Maghi, „gehe ich lieber alleine in den Dschungel, sonst laufen mir sämtliche Tiere weg. Von wegen Jagen! Dafür werden gereizte Elefanten Jagd auf uns machen!“
Das sei eine Touristenausgehuniform, entschuldigte er sich. Zwanzig Rupees verlangte er pro Tagestour. Ich sagte ihm, das sei mir zu wenig. Ein guter Guide müsste mindestens 100 Rupees kosten, und das sei auch der Preis, den er mir zahlen müsste, wenn er sich mir aufdrängen würde, denn ich war sicherlich der bessere Guide von uns Zweien. Das verblüffte Maghi. Er hielt es für einen Scherz, aber ich versicherte ihm, dass ich es ernst meinte. Er lachte. Ich fragte ihn, was das für ein Vogel am Himmel wäre. Er sagte, ein Adler! Ich fragte weiter, was für ein Adler? Er lachte. Ich hatte ihn verunsichert.
„Du bist zweifellos ein großer Shikari Guide!“
„I can show you Rhinos!“ Er schraubte seine Ansprüche doch merklich zurück. Wie sich sehr bald herausstellte, brauchte man keinen Guide, um Nashörner zu sehen zu bekommen.
Ich erzählte Maghi die Geschichte von Old Muneswamy, der aller Welt, vorzugsweise aber reichen Touristen weismachen wollte, dass er ein großer Guide und Shikari wäre. Jagen war zwar auch damals schon nicht erlaubt, aber daran störte sich ein echter Großwildjäger nicht. Die Strafen waren vergleichsweise gering und waren sozusagen im Preis inbegriffen. Also versprach Old Muneswamy den Jägern aus Übersee innerhalb kürzester Frist einen Tiger zu besorgen, den sie ohne Risiko und Mühe schießen könnten. Dann kassierte er eine Vorauszahlung, angeblich um die entsprechenden Vorkehrungen treffen zu können, wozu jedoch ein weit geringerer Geldbetrag ausgereicht hätte. Er kaufte nur eine Ziege, führte sie in den Dschungel und tötete sie eigenhändig. Dazu legte er Spuren, als ob sie von einem Tiger stammten. Schließlich überbrachte er dem ungeduldigen weißen Jäger die frohe Kunde, dass der Tiger angebissen hätte. Er würde zu seinem Kill zurückkehren, um bequem von dem weißen Shikar erlegt zu werden. Und während er sich noch einmal für seine vorzüglichen Dienste entlohnen ließ, riet er dem von Jagdfieber und der Vorfreude auf den baldigen Besitz eines Tigerfells gepackten Möchtegern-Shikar, er müsse sich beeilen, denn wenn der Tiger sich den Rest der Beute holen würde, wäre das natürlich nicht die Schuld von Old Muneswamy. Der weiße Mann beeilte sich, saß brav auf seinem Machan über der toten Ziege und wartete auf den Tiger, den es nicht gab.
Old Muneswamy machte seine Geschäfte und sie gingen gut, bis es sich doch herumgesprochen hatte, dass sie immer nur für ihn gut verliefen. Deshalb beschloss er eines Tages seinen ramponierten Ruf aufzubessern. Er wollte selber einen Tiger schießen, ihn dann seinen Kritikern und Spöttern vor die Füße legen und triumphierend vor der Kamera der Presse posieren. Die Visitenkarte vom Fotographen würde seine wahren Qualitäten für alle Zeiten dokumentieren.
Tatsächlich verirrte sich ein Tiger zu Old Muneswamy Köder. Das hätte nicht sein müssen. Aber das Schicksal wollte es so. Als der große Jäger seine Muskete abfeuerte, verletzte er den Tiger jedoch nur. Der Tiger war über diesen Affront so verärgert, dass er von Stund‘ an Jagd auf Menschen machte. Die Dorfleute hätten Old Muneswamy beinahe gelyncht. Er hatte natürlich überall verkündet, was für großartige Pläne er hatte und so hatte man von Anfang an den Schuldigen. Die Behörden gaben dem selbsternannten Expert-Shikar eine Frist, mit der Auflage, den Tiger zur Strecke zu bringen oder für den Rest seines Lebens in Einzelhaft zu gehen.
Aber wie sollte ein alter Mann wie er, der den Dschungel nur vom Ziegen verschleppen kannte, einen Maneater aufspüren und unschädlich machen können? Er hatte überhaupt noch nie einen Tiger oder sonst ein gefährliches Tier erlegt.
Zum Glück für Old Muneswamy und die Dorfleute erledigte das Geschäft ein erfahrener Shikar aus Bangalore, dem er einst vergeblich einen Handel angeboten hatte.
Maghi meinte, so etwas könnte nur in Indien passieren. In Nepal sei dies nicht möglich. Man dürfe Tiere hier nur mit der Kamera schießen. In Nepal gäbe es auch keine Halunken, auch nicht im Dschungel des Terai, es sei denn, sie kämen zum Wildern über die Grenze herüber.
„Gewiss, und wenn die Arbeitselefanten sich einmal verweigern, dann werden sie „indische“ Elefanten gescholten!“ Freilich eine Art „nepalesischer Elefant“ gab es ja nicht.
„Nein! Wir haben keine indischen Arbeitselefanten, wir haben unsere eigenen. Aber vor kurzem ist in Thori ein Ochsenkarren mit einem wilden Elefanten zusammengestoßen. Er war aus den Bhabarwäldern über die Grenze herübergekommen.“
„Nicht übel, wenn die Büffel durchgehen, erhöht sich wenigstens die Reisegeschwindigkeit!“
„No, my friend, we have good bulls!“
Die nepalesischen Hausbüffel sind berühmt für ihre Treue und Unerschrockenheit. Eine Frau trieb einmal ihre Büffel auf die Weide. Sie lief hinter den Büffeln her. Plötzlich wurde sie von einem Tiger angegriffen. Die Büffel machten sofort kehrt und vertrieben den Tiger. Den Verteidigungsring, den sie um die verletzte Frau bildeten, gaben sie nicht eher wieder auf, als Hilfe kam. Es ist nicht anzunehmen, dass die Frau den Büffeln ein schweres Joch auferlegt hatte.
In einem anderen Fall hat der Tiger versucht, eine solche Verteidigungsformation aufzubrechen. Er tötete fünf Büffel und musste sich dann erschöpft davon machen. Diese Charakterzüge der Treue und Standfestigkeit, in Verbindung mit physischer Stärke, haben sie von ihren wilden Verwandten geerbt, die es leider nur noch in Assam gibt. Von dort wurde berichtet, dass ein Bulle dem anderen zu Hilfe geeilt war, als dieser von einem Tiger angefallen wurde, obwohl er dies nicht sehen, sondern nur hören konnte. Der Bulle vertrieb den Tiger und hielt Totenwache. Dabei musste er sich mehrmals der Attacken des zurückkehrenden Tigers erwehren, dem es nun auch nicht mehr darum ging, seinen Hunger zu stillen. Ein Tiger fühlt sich immer nur von starken Gegnern herausgefordert. Auch deshalb lässt er die Menschen meistens unbeachtet. Alas! Ausgerechnet in Chitwan ist der wilde Büffel ausgerottet worden durch Großwildjäger!
Chitwan bedeutet „Herz des Dschungels“ und diesen Namen trägt das Gebiet zurecht. Der tropische Galeriewald an den Flussufern; das mit hohem Elefantengras bewachsene, schier undurchdringliche Grasland, umgeben von laubabwerfendem Mischwald, und über allem thront im Hintergrund das Himalayagebirge mit seinen schneebedeckten Achttausender Gipfeln! Dies alles bietet einen einzigartigen Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten, die es in solcher Vielfalt sonst kaum noch irgendwo auf dem indischen Subkontinent gibt. Und wegen einer dieser Besonderheiten war ich hergekommen: dem indischen Panzernashorn. Von rund 1000 Rhinozerossen, die es auf der Welt noch gab, befanden sich über ein Drittel allein im Royal Chitwan National Park. Diese Art trägt den wissenschaftlichen Namen Rhinocerus unicornis.
Der Chitwan National Park liegt im Terai, dem nepalesischen Tiefland. Nach Indien im Süden wird er von den Siwallik Hills abgegrenzt. Diese Hügelkette ist der erste Anstieg, den man auf dem Weg von der Ganges Tiefebene bis zu den Himalayahochgebirgszügen überqueren muss. Sie erstreckt sich mit ihren Fortsetzungen in west-östliche Richtung 2400 Kilometer weit, davon liegen 700 Kilometer in Nepal. Nach Westen zu gehen die Siwallik Hills in das Bhabarvorgebirge im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh über. Ein Teil davon liegt im Jim Corbett Nationalpark.
Die Siwallik Hills sind raue Berge mit einem steinigen Boden, der für Ackerbau nicht geeignet ist. Aus diesem Grund blieb die Gegend unbesiedelt und damit war eine natürliche Grenze zu Indien geschaffen. Dahinter kam das Terai, ein tieferliegendes Überschwemmungsgebiet der Flüsse Rapti, Reu und Narayani, die nach der Schmelze und zur Monsunzeit mehr Wasser führen als jeder europäische Fluss. In den sumpfigen Niederungen siedelten zu früheren Zeiten Massen von Anophelesmücken. Die Malaria verbreitete sich in verschiedenen Erscheinungsformen. Deshalb blieb auch das Terai von übermäßiger Besiedlung verschont. Nur ein paar Stämme, die Bote, Musahar, Kumal und Tharus hielten sich hier über die Jahrhunderte. Es gab aber noch einen anderen Grund für die Erhaltung der Natur!
Die Herrscher von Nepal benötigten ihre „hunting-grounds“ für ihre exzessiven Obsessionen. Nur die Eingeborenen wurden von der Flinte verschont, sonst trachteten die royalen Nepalis nach jeder lebenden Seele.
Bereits 1846 wurde das Nashorn zum königlichen Wild ernannt, was seine Unantastbarkeit durch das gemeine Volk bedeutete, solange bis sich die großen Jagdgesellschaften der Ranaherrscher und ihrer geladenen Gäste um die Dezimierung des Bestandes kümmerten. Dies geschah meist in den monsunfreien Monaten Dezember bis Februar. Man gab dem Großwild über den Rest des Jahres Gelegenheit, sich wieder zu erholen. Die Jagdbeute war gleichwohl beachtlich. Der Erfolg einer Jagd wurde damals noch gemessen an der Zahl der erlegten Tiere. König Georg V. von Englands Besuch im Jahre 1911 kostete allein in Chitwan 39 Tigern, 18 Rhinos, 4 Bären und einigen Leoparden das Leben. Das war jedoch nichts im Vergleich zu dem Blutrausch, der zu Ehren des damaligen Vizekönigs von Indien, Lord Linlithgow veranstaltet wurde. 120 Tiger, 38 Rhinos, 27 Leoparden und 15 Bären wurden ausgelöscht. Tabula Rasa kurz vor dem 2. Weltkrieg. Im Vergleich dazu nehmen sich die 21 Elefanten, 31 Tiger, 3 Leoparden, 1 Rhino, 7 Sambar, 20 Axis, 1 Krokodil, 4 Bären und 6 Fasane des Ranaherrschers Bahadur aus dem Jahre 1850 eher bescheiden aus. Wozu die Fasane geschossen wurden?
Bei dieser Abschussrate sieht man, wie wildreich der Dschungel zu früheren Zeiten war. In einem Gebiet, wo 1939 noch 120 Tiger von einer Jagdgesellschaft erlegt werden konnten, gibt es heute vielleicht gerade noch 50. In den Salwäldern gibt es nur noch ungefähr 100 wilde Elefanten. Die Zahl der Leoparden dürfte die der Tiger kaum überschreiten.
Die Ranaherrscher erkannten die politische Bedeutung des Teraidschungels. Sie verboten die Besiedlung. Anfang des 20. Jahrhunderts streckte das Britische Empire seine gierigen Finger aus. Aber das Terai mit seinen extremen klimatischen Bedingungen zog die hill people ohnehin nicht an. Anders wurde die Situation in den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts, als die Ranas abdankten und die Bevölkerungsexplosion die Leute in die Täler herunterdrückte. Das 1954 durchgeführte Programm zur Ausrottung der Malaria tat ein Übriges. Wilderei und Entwaldung waren die Folgen. Vor allem das Rhinozeros wurde gejagt, nachdem die Nashörner in Afrika knapp geworden waren. Das Pulver, das man aus dem Horn als Aphrodisiakum herstellt, ist nach wie vor in Ostasien heiß begehrt. Dahinter steckt der Irrglaube der Chinesen, sie müssten ihrer Potenz in der Welt noch mehr Geltung verschaffen. Die Holzhammermethode würde bei diesen affengeilen Pulverschluckern zu weit besseren Ergebnissen führen. Ebenso abartig ist das Brauchtum in Jemen. Jeder Mann wünscht sich als Symbol der Wehrhaftigkeit und Würde einen Dolch mit einem Nashorngriff. Es wäre noch wünschenswerter, das Selbstbewusstsein der jemenitischen Männer auf eine andere Art und Weise zu stärken. Ich denke an einen Plüschturban. Ernsthaft kann man hier nur erkennen, dass die menschliche Tradition oft auch die kranke menschliche Seele wiedergibt.
Bis 1960 waren 65% der Wälder im „Herzen des Dschungels“ abgeholzt. Man erkannte die Gefahr und siedelte die Menschen wieder um. Doch die Eingriffe durch die am Rande des Parks lebenden Menschen blieben. Das Chitwan Rhinocerus Reservat wurde geschaffen. In jener Zeit verschwanden die letzten Sumpfhirsche. 1970 wies König Mahendra die Regierung an, einen Nationalpark einzurichten. 1973 war es endlich soweit. 1984 wurde in Anbetracht des Reichtums an Flora und Fauna der Royal Chitwan zum World Heritage Natural Site durch die UNESCO erklärt. Wie gut, dass sich die Natur immer wieder erholt und regeneriert. Doch das kann sie nur, wenn Restbestände vorhanden sind. Ich betrachte es als vorteilhaft, dass die Zufahrtswege nach Chitwan immer noch so schlecht sind. Man sollte weder Straßen bauen noch elektrische Leitungen verlegen, vorausgesetzt es geschieht im Interesse des Naturschutzes und man kann auf die Einnahmen aus dem Tourismus verzichten. In Ostafrika hat der Tourismus nicht unwesentlich zur Erhaltung der Natur beigetragen! Es ist klar, dass es in Nepal nicht anders verlaufen wird.
Ich war jedenfalls froh, ein bescheidenes Quartier in der „Jungle Lodge“ gefunden zu haben. Der Name stimmte. Meine Hütte war gut getarnt mit Klettergewächsen und Blumengirlanden. Das Innere war bereits besetzt als Heimstätte vieler Tiere und Pflanzen. An den Wänden liefen Geckos, von der Decke hing eine Spinne. Das löchrige Moskitonetz beherbergte Hautflügler und Nachtfalter, auf dem Boden waren Nagespuren zu erkennen. In der Zimmerecke wucherten Schimmelpilze. Ich war zufrieden, denn in der „Chitwan Tourist Lodge“ hatte es noch unwohnlicher ausgesehen. Die Einheimischen wohnten sauberer. Außerdem hatte ich hier eine schönere Umgebung. Der Garten war urtümlich und gemütlich. Wasserknappheit gab es nicht. Diese beiden Unterkünfte schienen die einzigen zu sein, die noch nicht in auswärtiger Hand waren, wie man an den Preisen ersehen konnte.
Mein erster Gang führte mich zum Büro des Park-Direktors. Ich wollte ihn mit einer Kollektion Fotografien für mich gewinnen. Ich hatte ein paar Sonderwünsche. Aber Parkdirektoren sind in der Regel nicht da, wo man sie erwartet. Und der Deputy besitzt wie immer keine Kompetenzen.
Nach dieser Enttäuschung vermachte ich ein Bild der Jungle Lodge, das nach Wunsch des Personals sogleich in der Lounge - ein Raum von zwei mal zwei Metern Größe- aufgehängt werden sollte, wogegen ich mein Veto einlegte, weil ich glaubte, dass der Raum zu dunkel war. Außerdem hatte das Bild einen Rahmen verdient.
Ich bestellte mein Mittagessen und duschte. Nach dem Essen wollte ich mir einen ersten Überblick über die Örtlichkeiten verschaffen. Ich hatte keine Karte bekommen können, hatte mir aber im Parkoffice eine Übersichtskarte abgezeichnet.
Sauraha lag am Rande eines Wäldchens. Es gab ein paar Touristenlodges und Gebäude der Parkverwaltung um das kleine Dorf herum verstreut. Hinter dem Dorf floss der Rapti River. Das Wäldchen wurde südlich von einem schmalen Zufluss begrenzt, der als Dhungeli Creek bezeichnet wurde. Zwischen Dhungeli Creek und Rapti lag eine Landmasse, die zum Teil aus Grasland, zum überwiegenden Teil aus Galeriewald bestand. Der eigentliche Park lag aber jenseits des Rapti. Dort drüben erstreckte sich Grasland, nach Westen hin, flussabwärts, bis zur Krokodilstation in Kasara auf einer Länge von 15 Kilometer und eine Breite von bis zu drei Kilometern. Südlich davon ging das Grasland in Wald über. Unten am Fluss war eine Furt. Am anderen Ufer begann der Galeriewald. Ein Stück flussaufwärts war Grasland, das nicht zum Park gehörte. Dort befand sich das kleine Dorf Vile. Fährboote gab es keine, da der Verkehr über den Fluss entweder zu Fuß oder mit Dugout Kanus von statten ging.
Ich folgte einigen Dorfleuten hinüber zum anderen Ufer und beging dann einen Pfad in den Galeriewald hinein. Ich war nicht wenig erstaunt, als ich schon bald auf einen Kothaufen stieß. Die Kotballen waren hoch aufeinandergetürmt. Ich hatte dergleichen noch nie gesehen, wusste aber sogleich, dass dies nicht das Werk eines künstlerisch begabten Elefanten war, sondern eines anderen Dickhäuters.
Der Kot war nicht frisch, trotzdem war mir klar, dass das Tier, das ihn produziert hatte, noch in der Nähe sein konnte. Wilde Elefanten mögen die menschliche Gesellschaft nicht und meiden deshalb auch ihre Nähe. Bei Nashörnern ist das anders. Man könnte sagen, dass sie sich der menschlichen Gesellschaft nicht bewusst sind, außerdem sind sie nicht so nervös und schreckhaft wie Elefanten. Da ich die Verhaltensweise der Nashörner noch nicht studiert hatte, dazu war ich ja hierhergekommen, verließ ich den Galeriewald wieder. Es war gut, erst einmal die Landessprache zu lernen, bevor man einen Nichtangriffspakt mit den Nashörnern zu schließen bereit war.
Ich umging das ungefähr zwei Quadratkilometer große Wäldchen, hinter dem sich wiederum Grasland breitgemacht hatte, bis zum Salwald, durch den der Weg weiter nach Kasara führte. Diese Landschaft war sehr abwechslungsreich und vielversprechend, denn sie bot Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Das war genau das, was ich gesucht hatte. Hier war ich wirklich im Herzen der Wildnis, ohne dass ich lange Anmarschwege in Kauf nehmen musste. Und offensichtlich war ich das einzige denkende Wesen weit und breit, das dieser Tatsache irgendeine Bedeutung zumaß. Meinethalben konnte ich vollends die Alleinvertretung meiner Art in diesem Gebiet übernehmen.
Doch bevor ich mich der unbescheidenen Einbildung, der unumschränkte Herrscher über diese Parzelle zu sein, hingeben und sie einer genaueren Begutachtung unterziehen konnte, entdeckte ich in einiger Entfernung zwei Touristen.
Dass es Touristen und nicht etwa Eingeborene waren, erkannte ich wie immer in solchen Fällen sogleich an den grellen Farben der Bekleidung. Die Eindringlinge in mein Reich verhielten sich sonderbar. Ich beschloss, den Grund dafür herauszubekommen.
Jetzt kletterten die beiden sogar auf einen Baum – jeder auf einen eigenen! Die Ursache dafür konnte ich nicht erkennen. Ich ging langsam näher, bis ich genau zwischen den beiden Touristen war. Sie hatten mich bemerkt und deuteten auf den Waldrand hin. Jetzt sah ich den Grund für ihre erhöhte Position. Das Gras war überall zwei Meter hoch und höher, außerdem versperrte Buschwerk die Sicht. Aber nun sah ich dort am Waldrand erst zwei, dann drei Nashörner in einer Entfernung von hundert Metern, die Hinterteile mir zugewandt!
Ein Baum in der Nähe war noch unbesetzt. Nicht mehr lange. Sehr schnell war ich oben. Es war kaum zu glauben. Ich war keine zwei Stunden in Chitwan und sah schon drei Exemplare von einer der seltensten Tierarten der Welt!
Diese urtümlichen Geschöpfe machten einen friedsamen Eindruck. Sie ästen gemächlich, drehten sich einmal nach links und dann wieder nach rechts und kamen immer näher zum Waldrand. Ich wurde mutiger und wendete jetzt die Taktik des Inselspringens an, in der Abwandlung, dass meine Inseln Bäumchen waren, die ich zu erklettern hatte. Ich lernte nacheinander einen Tatari, Bhelur und einen verkrüppelten Salbaum kennen. Bei letzterem machte ich einer Calotes-Eidechse den Platz an der Sonne streitig. Es kam mir so vor, als ob ihr Gesichtsausdruck bedeuten sollte: „Der Baum gehört mir!“ Und im Übrigen seien meine ungelenken Verrenkungen das merkwürdigste, was sie je gesehen habe. Ich stieg auch vom Baum herunter, denn es war wirklich lächerlich. Das zeigte mir besonders ein Blick zurück, wo die beiden Touristen immer noch auf ihren Bäumen hingen. Die Nashörner standen 40 Meter vor mir im tiefen Gras. Sie wussten nichts von meiner Anwesenheit. Ihre Nasen hatten sie in duftendes Grün getaucht; in ihren Ohren summten freche Fliegen wie das ruckartige Wackeln der Ohrmuscheln anzeigte. Und ihre Augen waren so kurzsichtig, dass nur Kontaktlinsen ihrer Sehschwäche hätten Abhilfe leisten können. Ich nahm mir vor, nie mehr wieder wegen eines Nashorns auf einen Baum zu steigen. Dabei würde ich es noch so dringend nötig gehabt haben!
Die drei Nashörner verschwanden in dem Galeriewäldchen, aus dem ich vorher gekommen war. Es war unmöglich, ihnen durch das Dickicht zu folgen.
Hochzufrieden schon den Stoff für eine Reportage mit einem Dutzend guter Bilder zu haben, beschloss ich, dem Tal Machan, einer Art Hochsitz, noch einen Besuch abzustatten. Er musste nach meiner Zeichnung ungefähr 400 Meter entfernt am südwestlichen Eck des Wäldchens stehen.
Er war nicht zu übersehen. Sein Gerüst stand wohl an die 15 Meter hoch. Es fehlte leider die unterste und mittlere Plattform und die Treppe war auch nicht mehr vorhanden.
Es war Trockenzeit und von einem „Tal“, was einen kleinen See oder Teich bezeichnet, war nichts mehr zu sehen. Nur ein sumpfiger Tümpel war übriggeblieben, der nicht überschaubar war, weil er mit Riedgras und Schilf dicht umstanden war. Ich wollte mir von oben einen besseren Überblick verschaffen. Mich von Querbalken zu Querbalken nach oben ziehen, wäre eine leichte Übung. Während ich mich hochhangelte, dachte ich noch spaßhaft und vermessen, wie schade es war, dass kein gereiztes Rhino hinter mir her war. Ich denke oft in fotografischen Momentaufnahmen.
Doch kaum hatte ich den zweiten Querbalken erreicht, gab es eine Überraschung! In dem Tümpel direkt unter mir lag ein Rhino! Es hatte mich entdeckt und arbeitete sich sogleich aus dem Schlammbad heraus. Der Machan stand also doch an der richtigen Stelle! Da er keine Stufen hatte, konnte mir das Rhino unmöglich nachsteigen. Dafür hätte es das stelzenartige, in den Boden gerammte Gerüst mit Leichtigkeit umstoßen können und ich wäre in dem nämlichen Loch gelandet, wo vorher das Rhino dringesteckt hatte.
Das Rhino hatte solche Gemeinheiten nicht im Sinn. Es entfernte sich und verschwand im Grasdschungel, mit optischer und akustischer Vehemenz. Ich war irgendwie erleichtert. Trotzdem, schade!
Der Machan war wirklich sehr heruntergekommen. Dabei war er der ideale Beobachtungsplatz, vorausgesetzt man war rechtzeitig oben. Vielleicht hatte man den Machan gerade deshalb aufgegeben, weil die Rhinos hier ungestört baden sollten, ohne von Wilderern und Touristen daran gestört zu werden. Die Bretter des Bodens auf der Plattform drohten jeden Augenblick unter meinem Gewicht zusammenzubrechen. Hier oben hatte sich schon lange niemand mehr aufgehalten, das war nicht schwer zu erraten. Es war nun ein beliebter Landeplatz für Vögel wie man an ihren Hinterlassenschaften sehen konnte. Das morsche Holz hatte außerdem bereits zahlreiche Bohrlöcher. Ich hatte das Gefühl, dass ich auf dem Erdboden besser aufgehoben wäre und so stieg ich wieder herunter.
Wenn ich aber gedacht hatte, für heute keine weiteren Begegnungen mit dem Erdzeitalter des Miozäns zu machen, sah ich mich bald getäuscht, jedoch keinesfalls enttäuscht.
Ich war zum Weg zurückgegangen. Schon beim ersten Blick über die bis zum Rapti sich erstreckende Grasflur hatte ich schon wieder zwei Einhörner entdeckt! Hier gab es keine Bäume. Das tat jedoch meinem Jagdtrieb keinen Abbruch. Die Nashörner fingen auf einmal an, miteinander zu streiten, wenn man das Kopf-gegen-Kopf-Geschiebe nicht anders interpretieren musste. Zwischen den Nashörnern und dem Weg suchte ich hinter einer Reihe Büsche Deckung. Jetzt durften die Nashörner von der unangemeldeten Fotosession nicht Wind bekommen, denn ich hätte keine Chancen die nächsten Bäume zu erreichen. Sie standen hundert Meter weit weg. Bis zu den Trampeltieren waren es noch dreißig Schritte.
Aber die Büsche, zwischen denen ich saß, waren Bhanti, eine Clerodendronart, die glücklicherweise in Blüte stand. Ihre weißen Blüten rochen streng. Sie mussten meinen Eigengeruch überdecken.
Ich setzte einen Punkt hinter den letzten Absatz meiner gedanklichen Reportage, schoss den Film voll und setzte mich nach hinten ab.
Hier gab es Nashörner so zahlreich wie der Sand am Ufer des Rapti. Ich lebte in einer anderen Zeit. Diese Tiere waren Überbleibsel vorsintflutlicher Zeitgenossen der Sauriere. Vor der letzten Eiszeit lebten in dieser Gegend vierhörnige Sivatherium zeitgleich mit der Art, die bis heute überlebt hat. Man fand von beiden Fossilien. Was hatte sich so sehr geändert im Terai? Man hätte sich gut vorstellen können, dass die Landschaft stets die gleiche geblieben war. Doch der nachhaltige Einfluss von Menschen ist überall nachweisbar, auch wenn man ihn nicht auf den ersten Blick sieht. Zum anderen ist die Umgebung von Chitwan auch ohne den Menschen nicht statisch, sondern dynamisch. Die Flüsse ändern stetig ihren Lauf, wo Galeriewälder stehen, ist bald Grasland und umgekehrt. Wasser und Feuer schaffen abwechselnd Veränderungen in der Vegetationsdecke. Aber das alles ist nichts im Vergleich zu den großen Veränderungen in deren Folge sich das Himalayagebirge auftürmte. Damals wurde das Antlitz der Erde in Kataklysmen total verändert. Das Himalayavorland faltete sich wie ein Teppich zu den Siwallikhöhenzügen oder Churiahills wie man sie in Nepal auch bezeichnet. Und das geschah in kurzer Zeit, weshalb viele Lebewesen umkamen, deren Überreste oder Versteinerungen man heute noch finden kann. Fossilien sind immer ein Hinweis auf bedeutende Verschüttungen durch katastrophale Ereignisse innerhalb kurzer Zeit. Im Sandkasten spielen sie sich nicht ab.
Fast konnte es einem so vorkommen als hätte sich das Panzernashorn aus dieser fernen Zeit zu uns verirrt. Es war nicht vorsintflutlich, sondern voreiszeitlich. Aber ist es so viel ungewöhnlicher in seiner Erscheinung als der Elefant? Oft macht uns nur die Seltenheit staunen. Ich wäre zwei Wochen in Chitwan geblieben, nur um ein Rhinozeros zu sehen. Wäre ich nur deshalb gekommen, hätte ich schon wieder gehen können, denn ich hatte mein Ziel erreicht. Aber Chitwan hatte weit mehr zu bieten als nur prähistorische Erscheinungen.
Das Nashorn ist auch in Chitwan hauptsächlich durch die Wilderer gefährdet. Ein so großes und seltenes Tier wird getötet, nur um an seinen Nasenfortsatz zu kommen! Dabei müsste man es nur betäuben, dann könnte man das Horn absägen. So wird es in einigen Zoos und Nationalparks in Afrika gemacht. Das Horn ist aus Keratin und wächst wieder nach. In seltenen Fällen wird es sogar bis zu 60 Zentimeter lang.
Auf dem Rückweg kam mir eine Kolonne Elefanten mit Touristen auf ihren Rücken entgegen. Dies war die andere Art wie man sich in den Park begeben konnte, wenn man nicht zu Fuß wie ich, allein oder mit einem Guide, unterwegs sein wollte. Vorerst gab es nur im Westteil des Parks auch Ausflüge mit Jeeps. Es war abzusehen, dass diese Methode auch im Ostteil Einzug halten würde.
Ich war mein eigener Guide. So bekam ich mehr zu sehen. Ein einzelner Mensch ist unauffällig und erweckt sogar die Neugier mancher Tiere. Zwei sind jedoch zu viel des Guten. Die vielen Privatunternehmen, die von Katmandu aus operierten, hatten zusätzlich europäisches Preisniveau eingeführt. Dass das Teuerste nicht das Beste ist, sieht man auch an den drei Exklusivunterkünften innerhalb des Parks. Im Wesentlichen trifft ihre Exklusivität nur auf die Preise zu.
Namen will ich nicht nennen. Das eine Resort liegt in der Ostecke des Parks, wo es keine Nashörner gibt, weil das Grasland fehlt. Das Top Hotel am anderen Ende des Parks liegt reizvoll. Es ist aber ein Club, der kaum Möglichkeiten bietet, die Wildnis individuell zu erfahren. Aber das will auch niemand, der für einen Tag Aufenthalt in der Wildnis den Monatslohn zweier nepalesischer Arbeiter zahlt. Die Ausflüge schließlich, die von dem Luxushotel in der Nähe von Sauraha unternommen wurden, konzentrierten sich meist nur auf den nördlichen Uferbereich des Dhungeli und des Rapti, die Gegend, die ich noch sehr gut kennenlernen würde.
Wer sich von diesen beschränkten Aktivitäten fernhalten möchte, der führt seine Privatunternehmungen am besten von Sauraha aus durch. Die Moskitonetze dort sind nicht durchlässiger, das Essen ist nicht schlechter, und wenn man einen Guide braucht, dann bekommt man einen guten und preiswerten.
Das bestätigte mir auch der Forest Officer, zu dem mich der Ticket Officer geschickt hatte. Er hatte bereits von meinem einzelgängerischen Wesen erfahren. Eigentlich wollte ich nur die entrance fee für eine Woche im Voraus zahlen. Doch dann erinnerte mich der Forest Officer daran, dass so viele junge Männer aus dem Dorf ihr Geld als Guide verdienen würden. Auch die zwei Touristen, die ich gesehen hatte, hätten ihren Guide gehabt, versicherte er mir. Ich hätte ihn nur nicht gesehen. Aber er hätte mich gesehen und das auch gemeldet.
„Und er hat meinen Guide nicht gesehen!“ gab ich scherzhaft zurück.
Was die Dorfleute betraf, ihr Dorf Vile gehörte nicht zum Chitwan Park, der es aber umschloss. Trotzdem durften sie sich frei in ihm bewegen. Das Dorf gab es ja schon länger als den Park. Der Officer bat mich, in der näheren Umgebung von Sauraha und Vile zu bleiben, was ich in Anbetracht des langen Anreiseweges von mehreren hundert Kilometern für akzeptabel hielt. Und außerdem sollte ich auf den Wegen bleiben. Dann erzählte er mir von einem Unfall, der sich erst vor wenigen Wochen ereignet hatte. Zwei junge finnische Frauen waren von einem Nashorn übel zugerichtet worden und lagen noch immer im Krankenhaus von Katmandu. Sogar das Fernsehen hatte davon berichtet. Ich sagte, dass ich sehr kamerascheu sei und lieber hinter der Kamera stehen würde. Auf meine Frage, ob die Frauen alleine unterwegs gewesen seien, schwieg er.
„Guide schützt vor Gefahren nicht!“
Ich zitiere aus einem Führer:
„Approaching Rhinos on foot is extremely dangerous and a few visitors and locals are gored every year.“
Ich kann dies nur bestätigen. Sich Nashörnern zu Fuß zu nähern, ist sehr gefährlich, oder besser gesagt, kann sehr gefährlich werden. Man sollte daher einen Sicherheitsabstand von wenigstens 50 Metern in offenem Gelände einhalten!
Die schöne Natur hat ihre hässlichen Seiten. Das war auch wieder in „Tiger Cottage“ zu erfahren, einem kleinen Hotel, das über kühle Getränke verfügte. Einem Pappschild war zu entnehmen, dass der Sohn des Hauses vor einem Jahr von einem Tiger angefallen worden war, während er als Guide den Rückzug der Touristen deckte. Um eine Geldspende wurde gebeten. Ich erfuhr von dem Bruder des Verunglückten Einzelheiten über diese Tragödie. Birendra hatte mich zum Dinner eingeladen und nun saß ich in einem schmucklosen, aber sauberen Raum in einer Lehmhütte und aß Goranhifisch und Gemüseauflauf.
Der Guide war mit vier Deutschen im vier Meter hohen Narengagras unterwegs gewesen. Sie hatten keine Chancen dem Tiger auszuweichen. Chitwan ist berühmt, aber auch berüchtigt für seine ausgedehnten Grasdschungel. Man kann sich keinen Weg bahnen wie über einen Golfplatz. Man muss die tunnelartigen Trampelpfade der Rhinos benutzen, wenn man in dem Grasmeer vorwärtskommen will.
Ich fragte Birendra, warum die Guides diese unübersichtlichen Wege mit den Touristen überhaupt begehen würden. Es konnte ja hinter jeder Biegung ein Rhino stehen.
Ich bekam keine klare Antwort, aber ich konnte mir auch eine denken. Die Touristen versprechen sich von einem Ausflug in die Wildnis, Tiere aufzuspüren. Dazu gehörte auch der Nervenkitzel. Und wenn nicht das eine ausreichend zu haben ist, dann doch jedenfalls das andere. Es benutzen aber nicht nur Rhinos und Menschen diese Hohlwege, sondern auch Tiger.
Das plötzliche Auftauchen von fünf Menschen musste den Tiger irritiert haben. Vielleicht wäre das Folgende ausgeblieben, wenn die fünf Nepalesen gewesen wären. So hatte die Gruppe doch ein anderes Erscheinungsbild. Der Guide erkannte zwar sofort die Gefahr und rief den anderen zu, dass sie sich langsam zurückziehen sollten. Doch da stürzte sich der Tiger auch schon auf den nächsten in der Reihe. Die vier jungen Deutschen ergriffen nun aber nicht die Flucht wie man sich hätte denken können, sondern bewiesen, ganz tapfer und treu, die Nützlichkeit von Tapferkeit und Treue. Das war befremdlich für den Tiger. Er ließ von dem Guide ab und tat, was er gleich hätte tun sollen: er verschwand im dichten Grasdschungel.
Zum Glück hatte er sich nur kurz mit dem Guide beschäftigt, trotzdem war schnelle ärztliche Hilfe dringend erforderlich. Die vier jungen Leute schleppten den bewusstlosen, schwer verletzten Guide nach Sauraha. Er überlebte, war aber ein Jahr später immer noch in ärztlicher Behandlung. Die Geschichte sei auch deshalb bezeugt, weil hier die vielgescholtenen Touristen einen vorbildlichen Eindruck hinterlassen haben, auch wenn sie mitverantwortlich waren, dass es überhaupt so weit gekommen war. Besser ist es deshalb, wenn man sich mit seinen Schutzbefohlenen nicht in solche Gefahren bringt. Leider ließe sich das gänzlich nur vermeiden, wenn man den Dschungel links liegen ließe. Aber ich sagte bereits, in den Dschungeln der Großstädte ist es weit gefährlicher. Es wäre nicht sehr originell, Ausflüge in die Wildnis bleiben zu lassen, nur, weil hin und wieder etwas passiert. Der Mensch braucht die Begegnung mit der Natur. Vielleicht geht ihm irgendwann einmal ein Licht auf, was er eigentlich versäumt hat, all die Jahrhunderte, in denen er die Natur nicht so behandelt hat, wie es gut für sie und ihn gewesen wäre.
Ich möchte dennoch niemand ermutigen, sich einem Risiko auszusetzen, dass er nicht einschätzen kann. In einer Veröffentlichung über die Sunderbans in Bangladesch wurde meine Aussage über die Gefahren in diesem größten Sumpfgebiet der Erde ohne mein Einverständnis abgeschwächt, um das touristische Interesse nicht zu gefährden. Gegen solche Machenschaften möchte ich mich ausdrücklich verwahren.
Auch die beiden finnischen Frauen hatten sich in den Irrgarten des Grasdschungels gewagt. Dieses Mal war es nicht ein Tiger, sondern ein Nashorn, das sich bedroht fühlte und die beiden niederrannte, während sich der Guide mit einem - vielleicht auch mit mehreren Sprüngen zur Seite rettete. Das Nashorn spießt seine Gegner nicht etwa mit dem Horn auf. Es traktiert sie mit seinen scharfen Hauern und fügt ihnen schlimme Bisswunden zu. Es hört damit erst wieder auf, wenn es seiner Meinung nach reicht, um den Gegner unschädlich gemacht zu haben. Es reicht immer. Leider sind die urzeitlichen Rhinos schwer von Begriff. Sie können nicht unterscheiden zwischen dummen Menschen, die ihnen in böser Absicht nachstellen und solchen, die sie nur für interessante Urweltviecher halten. Sie sind aber alles andere als schwerfällig. Sie erreichen zwar eine Schulterhöhe von 1,8 Metern bei einem Gewicht von über zwei Tonnen. Aber trotz ihrem behäbigen Äußeren sind Rhinos sehr gewandt, wenn es darauf ankommt. Sie können sehr schnell laufen und, wenn sie wollen, mitten im Lauf Haken schlagen. Dann sind sie sogar beweglicher als Tiger, die bei ihren Angriffen immer nur geradeaus laufen. Dafür können Rhinos nicht auf Bäume!
Rhinos führen Scheinangriffe, wenn sie sich gestört fühlen. Wenn sie sich bedroht fühlen, greifen sie an und dann bringt sie nichts mehr zum Stehen. Könnte man doch rechtzeitig entscheiden, wann sie unterscheiden zwischen Störung und Bedrohung! Weibchen mit ihren Kälbern sind stets hochsensibel. Sie fühlen sich nie gestört! Immer nur bedroht!
„Ich werde keinen Guide in Gefahr bringen“, stellte ich gegenüber meinem Guide-Bewerber kategorisch fest.
„Mir reicht es, wenn ich auf mich selber aufpassen muss!“
Ein Guide, der durch den Dschungel geht, macht keine Geräusche. Aber zwei Guides machen viele Geräusche. Sie unterhalten sich über jede Spur und streiten sich, ob 14 Hirsche oder nur zwölf das Gras niedergetrampelt haben. Ich würde mir selbst meine Rückwege decken und das hohe Elefantengras meiden, das versicherte ich Birendra.
„Ich werde mich schon rechtzeitig erschrecken, sei ohne Sorge!“
2. Kapitel
Spurenleser
Es gibt Menschen, die überall hingehen würden, wenn sie sich nicht durch einen ärgerlichen Mangel an natürlichen Kräften beschränken lassen müssten. Das Ideal der Freiheit, allein dem Unternehmungsgeist zu folgen, wurde früher von den Waldbewohnern gelehrt:
Sarram eva bishanti - sie dringen in alle Dinge ein, das Außen und das Innen. Und deshalb ist ein Waldläufer einer, der sich selber erkennen will.
„Du bist ein Guide, du bist ein Mann von Welt!“ sagte ich zu Maghi.
„Wer hat die längste Nase?“ fragte er mich. Ich strich mir über die Nase und antwortete zögerlich:
„Der Elefant!“
„Wer hat die längste Schnauze?“
„Der Pangolin!“
„Wer schießt mit Stacheln?“
„Das Stachelschwein, das kommt vom Schütteln!“
„Wer hat den stärksten Atem?“
„Der Lippenbär, er saugt die Termitenhügel leer!“
„Was leuchtet nachts den Weg?“
„Der Leuchtkäfer! Taschenlampen habt ihr ja keine!“
„Wer ruft des Tags: cool drink!?“
„Der Tourist!“
„Du bist ein Shikari. Aber ein Guide bist Du erst, wenn Du Spuren lesen kannst!“
Heute Morgen wollte er mich auf die Probe stellen.
Noch vor dem Frühstück erzählte er mir, dass ein Guide ihm von einem Touristen berichtet habe, der selber wie ein Nashorn, immer der eigenen Nase nach, gelaufen wäre. Angesichts meines hervorragenden Geschmacksorgans konnte nur ich gemeint sein.
„Der Mann hatte wohl recht. Ich denke, wenn die Rhinos mich riechen könnten, könnten sie mich riechen!"
Das musste ich ihm näher erläutern. Er meinte nur, er wolle meine Nase gerne auf eine Spur ansetzen. Wo? Drüben in Bhata, einem Tharudorf in der Nähe. Warum gerade dort? Das eben sollte ich selber herausfinden.
Ich las die Spuren von nächtlichen Moskitobesuchen auf meinem Unterarm. Genügte das nicht als Nachweis, dass ich ein Spurenleser war? Er solle doch nicht so großes Aufheben machen. Ich wollte nicht nach Bhata gehen, denn ich beabsichtigte gleich in den Dschungel aufzubrechen. Dafür würde ich zugeben, kein Guide zu sein.
Ich besann mich aber gleich, als Maghi erläuterte, dass mich die Sache interessieren müsste, denn in dem Dorf würde eine Ziege fehlen und er würde mir zutrauen, herauszufinden, dass „ein wildes Tier“ den Diebstahl begangen hatte. Das hörte sich wirklich interessant an. Wie weit weg war das Dorf? Wir würden fahren!
Ich folgte ihm nach draußen. Da stand sein Fahrzeug, durchaus ein Erzeugnis aus dem zwanzigsten Jahrhundert. Er entschuldigte sich, als er meine Skepsis bemerkte, dass er nicht auch für mich ein solches Fahrzeug besorgt hätte. Aber das Fahrrad hatte ja einen Gepäckträger.
Der anstrengende „Ritt“ nach Bhata wurde etwas kompensiert durch die reizvolle Flusslandschaft entlang des Rapti. Hin und wieder durchquerten wir verwildertes Grasland. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn plötzlich ein Nashorn auf dem Weg gestanden hätte. Als ich genug durchgeschüttelt war, bestand ich auf einen Platzwechsel. Als Fahrer hatte man den besseren Teil für sich.
In Bhata gab es anscheinend nur Frauen und Kinder, die unser Kommen an sich, zugleich aber auch das Wie, staunend und neugierig zur Kenntnis nahmen. Maghi führte mich zuerst in einen kleinen Stall neben einem Wohnhaus. Die Räume waren nicht untereinander verbunden. Der Stall grenzte an ein umzäuntes Feld.
Ein Tiger habe hier die Stalltür aufgebrochen, erklärte Maghi. Ich konnte jedoch keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens feststellen. Der einfache Holzriegel sei aus der Halterung gefallen, wurde mir gesagt. Jetzt befand er sich wieder an Ort und Stelle. Als der Räuber sich die eine Ziege aus dem Stall holte, flüchteten die anderen. Dass er drinnen war, konnte man an den Blutflecken auf dem Lehnboden erkennen. Der Boden war hart und wies weder drinnen noch draußen Fußspuren auf.
Ich ging mit Maghi zum Flussufer. Für Tiger sind seichte Gewässer kein Hindernis.
Ich wunderte mich, warum ein Tiger bei dem großen Nahrungsangebot in Chitwan, drüben auf der anderen Seite des Flusses, dieses Abenteuer überhaupt unternommen haben sollte.
„Hier! Hier hat der Tiger seine Spuren hinterlassen!“ Maghi zeigte mir die Stelle. Und tatsächlich, im feuchten Sand-Lehm-Gemisch waren deutlich die Abdrücke zu sehen. Vier Zehen einer großen Pfote. Ich hob meine Hand über den Abdruck und achtete darauf, dass meine Finger den Boden nicht berührten. Die Zehen der Katzenpfoten ragten geringfügig darüber hinaus. Es war klar, dass es keine Fischkatze gewesen war, die sich die Ziege geholt hatte!
Ich stand wieder auf und sagte zu Maghi:
„Es war kein Tiger! Es war ein Leopard. Aber es ist nicht schlimm, dass du dich geirrt hast. Es ist meine erste Leopardenspur in Nepal, die ich sichte. Es ist tatsächlich ein großer Leopard, sicherlich ein Männchen!“ Maghi bekam große Augen. Er warf einen geringschätzigen Blick auf die Spur und fragte:
„Und woher willst du das wissen?“
„Bücherweisheit! Was die Unterscheidung von Tigern und Leoparden betrifft, muss man aufpassen. Die einen haben ein geflecktes, die anderen ein gestreiftes Fell. Das ist das zuverlässigste Unterscheidungsmerkmal. Aber es ist nicht das einzige. Wir haben hier den Fußabdruck.
Männliche Tiger haben einen Pfotendurchmesser von ca. 12-14 cm, weibliche Tiger von 11-13 cm, wobei die Zehen etwas länglicher sind, das kommt wahrscheinlich von der Maniküre. Leopardenpfoten messen ca. 10-11 cm. Meine Handfläche ohne die Finger kann den Abdruck gerade überdecken. Damit steht für mich fest, es müsste ein kleiner, gefleckter Tiger, oder sagen wir besser, ein ausgewachsener Leopard gewesen sein.“
Maghi grinste. „Wenn es aber ein junger Tiger war?“
„Das ist eher unwahrscheinlich. Einen vergleichbaren Abdruck produzieren junge Tiger, wenn sie zwölf Monate alt sind. In dem Alter jagen sie oft noch nicht auf eigene Faust- wollte sagen, auf eigener Pfote. Die Mutter ist meist in der Nähe. Hier haben wir es wohl aber mit einem Einzelunternehmen zu tun, noch dazu in der Nacht! Typisch Leopard! Junge Tiger, die nachts über den großen Fluss waten, um Menschen zu bestehlen, das ist zu viel, was man glauben müsste. Da ist es wesentlich einfacher, an einen Leoparden zu denken, der in die Jahre gekommen ist und nicht mehr flink genug ist, einerseits das Wild zu schlagen, andererseits den bei Tage jagenden Tigern aus dem Weg zu gehen. Tiger töten Leoparden, wann immer sie sie zu fassen kriegen. Aber ich verrate dir ein Geheimnis. Ich habe von Anfang an, auch ohne die Spur, geglaubt, dass ein Leopard der Ziegendieb war, weil es einfach typisch für ihn ist, solche Dinge anzustellen. Man hätte mir den Tiger schon beweisen müssen. Aber du wusstest ja, dass es ein Leopard war, nicht wahr?“
Das war also die Guideprüfung! Ich erfuhr, dass die Ziegen erst Alarm geschlagen hatten, als der Leopard bereits mitten unter ihnen war. Die Leute waren aus den Häusern gelaufen und hatten mit ansehen müssen, wie der Leopard mit der Ziege im Maul an ihnen vorüber lief. Wenn das Schule machte! Dann war nichts mehr mit „Gute Nacht!“
Wir wateten über den Fluss und suchten am anderen Ufer nach weiteren Spuren. Dort war aber der Ufergrund von anderen Wildtieren zertreten. Wir folgten einem Wildpfad durch zwei Meter hohes Khairgras. Das war die stille Reserve der Leute von Bhata, denn Khairgras ist das Multifunktionsgras der Dorfleute.
Es war nicht anzunehmen, dass der Leopard die Ziege gleich wieder mit herübergeschleppt hatte. Vermutlich hatte er nicht weit vom Dorf, also noch auf der anderen Seite, mit dem Fressen angefangen, wo ihn des nachts weder Mensch noch Tier dabei stören würden. Jedenfalls war der Leopard mitsamt seiner Beute drüben vor Tigern sicher. Mancherorts sind Leoparden beinahe schon als Kulturnachfolger zu bezeichnen, wenn sie eine Vorliebe für domestizierte Tiere entwickelt haben. Ganz oben auf ihrem Speisezettel stehen Dorfhunde, heißt es.
„Ein Leopard, der an Ziegen Gefallen findet, wird es doch nicht auch noch auf Menschen abgesehen haben? Von wo kommt der Wind?“
Es war windstill. War es schon einmal vorgekommen, fragte ich weiter, dass Menschen im Terai von Leoparden angegriffen worden waren? „Sometimes!“ sagte Maghi nichtssagend. In Sri Lanka gab es in den letzten fünfzig Jahren nur zwei bezeugte Angriffe von Leoparden auf Menschen. Im gleichen Zeitraum sind hunderte von Menschen durch wilde Elefanten ums Leben gekommen. Deshalb mag man den Ceylonesen nicht glauben, wenn sie eine angeblich tolerante, buddhistische Haltung gegenüber Tieren als Begründung anführen. Als ob Leoparden eine Vorliebe für menschliche Einstellungen belohnen würden! Auch in Nepal ist der Buddhismus Religion der Mehrheit.
In Wahrheit ist der Leopard ungefährdet und ungefährlich dort, wo er genügend Lebensraum hat. Das ist im Osten von Sri Lanka noch der Fall. Nicht aber im Terai außerhalb von Chitwan. Batha lag am Rande des Parks.
Vorsichtshalber bewegten wir uns nur langsam vorwärts. Auf dem Pfad waren keine Spuren zu erkennen. Leopardenspuren kann man von den Spuren junger oder weiblicher Tiger nur sicher unterscheiden, wenn man beide nebeneinander hat.
Andernfalls gehört viel Erfahrung dazu. Die Zehen sind bei gleichem Pfotendurchmesser beim Tiger größer als beim Leoparden. Die Spur einer Hyäne sieht ähnlich aus. Die Hyäne ist aber kein Beutegreifer, der sich anschleicht, daher überrascht es nicht die Zehen als vergleichsweise groß zu finden. Außerdem sind in den Abdrücken die Klauen sichtbar. Schließlich sind ihre Vorderpfoten größer als die Hinterpfoten.
Alles was wir noch fanden, waren Schweinespuren, deren rudimentäre Zehen hinter den eigentlichen Zehen schwache Abdrücke hinterlassen hatten.
Wir kamen an zwei Bhelurbäume. Ihre Rinde ist normalerweise grau und hat einen weiß- und orangefarbenen Flechtenbewuchs. Einer der Bäume wies Kratzspuren von Leopardenkrallen auf. Sie befanden sich in Augenhöhe, damit war klar, dass sie nicht von einem Tiger stammen konnten, denn diese wären in Höhe eines ausgestreckten Armes zu finden gewesen. Der Leopard benutzte diesen Pfad öfters, sonst hätte er diese Markierung nicht hier angebracht.
Tiger verhalten sich ähnlich. Erfahrene Shikars können bei solch spärlichen Spuren sogar das Geschlecht des Tieres ablesen, wohin es anschließend gelaufen sein muss, was für ein Tier es zuletzt getötet hat - und ob es ein Tier war!
Die Spuren des Geläufs sind noch aufschlussreicher. Geschlecht, Alter, Gesundheit, Richtung und Geschwindigkeit verraten sie. Bei Schritttempo sieht man von größeren Katzen nur die Abdrücke der Hinterbeine, weil sie die genau in die Abdrücke der Vorderbeine hineinsetzen. Bei zunehmender Geschwindigkeit setzen die Hinterbeine vor den Vorderbeinen auf, so dass man alle vier Fußabdrücke zu sehen bekommt. Am Abstand von Vorder- und Hinterbeinen kann man so die Geschwindigkeit ablesen. Im Unterholz nutzten diese Erkenntnisse nichts.
Es gab hier auch keine Spuren von Nashörnern, dafür waren die Spuren von Axishirschen sehr zahlreich.
„Wie viele Hirsche waren hier?“ fragte ich Maghi.
„Zehn oder zwanzig!“ antwortete er. Ich hatte den Eindruck, dass er geraten hatte. Um bei einer vorhandenen Spur festzustellen, wie viele Tiere man vor sich hat, zieht man einfach zwei Striche quer zur Laufrichtung im Abstand von 60 cm. Das ist der Abstand zwischen Vorder- und Hinterhufen. Dann zählt man die Abdrücke, die sich dazwischen befinden und teilt die Zahl durch zwei. Damit hat man die ungefähre Zahl der Tiere. Diese Methode funktioniert im Prinzip bei allen Tieren und sogar, etwas abgewandelt, bei Zweibeinern, vorausgesetzt die Laufrichtung bleibt die gleiche und die Abdrücke sind noch zählbar.
Maghi untersuchte den Wegrand, konnte aber keine Schleifspuren entdecken. Er glaubte immer noch, dass der Leopard die Ziege über den Fluss geschleppt hatte. Tiger und Leoparden heben ihre Beute an, wenn sie einen Weg überqueren. Es soll dadurch vielleicht vermieden werden, Bären und Hyänen eine Duftspur zu hinterlassen. Dieses Verhalten lässt auf vorausgedachtes Handeln schließen. Höhere Tierarten sind zweifellos intelligenter als sie oft dargestellt werden. Es fragt sich nur wie intelligent – ganz wie beim Menschen. Sie sind von ihrem Schöpfer mit allem ausgestattet, was sie in ihrem natürlichen Lebensraum benötigen, solange er noch natürlich ist!
Wenn Leoparden und Tiger mit ihrer Mahlzeit nicht fertig werden, decken sie die Überreste, den „Kill“, mit Laub zu, um ihn vor Aasfressern zu verbergen. Diese Maßnahme bringt nicht einmal der Deutsche Schäferhund fertig. Er bräuchte eine höhere Schulung.