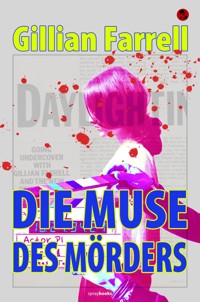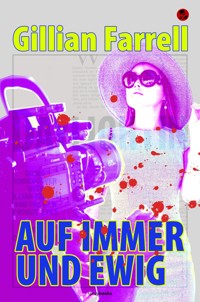
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: spraybooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Annie McGrogan
- Sprache: Deutsch
Die Schauspielerin Annie McGrogan hat sich aus Hollywood verabschiedet. Sie hat ihre verkorkste Ehe, ihre bescheidene Karriere, ihr Auto und eine schmerzhafte Liebesaffäre hinter sich gelassen, um in New York einen neuen Anfang zu wagen. Hier allerdings machen Schauspielerinnen alles, vom Kellnern bis zum Putzen, aber sie schauspielern wenig bis gar nicht. Auch Annie muss Miete zahlen und bewirbt sich als Detektivin beim Expolizisten »Duke« DeNobili. Der ist zwar nicht gerade von ihren Fähigkeiten auf seinem Sektor überzeugt, aber er engagiert sie als nächtlichen Bodyguard für Lucinda Merrill, dem Star der TV-endlos-Soap-Opera »Forever and Ever«. Doch schon am Morgen nach Annies erster Arbeitsnacht gibt es Schwierigkeiten: Lucinda Merrills Mann wurde in einer entfernt liegenden Wohnung ermordet, und der Fernsehstar wurde von Zeugen am Tatort gesehen. Annie schwört, dass ihr Schützling die Wohnung nicht verlassen hat, aber die Presse stürzt sich natürlich auf den Skandal und schürt die Verdachtsmomente. Annie bleibt nichts anderes übrig, als ihre wahren detektivischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen … Annie McGrogan gibt mit ihrem ersten Fall eine beeindruckende, witzige und höchst spannende Vorstellung, indem sie einen Mörder in die Falle lockt, wie es nur ihr als Schauspielerin gelingen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Was tut eine Schauspielerin, die gerade in New York angekommen ist, kein Geld mehr hat und deren Kreditkarte gesperrt wurde?
Nein, sie wird nicht Kellnerin. Annie McGrogan wird Privatdetektivin. Und obwohl ihr neuer Chef nicht gerade hundertprozentig von ihren Fähigkeiten überzeugt ist, nimmt er sie. Doch schon in ihrer ersten Nacht als Bodyguard passiert ein Mord, und aus dem kleinen Nebenjob wird blutiger Ernst …
»Kaum zu glauben, dass Auf immer und ewig ein Erstling ist. Welch ein Hochgenuss. Gut geschrieben, frisch und funkensprühend, ein ausgetüftelter Plot, viel New Yorker Lokalkolorit und wunderbare Einblicke in die Welt der wirklichen Schauspieler.«
THE WASHINGTON TIMES
Die Schauspielerin Annie McGrogan hat sich aus Hollywood verabschiedet. Sie hat ihre verkorkste Ehe, ihre bescheidene Karriere, ihr Auto und eine schmerzhafte Liebesaffäre hinter sich gelassen, um in New York einen neuen Anfang zu wagen. Hier allerdings machen Schauspielerinnen alles, vom Kellnern bis zum Putzen, aber sie schauspielern wenig bis gar nicht. Auch Annie muss Miete zahlen und bewirbt sich als Detektivin beim Expolizisten »Duke« DeNobili. Der ist zwar nicht gerade von ihren Fähigkeiten auf seinem Sektor überzeugt, aber er engagiert sie als nächtlichen Bodyguard für Lucinda Merrill, dem Star der TV-endlos-Soap-Opera »Forever and Ever«. Doch schon am Morgen nach Annies erster Arbeitsnacht gibt es Schwierigkeiten: Lucinda Merrills Mann wurde in einer entfernt liegenden Wohnung ermordet, und der Fernsehstar wurde von Zeugen am Tatort gesehen. Annie schwört, dass ihr Schützling die Wohnung nicht verlassen hat, aber die Presse stürzt sich natürlich auf den Skandal und schürt die Verdachtsmomente. Annie bleibt nichts anderes übrig, als ihre wahren detektivischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen … Annie McGrogan gibt mit ihrem ersten Fall eine beeindruckende, witzige und höchst spannende Vorstellung, indem sie einen Mörder in die Falle lockt, wie es nur ihr als Schauspielerin gelingen kann.
Der zweite Roman mit Annie McGrogan, Die Muse des Mörders, erscheint ebenfalls bei spraybooks.
Auf immer und ewig
EIN FALL FÜR ANNIE MCGROGAN
BUCH EINS
GILLIAN B. FARRELL
ÜBERSETZT VONMECHTILD SANDBERG-CILETTI
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Die Autorin
Titel der englischen Originalausgabe ALIBI FOR AN ACTRESS, 1992
Copyright © 1992, 2023 by Gillian B. Farrell
Copyright der deutschen Übersetzung © 1993, 2023 by Mechtild Sandberg-Ciletti
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN: 978-3-945684-41-2
eBook v1.0, August 2023
Copyright © dieser Ausgabe 2023 spraybooks Verlag, Köln
Redaktion: Doris Engelke
Korrektorat: Ute Lüers
spraybooks Verlag Bielfeldt und Bürger GbR
Remigiusstr. 20, 50999 Köln
www.spraybooks.com
Prolog
Als kleines Mädchen liebte ich Nancy Drew.
Als Erwachsene wurde ich Nancy Drew.
Ich habe sogar einen kleinen roten Roadster,
einen Triumph TR 6.
Das klingt so simpel,
so nach „glücklich bis an ihr Lebensende“.
Natürlich stimmt das nicht.
Eins
Zest-Time Cola machte eine Reihe neuer Werbespots. Das Thema waren menschliche Wärme und jugendliche Lebensfreude.
Menschliche Wärme und jugendliche Lebensfreude können viele Dinge bedeuten; diesmal bedeuteten sie schrilles Gequietsche an einem Strand und totale Verzückung angesichts einer kühlen Flasche Zest-Time Cola an den Lippen. Ich suchte fünf Stunden nach einem Badeanzug, der schmeichelte, ohne ordinär zu sein, und den ich mir leisten konnte. Zum Glück war es schon September und Badeanzüge waren weit heruntergesetzt. Nice Price, Ecke Columbus Avenue und 84. Straße, hatte einige passende Angebote, die sogar noch das Bloomingdale-Etikett trugen. Außerdem entdeckte ich dort einen Overall aus Rohseide in einem gedämpften Grün, das hervorragend zu meinem roten Haar passt und das Grün meiner Augen so richtig zur Geltung bringt. Meine Augen changieren. Manchmal sind sie blau, manchmal grün, manchmal grau. Sie spiegeln, was mich gerade umgibt, und wie ich mich fühle, aber ihre Farbe verändert sich auch durch Lidschatten und Kleidung. Ich hatte den Overall knapp einen Monat vorher bei Altman gesehen für über vierhundert Dollar. Jetzt war er auf neunundsiebzig fünfundneunzig heruntergesetzt. Der einzige grüne – die einzig gute Farbe – hatte meine Größe. Schicksal, Kismet, wie man will, ich zahlte mit meiner Visa-Karte. Entweder war ich tatsächlich noch unter meinem Limit, oder irgendwo verrechnete sich jemand, jedenfalls ging die Lastschrift anstandslos durch. Ich erwog einen Besuch beim Friseur, aber das Trinkgeld hätte ich bar geben müssen, und dazu reichte es nicht. Also wusch ich mir die Haare selbst. Das Wetter war gut, kühl und trocken, so dass ich den Bus nehmen und kein Geld fürs Taxi ausgeben musste.
Ich beschäftigte mich ziemlich intensiv mit meinem Outfit, obwohl es überhaupt nicht das war, was ich tun wollte. Ich wollte die Geheimnisse Becketts entwirren. Ich wollte die Lady Macbeth einstudieren. Ich wollte auf der Bühne stehen, als eine von Strindbergs tödlichen Frauen.
Das Casting für die Fernsehwerbung wird von Werbeagenturen erledigt, obwohl die eigentlich gar nicht dafür geeignet sind. Jedenfalls nicht aus der Sicht des Schauspielers. Als Wartezimmer dient meist das Foyer, wo die Aufzüge und die Aschenbecher sind. So ist es jedenfalls bei SSB & G. Ich weiß nicht, irgendwie scheinen diesen Leuten Zahlen ungeheuer wichtig zu sein. »Ja, Mr. Jones, wir haben in jeder Kategorie 4852 Frauen gesehen, Sir. Wir haben sie im Badeanzug aufmarschieren lassen und haben auch den Talenttest gemacht. Unsere Filiale in L.A. hat sich genauso viele angesehen. Hier ist der Bericht, und wir haben alle auf Video.« Wenn sich also der Zucker, das Parfum oder die Limonade nicht gut verkaufen, kann man den Schauspielern die Schuld geben, aber nicht der Agentur vorwerfen, sie hätte nicht gründlich genug gesucht. Na gut, da wären wir also, zwölf bis fünfundzwanzig Frauen in einem Raum, der für vier oder fünf gedacht ist, auf modernen unbequemen Sitzgelegenheiten aus Schaumstoff verteilt, alle aufgedonnert bis zum Gehtnichtmehr, die Models mit ihren großen Ledermappen voller Fotos und Referenzen, die bezeugen, dass sie schon andere Engagements hatten, und genug Geld für Fotos und Kram und wir alle mit unseren Reisetaschen voller Kleider für andere Vorstellungstermine, unseren Handtaschen mit Geld und Kreditkarten und Filofaxe, Schminktäschchen, Zeitschriften und Taschenbüchern, damit die Zeit nicht so lang wird, Tampons, Deos, Kleenex, Bürsten, Kämmen, einem Talisman vom derzeitigen Freund oder Ehemann und irgend etwas, das uns Mut machen soll – die Bibel, Pfefferminzbonbons, ein Handbuch über Selbstverwirklichung, ein Empfehlungsschreiben von unserem Schauspiellehrer, Valium, einen Joint.
Eine Garderobe oder einen Umkleideraum gibt es nicht.
Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man trägt den Badeanzug unter den Kleidern und legt beim Vorstellungsgespräch gleich noch einen Strip hin. Oder man zieht sich in der Damentoilette um.
Ich entschied mich für das Letztere. Drei Frauen waren schon da, als ich hineinkam. Außerdem zwei Angestellte der Agentur. Die eine saß auf dem Klo. Die andere machte eine kleine Schminkpause. Sie umrahmte ihre braunen Augen mit einem grünen Lidstrich und benutzte zu ihrem gelblich fahlen Teint ein ins Violett gehendes Rouge. Das passte überhaupt nicht zusammen, und ich hätte es ihr sagen können, aber manche Dinge lassen sich Leuten nur sehr schwer beibringen, selbst wenn es zu ihrem eigenen Besten ist. Eine der Schauspielerinnen kannte ich flüchtig. Sie hieß Irene. Ich hatte sie das letzte Mal vor einem Jahr in L.A. gesehen, aber sie sah aus, als wäre das über zehn Jahre her. Verstehen Sie mich nicht falsch, sie sah nicht alt aus. Letztes Jahr war sie zweiundzwanzig gewesen und wirkte wie vierzehn, jetzt war sie dreiundzwanzig und sah aus wie achtundzwanzig. »Hi!« sagte sie, während sie im Spiegel ihr Make-up prüfte. Ich sagte ebenfalls »Hi« und fragte, ob sie arbeitete. Natürlich, sagte sie, sie müsste schließlich ihre Miete bezahlen. Ich hatte gemeint, ob sie Theater spielte.
»Es ist doch alles Theater, Annie«, versetzte sie in einem Ton, als handelte es sich um eine zutiefst mysteriöse Erkenntnis.
»Was ist alles Theater?«, fragte ich.
Sie sah sich hastig um. Die andere Schauspielerin war gegangen, und die Angestellte der Agentur, die ihr Make-up erneuert hatte, war auf dem Weg hinaus. Eine der Kabinen war noch besetzt, aber Irene war es anscheinend egal, ob sie ertappt wurde, oder vielleicht wollte sie ja ertappt werden, oder hatte beschlossen, es sei egal, ob sie ertappt wurde. Sie holte ein Fläschchen Kokain heraus und schniefte.
»Ich wusste gar nicht, dass das noch in ist«, sagte ich. Vor ein paar Jahren war es so en vogue gewesen wie Hungern, aber als ich aus Los Angeles wegging, war dort praktisch alles auf Entzug.
Sie musterte mich in meinem einteiligen Badeanzug von oben bis unten. »Hast du eine Narbe, oder was?«, fragte sie.
»Keine Spur«, antwortete ich. Ich habe eine sehr helle, beinahe makellose Haut, wenn man die Sommersprossen nicht zählt und ein sehr verführerisch platziertes Muttermal.
»Komm, ich zeig dir was«, sagte sie. Sie meinte es gut und bemühte sich aufrichtig, mir zu helfen. Sie war, was die Oberweite anging, weit beeindruckender als ich. Ganz lässig hakte sie ihr Bikinioberteil auf und zeigte sich mir in unschuldiger Nacktheit. Sie war nicht wesentlich üppiger als ich – ich bin rundherum schlank –, aber ihr Oberteil war so ausgepolstert, dass es ihren Busen hochschob und viel üppiger erscheinen ließ.
»Busen im Naturzustand macht noch lang kein Dekolleté«, meinte sie und zog sich wieder an.
Verblüffend, wie viele Werbetexter so wenig zu tun hatten, dass sie im Korridor herumlungerten und uns angafften, als wir in unseren Badeanzügen von der Damentoilette zum Konferenzzimmer gingen. War ich die einzige, der das auf die Nerven ging? Hoffentlich nicht.
Es waren anwesend: der Artdirector, der Creative Director, der Texter, der Kontakter, der Kontaktassistent, drei Vertreter des Kunden und der Regisseur, der sich genau nach dem richten muss, was diese anderen Leute ihm sagen. Mit den Herren bekannt gemacht zu werden, war mir allerdings nicht vergönnt. Ich schloss aus ihrer Kleidung, wer sie waren. Der Artdirector trug kein Jackett, dafür ein Hemd in mehr als zwei Farben; der Creative Director war früher Bohemien gewesen, trug aber jetzt einen Schlips; der Texter hatte tatsächlich Lederflecken an den Ellbogen seiner Cordjacke; der Kontakter war in einen edlen, leicht abgetragenen Tweedanzug gehüllt, der Kontaktassistent trug einen neuen Anzug italienischen Stils, die Kundenvertreter trugen Anzüge von provinzieller Gediegenheit und der Regisseur präsentierte sich in Levis mit messerscharfer Bügelfalte und Cowboystiefeln.
»Was sehen wir hier? Wir sehen den blühenden Sommer!« sagte der Art-Director. Obwohl er dasselbe mindestens dreißigmal über dreißig Frauen vor mir gesagt hatte, schaute er sich um, als wollte er sehen, ob die anderen mit seiner Wortwahl einverstanden waren.
»Die Jugend. Den Inbegriff der Jugend«, verkündete der Creative Director feierlich.
»Jetzt möchte ich, dass Sie sich vorstellen, Sie seien mitten in einem Volleyballspiel. Sie sind mit Feuereifer dabei. Mit Leidenschaft. Sie geraten in der Sommersonne so richtig ins Schwitzen. Mann o Mann wird dieses eisgekühlte Zest-Time Cola nachher göttlich schmecken! Klar?«
Eine schauspielerische Übung, sagte ich mir. Ein Training der Sinne. Mich so in die Situation hineinzuversetzen, dass ich die Sonne auf meiner Haut und den grobkörnigen Sand unter meinen Füßen spüren konnte; das Klatschen der Brandung, das Gedudel der Kofferradios, das ausgelassene Geschrei der jungen Leute am Strand hören konnte. Ich versuchte, nicht daran zu denken, dass ich halbnackt von vollbekleideten Männern umgeben war, und es diese Männer überhaupt nicht interessierte, dass ich bei Vera Wlasowa vom Moskauer Theater und bei Jeff Gorey studiert hatte, dass Geraldine Page mich für die Rolle ihrer Gegenspielerin in The Trip to Bountiful vorgeschlagen hatte; ich bemühte mich, die kalten, harten Linien eines Wolkenkratzers aus Glas und Chrom und das schicke Konferenzzimmer zu vergessen und nicht daran zu denken, dass dieses sogenannte Vorstellungsgespräch den Herren nur dazu diente, ein paar hübsche Frauen mit Hüften und Busen wackeln zu sehen. Und wenn den Kerlen das Gewackel gefiel, würden sie noch zusehen, wie sie an einer Flasche nuckelte.
Ich musste »Volleyball« von vorn, im Profil und von hinten spielen.
* * *
Ich war erst seit sechs Monaten in New York, aber mir war ziemlich bald aufgefallen, dass eine Menge Leute hier eigentlich Schauspieler waren. »Hallo, mein Name ist Tod, ich bediene Sie heute Abend, aber eigentlich bin ich Schauspieler. Heute Abend können wir unseren Steinbutt mit einer feinen Chablissoße empfehlen.« Oder das junge Mädchen am Empfang sagt: »Ja, ich arbeite hier, aber nur als Aushilfe. Eigentlich bin ich Schauspielerin.« Jeder Taxifahrer, dessen Muttersprache Englisch ist, ist »eigentlich Schauspieler«. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich hatte gehofft, hier Schauspielern zu begegnen, die tatsächlich von der Schauspielerei lebten, die Brecht, spielten, oder Vaclav Havel, Sophokles oder Neue Junge Autoren.
Die Willie von Willie’s, dem besten altmodischen Saloon in New York, heißt in Wirklichkeit Connie Jean Snyder, kommt aus Peculiar, Missouri, und ist eine gute Freundin. Genauer gesagt, eine meiner drei besten Freundinnen. Und das ist sie nicht nur, weil ihre Kneipe für mich eine Art zweites Zuhause ist, jetzt, da ich kein Zuhause mehr habe, jedenfalls nicht in dem Sinn wie noch vor kurzem; und sie ist es auch nicht, weil sie eben jemand ist, den ich noch von Los Angeles her kenne. Sie ist meine Freundin, weil sie sich wie eine Freundin verhält. Sie hört einem zu, sie ist loyal, sie nimmt Anteil. Auch sie ist eigentlich Schauspielerin, und Willie ist ihr Künstlername. Sie war als Schauspielerin gut, und sie ist als Kneipenwirtin genauso gut – sie schafft eine Atmosphäre, wie man sie aus Filmen über New York kennt.
Willie begrüßte mich mit einer herzlichen Umarmung und einem Kuss, einem »Was hast du getrieben?«, und einem »Möchtest du was essen oder trinken?«.
»Nur ein Glas Mineralwasser«, sagte ich, als hätte ich nur ein wenig Durst, eine trockene Kehle von der hoffnungslos verschmutzten Stadtluft und nicht totale Ebbe im Portemonnaie.
(»Blödsinn!«, widersprach Willie und schob mich an einen Tisch. »Ich hab’ heut eine echt gute Erbsensuppe mit Schinken. Und danach musst du die Shrimps mit Safranreis probieren. Und dazu ein Bier. Bier ist gesund, hat einen Haufen Vitamin B.«
»Aber ich hab’ gar keinen besonderen Hunger«, log ich, während mir das Wasser im Mund zusammenlief.
»Hallo, Annie, mein Schatz, wie geht’s dir?«, rief Andrew. Er ist Kellner im Willie’s, und eigentlich Schauspieler. Er hätte wirklich ein Engagement verdient. Er ist gut. Er gab mir einen schallenden Kuss auf die Wange.
»Andrew, du siehst prima aus«, sagte ich.
»Danke schön«, erwiderte Andrew.
»Bring ihr ein Bier und eine Suppe und die Shrimps – das geht aufs Haus«, sagte Willie.
Andrew setzte sich. »Ich bin in die Endauswahl gekommen, gleich zweimal diese Woche. Einmal für eine Rolle in Forever and Ever.« Ich hatte mit ihm für diese Sprechprobe geübt und freute mich über seinen Erfolg, trotz der Erfahrung, die ich gerade mit Zest-Time Cola gemacht hatte. »Das andere wäre ein Engagement an einem Dinner-Theater in Tampa. Ganz große Sache«, sagte er, ohne eine Miene zu verziehen. »Abwechselnd Hello, Dolly und Der Widerspenstigen Zähmung. Jeweils in Ein-Stunden-Versionen.«
»Und was spielst du, die Widerspenstige?«, fragte Willie.
Andrew ignorierte sie. »Die Leute von Forever and Ever waren ganz hingerissen von mir. Ich hätte genau dieses Heimtückische und Böse, das sie suchen, sagten sie.«
»Was ist denn das für eine Rolle?«, fragte Willie.
»Ein hinterhältiger Killer aus einem bisher namenlosen nahöstlichen Land.«
»Zum Beispiel Irak oder Iran«, sagte ich.
»Zum Beispiel Libyen oder Libanon«, meinte Andrew, »je nachdem, wer in der Woche der Enthüllung gerade der Bösewicht in den Nachrichten ist. Forever and Ever ist immer voll auf dem Laufenden und bärenstolz darauf.«
»Bösewichter sind gut«, fand ich.
»Du bist ideal für die Rolle«, erklärte Willie. »Intrige und Verrat. Genau die Eigenschaften, die ich bei einem Kellner suche.« Sie hatte keine Angst, ihn zu verlieren, obwohl er beliebt und zuverlässig war; es gab eine lange Schlange eigentlicher Schauspieler, die nur darauf warteten, ihn abzulösen.
»Wisst ihr, ich habe das so richtig inbrünstig gespielt. Fast verführerisch. Habe nicht einen dieser pathetischen, wahnsinnigen nahöstlichen Fanatiker gegeben. Und das hast du mir geraten«, sagte Andrew aufrichtig. »Sie waren hingerissen. Wenn ich die Rolle kriege und Amerikas Verbrauchern, diesen Frauen, die tatsächlich Amerikas Windeln kaufen, als Raschid Raschad Abdullah gefalle, werde ich mich als der lang verschollene uneheliche Sohn Beaumont Ridleys entpuppen, ihr wisst schon, das ist der alte Knacker, der mit Öl Millionen verdient hat. Ich komme zurück, um Rache zu nehmen, weil er meine Mutter schnöde im Stich gelassen hat, so dass der Ayatollah ihr öffentlich die Kleider vom Leibe reißen und sie auspeitschen lassen konnte, nur weil sie das Verbrechen begangen hatte, ihren Schleier zu lüften, um sich ein Schlückchen Anislikör zu genehmigen. Wenn die Fans mich wirklich toll finden, wird sich natürlich herausstellen, dass Ridley gar nicht von mir wusste, ich werde ihm vergeben, wir werden uns versöhnen, mein Vertrag wird um ein Jahr verlängert, und ich werde mich zum Edelhelden mausern.«
»Das alles haben sie dir schon erzählt?«, fragte Willie perplex. Die zukünftige Handlung einer Seifenoper ist ein streng gehütetes Geheimnis.
»Hast du schon einmal eine Seifenoper gesehen, wo es nicht so abgelaufen ist?« Er stand auf. »In dem Dinner-Theater«, fügte er zu mir gewandt hinzu, »bin ich in der engeren Wahl für Petruchio, die Hauptrolle, oder Grummio, den komischen Diener. Wenn ich den Grummio bekomme, muss ich außerdem als Kulissenschieber arbeiten und in den Pausen kellnern. So, und jetzt hol ich dir was zu essen.«
»Ich gehe wieder ans Theater«, sagte Willie. »Ich hab’ hier einen Agenten als Stammgast, der war früher bei CAA und ist ganz scharf drauf, mit mir zu arbeiten. Sobald es hier ein bisschen ruhiger wird«, sagte sie, wie sie es schon seit Jahren tut, seit sie das Lokal aufgemacht hat »und ich ein bisschen freie Zeit habe, nehme ich das in Angriff. Ted sagt, ich sehe besser aus denn je. Was meinst du?«
Was sagt man zu einer Schauspielerin? Egal, ob es stimmt oder nicht, man sagt, »Besser denn je«.
Andrew war in Windeseile zurück, stellte mir meine Suppe und einen Korb mit warmen Baguettes hin. »Wie war denn deine Sprechprobe?«
»Ach, das hatte mit Schauspielerei nichts zu tun«, antwortete ich. »Werbung, verstehst du. Da geht’s immer nur darum, ob man der richtige Typ ist. Heute wollten sie Hintern und Busen.«
»Da hätten sie mich anrufen sollen«, bemerkte Willie. Sie hat eine sehr beeindruckende Figur und ist entweder eine zweite Marilyn-Monroe, oder sie hat deren atemlose Kleinmädchenstimme und den Hüftschwung kultiviert. Über das Stimmengewirr und das Plärren der Jukebox hinweg brüllte der Barkeeper, es sei ein Anruf für sie da. »Ich muss weiter«, sagte sie.
Ein Gast winkte Andrew; der machte sich achselzuckend wieder ans Geldverdienen. Plötzlich war ich allein. Ich begann meine Suppe zu löffeln. Ich hatte seit dem Frühstück am Vortag nichts mehr gegessen.
Als der Suppenteller leer war, fühlte ich mich noch einsamer als vorher. Ich war total pleite. In einer Woche war meine Miete fällig. Ich hatte das Fahrgeld für die U-Bahn nach Hause, eine Kreditkarte, die bis zum Limit belastet war, eine zweite, die überzogen war, und siebenunddreißig Cents auf dem Bankkonto.
Aber ich war entschlossen, nicht zurückzublicken oder mir zu wünschen, ich hätte noch einen Ehemann. Oder einen Liebhaber. Wäre noch bei meinen Freunden in Los Angeles. Hätte noch die Engagements, die ich dort gehabt hatte, wo ich kaum je vorzusprechen oder die Runde bei den Agenten zu machen brauchte, und immer einen Ehemann im Hintergrund hatte, der dafür sorgte, dass mir das Geld nicht ausging, wenn mal wirklich kein Engagement in Aussicht war.
Ich hatte mir sechs Monaten gegeben, um hier beruflich Fuß zu fassen. Hauptsächlich, weil ich wusste, dass meine Ersparnisse nicht weiter reichen würden. Jetzt war der Augenblick der Wahrheit gekommen. Ich hatte es nicht geschafft. Zum ersten Mal in meinem Leben würde ich eigentlich Schauspielerin sein müssen.
Die Frage war nur, in welcher Sparte. Schauspieler brauchen Jobs, die ihnen eine gewisse Freiheit lassen, die ihnen erlauben, eine Stunde zu verschwinden für eine Sprechprobe, oder einen Monat für eine Rolle, die sie an den Nagel hängen können, sobald sie ihre Chance bekommen. Ich habe nichts gegen harte Arbeit, aber ich wollte mir meine Brötchen nicht als Kellnerin, Büroaushilfe, Barfrau, Putzfrau oder Hundesitterin verdienen. Mir ist völlig klar, dass manche Frauen sich auch auf anderes einlassen, um über die Runden zu kommen. Ich will bestimmt keine Steine werfen, aber so ein Arrangement ist für mich nicht das richtige.
Ich bin in Neuengland aufgewachsen, in einer Kleinstadt mit engem Horizont, und wenig Platz für Fantasie. Ich bin auf eine katholische Schule gegangen, war jeden Sonntag in der Kirche und habe mir Sünden ausgedacht, die ich beichten konnte: »Vater vergib mir, ich weiß, ich habe gesündigt, ich habe vor drei Stunden das letzte Mal gebeichtet und hatte zwei unkeusche Gedanken.« In Wirklichkeit bin ich erst sehr spät auf unkeusche Gedanken gekommen, und selbst jetzt habe ich sie nicht halb so oft wie andere sie zu haben scheinen, wenn man den Seifenopern glauben darf, für die ich vorgesprochen habe.
Mit fünfzehn lernte ich Patrick kennen – er war eine Klasse über mir – und heiratete ihn, als ich zwanzig war. Unsere Ehe hielt elf Jahre. Obwohl wir nach Los Angeles zogen, und ich ziemlich viel im Showgeschäft arbeitete, und viele meiner besten Freunde mit Drogen genauso lässig umgingen wie mit Ehebruch, blieb ich in vieler Hinsicht das Mädchen, das die Nonnen erzogen hatten.
Das Beste, was ich über meine jahrelange Ehe sagen kann, ist, dass sie mich kaum hat altern lassen. Mein Teint ist unverändert rein und klar, mein Gesicht bar der Sorgenfältchen, die so viele meiner Freundinnen zum Schönheitschirurgen getrieben haben. Kann natürlich sein, dass das nur so ist, weil ich nie in der prallen Sonne sitze.
Das Schlimmste, was ich sagen kann, ist, dass es mir nicht gelungen ist, meine Ehe halbwegs zivilisiert zu beenden.
Aber wenigstens stand ich nun endlich auf eigenen Füßen.
Andrew brachte mir die Shrimps. Die Sauce war ein Genuss und gut gewürzt. Ich fühlte mich deswegen nicht weniger allein.
Die Leute vom Nachbartisch, die gerade gegangen waren, hatten ein Heft des Metropolitan liegengelassen. Ich holte es mir, um beim Essen ein wenig Gesellschaft zu haben. Ich las erst die Theaterkritiken, dann die Filmbesprechungen.
Als ich mit dem Essen fertig war, warf ich Willie, die alle Hände voll zu tun hatte, zum Abschied einen Handkuss zu. Die Zeitschrift nahm ich mit, wollte sie im Bett lesen. Ich beschloss, zu Fuß nach Hause zu gehen, und legte meinen letzten Dollar auf den Tisch, als Trinkgeld für Andrew.
Die Titelstory im Metropolitan befasste sich mit einem Ehepaar, das einen Haufen Geld ausgab. Der Text versprach, genaueste Details davon zu liefern, wie die Leute ihr Geld ausgaben und wofür. Der Artikel danach, »Privatdetektiv ganz groß«, war von Guido Pellegra, der im Metropolitan häufig über Verbrechen und Verbrechensbekämpfung schrieb. Seine Berichte waren immer sehr lebendig, vielleicht ein bisschen zu farbig, um wahr zu sein, aber wer liest schon den Metropolitan, um die Wahrheit zu erfahren? Man liest ihn, um sich zu informieren, wo man gut einkauft und wo man gut isst.
Die Story drehte sich um »Duke« DeNobili, einen ehemaligen Bullen, der sich als Privatdetektiv niedergelassen hat. Pellegra zufolge hatte er im Alleingang und auf ganz persönliche Weise einige der größten und dreistesten New Yorker Verbrechen gelöst. Dann hatte er sich zur Ruhe gesetzt. Auf die Gründe dafür ging Pellegra nicht ein. Jetzt arbeitete er mit Banken und Wirtschaftsbossen zusammen und mischte bei jener Art Scheidungen mit, die aus Rechtsanwälten Millionäre machen. Er sah außerdem ausgesprochen gut aus und kleidete sich hervorragend, wenn auch etwas auffallend.
Ich wusste auf Anhieb, dass das der ideale Job für mich war. Ich überlegte mir, was ich sagen würde. Dreimal wachte ich in der Nacht auf und hatte meinen Text auf den Lippen. Am nächsten Morgen rief ich ihn an.
»Mr. DeNobili«, sagte ich, nachdem ich seine Sekretärin überredet hatte, mich durchzustellen »ich habe im Metropolitan den Artikel über Sie gelesen und bin sehr beeindruckt. Ich würde gern für Sie arbeiten. Ich bin Schauspielerin. Masken und Akzente sind meine Spezialität. Wenn ich eine Straße hinuntergehe, kann ich es so machen, dass jeder sich nach mir umdreht, oder so, dass keiner mich bemerkt.«
»Ey, das ist echt gut, Lady«, sagte Duke. »Alle meine Mitarbeiter waren mindestens zwanzig Jahre bei der Polizei, wenn Sie verstehen, was ich meine. Mit anderen Worten, ich rede von Erfahrung. Haben Sie einen Waffenschein?«
Sturer Hund, dieser Duke.
»Na ja, also, wenn Sie mal einen Fall haben, wo Sie eine Frau brauchen, würde ich mich freuen, wenn Sie an mich denken«, sagte ich. »Es gibt doch sicher Situationen, wo eine Frau nützlicher ist als ein Mann. Wenn man zum Beispiel eine Frau in einer Frauensauna beschatten soll. Oder eine Frau verhören soll.«
»Schauspielerin, hm«, meinte er nachdenklich.
»Ja«, sagte ich und machte meine Stimme ein bisschen rauchig, damit er sich etwas Verführerisches vorstellen konnte. »Ich gebe Ihnen meine Nummer, dann können Sie es sich überlegen.«
»Ja, in Ordnung, ich lass es mir durch den Kopf gehen«, sagte er. Aber er schien mir eher ein Mann der Tat zu sein.
Zwei
»Ja«, sagte ich, »wir kennen diese Casanova-Philosophie. Die Folgen für die Frau werden ignoriert.«
»Die Folgen, ja, sie sind der Grund, dass sie sich so wild an den Mann klammert«, erwiderte Ralph und sah an mich mit seinen prachtvollen Augen, so blau wie die von Paul Newman. »Aber diese Anhänglichkeit wirst du doch bestimmt nicht als eine gefühlsmäßige Bindung bezeichnen. Ebenso gut könnte man die Anhänglichkeit eines Polizisten an seinen Gefangenen eine Liebesbeziehung nennen.«
»Ich glaub dir kein Wort«, sagte ich frustriert. Ich wohne in einem New Yorker Brownstone. Ralph wohnt in der Etage über mir.
»Gehört das zum Text?«, fragte er verwirrt.
»Nein«, gab ich zurück, genervt, wo ich hätte geduldig sein sollen.
»Ich finde, du bist ein bisschen gereizt«, sagte er.
Ralph hatte mich um Hilfe gebeten. Er wollte gern in eine gute Schauspielschule. Dazu brauchte er einen Monolog, den er vorsprechen konnte. Ich versuchte, den richtigen für ihn zu finden und ihn dann mit ihm einzustudieren. Ich selbst arbeitete gerade George Bernard Shaws Die heilige Johanna durch, deshalb suchte ich für Ralph Shaws Mensch und Übermensch aus. Wenn es sich jetzt als eine Nummer zu groß für ihn erwies, war das meine Schuld. Aber wie sollte ich ihm das erklären, ohne ihn noch mehr zu verletzen? Zum Glück läutete das Telefon.
Ich sagte »Hallo«, und Duke sagte: »Haben Sie Lust, was zu arbeiten?« Drei Tage waren vergangen, seit ich ihn angerufen hatte.
»Wann?«
»Heute Abend«, antwortete er.
»Äh – um wieviel Uhr?«
»Ab sieben«, meinte er.
Ich sah auf die Uhr. Es war zehn nach fünf. Ich hatte keine Ahnung, was für ein Auftrag das war. Ich hatte keine Ahnung, was ein Detektiv können muss. Ich hätte gern gewusst, was für eine Ausbildung ich vorweisen musste. Gab es da keine Lehrzeit? Brauchte man eine Lizenz? Eine Waffe? Einen Waffenschein? Lieber Gott, ich wusste überhaupt nichts.
»Was soll ich anziehen?«, fragte ich.
»Hören Sie«, sagte er, »das ist eine ganz einfache Geschichte. Sie fahren in die Lexington Avenue, Nummer 1191. Dort treffen Sie sich mit Sonny, Sonny Gandolfo. Sie erkennen ihn auf den ersten Blick, er sieht aus wie der typische Exbulle. Nicht zu übersehen. Sie sagen ihm, wer Sie sind. Er sagt Ihnen, was Sie zu tun haben. Okay?«
»Ja, Mr. DeNobili«, antwortete ich.
»Ich komm vielleicht selbst mal auf einen Sprung vorbei, wenn sich’s ergibt, und schau mir an, was Sie für eine sind. Nennen Sie mich einfach Duke.«
»In Ordnung.«
»Eines noch – dem Klienten gegenüber tun Sie so, als wären Sie schon eine Ewigkeit im Geschäft, wüssten genau, worum es geht. Sagen Sie einfach, Sie wären bei der Polizei gewesen oder so.«
Das konnte ich nicht, das wäre ja eine Lüge gewesen. »Ich mach das schon«, versicherte ich.
»Ich geb Ihnen fünfzehn Dollar die Stunde«, sagte Duke.
»Fünfzehn«, wiederholte ich tief beeindruckt, aber meine Betonung führte ihn offenbar auf die falsche Fährte, denn er fing an, mir zu erklären, warum es so wenig sei.
»Die festen Leute, die kriegen zwanzig. Aber die haben auch eine Menge vorzuweisen. Mindestens zwanzig Jahre bei der Polizei. Eigene Waffe – haben Sie eine Kanone?«
»Nein«, erwiderte ich. Und ich wollte auch nie eine, schönen Dank auch.
»Darum kriegen die Tarif A, und Sie kriegen Tarif B. Ich finde das fair.«
»Natürlich«, stimmte ich zu.
Duke legte auf. Mir blieb eine knappe Stunde, um mich fertigzumachen. Ohne Ralph, der auf dem Boden hockte und sein Exemplar von Mensch und Übermensch studierte, die Lage zu erklären, riss ich meinen spärlich bestückten Schrank auf. Ich fange immer unten an. Ich schob die Kleider zurück und suchte nach den richtigen Schuhen.
»Mein erster Tag als Detektivin«, sagte ich zu Ralph, »und ich hab keinen Schimmer, was ich anziehen soll.« Meine relativ neuen Pumps von Fausto Santini, Rom, fielen mir ins Auge.
»Keine hohen Absätze«, rief Ralph. »Jedenfalls nicht, wenn eine Verbrecherjagd drin vorkommt.«
»Es ist kein Film«, sagte ich. Aber er hatte recht, hohe Absätze waren nicht das richtige, falls ich zu Fuß jemanden beschatten musste. Bequemes Schuhwerk war die Parole.
»Ach, kein Film? Was dann? Eine Pilotsendung?«
»Kleid, Rock, lange Hose oder Jeans?«, sagte ich. »Mal angenommen, ich muss draußen warten wie Gene Hackman in The French Connection, und es regnet und ist kalt, und ich hab’ nichts zu essen außer einer widerlichen, matschigen Pizza? Nein, kein Rock. Auf alle Fälle kein Rock. Aber was, wenn ich ein bisschen cleverer bin als Gene und in die Kneipe reingehe, um die Heroindealer zu beobachten. Essen Drogenhändler großen Stils in Lokalen, in die man auch mit Jeans hineingelassen wird?«
»Gehst du zum Vorsprechen, oder hast du die Rolle?«, wollte Ralph wissen.
»Und was für eine Bluse?«, fragte ich und hielt eine bedruckte Seidenbluse hoch. Aber ich brauchte sie mir nur anzuhalten, um zu sehen, dass sie viel zu unruhig war.
»Machst du so was wie Cagney und Lacey, oder suchen sie jemanden wie aus Charlies Engeln?«
»Das ist kein Theater, Sportsfreund. Das ist raue Wirklichkeit«, erklärte ich.
»Das ist was?«, fragte Ralph.
Ich entschied mich für meine blauen Wildlederstiefel. Sie haben einen niedrigen Absatz, sind bequem und verleihen meiner Jeans einen gewissen Chic, zumal ich einen Gürtel habe, der fast perfekt zu ihnen passt. Dazu eine edle Bluse von Bendel, schlicht, weiß, hundert Prozent Baumwolle. Darüber hätte ein alter zerknitterter Trenchcoat gehört, in dessen Falten Jahre des Geheimnisses stecken. Da ich keinen hatte, nahm ich meinen pflaumenblauen Mantel aus kanadischen Armeebeständen. Ich hatte ihn für zehn Dollar erstanden, als ich ein Fernsehspiel machte, das in Manitoba gedreht wurde, weil es mit kanadischen Abschreibungsgeldern finanziert wurde.
Zum Umziehen ging ich ins Schlafzimmer, obwohl ein Strip Ralph gar nicht interessiert hätte. New Yorker Frauen beschweren sich immer, dass alle guten Männer verheiratet sind, und die gut aussehenden alle schwul. Ralph sieht unglaublich gut aus.
»Das ist was?«, rief er aus dem Wohnzimmer.
»Es ist ein Job. Damit ich meine Miete zahlen kann.«
»Du meinst, du hast die Rolle schon.«
»Nein. Ich arbeite wirklich als Detektivin, so wie andere als Kellner oder Schuhputzer arbeiten.«
»Ach so«, sagte Ralph.
»Was soll ich bloß mit meinen Haaren machen?«, stöhnte ich. Da keine Zeit mehr blieb, noch groß etwas mit ihnen anzufangen, bürstete ich sie einfach durch.
»Ich wusste gar nicht, dass du Detektivin bist«, sagte Ralph.
»War ich ja bis jetzt auch nicht«, erklärte ich. »Ich bin’s gerade geworden.«
»Wie soll denn das gehen? Das kann doch gar nicht sein.«
»Doch, wie du siehst«, entgegnete ich und maß ihn mit stählernem Blick. Das schien zu wirken – ich bin eine sehr gute Schauspielerin –, und Ralph glaubte mir.
»Und woher weißt du, was du tun musst?«
»Im Improvisieren kenne ich mich aus. Was meinst du, wie viele Rollen ich schon gespielt habe«, sagte ich. »Gib mir eine Rolle, und ich spiele sie.«
»Ja, aber das ist doch das wirkliche Leben«, hielt er mir vor.
»Um so besser«, sagte ich, und plötzlich überfiel mich der Gedanke, dass das vielleicht sogar stimmte. Gleichzeitig wurde mir klar, dass ich mein Haar nicht offen tragen konnte. Ich bin rothaarig, und mein Haar ist lang – es war einfach zu auffällig, mit der Pracht konnte ich niemanden beschatten. Also steckte ich es hoch und stülpte eine Baskenmütze drüber. Schmuck? Einfache Kreolen. Ich legte mein Lieblingsarmband um, ein indianisches Schmuckstück aus Silber und Türkis. Ich wollte einen guten Eindruck machen. Aber was macht einen guten Eindruck auf einen Exbullen Sonny Gandolfo oder einen Privatdetektiv Duke DeNobili?
Mir fiel plötzlich ein, dass ich kein Geld für die U-Bahn hatte, geschweige denn für ein Taxi. Außerdem musste ich dringend etwas essen, sonst würde ich noch ohnmächtig werden.
»Ralph«, säuselte ich, »bitte, bitte kannst du mir zehn Dollar leihen, damit ich zur Arbeit fahren kann. Ich geb’s dir zurück, sobald ich bezahlt werde.«
»Du hast diesen Job wirklich?«, erkundigte er sich vorsichtig. »Es ist nicht nur ein Termin zum Vorsprechen oder so?«
»Es ist ein Job, Ralph, und ich bitte dich bloß um zehn Dollar.«
»Ich hab’ nur fünf«, sagte er, »aber die kannst du haben.«
Ich kaufte mir ein Stück Pizza, genau wie Gene Hackman, nahm den Bus und hatte zwei Dollar fünfzig übrig.
* * *
Duke hatte Sonny richtig beschrieben. Er sah so sehr wie der typische Exbulle aus, dass ich ihn tatsächlich auf Anhieb erkannte.
»Sind Sie Sonny?«, fragte ich und sah ihn mir genau an, um herauszubekommen, woran es lag, dass seine Identität einem so deutlich ins Auge sprang. Solche Detailbeobachtung macht die gute Schauspielerin aus. Der Mann war groß und kräftig, aber daran lag es nicht. Er trug viel protzigen Schmuck, Ringe, Armband, Armbanduhr, Goldkettchen. Hatte markante Falten im Gesicht. Aber die kommen meistens vom Rauchen. Das ist, nebenbei gesagt, ein ganz wichtiger Tipp – als Nichtraucherin spart man mindestens fünfzig Gesichtsmassagen und fünf Schönheitsoperationen. Aber es lag an keinem dieser Details.
»Ja«, antwortete er und musterte mich. Sein Blick zeigte leichte Zweifel. »Sie sind die Schauspielerin?« Was für eine Stimme! Ein dunkler Bass mit dem rauen Timbre verqualmter Kneipen und durchzechter Nächte.
»Annie McGrogan«, sagte ich und gab ihm die Hand.
»Haben Sie eine Waffe dabei?«, fragte er.
»Nein«, antwortete ich, »der Duke hat nichts davon gesagt, dass ich eine mitnehmen sollte.«
»Kein Problem«, meinte er. »Gehen wir.«
Er marschierte ins Foyer des Hauses 1191 Lexington Avenue. Ich folgte ihm. In New York gibt es zwei Sorten von Luxuswohnburgen, vor dem Krieg gebaut und nach dem Krieg gebaut. Bei dem Krieg handelt es sich um den Zweiten Weltkrieg. Vor seinem Ausbruch baute man Häuser wie das Dakota, diese berühmte Festung am Central Park West in der 72. Straße, wo Yoko Ono und Lauren Bacall wohnen. Diese Häuser haben große, hohe Räume, große Fenster, Wohnküchen, dicke Mauern und Böden, Holz an Türen und Fenstern. Sie haben wenigstens eine gewisse Ähnlichkeit mit den Wohnungen in alten Filmen über das elegante New York. Nach dem Krieg wurden die Räume kleiner und niedriger und die Wände dünner, die Küchen wurden zu reinen Arbeitsräumen degradiert, die Mädchenzimmer abgeschafft. Das Resultat ist zum Beispiel der Trump Tower; dort kann man sich eine Wohnung für mehrere Millionen Dollar kaufen und hört trotzdem den Nachbarn husten. Die meisten »neuen« Luxusgebäude sind auf der East Side von Manhattan. Das Haus, in dem Sonny Gandolfo und ich zu tun hatten, war ein typisches Exemplar. Dort gab es einen Portier und einen Mann am Empfang. Im Foyer mit den marmorgetäfelten Wänden stand eine grün patinierte Kupferskulptur. Für Gäste, mit denen man zwar auszugehen gewillt war, die man aber nicht in die Wohnung lassen wollte, standen ein Sofa und zwei Sessel bereit. Sonny marschierte so lässig hinein, als sei er hier zu Hause, als sei er überall zu Hause. Ich folgte ihm.
»Detective Gandolfo«, sagte er am Empfang. »Wir möchten zu Mrs. Hoffman.«
Der Mann am Empfang rief an. Sonny musterte ihn, als wüsste er, dass der Mann unsaubere Geschäfte machte, Wetten fürs Pferderennen annahm oder vielleicht Haschisch verkaufte.
»Sie werden erwartet«, sagte der Mann. »Wohnung achtundzwanzig B. Oberste Etage.«
Im Aufzug erklärte mir Sonny: »Wir sind nur zum Babysitten da.«
»Okay«, meinte ich, als wüsste ich, wovon er redete.
Im achtundzwanzigsten Stockwerk gab es nur vier Wohnungen. Die Wände waren getäfelt, und auf dem Gang hingen zwei Ölgemälde. Sie sahen aus wie Originale. Alt, aber nicht besonders gut. Fünfzig Dollar das Stück auf einer Auktion bei Saugerties. Nicht viel für ein Gemälde, aber eine Menge für etwas, das so hängt, dass es jederzeit gestohlen werden kann. Das eine Bild zeigte eine Fuchsjagd, das andere eine alte Frau an einem alten Fenster.
Sonny läutete. Die Tür wurde sofort geöffnet. Eine Schwarze empfing uns.
»Detective Gandolfo und Detective McGrogan«, sagte Sonny.
Oh, là, là, er hatte mich als Detective McGrogan vorgestellt. Wenn ich den Job als Improvisationsübung nahm, würde ich das schon hinkriegen. Jeff Gorey sagte immer: »Seid intuitiv. Freie Assoziation ist alles.«
»Gut«, meinte sie. »Ich sage Mrs. Hoffman, dass Sie da sind.«
Sie bat uns herein. Die Wohnung sah aus, wie von einem Bühnenbildner gestaltet, der den Auftrag gehabt hatte, für eine Seifenoper die »Wohnung einer reichen Frau« einzurichten. Einen Augenblick später erschien die Dame des Hauses.
»Ich bin so froh, dass Sie da sind«, sagte sie. Aber das war gar nicht Mrs. Hoffman. Das war Lucinda Merrill, besser bekannt als Shanna McWarren, Star von Forever and Ever. Sie hatte etwas Besonderes, und es war unverkennbar. Eine Veronica Lake des nachmittäglichen Fernsehdramas, mit glattem blondem Haar, das über ein Auge fiel, einem geschmeidigen, schlanken Körper mit Posen, die sie der jungen Lauren Bacall abgeguckt hatte. Was sie davor rettete, wie ein billiges Imitat zu wirken, war eine gewisse Frische, ja, Unschuld, eine Ausstrahlung wie ein Schulmädchen, das den Vamp spielt. Man hätte sie selbst bei strahlendem Sonnenlicht für dreißig halten können, tatsächlich jedoch war sie mindestens zehn Jahre älter. Das Beste, was mit Geld zu kaufen ist, hatte sie jung erhalten.
»Sieben Uhr«, sagte Sonny und blickte auf seine dicke goldene Uhr.
»Ja, natürlich, aber ich mache mir solche Sorgen.« Sie sprach ganz ihrer Rolle entsprechend. Shanna McWarren war die – alternde – kindlich kokette Verführerin, die immer irgendeinen Mann im Auge hatte, alles tat, um ihn herumzukriegen, ihn unweigerlich herumkriegte und ihn dann abservierte. Aber das war nicht ihre Schuld; ein glückliches Paar ist das Ende der Story. In der Seifenoper ist das gemeinsame Glück der Anfang vom Ende. Eine glückliche Ehe interessiert niemanden.
»Kann ich jetzt gehen, Mrs. Hoffman?«, fragte die Schwarze.
Die Dame des Hauses sagte: »Ja, Sheila. Danke, dass Sie gewartet haben. Ich hoffe, es macht Ihrem Kleinen nichts aus.«
»Nein, Madam, es ist schon in Ordnung«, antwortete Sheila. Ihr Ton war ausdruckslos, ich hätte nicht sagen können, ob sie aufrichtig war oder unterwürfig. Sie nahm einen ziemlich tristen Mantel und ging. Der Mantel kam mir irgendwie bekannt vor. Ich kramte in meinen Erinnerungen. Ich war mit mehreren Kolleginnen zusammen drei Wochen lang mit einem Tourneetheater unterwegs gewesen. Nachmittags konnte man nicht viel unternehmen, und vier von uns sieben waren Fans von Forever and Ever. Ganz gleich, in wessen Zimmer man ging, die Schnulze lief überall, und die Mädchen schwatzten mehr über das Liebesleben der Fernsehstars als über ihr eigenes. Zu dieser Zeit gab es eine längere Sequenz, in der Shanna McWarren ihre Brieftasche, ihre gesamte Garderobe und ihr Gedächtnis verlor. Es war eine dieser Amnesiegeschichten, in der die Heldin in Verhältnissen landet, die weit unter ihrem gesellschaftlichen Standard liegen, und sich entsprechend kleiden muss. Daher stammte der triste Mantel.
Lucinda »Shanna McWarren« Merrill Hoffman sah mich an. Ich sah sie ebenfalls an. Es fiel mir nicht ein, mich – wie das vielleicht manche Kollegen getan hätten – selbst herabzusetzen, indem ich darauf hinwies, dass ich Kollegin sei; ich versuchte nicht, mich bei ihr einzuschmeicheln, in der Hoffnung, eine Rolle zu bekommen. Ich hatte bereits eine Rolle, und die spielte ich auch. Ich nahm mir Sonny zum Vorbild, der dastand, als könnte ihn überhaupt nichts beeindrucken.
»Oh, Sie sehen aber sehr jung aus«, sagte unsere Klientin.
»Aber sie weiß, was sie tut«, entgegnete Sonny. Fantastisch! Ich war hingerissen. Noch nie hatte ein Mann so galant für mich gelogen.
»Oh, ich wollte keinesfalls das Gegenteil unterstellen«, versicherte Mrs. Hoffman-Merrill-McWarren. »Es ist nur – ich nehme diese Drohungen eben sehr ernst.«
»Ja, Madam«, sagte Sonny.
»Und Sie bleiben die ganze Nacht?«
»Ja, Madam.«
»Sie müssen die Tür ständig im Auge behalten.« Sie deutete auf die Tür, durch die wir hereingekommen waren. »Damit niemand herein oder hinaus kann.«
»Hinaus, Madam?«
»Sie wissen schon, was ich meine. Ich bin ein bisschen durcheinander. Tut mir leid. In der Küche ist Kaffee. Sheila hat eine ganze Kanne gekocht. Brote sind auch da. Das Gästebadezimmer ist dort.« Sie zeigte es uns. »Ich bin in meinen Räumen. Falls Sie mich brauchen.«