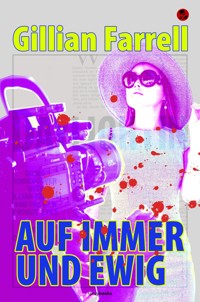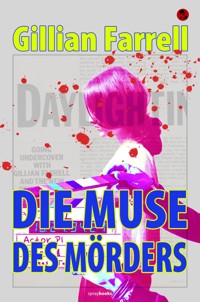
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: spraybooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Annie McGrogan
- Sprache: Deutsch
In einem abgelegenen, verschneiten Hotel in den Bergen hat Star-Regisseur Alan DeLucca seine Crew versammelt. Er will ein paar Einstellungen seines neuesten Films drehen, in dem Annie die Hauptrolle ergattert hat. Nur ein Wermutstropfen trübt ihr Glück: Der charismatische DeLucca erweist sich ihren Annäherungsversuchen gegenüber als resistent, schließlich ist er verheiratet. Doch bald hat Annie weitaus ernstere Probleme, denn DeLucca wird ermordet – und Annie steht als Hauptverdächtige da. Adieu Romantik. Adieu Filmkarriere. Stattdessen versucht Annie zusammen mit einem alten Freund, dem Ex-Cop Sonny, Licht ins Dunkel zu bringen. Einen weiteren Fall löst Annie McGrogan in Auf immer und ewig (dt. von Mechthild Sandberg-Ciletti).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
In einem abgelegenen, verschneiten Hotel in den Bergen hat Star-Regisseur Alan DeLucca seine Crew versammelt. Er will ein paar Einstellungen seines neuesten Films drehen, in dem Annie die Hauptrolle ergattert hat. Nur ein Wermutstropfen trübt ihr Glück: Der charismatische DeLucca erweist sich ihren Annäherungsversuchen gegenüber als resistent, schließlich ist er verheiratet. Doch bald hat Annie weitaus ernstere Probleme, denn DeLucca wird ermordet – und Annie steht als Hauptverdächtige da. Adieu Romantik. Adieu Filmkarriere. Stattdessen versucht Annie zusammen mit einem alten Freund, dem Ex-Cop Sonny, Licht ins Dunkel zu bringen.
Einen weiteren Fall löst Annie McGrogan in Auf immer und ewig (dt. von Mechthild Sandberg-Ciletti).
Die Muse des Mörders
EIN FALL FÜR ANNIE MCGROGAN
BUCH ZWEI
GILLIAN B. FARRELL
ÜBERSETZT VONJÜRGEN BÜRGER
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
Anmerkungen
Die Autorin
Titel der englischen Originalausgabe MURDER AND A MUSE, 1994
Copyright © 1994, 2023 by Gillian B. Farrell
Copyright der deutschen Übersetzung © 1996, 2023 by Jürgen Bürger
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
ISBN: 978-3-945684-42-9
eBook v1.0, August 2023
Copyright © dieser Ausgabe 2023 bei spraybooks Verlag, Köln
Redaktion: Doris Engelke
Korrektorat: Ute Lüers
spraybooks Verlag Bielfeldt und Bürger GbR
Remigiusstr. 20, 50999 Köln
www.spraybooks.com
Für Connie Jean »Willie« Snyder – die Willie von Willie’s on Tenth, Schauplatz mehrerer Szenen dieses Buches und seines Vorgängers, Alibi for an Actress. Es war ein ganz besonderes Lokal. Leider wird es, wenn überhaupt, nur auf den Seiten dieses und zukünftiger Bücher weiterbestehen. Falls Sie also nie dort gewesen sein sollten, haben Sie echt was verpasst. Hoffentlich wird Willie woanders neu anfangen.
Ich jedenfalls freue mich schon darauf.
Eins
Da stehe ich. Im Büro meines Lovers. Es ist kein besonders tolles Büro. Ich wünschte, ich könnte sagen, er ist auch kein besonders toller Lover. Aber das stimmt nicht. Das Büro sieht aus wie das typische Büro eines Privatdetektivs. Gewerberäume mit langfristigem Mietvertrag in Midtown Manhattan.
Er ist auswärts gewesen. Behauptet er wenigstens. Wegen eines Jobs. Detektive verlassen die Stadt wegen Jobs. Sie haben merkwürdige Arbeitszeiten. Jede Menge Nächte. Das weiß ich. Was ihm jede Menge Gelegenheiten bietet zu … Affären. Ich habe darauf gewartet, dass es passiert. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, ich habe darauf gewartet, dass mich irgendwas mit der Nase darauf stößt, damit ich nicht länger meine angeborene Skepsis ausschalte. Warten ist eigentlich nicht das richtige Wort. Warten impliziert Erwartung, eine gewisse Vorfreude. Fürchten? Befürchtung? Ein ungutes Gefühl haben? Argwöhnen?
Außerdem warte ich auf seine Rückkehr. Von auswärts. Falls er tatsächlich dort ist. So lautet einer seiner Lieblingssprüche – er lässt ihn nicht mehr fallen, wenn ich dabei bin. Wann hat er eigentlich damit aufgehört? In dem Moment, als der Witz nicht mehr komisch war? Wenn ich diesen Augenblick bestimmen könnte, wüsste ich dann mehr über das, was ich gar nicht wissen will? »Weniger als fünf Minuten und außerhalb der Stadt zählt nicht.«
Für so eine Konfrontation bin ich nicht passend angezogen. Hätte ich es gewusst, was hätte ich getragen? Irgendwas Provokatives und Verführerisches? Oder hätte ich mich für strenge Schlichtheit entschieden – aber trotzdem vorteilhaft und wettbewerbsfähig? Instinktiv überprüfe ich Frisur und Make-up.
Dann geht die Tür auf, und er kommt rein.
Was werde ich sagen? Was werden die ersten Worte aus meinem Mund sein? »Hallo, Liebling, ich freu mich ja sooo, dass du zurück bist, ich hab dich schrecklich vermisst.« Oder wie wär’s mit: »Du falscher Hund, verschwinde aus meinem Leben …« Fast wünsche ich, er wäre nur ein Mann für eine Nacht – oder fünf – oder sonst wie als Teilzeitaffäre geeignet, dann könnte ich ihn nämlich locker sausenlassen. Aber so ist das nicht. Er taucht nicht einfach auf, legt den Kopf auf mein Kissen und stellt die Stiefel unter mein Bett. Er lebt in meinem Leben. Die Schränke sind voll mit seinem Kram. Mein Leben ist voll mit seinem Kram. Und mein Sohn, der nicht sein Sohn ist, hängt an ihm. Ich könnte sagen: »Du hast mich belogen.« Aber nichts dergleichen.
Raus kommt’s folgendermaßen:
»Ich hab was getan, das ich besser nicht hätte tun sollen.« Fangen wir so an. Ich will nicht, dass die Art und Weise, wie ich es herausgefunden habe, zum Thema wird. Weil das unwichtig ist und nichts zur Sache tut. Oder bin ich zu wenig auf Konfrontationskurs? Wäre ich ein Typ, würde ich ihm dann einfach eine vor den Latz knallen, sobald er durch die Tür kommt?
»Oh«, sagt er. Neutral. Die Rädchen in seinem Hirn beginnen sich zu drehen.
»Jedenfalls hab ich mir Sorgen gemacht …«, sage ich und erkläre, wie’s dazu kam. Auch wenn der Beweis, der Gegenstand selbst, dort steht: ein kantiger Plastikklumpen auf dem Schreibtisch neben uns. »Du hast nicht angerufen. Du warst nicht im Hotel. In dem, wo du übernachten wolltest.«
»Hm, hm«, macht er. Weiß er, was kommt? Sehe ich da Schuldgefühle in seinen Augen sehe, oder sammelt er einfach nur Energie, um besser zu lügen und zu leugnen?
»Ich bin hergekommen«, erkläre ich.
»Ich verstehe«, behauptet er. Cool und männlich. Logisch und Beweismaterial sammelnd.
Ich gestehe es. »Ich hab deinen Anrufbeantworter abgehört.« Die Bombe.
»Ja, und?«
»Du weißt, was ich gehört habe.« Ich kann einfach nicht fassen, wie er reagiert. Zero. Mr. Cool. Er mauert.
Und schüttelt verneinend den Kopf. Als wüsste er’s nicht.
Kann es sein, dass er es nicht weiß? »Du hast deine Nachrichten noch nicht abgehört?«
Wieder schüttelt er den Kopf. Noch mehr Nein.
Es platzt aus mir heraus: »Ich wünschte, ich wäre nie hergekommen.« Aber was empfinde ich dabei? Ich empfinde ungefähr acht Sachen gleichzeitig, und das meiste davon passt nicht zusammen.
»Was ist denn drauf?«, fragt er.
Ich weiß nicht, ob er’s weiß oder nicht. Aber die Problemlöser-Nummer beherrscht er gut. Das ist wieder eine seiner logischen Untersuchen-wir-das-Beweismaterial-genau-wie-vor-Gericht-Arien. Ein Trick, um Emotionen zu dämpfen und Situationen in den Griff zu bekommen. Ich antworte nicht. Wir sehen beide den Anrufbeantworter an. Er geht hinüber. Der Augenblick ist geladen und die Spannung wächst. Beinahe zögert er. Dann drückt er auf die Wiedergabetaste. Wir hören das Band zurückspulen, mit der Wiedergabe beginnen, dann kommt dieser Moment, unmittelbar, bevor eine Stimme einsetzt. In diesem Moment atmen wir beide nicht.
»Ich mag diese Dinger nicht«, erklingt die Stimme seiner Mutter. Eine komische Antiklimax, haha, überhaupt nicht komisch für mich, ich hab vergessen, dass diese Nachricht auch noch drauf war. Er sieht mich an, hebt eine Augenbraue, als wollte er sagen: »Ist das die problematische Nachricht?« Er weiß, dass sie’s nicht ist. »Bitte, ruf deine Mutter an«, sagt die Maschine.
Das Band dreht sich weiter.
Eine Nachricht von seinem Onkel. Noch eine Antiklimax. Wenn er jetzt grinst, explodiere ich. Würde zu ihm passen. Wenn ich die Nerven verliere, kann er ruhig werden. Hysterische Frau, logischer Mann – wir wissen, wer gewinnt.
»Oh, Tony«, ihre Stimme, lechzend, honigsüß. »Bitte, ruf mich an. Bitte. Sobald du zurück bist. Ich muss mit dir reden, dich sehen.«
»Aha«, sagt er. Ich wusste es. Cool. Nichts passiert.
»Was läuft hier?«, frage ich mit der gleichen Coolness, lasse aber keinen Zweifel daran, dass mir diese Info nicht reicht.
»Nichts«, sagt er. Ja, genau.
»Lüg mich nicht an. Ich kann alles ertragen, nur keine Lügen.«
»Ich bitte dich«, sagt er, »ich habe eine Klientin. Sie neigt zur Hysterie. Sie hasst ihre Mutter …« Als ob mich ihre Probleme interessieren würden. Ich weiß, wer sie ist. Und ich weiß zwei Dinge über sie. Beide gefallen mir nicht. Sie ist jünger als ich, und sie hat eine Menge Geld. Und noch etwas, egal, was er sagt: Sie will meinen Mann. »Die Frau hat ein schlechtes Gewissen wegen ihrem Vater …«, plappert er weiter. »Sie misstraut ihren Anwälten und hat das Gefühl, außer mir keinem Menschen auf der Welt trauen zu können. Deshalb klingt sie so. Und ich werde sehr gut bezahlt. Das Dreifache von dem, was ich von manchen der Arschlöcher kriege, für die ich sonst arbeite.«
»Wenn du nicht ehrlich bist, wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, dann haben wir nichts. Ich will die Wahrheit.«
»Auch, wenn ich untreu bin?«
»Bist du denn? Ich will die Wahrheit hören.«
»Was, wenn ich gestehe, dass ich sie ficke?«
»Dann sage ich: Pack deine Koffer, verpiss dich aus meinem Haus und bums dir deinen kleinen Schwanz ab.«
»Schön«, entgegnet er. »Das werde ich tun.«
Dann fängt er an, sein Hemd aufzuknöpfen. Was soll das? Unsere Beziehung basiert nicht auf seinen Brustmuskeln. »Was tust du da?«
»Es blutet schon wieder durch das verdammte Hemd«, erklärt er.
Bluten? Was ist hier los? Soll ich jetzt Mitleid bekunden, oder was? Ich denke ja nicht dran. Stattdessen werde ich herausfinden, was hier los ist. »Ist alles in Ordnung?«
»Wenn du Streit willst«, sagt er und zieht einen seltsam unbeholfenen, schmerzerfüllten Ausziehtanz ab, »dann streiten wir eben. Aber da läuft nichts.« Er klingt müde, erschöpft. Aufrichtig. Glaube ich das? Ich ertrag’s einfach nicht zuzusehen, wie er sich mit diesem blöden Hemd abkämpft. Also helfe ich ihm. Kann sein, dass er die Wahrheit sagt. Dass dieses Mädchen, seine Klientin, auf ihn steht, ohne dass er irgendwas dafür kann. Jedenfalls, ohne dass er mit ihr geschlafen hätte. Verlangen kann durchaus einseitig sein. Da sind Verbände. Und Blut sickert durch. Quetschungen. Ich bin für ihn da. Ich bin diejenige, zu der er kommt, wenn er Fürsorge und Heilung sucht.
»Baby, ich brauche dich«, behauptet er. Diese Worte sollten besser, überzeugender klingen, sonst versaut er die ganze Szene.
»Ach ja?«, sage ich. »Ich hoffe, das meinst du auch so.« Was zu viel über mich selbst verrät. Viel zu viel.
Er hat noch mehr Text. Aber das spielt jetzt keine Rolle, weil sie keine Tonys vorsprechen lassen, sondern Glendas.
* * *
Es sei, hat meine Agentin mir gesagt, »eine wichtige Rolle« in einem »bedeutenden Projekt« mit einem »namhaften Regisseur«, und könnte zu einer »Schlüsselrolle meiner Karriere« werden. Sie war sehr stolz, mir den Vorsprechtermin beschafft zu haben.
Der namhafte Regisseur war Alan DeLucca, bekannt als »Italian Alan«, im Gegensatz zu – oder in Anspielung auf – Woody Allen. Womit keinesfalls angedeutet werden soll, dass er einer war, der mit der adoptierten Tochter seiner Geliebten eine Beziehung anfangen würde. Soweit ich wusste, war er ziemlich normal verheiratet, und zwar bereits seit einiger Zeit, hatte zwei Kinder, die tatsächlich aus dieser Ehe stammten, und lebte mit ihnen unter einem Dach. Vielmehr war es eine Anspielung auf seine Arbeitsweise. Die anderen berühmten italo-amerikanischen Regisseure – DiPalma, Scorcese, Coppola, Cimino – haben sich ausnahmslos einen Namen gemacht durch Gewaltorgien voller Blut, Gangster und Krieg. Nicht so DeLucca. Ein leichterer, komödiantischerer Touch. Keine Megahits, aber ausnahmslos profitable Filme, und das mit einer gewissen Beständigkeit. Seinen Filmen nach zu urteilen, ist er ein sehr guter Schauspieler-Regisseur. Ein Regisseur, wie ihn die New Yorker Kritiker lieben … einer »wie Woody Allen« eben.
Dies war sein erster Flirt mit Mord. Die Adaptation eines Kriminalromans namens Nichts ist umsonst von Larry Rhinebeck, der einen Preis gewonnen hat. Ich hatte noch nie von dem Krimi gehört, aber es hieß, er sei ein Klassiker. Der Kult war wohl sehr klein, denn ich war auch noch nie einem Anhänger begegnet.
Es gibt zwei Geheimnisse, die man über das Vorsprechen wissen muss.
Das erste ist, dass noch nie jemand nach einem Vorsprechen engagiert wurde. Ich war schon bei Hunderten. In fünfzehn Jahren habe ich auf diese Weise nur eine einzige Rolle bekommen. In Wirklichkeit werden Schauspieler engagiert, weil irgendwer schon mal mit ihnen gearbeitet hat und ihm ihre Arbeit gefällt, weil sie Stars sind und Leute anlocken werden, die dafür zahlen, sich die Produktion anzusehen; weil sie mit jemandem schlafen, der für die Engagements zuständig ist; weil sie Kind oder Ehegatte oder sonstiger Blutsverwandter desjenigen sind, der für die Engagements zuständig ist; weil sie in ihrem letzten Film einen komischen Auftritt hatten und der Regisseur oder Produzent diese komische Einlage in seiner Produktion wiederholt sehen möchte.
Das zweite Geheimnis ist, dass wir trotzdem alle brav zu Vorsprechterminen gehen. Mehr noch, wir ziehen los und geben unser Letztes. Wir bereiten uns vor, wir planen, wir wählen die Garderobe, wir lassen uns die Haare machen und die Nägel maniküren und ertragen sogar kosmetische Chirurgie. Dann werden wir beurteilt. Nicht einfach nur abgewiesen. Beurteilt. Dieses Urteil wird dann unseren Managern und Agenten mitgeteilt. Ja, wir bitten diese sogar herauszufinden, warum wir die Rolle nicht bekommen haben, und es uns dann zu sagen. Wir wissen, warum wir die Rolle nicht bekommen haben. Weil kein Mensch nach einem Vorsprechtermin engagiert wird. Aber das deckt sich nicht mit dem, was sie uns sagen. Uns gegenüber behaupten sie, wir wären zu klein/groß, leise/laut, sexy/hausbacken, langweilig/unwiderstehlich, amerikanisch/exotisch, unsere Stimme sei zu schrill, der Blick sei zu alt, das Auftreten zu mädchenhaft, der Gang zu steif, die Knie zu knochig, die Einstellung völlig falsch, wir spielten zu übertrieben, könnten zu wenig begeistern, wären der falsche Typ, schlicht, einfach nicht das, was sie suchten.
Trotzdem war es ein wichtiger Vorsprechtermin.
Italian Alan war ein wichtiger Regisseur.
Meine Agentin und mein Manager würden dabei sein, um zu sehen, »wie ich mich machte«.
Falls ich die Rolle bekam, würde es mit meiner Karriere endlich aufwärtsgehen. Sie wäre für mich der entscheidende Sprung nach vorn, und ich müsste nicht mehr vorsprechen. Ich bekäme Rollen, weil man meine Arbeit kennt.
Und es war eine Chance, bei einem erstklassigen Projekt mit talentierten Leuten zusammenzuarbeiten.
Also strengte ich mich an. Ich hatte zwei Tage, um mich vorzubereiten. Das erste Problem bestand darin, an Informationen heranzukommen.
Die Schauspieler bekamen kein Drehbuch. Nur die zwei Seiten lange Szene, die wir »spielen« sollten. Die Krönung des Ganzen war die Legende, dass DeLucca für die Vorsprechtermine niemals Szenen aus dem späteren Film auswählte. Das gehörte zu DeLuccas Methode und Mythos, und legte ebenfalls Vergleiche mit Woody Allen nahe. Ein solches Vorgehen ermutigt Leute, die zu lange zur Schule gegangen sind, dazu, hochgestochene Kommentare über Filmemacher zu schreiben. Sie behaupten, dass Schauspieler Kleiderständer sind, und dass die Qualität einer Szene entscheidend bestimmt wird durch Kamerawinkel und Ausleuchtung. Dass um – zum Beispiel – einen Ausdruck der Angst zu erreichen, ein Regisseur eine Schauspielerin in einen echten Käfig mit lebenden, fuchsteufelswilden Vögeln stecken und diese bis zur Hysterie picken müssen, statt dass sie die Schauspielerin einfach spielen lassen.
Ich bin Praktiken und Theorien leid, die den Schauspieler herabsetzen. Ich nehme so was persönlich.
Die komplette Rollenbeschreibung wie – vermutlich – von DeLucca skizziert, weitergegeben – über einen persönlichen Assistenten oder eine Produktionssekretärin oder sogar einen leitenden Produzenten – an den Besetzungschef, von diesem verteilt an wichtige Agenten und von denen wiederum an bestimmte Schauspieler wie mich, lautete: »Glenda – dreißigundirgendwas.«
Was war das? Eine Beleidigung? Desinteresse? Tiefes Verständnis? Ein Koan aus dem Zen?
Wenn Italian Alan nicht wollte, dass ich einen Blick in sein Drehbuch warf, geschweige denn auf seine Absichten, ehe ich vorsprach, dann würde ich eben direkt an der Quelle, im Roman, herausfinden, wie diese Figur war, wie ihr Leben aussah, und ihr so ein bisschen Tiefe geben.
Ich versuchte mein Glück in mehreren Buchhandlungen, ohne das Buch zu finden. Ein Freund, der solche Sachen liest, empfahl eine Spezialbuchhandlung für Krimis. Der Laden hieß Foul Play und lag im West Village. Ein sehr engagierter und kenntnisreicher Verkäufer informierte mich, dass es nicht mehr verfügbar sei. Dass es schon kurz nach der Veröffentlichung vergriffen war. »Mit einem Oliver«, sagte ich, »wird doch irgendwer das Ding nachdrucken wollen.«
»Mit was?«, fragte der Verkäufer.
»Mit dem Preis, den er bekommen hat.« Plötzlich war ich unsicher, was den Namen betraf.
»Oh. Sie meinen den Edgar.«
»Ja, genau den.«
»Es hat einen bekommen.«
»Wahrscheinlich kein wichtiger Preis.«
»Oh, er ist sehr wichtig«, widersprach der Verkäufer und war ganz aufgebracht, dass ich das nicht wusste. »Er ist nach Edgar Allan Poe benannt und eine Art Oscar für Krimiautoren. Ihn verliehen zu bekommen, ist eine große Ehre.«
»Aber nicht wichtig genug, um das Buch lieferbar zu halten?«
»Nein«, seufzte er.
Ich wandte mich zum Gehen.
»Es gibt aber eine Fortsetzung«, sagte er.
»Erfahre ich da auch was über die Figuren?«
»O ja. Es ist eine Serie. Ich denke, das ist gemeint, wenn man von einer Fortsetzung spricht.«
»Und taucht die Figur der Glenda darin auf?«
»Die Freundin?«, fragte er. »Ja, tut sie. Ich bin mir sicher, dass es Ihnen gefallen wird.« Er holte den Roman aus dem Regal. Der Titel war Gekauft und bezahlt.
Ja, sie kam darin vor. Spielte offenbar dieselbe Rolle wie im ersten Roman – obwohl ich dem Autor zugutehalten muss, dass er nie Zusammenfassungen a la »Wie in meinem letzten Abenteuer« einflocht. Der sogenannte Held war ein unter Existenzangst leidender, hemmungsloser Mann, der gerne Lust mit Liebe verwechselt, nur weil ihm der Hintern einer jüngeren Frau in Joggingshorts gefiel, die eine Treppe hinaufging. Und der die Beziehung zerstören würde – nicht nur zu Glenda, einer attraktiven, intelligenten Frau, die ohnehin viel zu gut für ihn war, sondern auch zu ihrem Sohn, der ihn anhimmelte.
Ich reimte mir zusammen, dass er genau das im ersten Buch getan haben musste. Glenda nahm ihn zurück, damit er sich im zweiten Buch genauso benehmen konnte.
Ich kann nur betonen, dass ich nie eine der Frauen dieses Autors sein wollte.
* * *
Als ich das Buch halb durchgelesen hatte – wobei ich häufig Seiten nur überflog –, war es Zeit, zur Arbeit zu gehen. Das Buch nahm ich mit.
Mein Arbeitsplatz, an diesem Abend wie auch an vielen anderen Abenden, war ein alternder Cadillac, vollgequalmt wie bei einer Szene mit James Dean. Das Auto heißt Silver Bullet. Es gehörte Sonny Gandolfo.
Wir observierten gerade jemanden für Duke Investigations. In einer Ehesache. Wenn wir an sowas arbeiten, nennt Sonny uns gern die SAD-Truppe. Das steht für Sonder-Anti-Ehebruch Division. Nur dass diese zwei nicht wirklich verheiratet waren. Der Klient hieß Rudi Dietz, ein deutsch-amerikanischer Geschäftsmann. Es ging um seine Geliebte. Ein altmodischer Begriff, aber nach allem, was der Duke uns erzählt hatte, ein durchaus passender. Dietz zahlte die Miete ihres Hochhausapartments an der Third Avenue zwischen der 78th und 79th Street. Außerdem gab er ihr jeden Monat 8.000 Dollar Taschengeld. Sie hieß Elissa.
Wir sollten um sieben Uhr abends mit der Beobachtung des Gebäudes beginnen. Mr. Dietz wollte sich dort mit uns treffen, um uns Fotos und letzte Anweisungen zu geben.
Sonny und ich kamen einige Minuten zu früh. Ich stieg zu ihm in den Wagen. Wir spekulierten darüber – wer würde das nicht tun –, was für eine Sorte Mann glaubte, soviel Geld ausgeben zu müssen, um sich eine Freundin zu halten. Sonnys verschiedene Freundinnen gaben sicherlich genau so viel Geld für ihn aus, wie er für sie. Mir gegenüber ist mit Sicherheit noch niemand so spendabel gewesen. Es hat mir noch nicht mal einer angeboten. Auch mein Ex-Mann nicht. Ob Rudi wohl so was wie ein Elefantenmensch war? Oder hatte er eine irgendwie anders geartete, körperlich groteske Gestalt?
Um fünf nach sieben fuhr ein Lincoln mit Chauffeur vor und hielt. Die hintere Tür wurde geöffnet. Ein sehr gepflegter Mann Ende Vierzig, Anfang Fünfzig stieg aus. Er hatte silbergraues Haar, trug einen dunkelblauen Nadelstreifenanzug, weißes Hemd mit gestärktem Kragen, eine Seidenkrawatte in dezenten Farben und Schuhe von Bally. Er war weder dick noch dünn, weder groß noch klein, weder hässlich noch übermäßig gutaussehend. Kurz, ein ganz normaler, reicher Mann.
»Mr. Gandolfo? Ms. McGrogan?«
»Genau«, antwortete Sonny durch die offene Seitenscheibe. »Sie sind Dietz?«
Der nickte und setzte sich so selbstverständlich auf den Rücksitz des Silver Bullet, als würde er seine Besprechungen immer auf diese Art führen. Er sah auf seine Armbanduhr. »Ich bin unterwegs zum Flughafen«, sagte unser Auftraggeber. Sein Englisch war ausgezeichnet, hatte nur einen leichten Akzent. »Nach Frankfurt. Elissa weiß, dass ich abreise. Natürlich. Ihr Freund wird zwischen 7 Uhr 30 und 7 Uhr 45 kommen. Hier sind die Fotos.« Er gab uns einen Briefumschlag mit drei Schnappschüssen. Auf zweien war Elissa zu sehen. Das andere zeigte ein Trio. Rudi, Elissa und einen jüngeren Mann. »Das ist ihr Freund Stephen«, sagte Rudi. Stephen war ein typischer East-Side-Mann, Mitte bis Ende Zwanzig, hellbraunes Haar, spitze Nase, große Augen, deren Farbe auf dem Foto nicht zu erkennen war. Ich versuchte zu definieren, wodurch jemand »typisch East Side« wurde. Wahrscheinlich, weil man noch andere Einkommensquellen außer seinem Gehalt hat. »Sie werden ein bisschen Marihuana rauchen. Dann, um halb neun, verlassen sie das Haus und gehen zu Mortimer’s. Zu Fuß. Es sei denn, es regnet, was aber nicht vorhergesagt ist. Falls doch, werden sie natürlich ein Taxi nehmen, und irgendwo zu Abend essen. Dann werden sie zurückkommen.«
Er schien alles zu wissen. Wozu brauchte er uns?
»Ich will, dass Sie herausfinden, was das für eine Beziehung ist«, sagte Dietz.
»Sonst noch was?«, fragte Sonny. Die Limousine wartete. Zwei Tonnen Geduld und Gehorsam.
»Mich interessiert, ob Stephen nach Hause geht. Oder ob er die Nacht hier verbringt.« Wieder warf er einen Blick auf seine Uhr. »Viel Erfolg«, meinte er vergnügt. Dann stieg er in seine Limousine und machte sich auf den Weg zum Flughafen.
»Tja«, sagte ich, »für den scheint ja alles ziemlich klar zu sein.«
»Was liest’n da?«, fragte Sonny.
Ich erklärte ihm das mit dem Vorsprechtermin und dass ich das Buch lesen müsse, um wenigstens eine grobe Vorstellung von dem zu bekommen, um was es bei dieser Rolle ging. »Ich weiß nicht, was sie in dem Film mit ihr machen werden, aber im Buch ist diese Figur einfach unmöglich. Der Typ zieht los und betrügt sie, sobald eine andere Frau ihn nur anlächelt. Sie regt sich zwar ein bisschen auf, nimmt ihn aber wieder zurück. Gibt’s solche Frauen wirklich?«
In dem Augenblick, als ich den Mund aufmachte, wurde mir natürlich sofort klar, dass ich gerade den Papst gefragt hatte, ob es wirklich Katholiken gab.
Sonny hat eine Frau, Cindy. Sie haben zusammen zwei Kinder, Sonny jr. und Annette. Die drei wohnen auf Long Island. Die Tochter ist acht. Seit sieben Jähren wohnt Sonny nicht mehr dort. Sie sind nicht geschieden. Er hat eine feste Freundin in New York. Und noch eine feste Freundin in Miami.
Das ist eher der Normalfall. Duke DeNobili, der Duke von Duke Investigations, hat eine Frau auf Staten Island, mit der er zwei Kinder hat, dazu noch eine feste Freundin in Manhattan plus ein festes Arrangement mit dem Hotel Rensselaer für alles, was sich sonst noch ergibt.
Dann sind da noch Tommy Zee und Tommy Martini, zwei weitere Detektive, beste Freunde und Partner, die für einen Job nach San Juan gefahren und mit zwei Mädchen namens Maria zurückgekommen sind – die in New York blieben und ihre festen Freundinnen wurden. Tommy Zee und Martini haben beide Frau und Kinder. Aber die sind in Queens.
Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.
»Tja, hast du schon mal drüber nachgedacht«, sagte ich. »Über die Kehrseite? Warum bleibt Cindy bei dir?«
»Warum sollte sie nicht?«, erwiderte er.
»Will sie keine richtige Beziehung, mit einem Typen leben?«
»Wozu?«
»Genau. Wozu?«
»Da ist er ja«, sagte Sonny. »Pünktlich, auf die Minute.«
Es war halb acht. Der Freund war aufgekreuzt. Der Portier erkannte ihn, nickte freundlich und hielt ihm die Glastür auf. Das Foyer war offen und gut beleuchtet. Wir sahen, dass der Mann an der Rezeption den Freund ebenfalls freundlich begrüßte. Er rief nicht oben an, um nachzufragen, ob Besuch erwartet würde.
»Siehst du«, sagte Sonny, »verschiedene Frauen wollen unterschiedliche Dinge. Nimm Cindy. Sie ist glücklich, sie hat die Kids, das Haus, Unterhalt für die Kinder. Sie ist glücklicher, seit ich aus dem Haus bin. Für manche Frauen ist Sex eine Bürde. Besonders nachdem sie Kinder bekommen haben.«
»Vorher nicht?«
»Es war schon immer ein bisschen so. Deshalb haben wir ja geheiratet. Weil sie nicht wollte, bis wir verheiratet waren. Am Anfang war’s ziemlich gut. Aber dann kamen die Kinder. Mit Mercedes«, er meinte seine feste Freundin, »ist das ganz anders. Sie ist eine Frau, die es wirklich mag.«
»Warum lässt sie sich gefallen, dass du dich mit anderen Frauen triffst?«
»Tja, sie weiß nicht genau, dass ich andere Frauen habe. Sie weiß, dass das zum Leben dazugehört, aber sie hat mich noch nie mit einer anderen Frau gesehen. Außerdem ist sie Spanierin, und weiß, dass ein Mann ein Mann ist.«
»Was soll das heißen?«
»Männer haben Triebe, das weißt du doch. Sie sind animalischer als Frauen. Frauen, die meisten wenigstens, sind moralischer als Männer. Das sollte nicht so sein, ist aber so. «
»Was ist mit der, die wir observieren sollen?«
»Ich habe nicht alle Frauen und immer gesagt. Die meisten, meistens.«
»Fragt Mercedes dich manchmal, was du so machst, wenn du nicht bei ihr bist?«
»Hm.«
»Was machst du dann?«
»Ich lüge.«
* * *
Die Mätresse und ihr Freund kamen exakt um die Uhrzeit aus dem Hochhaus, die Rudi Dietz genannt hatte. Es war ein trockener, angenehmer Abend. Sie gingen zu Fuß. Wir folgten ihnen langsam im Wagen. Sie gingen Arm in Arm, waren ein bisschen high und kicherten. Einmal blieben sie stehen. Er beugte sich vor, als wollte er ihr etwas ins Ohr flüstern, schob ihr aber stattdessen die Zunge hinein. Woraufhin sie sich an ihn schmiegte.
Sie blieben bis um 22 Uhr 18 bei Mortimer’s, aßen zu Abend. Dann gingen sie zum Apartment zurück und nach oben.
Menschen haben unterschiedliche Erwartungen und Wünsche. Manche Frauen lieben Männer, die sie betrügen, bleiben trotzdem bei ihnen. Aber heißt das, dass man seine Liebe in den falschen Menschen investiert? Ist eine einmal geschenkte Liebe wirklich unwiderruflich? Oder ist es vielmehr das Gelübde, das Versprechen, das sie bei der Stange hält? Oder geht es um andere Erwartungen? Trägt das Betrügen zu notwendigem Konflikt bei – verursacht ein Konflikt Wut, und ist Wut schon das Äußerste an Aufregung, wenn eine Beziehung in die Jahre kommt?
Mir persönlich war das egal. Mich interessierte nur, wie ich die Rolle spielen würde. In meiner Beziehung gab es keine derartigen Probleme. Und ich wollte, dass das so blieb.
Der Freund blieb über Nacht.
* * *
Vor dem Vorsprechtermin blieb noch Zeit für ein paar Stunden Schlaf. Genug, dass ich frisch aussah. Entsprechendes Make-up half dabei. Dann wählte ich meine Garderobe. Ich wollte, dass sie attraktiv war, aber nicht umwerfend sexy. Das war der Part der »anderen Frau«.
Der Schlüssel zu Glenda, in der Szene und im Buch, ist, dass sie den Kampf verlieren will. Sie verlangt einfach nach einer Lüge, die so gut ist, dass sie sie glauben kann. Nachdem ich das begriffen hatte, wusste ich, wie ich die Rolle anlegen musste. Wenn Glenda angreift, ist siegen ihre größte Angst. Weil siegen bedeutet, die Wahrheit offenzulegen. Er schläft mit seiner Klientin und Glenda müsste ihn einfach rausschmeißen.
Er weiß das. Entweder instinktiv oder aus kalter Berechnung. Genau wie Sonny weiß, dass seine Frauen Lügen hören wollen. Dass sie sich deswegen mit einem notorischen Lügner eingelassen haben. Sonny ist ein lieber und wunderbarer Mann. Ich liebe ihn in vieler Hinsicht. Und mag ihn mehr als 99,5% der anderen Männer, die ich kenne. Sich auf eine sexuelle Beziehung mit ihm einzulassen wäre aber ausgesprochen dumm. Also wollen Cindy und Mercedes und Caren tatsächlich einen betrügerischen, verlogenen und hinterhältigen – wenn auch sehr maskulinen und charmanten – Mann. Irgendetwas in ihnen entscheidet sich für diesen Schmerz.
Jetzt hatte ich mehrere Schichten, mit denen ich spielen konnte: Was Glenda sagt, dass sie will; was sie denkt, dass sie will; und was sie wirklich will.
Italian Alan war beim Vorsprechen nicht dabei.
Nachdem man mich fast eine Dreiviertelstunde in einer immer kleiner werdenden, aber immer wieder ergänzten Gruppe Frauen warten ließ, alle etwa wie ich, was Alter, Größe und Gewicht betraf, wurde ich reingeschickt, um den Besetzungschef Fernando Howard kennenzulernen. Es hieß, dass enge Freunde ihn einfach Fern nennen. Er war dunkel und so übergewichtig, dass das Fett an seinem Körper zu klumpen schien.
»Ja?«, war seine Frage.
Ich gab ihm meinen Namen und mein Porträtfoto.
Er deutete auf einen Hocker im Scheinwerferlicht. Eine billige Videokamera war auf diese Stelle gerichtet.
»Wenn ich ›Action‹ sage, nennen Sie Ihren Namen und beginnen mit der Szene.«
»Mit der Szene beginnen?«
»Genau.«
Ich setzte mich. Er schaltete die Kamera an. Ein kleines rotes Lämpchen an der Seite leuchtete auf. Er sagte »Action«. Ich begann zu spielen. Er las den Text von Tony und dem Anrufbeantworter mit immer gleicher, monotoner Stimme. Ich versuchte mir einen dynamischen Hauptdarsteller vorzustellen, voller Leidenschaft, rau, aber mit einer gewissen Einfühlsamkeit, maskulin und hart – kurz, einen viel jüngeren Sonny Gandolfo. Statt der schwergewichtigen Gestalt unbestimmten Geschlechts, dem sein Text offensichtlich zum Hals heraushing, dem sowohl ich als auch das Lesen seiner Rolle scheißegal war und der nicht das leiseste Interesse hatte, inspirierend zu sein.
* * *
Am nächsten Tag las ich unter Vermischtes, dass Lucy Kohl die Rolle bekommen hatte. Lucys Großvater war einer von Alfred Hitchcocks Produzenten gewesen. Seine Frau, früher ein vollbusiges Starlet, hatte es trotz ihres außergewöhnlich guten Aussehens nie auf die Leinwand geschafft. Ihr Sohn, Lucys Vater, war ein Banker in der Filmbranche. Ihre leibliche Mutter war jetzt Managerin bei MGM. Vor einigen Jahren, als ich noch in Los Angeles lebte, hatte Lucy ein paar Hauptrollen gespielt. Die große Liebe eines vom Unglück verfolgten Rockstars, die süße, junge Partnerin eines mürrischen, alten Cops in einer Art Kumpelfilmvariante, die nie in die Kinos kam, und die Tochter, die umgebracht wurde, um einen Action-Abenteuer-Helden auf den Weg der Rache zu bringen. Sie können sich bestimmt an sie erinnern. Sie ist diejenige, bei der Sie sich immer gefragt haben: »Was macht sie in diesem Film? Sie hat wahrscheinlich gute Beziehungen zum Regisseur oder Produzenten oder so«. Dann verschwand sie von der Bildfläche. Nachdem sie ein paar Jahre lang bei renommierteren Anti-Alkoholprogrammen in L.A. gesehen worden war, hielt man sie heute wieder für einsetzbar.
Das mag vielleicht gehässig klingen, ist aber die Wahrheit.
Zwei
Den Dietz-Job hielten wir für eine einmalige Sache. Wir beobachteten, wir sahen, wir berichteten, und wandten uns dann anderen Dingen zu.
Ich sprach für eine Sitcom über eine Frau vor, die heute eine beinharte Bankerin ist, in einer früheren Inkarnation jedoch ein Freudenhaus in London des fünfzehnten Jahrhunderts geführt hatte. In kritischen Augenblicken wechselte sie von der einen zur anderen Persönlichkeit. Dadurch verlor sie die Orientierung, was die Quelle für einen großen Teil der Komik darstellte. Merkwürdigerweise schien dieses Freudenhaus, wie im Skript des Pilotfilms beschrieben, den Begriff der Prostitution nicht zu kennen. Ich sprach für die Rolle einer modernen Rechtsanwältin vor, die die Inkarnation einer französischen Gräfin aus dem siebzehnten Jahrhundert war, und, um einem Schicksal schlimmer als dem Tod zu entgehen, als Mann verkleidet geflohen war und sich den Musketieren anschloss. Auch sie wechselte zwischen den Zeitebenen. Was Quelle für einen Großteil der Komik war. Außerdem bewarb ich mich um die Rolle einer Frau aus der Werbung, die die Inkarnation eines Barbarenkriegsherrn aus dem fünften Jahrhundert war – eines Mannes. Sie pendelte auf witzige Weise zwischen den beiden Persönlichkeiten hin und her. Weiterhin bewarb ich mich für die Rolle einer Wissenschaftlerin, die schon zahlreiche Reinkarnationen hinter sich hat und höchstwahrscheinlich jederzeit jemand anderer aus einer anderen Zeit an einem anderen Ort werden konnte. Jedes Mal, wenn sich ihre Welt änderte, waren ihre stets unpassenden Reaktionen ein steter Quell urkomischer Szenen. Außerdem bewarb ich mich um die Rolle einer ägyptischen Prinzessin aus der XII. Dynastie, Theben, etwa 2.000 vor Christus, die als verwöhnte, reiche, jüdisch-amerikanische Prinzessin im Great Neck, Long Island, von heute wiedergeboren wurde.
Allmählich wurde ich deprimiert. Einen Vorsprechtermin nach dem anderen hinter sich zu bringen und die Rolle nicht zu bekommen, war eine Sache. Aber Ablehnungen zu ertragen für Rollen, die zu spielen mir peinlich gewesen wäre, wenn ich sie denn bekommen hätte: Das tat doppelt weh.
Das Büro von Duke Investigations liegt in Queens, gleich am Long Island Expressway. Merkwürdig, ich bin nie dort gewesen. Ich weiß, dass es da einen Briefkasten, ein Telefon, einen Anrufbeantworter, möglicherweise einen Aktenschrank, eine Sekretärin namens Brenda und wahrscheinlich viele gerahmte Fotos vom Duke geben muss, auf denen er entweder Auszeichnungen und Orden überreicht bekommt – aus seiner Zeit als Cop – oder aber mit ihm persönlich bekannten Berühmtheiten abgebildet ist.
Der Duke führt seine Geschäfte tatsächlich mit Hilfe eines Autotelefons und aus dem Stuyvesant Room heraus, einer Bar im Hotel Rensselaer an der West 44th Street. Der Wagen ist ein Seville. Wenn DeNobili sich in einer förmlicheren Umgebung mit jemandem treffen muss, dann geschieht dies entweder im Büro seines Klienten oder, häufiger, in der Kanzlei des Anwalts, der ihn engagiert hat. Andere Detektive wie Sonny oder ich sind bei solchen Terminen äußerst selten dabei. Wenn es darum geht, Lorbeeren für etwas zu ernten, dann teilt der Duke fünfzig Prozent weniger als unbedingt notwendig.
Trotzdem wurden Sonny und ich zu einer Besprechung in Rudi Dietz’ Büro gerufen.
Das Büro befand sich im 28. Stock eines Glasturms zwischen Park und Lexington Avenue Ecke 53rd Street. Es war hochpreisig. Es hatte einen Ausblick. Mr. Dietz mochte ja nur eine Person sein, aber, laut dem Schild an der Tür, war er mehrere Firmen.
Mr. Dietz war an diesem Morgen aus Europa zurückgekehrt. Obwohl der Duke ihm bereits vor zehn Tagen eine saubere und getippte Fassung unseres Berichts gefaxt hatte, wollte er alles noch einmal detailliert durchgehen. Wie hatten sie Händchen gehalten? Wie hatte Elissa reagiert, als Stephen ihr die Zunge ins Ohr steckte? Hatten wir einen Platz bei Mortimer’s ergattert, und wie hatten sie sich dort benommen? Was war, als sie nach Hause gingen – hatten sie es eilig?
Dann rief er Elissa über das Freisprechtelefon an.
»Liebling, ich bin wieder da«, sagte er.
»Oh, Rudi, ich habe dich vermisst«, sagte sie. Wir alle hörten ihre Stimme klar und deutlich, allerdings mit diesem eigenartig hohlen Klang, der für diese Art Telefon typisch ist.
»Wirklich?«, fragte Dietz.
»Oh, sehr sogar. Komm schnell her.«
»Was ist mit Stephen? Hat Stephen nicht dafür gesorgt, dass du dich weniger einsam fühlst?«
»Ach, sei nicht albern. Er ist nur ein Freund. Deine Eifersucht ist wirklich absurd.«
»Ach ja?«
»Ja, Rudi. Das ist sie. Ich will, dass du damit aufhörst.«
»Bist du nicht ausgegangen, sowie ich weg war?«
»Nur zum Dinner.«
»Oh, nur zum Dinner?«
»Ja. Nur zum Dinner. Soll ich etwa allein essen? Es gibt nichts Erbärmlicheres als eine Frau, die allein essen geht. Die Leute kichern doch hinter vorgehaltener Hand.«
»Aber war der Spaziergang zum Restaurant nicht romantisch …«
»Was redest du da?«
»… du in seinem Arm. Und dann seid ihr stehengeblieben, damit er seine Zunge in dein Ohr stecken konnte?«
»Rudi …«
»Du hast dich an ihn geschmiegt. In aller Öffentlichkeit«, sagte er. Allmählich wurde sein deutscher Akzent unüberhörbar. »Auf der Lexington Avenue!«
»Du hast einen Jet-lag. Du träumst.« Die meisten Leute hätten Dietz im Lauf dieses Gesprächs angeschnauzt, dass er wie der Zauberer von Oz klingt, und den verdammten Lautsprecher ausschalten soll. Aber ihr schien das nichts weiter auszumachen. Sie waren ein merkwürdiges Paar.
»Und nach dem Dinner«, sagte er. »Erzähl mir, was nach dem Dinner passiert ist.«
»Nichts.«
»Was soll das heißen, nichts?«
»Nichts!«
»Nichts?«
»Oh, soll ich etwa allein nach Hause gehen? Nachts. In New York City. Und vergewaltigt und angepöbelt werde und vielleicht noch Schlimmeres. Oh, du sorgst dich wirklich um mich.«
«Ja, ja, ja. Was dann? Ist er bei dir geblieben?«
»Nein.«
»Die ganze Nacht? Ja?«
»Nein.«
»Bist du ganz sicher?«
»Worauf du dich verlassen kannst, und …«
»Du Lügnerin! Ich kann beweisen, dass du lügst!«
»Ach ja?«
»Ja! Ich habe dich von Detektiven überwachen lassen.«
»Wie kannst du es wagen, du Dreckskerl!« Jetzt klang sie wirklich empört.
»Sie haben alles gesehen. Die Zunge in deinem Ohr, wie du dich ihm an den Hals geworfen hast wie eine Nutte, sie haben Stephen in deine Wohnung gehen sehen …«
»Wie kann man nur so was unbeschreiblich Schmutziges, Ekelhaftes tun? Detektive!«
»… und sie sind die ganze Nacht auf ihrem Posten geblieben.« Je wütender er wurde, desto deutscher wurde sein Akzent.
»Schnüffler und Spanner. Du bist widerlich. Du fasst mich nie wieder an.«
»Und Stephen ist die ganze Nacht geblieben. Er ist kein Freund.«
»Ich kann’s nicht fassen, dass du das gemacht hast.«
»Also bist du eine Lügnerin.«
»Geh zum Teufel!«
»Die Detektive sind hier bei mir. Duke, sagen Sie es ihr.«
»Äh, ja«, begann der Duke. »Ich, äh, hatte die ganze Nacht zwei Detektive auf Sie angesetzt. Und was Mr. Dietz sagt, ist wahr. Zwei Zeugen haben den Bericht unterzeichnet, versiegelt und abgeliefert.«
»Was für eine schmierige Art, sein Geld zu verdienen«, fauchte sie den Duke an. »Weiß Ihre Mutter, was Sie tun?«
»Lassen Sie meine Mutter aus dem Spiel«, forderte der Duke. »Meine Mutter ist eine Heilige. Ihren Name darf jemand wie Sie gar nicht aussprechen.«
»Weiter, Mr. Gandolfo«, sagte Dietz, »erzählen Sie ihr, was Sie gesehen haben.«
»Gottverdammt, wie viele Leute sind bei dir?«, fragte Elissa.
»Na ja«, meinte Sonny, »wenn Sie genaue Zeiten haben wollen, müsste ich in meinen Notizen nachschauen.«
»Ich gebe Ihnen genaue Zeiten!«, schimpfte Elissa. »Wollt ihr wissen, wie oft? Ich sag euch, wie oft. Ich sag’s jedem. Willst du wirklich, dass ich das tue, Rudi?«
»Ich will, dass du’s zugibst; du bist eine Lügnerin und Betrügerin und ich habe Zeugen hier, ich kann’s beweisen. Die sind hier bei mir. Du bist eine Lügnerin.« Sein Englisch wurde wieder besser, auch wenn er ziemlich wütend klang. Die sprachliche Kontrolle hatte er verloren, als es um Sex ging. Das hatte etwas zu bedeuten. Ich war nicht sicher, was, aber ich speicherte es in meiner Trickkiste.
»Warum lädst du nicht alle hierher ein«, schlug Elissa spöttisch vor. »Soll doch die ganze Meute zusehen. Du bist widerlich. Mich beschatten zu lassen.«
»Ich befehle dir, ihn nicht mehr zu treffen.«
»Geh doch zum Teufel! Verschwinde aus meinem Leben. Ich befehle dir, dass du mir niemals wieder nachspionierst.«
»Ich kündige deine Wohnung. Ich lasse deine Kreditkarten sperren. Du bekommst nichts mehr von mir. Du betrügst mich!«
»Nur zu. Du wirst schon sehen, dass mir das nichts ausmacht«, fauchte sie. Der Vortrag war toll. Aber keiner glaubte ihr.
»Warum hast du mich betrogen?«, fragte er. Das ergab eine Art Hintertür.
»Du hast mich alleingelassen. Ich war einsam. Ich bin sensibel. Ich fühle mich einsam, wenn ich ganz allein bin.«
»Das darfst du nicht tun.«
»Du darfst mich nicht beschatten lassen.«
»Wenn du schwörst, dass du damit aufhörst, werde ich dir noch einmal verzeihen.«
»Ich schwöre, damit aufzuhören. So toll ist Stephen sowieso nicht. Aber ich denke gar nicht daran, dich wieder reinzulassen. Wie konntest du es wagen, mich beschatten zu lassen? Gehst du auch an meine Post? Hörst du mein Telefon ab? Was ist mit meiner Unterwäsche? Kontrollierst du meine Unterwäsche? He, Leute, kontrolliert er auch meine Unterwäsche?«
Sonny sah zu mir herüber und verdrehte die Augen. Es gibt Leute, die so was machen. Unterwäsche auf Sperma und Blut überprüfen und beides analysieren lassen, ob es die richtige DNA ist. Duke macht so was gern. Es ist ultramodern, sehr hightech, und er kann dafür eine ordentliche Summe in Rechnung stellen.
»Ich musste es tun«, sagte Dietz und meinte die Observierung, nicht die Unterwäsche. »Und wie du siehst, hatte ich ja recht. Hör zu. Vergiss Stephen. Ich komme heute Abend zu dir. Wir werden eine ganz besondere Nacht miteinander erleben.«
»Wenn du kommst, werde ich nicht da sein. Ich hab’s dir doch gesagt …«
»Liebling …«
»Ich verzeihe dir nicht!«, schrie sie. Das alles lief immer noch über das Freisprechtelefon.
»… Es tut mir leid. Es tut mir leid«, stammelte er, »dass ich Detektive engagiert habe.«
»Das sollte es auch.«
»Wirklich.«
»Wenn du das nochmal machst, ist es endgültig aus zwischen uns. Du wirst mich nie wieder anfassen. Nie wieder!«
»Keine Detektive mehr. Ich versprech’s.«
»Schwör’s!«, schrie sie.
»Ich schwöre. Bei meiner Ehre.«
»In Ordnung«, meinte Elissa. »Du darfst rüberkommen.«
»Um sechs«, schlug er vor.
»Fein.«
»Und kein Stephen mehr.«
»Versprochen.«
Dietz drückte den Knopf, der das Telefon ausschaltete. »Ich danke Ihnen sehr«, sagte er zu uns.
»Gern geschehen. Duke Investigations freut sich, Ihnen behilflich zu sein. Duke Investigations liefert immer Ergebnisse«, sprach der Duke todernst und mit unbewegter Miene.
»Am Freitag fahre ich wieder weg«, erklärte Dietz. »Ich möchte, dass Sie sie überwachen.«
»In Ordnung«, antwortete der Duke.
»Können Sie diesmal auch Fotos machen?«, fragte Dietz.
* * *
Mit einigem Bedauern, vielleicht sogar Neid, sah ich, dass die Proben zu Gratisfahrt begonnen hatten und in ein paar Wochen Drehbeginn sein sollte. Alan DeLucca war einer dieser altmodischen Regisseure, die tatsächlich glaubten, Schauspieler könnten und sollten proben, als würden sie durch Ausprobieren, Trial-and-error, Arbeit und Nachdenken, in ihre Rollen hineinwachsen, Charakterebenen hinzufügen, ganz einfach besser werden. Das ist nicht unbedingt das gängige Vorgehen. Es ist ein größeres Problem bei Filmen mit großem Budget als bei solchen mit kleinem. Der Grund, warum ein Film zu einer Produktion mit großem Budget wird – dreißig, vierzig, fünfzig Millionen Dollar –, sind die Kosten für die Stars und die Regisseure. Aber je größer – und teurer – sie sind, desto weniger Zeit steht zur Verfügung. Ein Schauspieler, der das Minimalhonorar erhält, sechshundert und ein paar Zerquetschte pro Woche, kann ein ganzes Jahr proben, wenn nötig. Für alle anderen Schauspieler im Film gilt dasselbe. Aber für Fegefeuer der Eitelkeiten zum Beispiel kommen die Schauspieler von ihrem vorherigen Dreh, studieren vielleicht einen Tag das Drehbuch, improvisieren eine Runde und fliegen dann nach Rom zu ihrem nächsten Projekt. Dazu kommt, dass der Drehplan um sie herum organisiert wird. Also spielt Melanie Griffith einen Melanie-Griffith-Part, Morgan Freeman spielt eine Morgan-Freeman-Imitation und Bruce Willis macht, was er im Fernsehen gemacht hat.
Woody Allen und Alan DeLucca proben. Und steigern dadurch die schauspielerische Leistung.
Meine Vorsprechtermine schienen in Wellen zu kommen. Vielleicht war das eine Art psychisches Phänomen. Die Reinkarnationen erfolgreicher Frauen verschwanden schlagartig. Plötzlich bestand eine große Nachfrage – da draußen im Fernsehland – nach Frauen, die die verschiedenen Aspekte weiblicher Hygiene diskutierten.
Mir war klar, dass sich meine Agentin und auch mein Manager alle Mühe gaben, mir Vorsprechtermine zu besorgen. Sie hielten sich für wichtig. Immerhin, mit einem landesweit gesendeten Werbespot kann man viel Geld verdienen. Und eine ganze Weile kommt ständig Geld nach. Außerdem steigerte es meinen Bekanntheitsgrad bei den Casting-Firmen. Ja, sie fingen tatsächlich an, nach mir zu fragen.
Immer wieder abgelehnt zu werden hat Folgen. Aber engagiert zu werden machte mir viel mehr Sorgen. Wollte ich wirklich landesweit im Fernsehen zu sehen sein mit dem Spruch: »Wenn ich mal wirklich frisch sein will – dann nehme ich Ocean Spray Deodorant Douche. Frisch wie eine Meeresbrise. Kräftig wie Preiselbeergeschmack. Lebhaft wie ein Zitronenbaum. Jetzt in fünf natürlichen Duftrichtungen … nur für Girls, die – wirklich frisch sind.« Der letzte Halbsatz sollte mindestens eine dreifache Bedeutung haben. Dann gab’s da noch: »Früher habe ich mich vor den kritischen Tagen gefürchtet. Heute nicht mehr! Jetzt sind die kritischen Tage einfach wunderbar und mein persönliches Geheimnis.« Und wer könnte jemals vergessen: »Diese Tampons sind nicht die Ihrer Mutter.«
* * *
Rudi Dietz verließ die Stadt am Freitag. Wieder nahm er eine Maschine um 20: 30 Uhr. Diesmal nach London, glaube ich. Übers Wochenende. Er verließ Elissas Apartment um neunzehn Uhr. Neben unserem Wagen hielt seine Limousine kurz an. »Viel Glück.«
»Danke«, antwortete Sonny.
»Fotos?«
»Und ob«, sagte Sonny. Wir hatten eine 3,5-mm-Nikon mit hochempfindlichem Farbfilm sowie einen Sony Camcorder. Eine Leihgabe der Duke-DeLucca-Familiensammlung. Zum Glück hatte die DeLucca-Familie die Bedienungsanleitungen nicht verlegt.
»Könnten wir eine Kamera in der Wohnung installieren?«
»Könnten wir, aber nicht jetzt«, meinte Sonny.
»Ich wünschte, ich hätte früher daran gedacht«, brummelte Dietz.
»Beim nächsten Mal«, versprach Sonny.
»Duke soll mir morgen früh ein Fax schicken«, bat er.
Sobald unser Auftraggeber weg war, widmeten wir, Sonny und ich, uns wieder den Bedienungsanleitungen. Sie waren auf englisch, was manches erleichterte. Um 19:30 Uhr erschien Stephen. Um 20:30 Uhr kamen er und Elissa herunter. Sie schlenderten, Arm in Arm, zu Mortimer’s. Sonny fuhr langsam hinter ihnen her. Ich machte die Fotos. So was war neu für mich, daher war ich einigermaßen nervös. An der Ampel blieben sie stehen und küssten sich.
Wir folgten ihnen, der Cadillac fuhr Schritttempo. Das war nicht gerade unauffällig. Aber sie bemerkten nichts. Sie sahen sich auch nie wirklich um. Wie konnte es sein, dass sie sich unbeobachtet fühlten? Glaubte sie wirklich, dass Rudi Dietz’ Wort verlässlicher war als ihr eigenes? Vielleicht war es ihr egal. Vielleicht war es ein Spiel.
Die beiden gingen zu Mortimer’s.
Diesmal hatte ich genug Weitblick besessen, einen Tisch für uns zu reservieren. Also gaben Sonny und ich 189,50 Dollar plus Trinkgeld aus für ein Abendessen für zwei Personen und sahen Elissa und Stephen beim Trinken und Turteln und Gurren und häufigen Ausflügen auf die Toilette zu. Wir platzierten die Videokamera auf unseren Tisch und richteten sie auf ihren. Der Duke hatte vorgeschlagen, das rote Aufnahmelämpchen mit schwarzem Klebeband abzudecken. Was blendend funktionierte. Das Essen war angemessen. Der Service war außergewöhnlich unverschämt. Meine Kleidung entsprach nicht den East-Side-Standards. Sonny sah nicht einmal reich aus.