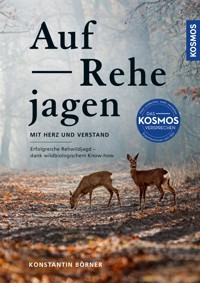
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
In diesem kompakten Ratgeber fasst Fachbuchautor Dr. Konstantin Börner alles Wichtige rund um das Rehwild und erfolgreiches Jagen auf diese Schalenwildart zusammen. Ebenso interessant wie leicht verständlich bereitet er Jägern, insbesondere Einsteigern, wildbiologisches und praktisches Hintergrundwissen auf und schafft so die Grundlage für eine erfolgreichere Jagd.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Meinen Eltern Annemarie und Bernd gewidmet. Sie weckten seit meiner frühesten Kindheit das Interesse an der Natur und ihren Prozessen in mir und legten so den Grundstein für meinen späteren Lebensweg.
WILDBIOLOGIE SCHAFFT JAGDKOMPETENZ
Das vorliegende Buch befasst sich neben der Jagdpraxis auch ganz bewusst intensiv mit der Wildbiologie des Rehwildes. Das Interesse für diese Disziplin ist bei vielen Jägern naturgemäß stark ausgeprägt. Diesen Umstand möchte ich mir zunutze machen, denn wildbiologisches Wissen gehört gleichzeitig zum elementaren jagdlichen Rüstzeug. Es wird nicht immer die neuste Rehwildbüchse, -patrone oder sonstiges „bahnbrechendes“ Zubehör benötigt. Was wir tatsächlich brauchen, sind gut (aus)gebildete Jäger. Denn nur wer mit der Biologie seiner Beute vertraut ist, wird sie langfristig erfolgreich bejagen und auch verantwortungsbewusst behandeln.
Belastbare, nachprüfbare Daten, die uns auch bezüglich unseres Rehwildes praktisch dauerhaft von der Wissenschaft vorgelegt werden, liefern uns in diesem Zusammenhang wichtige Entscheidungshilfen im Revier. Sie bilden zugleich die Grundlage, den heutigen Anforderungen an die Rehwildjagd gerecht werden zu können. Denn Jagd hat zweifellos Bedingungen zu schaffen, die den notwendigen Waldumbau gewährleisten muss. Die Kreatur darf dabei aber nicht aus den Augen verloren werden – auch ihr müssen wir ebenso gerecht werden wie allen übrigen Anforderungen. Der Jäger ist demnach also doppelt verpflichtet. Das ist der Grund, warum einige Zusammenhänge in diesem Buch besonders nachdrücklich und ggf. auch redundant dargestellt wurden.
Zu guter Letzt ist Wissen aber auch ein gutes gesellschaftliches Argument. Hohe Aus- und Weiterbildungsstandards helfen bei einer positiven öffentlichen Wahrnehmung der Jagd. Denn letztendlich ist es eben jene Gesellschaft, die darüber entscheidet, wie es mit der Jagd bei uns künftig weitergeht.
Dieses Wissen ist natürlich bei Weitem nicht allein mein Verdienst, sondern der zahlreicher internationaler Wildbiologen und Wissenschaftler, deren Veröffentlichungen auch zitiert werden. Das dazugehörige Quellenverzeichnis abzudrucken, hätte den Rahmen des Buches gesprengt. Näher Interessierte können es sich aber unter kosmos.de/rehe-jagen als PDF herunterladen.
Zuletzt bitte ich Leserinnen und Jägerinnen, mir nachzusehen, wenn ich in diesem Buch der Einfachheit halber meist nur die männliche Form, also z. B. „Jäger“ verwende. Selbstverständlich möchte ich immer alle Geschlechter ansprechen.
Panketal im Frühjahr,Konstantin Börner
© AdobeStock/Michael Fritzen
WILDBIOLOGISCHE FAKTEN
Mit den länger werdenden Tagen im Frühjahr stellt sich der Organismus unseres Rehwilds auf eine neue Phase des Jahres ein. Das Wild kommt in kurzer Zeit auf Hochtouren. Der alles steuernde Faktor ist das Licht.
DAS LICHT DES FRÜHJAHRS
Mit den länger werdenden Tagen im Frühling stellt sich der Organismus unserer Rehe auf eine neue Phase des Jahres ein. Rezeptoren im Inneren ihrer Lichter registrieren die Veränderungen der Tageslänge und ihr Körper stellt sich adäquat darauf ein. Für Rehwild, aber auch für andere Hirscharten der gemäßigten und borealen Zone ist es überlebensnotwendig, auf die periodischen Änderungen der jahreszeitlichen Bedingungen zu reagieren.
BÖCKE IM FRÜHLING
Bei den Böcken kommt es mit der Zunahme des Lichtes im Frühjahr zu deutlichen hormonellen Veränderungen. Grundsätzlich sind der zyklische Aufbau, das Fegen und auch der spätere Abwurf der Geweihe ein hormonell und neuronal kontrollierter Prozess. Die jahreszeitliche Taktung und Synchronisierung werden durch die unterschiedlichen Tageslängen im Jahresgang gesteuert. Auf diese Weise wird – wie auch bei den Ricken – sichergestellt, dass alle Abläufe zur rechten Zeit stattfinden.
Die länger werdenden Tage lassen den Testosteronspiegel der Böcke ansteigen und die Geweihbildung beginnen.© Karl-Heinz Volkmar
GEWEIHZYKLUS
Beim Geweihzyklus spielt das Hormon Testosteron eine sehr wesentliche Rolle. Untersuchungen haben bestätigt, dass eine geringe Menge an Testosteron für den Beginn und das Wachstum der Geweihe erforderlich ist. Für die Böcke bedeuten die länger werdenden Tage des Frühjahres einen Anstieg ihres Testosteronwertes. Erreicht dieser eine gewisse Konzentration, wird das Abstoßen des Bastes eingeleitet. Da dieser Schwellenwert bei Jährlingen erst zeitversetzt im Jahr erreicht wird, fegen diese ihre Geweihe später. Ab dem zweiten Lebensjahr verschiebt sich der Fegetermin häufig jedoch nicht mehr wesentlich. Ich selbst kannte Böcke, die Jahr für Jahr innerhalb eines wenige Tage umfassenden Fensters gefegt haben. Nimmt der Testosteronspiegel im Herbst wieder ab, werden die Stangen abgeworfen.
Welche Bedeutung Hormone für die Geweihbildung des Bockes besitzen, verdeutlicht folgende Tatsache: Die einmalige Verabreichung des weibliches Hormons Östrogen führt dazu, dass das Geweihwachstum eingestellt und kurz danach verfegt wird.
Übrigens ist die Bezeichnung „Gehörn“ für die Geweihe der Böcke biologisch nicht korrekt, auch wenn sie nach wie vor üblich ist und auch im vorliegenden Buch immer wieder einmal verwendet wird. Geweihe und Hörner unterscheiden sich grundlegend in ihrer Bildung und Zusammensetzung: Geweihe sind aus Knochen, während Hörner wie Hufe und Nägel aus Keratin bestehen.
KEIN HOLZ, SONDERN KNOCHEN
In vergangenen Jahrhunderten gingen Jäger und Naturforscher davon aus, dass Geweihe aus einer holzähnlichen Struktur bestehen. Erst später gelang der Nachweis, dass es sich um einen Knochen handelt. Dieser Geweihknochen ist um ein Vielfaches stabiler als ein vergleichbarer Skelettknochen. Vergleichsweise neu ist die Erkenntnis, dass es sich bei dem Geweihknochen um eine lebendige Struktur handelt. Genau wie ein Skelettknochen wird er mit Blut versorgt.
„… ALT FEGT ZUERST?“
Der Fegetermin eines Bockes hat entgegen der noch immer verbreiteten Meinung nur wenig mit dem Alter zu tun. Unterschieden werden können damit nur Jährlinge von mehrjährigen Böcken: Erstgenannte fegen nach dem ersten April, während mehrjährige Böcke zu diesem Zeitpunkt schon gefegt haben. Analog gilt das auch für den Zeitpunkt des winterlichen Abwerfens. Auch hier lassen sich mit einiger Sicherheit nur Jährlinge und mehrjährige Böcken unterscheiden. Jährlinge werfen ihr Geweih im Allgemeinen im November oder Dezember ab, während ältere Böcke dies schon eher tun.
Der Fegezeitpunkt sagt wenig über das Alter eines Bockes. Unterscheiden lassen sich dadurch nur Jährlinge und Mehrjährige.© AdobeStock/Joerg Wester
RICKEN
Mit Beginn des Frühjahrs sind die Ricken bereits hochtragend. Der Setzzeitpunkt ist so abgestimmt, dass er zu einer Zeit erfolgt, in der den Ricken ausreichend Äsung zur Aufzucht einer neuen, vitalen Kitzgeneration zur Verfügung steht.
Der mittlere Setzzeitpunkt hat sich beim Rehwild in vier Jahrezehnten um ca. eine Woche vorverlegt (Hagen et al. 2020).© KOSMOS-Archiv
KLIMAWANDEL …
Der Klimawandel stellt unser Rehwild und selbstverständlich auch andere Wildtierarten diesbezüglich vor eine neue Herausforderung. In den letzten 50 Jahren stieg die Jahresmitteltemperatur in Deutschland um 1,9 °C. Darüber hinaus beginnt das Frühjahr zeitiger. Als ein gängiger Indikator für den Frühjahrsbeginn wird in unseren Breiten die Forsythienblüte herangezogen: Bei dieser Strauchart hat sich der Beginn der Blüte in den letzten Jahrzehnten um ca. 13 Tage nach vorn verschoben.
Grundsätzlich sind Säugetierarten in der Lage, auf klimatische Veränderungen z. B. mit einer Verschiebung des Lebensraumes oder mit einer Anpassung ihres jährlichen Zyklus zu reagieren. Bezüglich des ansonsten sehr anpassungsfähigen Rehwildes ging man in der Vergangenheit allerdings davon aus, dass es nicht in der Lage ist, darauf zu reagieren (PLARD et al. 2014).
… UND REAKTION
In einer aktuellen Studie der Wildforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg (WFS) wurde untersucht, ob das Reh möglicherweise doch Reaktionen auf die klimatischen Änderungen zeigt (HAGEN et al. 2021). Bei dieser Analyse konnte auf eine enorme Datenreihe zurückgegriffen werden. Insgesamt lagen auswertbare Daten von 16 111 markierten Rehkitzen für den Zeitraum von 1972 bis 2019 vor. Nach umfassender statistischer Analyse wies man nach, dass sich der mittlere Setzzeitpunkt des Rehs seit 1972 um circa eine Woche nach vorn verschoben hat. Dieser ist nun der 20. Mai. Für eine Wildtierart, bei der über drei Viertel der Nachkommen innerhalb von vier Wochen gesetzt werden, ist eine derartige Verschiebung ein deutlicher Indikator für eine Anpassung.
Im Mittel werden heute die Kitze am 20. Mai gesetzt.© Dr. Kathleen Röllig
LICHTSTÖRUNGEN UND ANOMALIEN
Welche grundsätzliche Bedeutung die Tageslichtlänge besitzt, wird bei Hirscharten deutlich, die in der Nähe des Äquators leben. So besitzen z. B. der Rusahirsch in Indonesien und der Davidshirsch in Südchina keine Saisonalität. Sie ist auch nicht nötig, da jahreszeitliche Schwankungen nur gering oder gar nicht auftreten. Man kann auf der beliebten Ferieninsel Mauritius, auf der Rusahirsche eingebürgert wurden, daher zu jeder Zeit Hirsche in den verschiedenen Stadien ihres Geweihzyklus antreffen. Der Geweihkreislauf ist auch nicht an den Fortpflanzungszyklus gekoppelt.
Wann das Geweih geschoben, gefegt und abgeworfen wird, hängt am Äquator von der Geburt des Stücks ab. Interessant ist dabei, dass die einzelnen Phasen des Zyklus Jahr für Jahr zur selben Zeit ablaufen. Ein Hirsch, der im Juni abwirft, wird dies also über sein ganzes Leben hinweg beibehalten.
Siedelte man unsere Rehe in die Tropen um, käme es dazu, dass sich der Geweihzyklus ebenfalls von den Jahreszeiten entkoppelt, da die jahreszeitlich unterschiedlichen Tageslängen als Taktgeber entfallen. Bemerkenswert ist außerdem, dass die tropischen Hirscharten auch zu jeder Zeit des Jahres fruchtbar sind. Dies ist bei unseren Rehen nicht der Fall.
Die Geweihbildung indonesischer Rusahirsche ist nicht an Jahreszeiten gebunden.© AdobeStock/Mike Lane
ZWEI GEWEIHE IN EINEM JAHR
Welche Auswirkung Manipulationen der Photoperiode auf den Geweihzyklus haben können, verdeutlichen entsprechende Experimente. Auch wenn die Untersuchungen nicht an Rehböcken durchgeführt wurden, sind die grundsätzlichen Abläufe doch identisch und ermöglichen somit wichtige Einblicke in die Zusammenhänge.
Um herauszufinden, welchen Effekt das Sonnenlicht im Einzelnen auf die Geweihentwicklung nimmt, hielt man Damhirsche in einer Halle, die völlig vom Sonnenlicht abgeschirmt war (SCHNARE & FISCHER 1987). Den Hirschen wurde durch entsprechende Lichtverhältnisse der Verlauf zweier Jahresperioden vorgegaukelt, obwohl tatsächlich nur 365 Tage vergangen waren.
Das Ergebnis war höchst erstaunlich. Die auf diese Weise fehlgeleiteten Hirsche schoben innerhalb eines (echten) Jahres zweimal ein Geweih. Überraschend war weiterhin, dass die Hirsche in dieser Zeit auch optisch schneller alterten. Der Versuch, die Photoperiode noch weiter zu verkürzen, scheiterte allerdings, da die betreffenden Stücke dann nicht mehr in der Lage waren, korrekte Geweihe zu schieben.
Bei Versuchen mit Rehböcken wurde wiederum festgestellt, dass auch eine konstante Tageslänge dazu führen kann, dass innerhalb eines Jahres zwei Geweihe geschoben werden.
RICKEN, KNOCHEN UND GEWEIHE
In seltenen Fällen tragen auch Ricken ein Geweih, das sie – noch seltener – auch blank fegen. Interessante Versuche haben gezeigt, dass Verletzungen des Stirnbeins auch bei weiblichen Rehen ein Geweihwachstum auslösen können. Ebenfalls erstaunlich: Transplantiert man die geweihbildende Haut des Stirnbeins auf andere exponierte Knochen, kann auch dort ein Geweih wachsen!
Seltene Ausnahme: Ricke mit Geweih© Karl-Heinz Volkmar
ABNORME BÖCKE
Vorgenannte kleine Beispiele verdeutlichen eindrucksvoll, welchen Einfluss der Faktor Licht auf die Steuerung des Geweihzyklus ausübt. Das Sonnenlicht setzt gleich einem „Domino-Effekt“ eine komplexe physiologische Kaskade in Gang, an dessen Ende in den allermeisten Fällen ein „korrektes Geweih“ entsteht. Kommt es zu diesbezüglichen Beeinträchtigungen, kann dies zur Entstehung von Abnormitäten führen.
VERLETZUNGEN IM BAST
Beim Rehwild entstehen die meisten Abnormitäten durch Verletzungen des Bastgeweihs während des Schiebens. Dies kann 15 bis 30 % der Böcke betreffen (KURT 1999). In diesem Kontext sind auch Verletzungen der Rosenstöcke und des Körpers zu nennen, die auf das Geweih zurückwirken.
Früher gab es in den meisten Revieren zum Teil deutlich höhere Anteile abnormer Böcke. Der Grund dafür ist einfach: Die Zahl an Zäunen, Drähten und Stacheldrähten in den Revieren war erheblich größer als heute.
Ein großer Teil der Geweihanomalien bei Rehböcken geht auf das Konto von Verletzungen im Bast.© Dr. Konstantin Börner
STOFFWECHSEL, HORMONE, GENE
Andere Ursachen für Abnormitäten sind Störungen des Stoffwechsels (z. B. Widdergehörn) oder Hormonhaushaltes (z. B. Plattkopf). Ein sehr prominentes Beispiel für eine hormonell induzierte Geweihanomalie ist der Perückenbock. Infolge des Fehlens von Testosteron – meist in Zusammenhang mit Verletzungen der Brunftkugeln – erhält das Geweihwachstum kein Stoppsignal, sodass das Geweih permanent weiterwächst. Das führt zu einem abnorm perückenartig geformten Geweih.
Vereinzelt treten auch genetische Defekte als Ursache für Abnormitäten in Erscheinung.
Perückenböcke entstehen infolge hormoneller Störungen.© Karl-Heinz Volkmar
DOPPELKÖPFE
Eine beim Rehwild sehr seltene Abnormität ist der sogenannte Doppelkopf. Er entsteht, wenn das zunächst geschobene Geweih nicht abgeworfen wird und das Folgegeweih regelrecht um die noch auf dem Rosenstock sitzende Stange wächst. Dies kann beid- oder einseitig erfolgen, wobei letzter Fall nicht selten ist. In ausgesprochenen Ausnahmefällen kann es auch dazu kommen, dass sogar drei Geweihgenerationen auf einem Rosenstock getragen werden.
Der bekannte Wildbiologe Anthony Bubenik stellte die These auf, dass die Ursache solcher „Parallelgeweihe“ eine Störung des Hormonhaushalts ist, aufgrund derer es zu einer unzureichenden Trennung zwischen Rosenstock und Geweihstange kommt. Dabei bleiben die zu der Hormonstörung führenden Gründe häufig unklar.
Lange Zeit rätselte man, ob die Geweihneubildung durch den Abwurf des Geweihs ausgelöst wird. Die Doppelkopfbildung belegt jedoch, dass der Abwurf des Geweihs nicht den entscheidenden Stimulus für die Bildung des Folgegeweihs darstellt, denn dann wäre die Entstehung dieser Anomalie gar nicht möglich.
FROSTGEHÖRNE
Es wird immer wieder angenommen, dass obere Geweihteile bei starkem Frost absterben und dann abbrechen. Da diese Anomalie auch bei Böcken in sehr viel kälteren Arealen als unseren Breiten nicht häufiger vorkommt, scheint dies fraglich. Vermutlich handelt es sich eher um eine stoffwechselbedingte Beeinträchtigung.
Bei diesen Bock kam es vermutlich zu einem Bruch der rechten Stange während des Schiebens.© Karl-Heinz Volkmar
TERRITORIALITÄT UND MACHTANSPRUCH
TERRITORIUM IST NICHT GLEICH STREIFGEBIET
In der Biologie spricht man von einem Territorium, wenn ein Gebiet gegen Eindringlinge verteidigt wird. Ein Territorium stellt sicher, dass wichtige Ressourcen durch den Besitzer monopolisiert werden. Dabei geht es oft um die Sicherung von Nahrung, manchmal wird aber auch der Zugang zu Fortpflanzungspartnern gesichert. Im Gegensatz dazu ist ein Streifgebiet ein umschriebenes Gebiet, das zeitweise durch andere Artgenossen mitgenutzt wird. Es besteht also im Unterschied zum Territorium keine Exklusivität.
DER „ALTE“ IST IM VORTEIL
Das Frühjahr ist die Jahreszeit, in der Böcke ihre Reviere erkämpfen müssen. Sofern er noch lebt, ringt dabei der alte Inhaber mit allen Herausforderern um das betreffende Territorium. Der „Alte“ geht dabei mit einem gehörigen Vorsprung in die Auseinandersetzungen: Er ist in der Regel der älteste und körperlich stärkste Bock dieses Bereiches. Er verfügt zudem über die größte Erfahrung und Ortskenntnis.
Fast immer behält der Platzbock die Oberhand. Vor allem jüngere und schwächere Rivalen räumen meist kampflos das Feld.© Karl-Heinz Volkmar
Kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Jährlingen und Revierinhabern, klären sich die Verhältnisse im Allgemeinen, ohne das es zu einem tatsächlichen Kampf kommt. Der Jährling hat in solchen Duellen auch dann das Nachsehen, wenn er körperlich ebenbürtig ist. Häufig sind mehr oder weniger lange Hetzen die Folge. Tatsächliche Kämpfe, die auch mit den Geweihen geführt werden, sind sehr selten (HOEM et al. 2007).
Die Vorteile für den alten Platzbock sind i. d. R. so groß, dass er in den meisten Fällen auch wieder der neue Revierinhaber wird. Dies ist auch der Grund, warum man Böcke oft über Jahre hinweg in einem bestimmten Bereich bestätigen kann.
MEIN LIEBER FEIND
Selbst wenn ein Revier einmal besetzt ist, muss es gegen Eindringlinge behauptet werden. Unter Reviernachbarn geht es dabei weitestgehend friedlich zu. Dies folgt der „Lieber-Feind-Konvention“, wonach Kontrahenten, die einander kennen, weniger heftig aufeinander losgehen. Man kennt und akzeptiert den jeweils Anderen und die Grenzen der Reviere.
Unbekannte Eindringlinge werden dagegen scharf verfolgt. Dabei sind die Platzböcke umso aggressiver, je stärker der Eindringling ist. Schwache Jährlinge werden wie auch Territoriumnachbarn nur selten angegriffen. Von ihnen geht offenbar keine große Gefahr aus, sodass sie eher im eigenen Revier geduldet werden.
Aggressive Konflikte zwischen Böcken bleiben die Ausnahme. Die tatsächliche Eskalationsrate ist sehr gering, und nur selten kommt es zu einem körperlichen Kräftemessen. Findet in seltenen Fällen dennoch ein Kampf statt, geht das Revier des Territoriumeigners nicht zwangsläufig verloren, selbst wenn er unterliegt (HOEM et al. 2007). Ist also ein Revier einmal eingenommen, bleibt es, von Einzelfällen abgesehen, für einige Jahre auch in der Hand dieses Bockes.
Ein körperliches Kräftemessen zwischen Böcken ist die Ausnahme.© AdobeStock/WildMedia
GRÜNDE FÜR TERRITORIALITÄT
Eine grundsätzliche Frage stellt sich: Warum entwickeln Böcke überhaupt eine Territorialität? Immerhin ist die Verteidigung des Reviers für dessen Inhaber mit nicht unerheblichen energetischen Kosten verbunden. Die Antwort lautet: Auf diese Weise kann ein Bock mehr Ricken für sich monopolisieren, also für sich allein beanspruchen, als es zufällig und ohne Territorialität der Fall wäre. Im Durchschnitt sind dies zwei bis vier Ricken. Dieser Gewinn wiegt für ihn die Kosten der Revierverteidigung wieder auf. Hätten Böcke die Möglichkeit, die genannte Zahl an Ricken und deren Beschlag ohne Revierverhalten zu erlangen, gäbe es keine Territorialität.
EXKURS VERTEIDIGUNGSBEREITSCHAFT
Wie intensiv Territorien verteidigt werden, hängt in hohem Maße davon ab, wie wertvoll die zu verteidigende Ressource ist. Das Waldbrettspiel, ein bei uns häufiger Tagfalter, lebt überwiegend im Wald. An kleinen Sonnenplätzen warten die Männchen auf vorbeikommende Weibchen und verteidigen ihre Plätze gegen Geschlechtsgenossen. Die Kämpfe werden dabei aber mit keiner besonderen Härte geführt, weil diese Ressource häufig vorhanden ist. Anders als bei Rehböcken hat der Revierinhaber in der Auseinandersetzung nicht nur einen Vorteil und Eindringlinge verlieren immer gegen die „Revierinhaber“. Dieses Phänomen wird in der Biologie als arbiträre Konvention bezeichnet. Bei Versuchen mit Blaumeisen ging man einen Schritt weiter und entfernte den Territoriuminhaber aus dem Revier. War das Revier durch ein anderes Männchen neu besetzt, setzte man den alten Inhaber wieder zurück: In der Folge kam es zu Kämpfen, wie sie in dieser Vehemenz sonst nicht zu beobachten waren. Umso später die alten Revierinhaber nach der Übernahme eingesetzt wurden, desto geringer waren die Chancen, es zurückzugewinnen.
SCHRECKEN OHNE ENDE
Rehwild ist jetzt im Frühjahr deutlich aktiver als im übrigen Jahr und dementsprechend nun auch wesentlich häufiger zu hören. Wähnt es eine Gefahr, die es nicht eindeutig zuordnen kann, erschallt der markante „Bö“-Laut, das sogenannte Schrecken. Dieser Laut wird dann laut und staccatoartig ausgestoßen und die potenzielle Gefahrenquelle dabei in der Regel nicht aus den Augen gelassen. Manchmal beobachtet man auch, wie die Tiere dabei mit ihren Läufen aufstampfen und mit dem Haupt auf- und abwippen. Rehe tun dies, um einem vermeintlichen Räuber klar zu machen, dass er entdeckt ist. Die Botschaft an ihn lautet wohl, dass sich das Festhalten an seinem Plan nicht lohnt und man sich eine Verfolgungsjagd im wahrsten Sinne des Wortes besser „spart“, denn die kostet beide Seiten unnötig Energie.
SCHRECKKONZERTE
Nicht selten entwickelt sich aus dem Schrecken eines Rehs ein richtiges Konzert, sodass manchmal bis zu fünf Stücke von allen Seiten „Laut geben“. Dies steht jedoch nicht in erster Linie im Zusammenhang mit einem Warnen. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine Gemeinschaftsstrategie handelt, mit der ein potenzieller Feind verwirrt werden soll (OLI & JACOBSON 1995).
FEINDVERMEIDUNG
Dass im Frühjahr nun deutlich öfter geschreckt wird als im Winter, wird in erster Linie mit der einsetzenden Vegetation begründet. Denn nun können Gefahrenquellen weniger gut identifiziert werden. Daraus lässt sich die Grundregel ableiten: Je schlechter die Sicht, desto häufiger ertönt das Schrecken.
Geschreckt wird grundsätzlich von beiden Geschlechtern und allen Altersklassen. Kitze sind bereits etwa ab dem dritten Lebensmonat dazu in der Lage. Ihr selten zu hörender Schrecklaut hört sich wesentlich höher an als der älterer Stücke. Sie sind auch die Einzigen, die sich sicher von anderen ihrer Art unterscheiden lassen. Böcke erzeugen zwar im Vergleich zu Ricken tiefere und etwas kürzere Töne, diese sind aber meist nur im direkten Vergleich unterscheidbar.
Interessant ist die Tatsache, dass Ricken mit Nachwuchs häufiger schrecken als dies weibliche Einzelgänger tun.
Das Schrecken ist wohl auch eine Botschaft an den vermeintlichen Feind: „Verfolgung zweckos, du bist entdeckt.“© AdobeStock/Erik Mandre
TERRITORIALSCHRECKEN
Grundsätzlich schrecken Böcke häufiger als Ricken (REBY et al. 1998). Oft tun es Böcke auch dann, wenn es keinen erkennbaren Grund dafür gibt. Dieses Verhalten kann nicht im Zusammenhang mit Feindvermeidung oder dem Warnen anderer Rehe stehen. Tatsächlich handelt es sich um einen Laut, der als Merkmal der Territorialität zu verstehen ist. Sehr vereinfacht könnte er übersetzt heißen: „Hier bin ich, das ist mein Territorium.“ Dies ist auch der Grund, warum ältere Böcke häufiger schrecken als jüngere. Neben optischen und olfaktorischen Botschaften der Revierabgrenzung ist das Schrecken als akustisches Signal der Besitzanzeige zu deuten. Es trägt dazu bei, sich kampflos aus dem Weg zu gehen. Sehr wahrscheinlich können sich Reviernachbarn sogar an der Stimme erkennen.
Alle Funktionen des Schreckens sind noch nicht geklärt. Dass es bei Böcken außer Warnen auch ein akustisches Signal der Territorialität sein kann, weiß man aber.© AdobeStock/Liddy Lange
BÖCKE HERANSCHRECKEN
Vermutlich ist der Schrecklaut evolutiv zunächst im Rahmen der Feindvermeidung entstanden. Später wurde es teilweise umfunktioniert und von Böcken auch zur Territorialabgrenzung eingesetzt. Welche detaillierten Informationen Rehe mittels Schreckens noch mitteilen, ist jedoch noch nicht vollständig entschlüsselt.
Einem Jäger, der das Schrecken nachahmt, wird es nicht selten gelingen, das „Rückschrecken“ eines anderen Rehs zu provozieren. Vereinzelt wird sich auch ein Bock zum Zustehen bewegen lassen – in der Annahme, das imitierte Schrecken könne von einem Eindringling stammen. Dies zeigen auch Versuche an besenderten Böcken, denen Schrecklaute ihrer jeweiligen Reviernachbarn vorgespielt wurden.
In etwa einem Drittel der Fälle kam es zu einer Reaktion der Territoriuminhaber auf den vermeintlichen Eindringling. Etwa die Hälfte der reagierenden Böcke schreckte ihrerseits, ohne den Platz zu verändern, die andere Hälfte näherte sich dem Lautsprecher und nur einmal floh der Revierinhaber (REBY et al. 1999). Selbst Böcke „herbeizuschrecken“ und daraus vielleicht sogar eine zuverlässige Strategie entwickeln zu wollen, ist demnach sicher schwierig. Zuverlässiger lässt sich der nachgeahmte Schrecklaut gegenüber ziehenden Rehen einsetzen, um sie zum Verhoffen zu bringen. Rehwild reagiert darauf im Allgemeinen besser als auf einen Pfiff. Vielleicht probieren Sie es selbst einmal aus.
REHWILD UND SEINE FEINDE
Einer meiner Jagdfreunde erzählte mir vor einer Weile, dass er sich schon lange frage, wo das ganze Rehwild geblieben sei. In diesem Zusammenhang berichtete er mir von einer Ricke hinter seinem Haus, die sich ihm anfänglich noch mit zwei Kitzen präsentierte. Später führte sie nur noch eins, und auch dieses war irgendwann verschwunden. Die Ricke sei fortan nur noch allein anzutreffen gewesen, ohne dass eines der Kitze geschossen worden sei. Überhaupt, so war er sich sicher, ginge es mit dem Wild ständig bergab. Auch wenn es sich hier selbstverständlich nur um eine subjektive Einschätzung handelt, ließ er mich doch mit der Frage zurück, wo manchmal Kitze mitunter tatsächlich bleiben.
MARKIERT FÜR DIE FORSCHUNG
Durch Markierungsversuche konnte in der Vergangenheit schon einiges zur Klärung der Frage beigetragen werden, was im Laufe der Saison mit den gesetzten Kitzen passiert. In der Jägerschaft besteht zum Teil noch die Annahme, dass die getätigten Abschüsse plus gefundenes Fallwild der Summe aller Sterbefälle in einer Wildtierpopulation entspricht (SIEFKE 2014). Der Rehwildforscher CHRISTOPH STUBBE konnte dagegen nachweisen, dass der Großteil der von ihm markierten Kitze auf unbekannte Weise verschwand. Tatsächlich betrug der jagdlich genutzte Teil der Kitze nur etwa 50 Prozent.
In einer neueren französischen Studie untersuchte man den Verbleib von 57 in den ersten Lebenstagen markierten Rehkitzen. Dabei standen moderne Sender zur Verfügung, die einen etwaigen Tod der Tiere sofort anzeigten. Das Ergebnis: Nur 25 Kitze (43,9 %) überstanden die ersten etwa 100 Lebenstage überhaupt (MONESTIER et al. 2015). Alle anderen fielen Prädatoren zum Opfer oder kamen durch verschiedene menschliche Einflüsse (z. B. Mahd) ums Leben.
In einer neueren französichen Studie überlebten von 57 markierten Kitzen 32 die ersten ca.100 Lebenstage nicht.© AdobeStock/Mike Bender
PRÄDATOR WOLF
In unseren Gefilden spielt seit einiger Zeit der Wolf als Prädator wieder eine Rolle. Um sich einen Eindruck vom Einfluss des Wolfes auf eine Rehwildpopulation zu verschaffen, können ernährungsökologische Untersuchungen wichtige Hinweise liefern. Studien zur Ernährung des Wolfes aus der Lausitz zeigen, dass er sich dort etwa zur Hälfte von Rehwild ernährt. Jeweils etwa 20 Prozent der Beute machen Rot- und Schwarzwild aus.
Interessant ist die Tatsache, dass sich der Anteil des Rehs im Laufe der Jahre erhöht hat. War zunächst anteilig mehr Rotwild gerissen worden, wechselte der Wolf zunehmend auf Rehwild über. Das ist darauf zurückzuführen, dass diese Wildart dort am stärksten vertreten ist. Welchen Einfluss der Wolf auf die Wildbestände in der Lausitz ausübt, wird gegenwärtig noch wissenschaftlich untersucht.
WOTSCHIKOWSKY (2010) geht davon aus, dass ein Wolfsrudel bei uns im Jahr einen Fleischbedarf von 400 Rehen hat – hinzu kommen 54 Stück Rotwild und etwa 100 Sauen. Gehen wir weiterhin von einem Streifgebiet der Wölfe von 15 000 bis 20 000 Hektar aus, dann ergibt sich ein rechnerischer Eingriff in den Rehwildbestand von 2 bis 2,5 Stück pro 100 Hektar und Jahr.
PRÄDATOR LUCHS
Mehr als der Wolf ist der Luchs ein ausgesprochener Rehspezialist. Andere Arten spielen in seiner Ernährung eine untergeordnete Rolle. In einer schwedischen Untersuchung konnte die Beeinflussung des Rehwildbestandes durch den Luchs berechnet werden. Danach lebten in einem Gebiet von 120 000 Hektar etwa 4400 Rehe (3,6 Stk./100 ha). Die acht dort lebenden Luchse erbeuteten jährlich etwa elf Prozent des Rehbestandes (ANDRÉN & LIBERG, 2015). Als Richtwert kann man davon ausgehen, dass durch einen Luchs pro Jahr etwa ein Reh pro 100 Hektar genutzt wird. Dabei ist die Gefahr für Rehe, vom Luchs erbeutet zu werden, lebensraumabhängig verschieden. HEURICH et al. (2016) konnten nachweisen, dass das Prädationsrisiko für Rehe in waldreichen Habitaten größer ist als in offenen Lebensräumen.
„Pinselohr“ ist ein Spezialist: Er lebt fast nur von Rehen.© AdobeStock/Xaver Klaußner
PRÄDATOR FUCHS





























