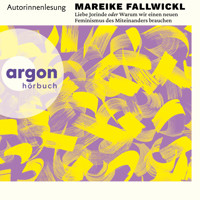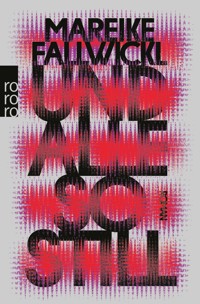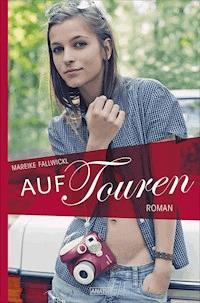
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Anais
- Sprache: Deutsch
Bei einem 'Sexunfall' mit ihrem verheirateten Lover trägt Nathalies feuerroter Mini Cooper Blessuren davon und sie muss sich nach einem neuen Fortbewegungsmittel umsehen. Einer spontanen Eingebung folgend, steigt sie eines Morgens in ein Taxi – und erlebt ein überraschendes Sexabenteuer. Die sommerlichen Temperaturen lassen die 25-Jährige von nun an nicht nur bei ihrer Kleidung freizügiger werden, sie geht auch in die erotische Offensive. Während ihre beste Freundin Luise sich auf die Ehe vorbereitet, lässt Nathalie sich mit dem Taxi durch Salzburg kutschieren und bezahlt dafür mit Sex. Bis plötzlich der gut aussehende Tobias im Auto sitzt. Er ist ebenso charmant wie geheimnisvoll. Und Nathalie setzt alles auf eine Karte, um ihn zu erobern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mareike Fallwickl
Auf Touren
Roman
Trennen sich zwei
Alles begann damit, dass Günther Sex im Auto haben wollte. Ich zierte mich einige Zeit, vielleicht zwei, drei Wochen lang, weil es noch März war und kühl, doch heute, an diesem milden Abend im April, ist es beschlossene Sache. Ohne ein Wort lassen wir Günthers dunkelgrauen Mercedes stehen und nehmen mein Auto, einen Mini Cooper in einem herrlich auffälligen Rot, den ich mit der Erbschaft meiner Oma gekauft habe. Er ist ein überteuerter Stadtflitzer mit Sonderausstattung und niedlich-runden Augen, der mir das Gefühl gibt, wagemutig zu sein, ein Feuerwehrauto im Kleinformat, das ich mit all der Leidenschaft, die man für materiellen Besitz aufbringen kann, liebe. Günther muss gekrümmt darin sitzen, den Kopf und die Schultern eingezogen, weil er ein großer Mann ist, er macht dabei immer einen unangenehm schuldigen Eindruck.
Wir fahren von Salzburg Richtung Hof, am Fuß des Gaisbergs vorbei, bis Günther mir deutet, rechts abzubiegen in einen kleinen Waldweg. Er hat die Gegend offenbar ausgekundschaftet und einen geeigneten Platz ausgesucht, ich ziehe fragend die Augenbrauen hoch, er ignoriert es. Ich halte den Wagen an und mache das Licht aus. Auf der linken Seite neigt sich ein baumgesäumter Hang nach unten zur Hauptstraße, das Mini-Rot ist von dort aus gut zu sehen, die Blätter der Bäume wachsen noch. Und doch stört das Günther anscheinend weniger als der Gedanke, jemand könnte sein Auto oder das Kennzeichen erkennen, sich wundern, nach dem Handy greifen und Günthers Frau anrufen. Ich halte das für absolut unwahrscheinlich, aber seine Paranoia kennt kaum Grenzen.
»Das habe ich mir schon seit Jahren gewünscht«, wispert er und knöpft seinen eleganten anthrazitfarbenen Mantel auf.
»Es ist noch nicht ganz dunkel«, sage ich laut.
»Niemand wird uns sehen«, murmelt Günther. »Der Weg führt zu einer Hütte, die erst Mitte Mai öffnet.«
Ich drehe das Radio auf, Lady Gaga gurrt aus dem Lautsprecher, ich mag nicht so recht in Stimmung kommen. Eine Weile sehe ich durch das Fenster dem Licht beim Dämmern zu. Es fällt mir schwer, mich auf Sex zu konzentrieren, wenn ich Sex haben soll, immer fällt es mir schwer, mich auf meine Körperlichkeit zu fokussieren, kopfgesteuert bin ich. Günther streichelt mich mit den Fingerkuppen im Nacken, mein Haar ist zu einem straffen Pferdeschwanz gebunden, den er zu lösen versucht. Mit der anderen Hand dreht er das Radio leiser, dann legt er sie auf mein Knie. Ich habe einen Minirock angezogen, einen schwarzen, um der anrüchigen Situation gerecht zu werden, und nun sitze ich da und fühle mich unwohl, was nicht am Rock liegt, nicht nur. Auf der Hauptstraße rauschen die Autos vorbei, die Scheinwerfer blenden, der Feierabendverkehr fließt aus der Stadt hinaus zu den günstigeren Wohngegenden auf dem Land, wo es eingezäunte Gärten gibt, einen Hund und zwei Kinder pro Haus.
»Ich weiß nicht«, sage ich und lasse den Satz unvollendet, weil ich keine Spielverderberin sein will. Trotzdem würde ich lieber in einem Bett liegen.
Günther schweigt, er küsst die Stelle, an der mein rechtes Ohrläppchen aufhört und mein Kiefer beginnt, ich schließe die Augen. Die Heizung bläst mir warme Luft ins Gesicht, Günther öffnet den Reisverschluss meiner schwarzen Lederjacke. Dass es keine gute Idee war, eine Strumpfhose anzuziehen, fällt mir auf, als Günther meinen Minirock hochschiebt. Man kann sich nicht verführerisch aus einer Strumpfhose schälen, unter keinen Umständen, schon gar nicht in der Enge eines roten Mini Cooper. Mit einem Ruck ziehe ich die Handbremse an und wende mich meinem Liebhaber zu. Ich befreie ihn von Mantel und Pullover, nestle an seinen Hemdknöpfen, während er sich mit fliegenden Fingern an meinem BH-Verschluss zu schaffen macht und in mein Dekolleté hineinschnauft. Ich würde ihn gern fragen, warum seine Frau keinen Sex im Auto haben will, aber wir sprechen nicht über seine Frau, nie.
»Wir sollten uns auf die Rückbank legen, oder?«, sage ich.
»Ja«, antwortet er. »Gut, jaja«, er hat schon seine heisere Sexstimme.
So plötzlich, wie die Dunkelheit hereingebrochen ist, werde ich nervös, jeden Moment könnte jemand an die Scheibe klopfen und eine entrüstete Frau mit Kopftuch und Leberfleck am Kinn würde losschimpfen, was wir denn da machten, eine Frechheit sei das, so eine Sauerei, mitten auf der Straße. Ich würde die Situation gern mit einem Kichern entspannen, aber ich bringe keines zustande.
»Beeilen wir uns«, murmle ich in meinen Kragen hinein, streife die hohen Schuhe ab und klettere auf den Rücksitz. Ich lehne mich zurück und hebe den Hintern, um die hautfarbene Strumpfhose so schnell wie möglich auszuziehen.
»Wie soll das funktionieren, Gü?«, wende ich ein. »Du bist fast eins neunzig groß. Du passt ja nicht einmal diagonal in mein Auto.«
»Das geht schon«, versichert er und öffnet seinen Gürtel. Die Dunkelheit hat die Umgebung ebenso wie das Wageninnere mit sattem Schwarz überzogen. Ich greife mit den Händen nach ihm und er stürzt mir durch den Spalt zwischen den Vordersitzen entgegen, halb gezielt, halb zufällig, dann zieht er den Ausschnitt meines T-Shirts hinunter und beißt durch den BH in meine linke Brustwarze. Ich versuche, mich auf ein Kribbeln zu konzentrieren, eines zu erzeugen, das nicht von Nervosität herrührt, sondern von Erregung, doch der Anblick von Günther, der zwischen den Vordersitzen eingeklemmt ist und vor der Windschutzscheibe mit den Füßen hin und her strampelt, ist nicht einmal ansatzweise erotisch.
»Das hat doch überhaupt keinen …«
»Hgggnnnrt«, sagt Günther und will sich auf die Rückbank stemmen, wobei er mit dem Knie die Handbremse löst, sodass der Mini auf dem leichten Hang zu rollen beginnt, rasch an Fahrt aufnimmt und auf die Bäume zusteuert.
»Scheiße!«, schreie ich und drücke mich gegen Günther, panisch, mit der Hand will ich zwischen seinen Beinen hindurch, um zur Handbremse zu greifen, aber es gelingt mir nicht, Günther ist zu groß, Günther ist überall.
»Dreh dich um«, rufe ich. »Dreh dich um, steig auf die Bremse!«
Ich spüre, dass der Wagen immer schneller rückwärts fährt, und beginne, vor Angst zu kreischen, ich kann in der Finsternis nichts erkennen, ich sitze in einem ruckelnden Sarg. Hektisch hüpfe ich auf und ab, Günther fuchtelt mit den Händen, er steckt fest, das Hemd ist ihm halb übers Gesicht gerutscht, und dann knallt es. Der Krach ist viel lauter als erwartet, und der abrupte Aufprall lässt Günther erst nach vorn in meine Richtung und dann zurück in die Fahrerkabine schießen, ich fliege ihm hinterher und lande mit der Stirn auf seinem Kinn. Vor Schmerz schießen mir Tränen in die Augen, Blut rinnt aus meiner Nase, Günther stöhnt leise. Der Mini bewegt sich nicht mehr, die Bäume haben ihn aufgefangen, nur wenige Meter weiter links fährt ein Auto auf der Hauptstraße vorbei, mit 80 Kilometern pro Stunde.
Ich fange an zu weinen und klettere über meinen bewegungslosen Geliebten, öffne die Fahrertür und falle mit dem Oberkörper voran aus dem Wagen, es ist überraschend kalt. Der Mini ist mit der Rückseite auf zwei Eichen geprallt, unbekümmert und gerade stehen sie da, der Kofferraum ist eingedrückt, das linke hintere Seitenfenster hat einen großen Sprung. Ich zwänge mich zwischen den Bäumen durch, stelle mich an den Straßenrand und winke zaghaft, aber die Autofahrer sind zu schnell dran und erkennen zu spät, dass da jemand steht. Nach zwei Minuten gebe ich auf und gehe zurück zum Auto. Günther spaziert neben der unversehrten Motorhaube hin und her, mit zugeknöpftem Mantel, einer Zigarette im Mundwinkel und dem Handy am Ohr. Verblüfft starre ich ihn an.
»Ich dachte, du bist bewusstlos«, sage ich und mache einen Schritt auf ihn zu, dann bleibe ich stehen.
Sein Blick macht mir klar, dass ich derangiert aussehen muss, und ich schaue an mir hinunter. Der BH hängt mir um den Hals, den Rock trage ich um den Bauchnabel und die Strumpfhose auf halber Höhe, Blut tropft von meinem Kinn. Die Autofahrer bereuen vermutlich, nicht angehalten zu haben, als da diese Nutte an der Straße stand. Hastig ziehe ich die Strumpfhose hoch und den Rock hinunter, den BH stecke ich in die Jackentasche.
»Ich wollte ein Auto anhalten und einen Rettungswagen rufen«, erkläre ich mit einer Handbewegung zur Straße.
»Es geht mir gut«, sagt Günther, »nichts passiert.«
Er tastet vorsichtig sein Kinn ab und kneift die Augen zusammen, dann wirft er die Zigarette auf die Wiese und tritt sie aus. Mir fehlen die Worte, ich zittere und sehne mich nach einer Umarmung, aber Günther kommt nicht auf mich zu, und ich habe nicht die Kraft, die Distanz zwischen uns zu überwinden.
»Du Idiot«, zische ich, »das ist alles deine Schuld. Wir hätten deinen Mercedes nehmen und uns in eine Tiefgarage stellen sollen, ganz nach oben unters Dach, wo es dunkel ist, wo keine Menschen sind und nichts passieren kann.«
Ich wende mich abrupt ab, marschiere durch das sumpfige Gras, meine Füße sind längst nass, ich setze mich ans Steuer und drehe den Schlüssel. Das Auto springt sofort an, doch bevor ich erleichtert ausatmen kann, quietscht und knarrt es so beängstigend, dass ich erschrocken den Fuß von der Kupplung nehme und der Motor erstirbt. Ich kann nicht mit dem Wagen nach Hause fahren, das steht fest. Mit einem Seufzer lege ich das Gesicht auf das Lenkrad und atme den Ledergeruch ein. Der Schock sitzt noch in meiner Brust, nur langsam beruhigt sich mein Herzschlag.
Als ich näherkommende Reifen auf dem Schotterweg knirschen höre, steige ich aus. Ich wundere mich, dass der Abschleppwagen so schnell eingetroffen ist, und blinzle entgeistert, als ich erkenne, dass Günther nicht den ÖAMTC, sondern ein Taxi gerufen hat. Die Scheinwerfer erfassen Günther und mich wie zwei auf frischer Tat ertappte Nachtgestalten, zerrupft und bleich.
»Wieso hast du … was ist … mit einem Abschleppwagen?«, krächze ich.
Günther sieht auf die Uhr und zuckt mit den Schultern.
»Ich muss nach Hause«, sagt er und öffnet die Beifahrertür des Taxis.
»Du kannst doch jetzt nicht …«, sage ich und mein Lachen klingt schrill.
»Wieso musst du plötzlich weg? Wir hatten doch was anderes vor, dafür hättest du ja auch Zeit gehabt?«
Günther antwortet nicht. Den Ausdruck in seinem Gesicht kann ich nicht deuten, er kommt mir vor wie Müdigkeit. Mein Körper ist mit einem Mal sehr alt und schwer.
»Das wagst du nicht«, setze ich leise hinzu.
Günther erwidert meinen Blick für einen Moment, und sein Gesicht ist so verschlossen, dass ich gar nicht sagen muss: Dann ist es aus. Sein Handeln macht diese Worte überflüssig, und ich beobachte stumm mit offen stehendem Mund, wie er in das Taxi steigt. Dann schlägt die Tür auch schon zu und das Taxi wendet. Entsetzt renne ich dem Wagen ein paar Schritte nach, Wut steigt in mir hoch wie fauliges Sodbrennen.
»Du Arschloch!«, schreie ich und suche hektisch nach etwas, das ich Günther nachwerfen könnte, das mit einem Knall auf der Taxiheckscheibe landen würde, aber ich finde nichts, ich habe ja nicht einmal Schuhe an.
»Du verficktes Hurensohnschwein!«, brülle ich und spüre die Enttäuschung bis in die Zehenspitzen, pure Aggression überschwemmt mich, die Demütigung sticht mit feinen Nadeln zu. Ein Schluchzen stiehlt sich aus meinem Mund und ich drücke die geballte Faust auf meine Lippen, meine Füße sind schmerzend kalt. Mit einem zornigen Knurren gehe ich zurück zum Mini, ziehe die Schuhe an und suche nach meiner Handtasche. Ich hole das Handy hervor und wähle den Abschleppnotdienst, meine Stimme klingt fremd, sehr rau und gar nicht mädchenhaft wie sonst. Man schicke mir jemanden innerhalb der nächsten Stunde, heißt es. Als ich aufgelegt habe, sehe ich mich um, oberhalb des Hangs glänzt nur zähe Schwärze. Die Dunkelheit fühlt sich an wie ein beobachtender Blick, ich verschränke die Arme vor der Brust. Die Straße ist nicht mehr so stark befahren, und ich fühle mich allein wie lange nicht mehr, vielleicht wie seit jenem Tag, an dem der Trainer mir erklärte, mit meinem mangelnden Gleichgewichtssinn könne ich niemals Eisläuferin werden, und mich an den Rand der Arena verbannte, von wo aus ich der feenhaften Luise beim Pirouettendrehen zusah. Das Geräusch der zufallenden Taxitür hallt noch in mir nach, ein Schlag ins Gesicht hätte nicht verletzender sein können. Und den ganzen Abend lang haben wir uns nicht ein einziges Mal geküsst.
Als es im Unterholz hinter mir raschelt, haste ich in den Mini und verriegle alle Türen. Das Handy halte ich noch in der Hand und mein erster Gedanke gilt Luise, aber ich will den Ich-hab-es-dir-ja-gesagt-Ton in ihrer Stimme nicht hören. Ich drücke die Kurzwahltaste für die Nummer meiner Mutter, weil es nur ein Wort im ganzen Wortschatz gibt, das in einer solchen Situation Trost spendet, und ich es jetzt, wie ein Kind, unbedingt sagen will: »Mama.« Heulend erzähle ich die Geschichte, die während des Erzählens entscheidende Details verliert, dass Günther verheiratet ist zum Beispiel und was wir im Auto eigentlich gemacht haben, als es zum Unfall kam.
Übrig bleiben der Schreck, der kaputte Mini und Günthers Rücksichtslosigkeit, wie er mich ganz allein stehen lassen hat im Nirgendwo. Nachdem ich sieben Mal wiederholt habe, was für ein egoistisches Sackgesicht Günther ist, merke ich, wie die Wut mit jedem Schimpfwort ein wenig kleiner wird. Meine Mutter murmelt Tröstendes und hört zu, sie wird mich zur Rede stellen wegen des Autos, das ich heimlich gekauft habe, aber nicht jetzt, erst einmal erkundigt sie sich, ob es mir gut geht, beschwichtigt und beruhigt mich.
Meine Mutter ist bis tief in ihr Wurzelwerk hinein eine pragmatische, anpackende Frau, selten wehmütig oder von Gefühlen überwältigt, deswegen denkt sie praktisch und plant mit mir, den verunfallten Mini zur Werkstatt in mein Heimatdorf zu bringen und sich dort mit mir zu treffen, und dann sagt sie, als ich aufgehört habe zu weinen und erschöpft hinausstarre in die Finsternis, ein bisschen unwirsch:
»Mein Gott, was wolltest du auch mit einem, der Günther heißt.«
Herzkirschsaftflecken
Sex mit Günther war Besser-als-nichts-Sex. Seine Hände setzte er sparsam ein, als fürchte er, die Balance zu verlieren, wenn er sich nicht darauf stützen könnte, manchmal verlagerte er das Gewicht auf seinen rechten Arm und umfasste mit der linken Hand meine Brust für einen Moment, oder umgekehrt. Sex mit Günther war Einfach-nur-daliegen-Sex, weil er abweisend schnaubte, wenn ich mich aufsetzen wollte, im Bett umdrehen, aufstehen gar, ihn in eine andere Stellung wälzen. Anfangs hatten wir uns meist in der Dusche geliebt, seifig, nass und mit animalischen Knurrlauten, im Hinterkopf das erregende Wissen, dass alle Spuren weggewaschen wurden, dass Günthers Frau nichts würde finden oder riechen können.
Ein paar Mal hatten wir die Waschmaschine in meinem zugigen Bad zweckentfremdet, die Hose um die Knöchel, den Rock nur hochgeschoben, Günther war mit gierigen Stößen in mich eingedrungen, von hinten, das Gesicht in meinem Haar vergraben. Scheinbar hatte jedoch auch in einer Affäre die Leidenschaft ein Ablaufdatum, sie verblasste mit der Zeit und verlosch nach wenigen Wochen, in unserem Fall vielleicht sogar schneller als in einer Beziehung. Ich hatte damit nicht gerechnet und konnte Günthers Desinteresse nicht verstehen, wozu betrog er seine Frau, wenn er es mit der Geliebten auf die gleiche monotone Weise trieb?
Es hatte Spaß gemacht, mit ihm zu schlafen, sechs Mal, acht Mal in etwa, dann war eine absurde Art von Routine eingekehrt, die in einer Affäre nichts zu suchen hatte. Günther gab sich keine Mühe mehr, im Bett wurde er faul, er ließ sich von mir mit der Hand bedienen oder ruckelte schweigsam auf mir herum, bis er mit einem klischeehaften Seufzen zusammensank und sich hastig von mir herunterhievte, um sich unter die Dusche zu stellen, allein. Aus den ausgedehnten, anregenden Küssen, von denen der Kiefer zwei Stunden schmerzte, wurden lasche Berührungen, es war wie nach 27 Jahren Ehe. Ich fürchtete, es könnte an mir liegen, an meiner fehlenden Erfahrung, meinem zu wenig nachgiebigen, umschlingenden Körper, aber ich konnte meine Ängste nicht formulieren, es kam kein Gespräch zustande. Vielleicht schämten wir uns, weil wir nicht leidenschaftlicher waren. Drei Monate, nachdem unsere Liebschaft begonnen hatte, war Sex mit Günther kaum noch besser als Sex allein.
Gefallen hatte er mir nicht auf Anhieb, aber aufgefallen war er mir schon. Ich traf Günther bei der Feier zum 65. Geburtstag meines ehemaligen Professors, der meine Diplomarbeit betreut und mir mit seiner freundlichen Bestimmtheit zum Abschluss verholfen hatte. Der Einladung in meinem E-Mail-Postfach folgte ich aus Höflichkeit und Langeweile, die Party fand an einem Donnerstagabend statt. Es war November, und der Professor brachte seine Partygesellschaft in den Stiftskeller St. Peter, wo beim Advent Mozart Dinner Concert Opernsänger in historischen Gewändern auftraten. Sie füllten das alte Gemäuer mit ihren Stimmen, die weißen Perücken bebten, und die Gäste lauschten mit geneigten Köpfen, während ein viergängiges Menü nach Rezepten aus dem 18. Jahrhundert aufgetischt wurde. Ich trug ein geblümtes Kleid und grünen Lidschatten, ich gehörte zu den Jüngsten und spürte die Abwesenheit einer Begleitung als Stechen im linken Ellbogen. Ich wurde an einen Tisch mit drei anderen Absolventen des Professors sowie einem Ehepaar gesetzt, das aus Günther und seiner Frau bestand, deren Namen ich nicht erfuhr und auch nie erfahren sollte. Man lächelte aneinander vorbei ins Ungewisse und konzentrierte sich auf die schwitzenden Sänger, um kein Gespräch beginnen zu müssen. In den Gesangspausen wurde die Stille allerdings peinlich, sodass der junge Mann im lilafarbenen Hemd neben mir sich räusperte und mit Nachdruck die allzu offensichtliche Frage stellte:
»Hast du auch bei Professor Seibert studiert?«
»Nein, ich bin seine heimliche Geliebte«, sagte ich und aß ungerührt weiter.
Nur einer am Tisch lachte, und so lernte ich Günther kennen. Er sagte nichts, er lachte laut auf, tupfte sich den Mund mit der Serviette ab und warf mir einen vergnügten Blick zu, der mir eine Leichtigkeit in die Brust legte und den Abend rettete. Das violette Hemd neben mir schwieg, stocherte irritiert im Dessert, und ich überlegte, meine Hand auf seine zu legen und »War nur ein Scherz!« zu flüstern, aber ich tat es nicht. Später, nach Gesang und Dinner, floss der Wein. Die drei Absolventen nutzten den Abend zum Netzwerken, sie wanderten durch den von Kronleuchtern befunkelten Saal und biederten sich den anderen Akademikern an, ich blieb sitzen und beobachtete die Gesellschaft. Als Günthers Frau zur Toilette ging, rückte er seinen Sessel weiter zu mir, füllte mein Glas auf und sagte leise: »Du hast einen sehr schönen Mund.«
Das ungewöhnliche Kompliment kribbelte auf meiner Haut, ich senkte den Kopf und lächelte über die linke Schulter zu ihm hin, in der Hoffnung, dass das elegant wirkte. Dann schwiegen wir, und als Günthers Frau zurückkam, half er ihr in den Mantel. Sie verließen die Feier. Ich sah den beiden hinterher und machte mir bewusst, dass ich der Frau keinerlei Beachtung geschenkt hatte, dass ich nicht sagen konnte, wie lang ihre Haare waren und ob ihr Hintern größer war als meiner. Günther dagegen hatte fein geschwungene Augenbrauen, graublaue Augen und dunkelbraune Haare, die Linien auf seiner Stirn waren nicht mehr dezent, ich schätzte ihn auf Mitte vierzig. Er war sehr groß, sicher 20 Zentimeter größer als seine Frau.
Ich freute mich über den kurzen, amüsanten Flirt und die Aufmerksamkeit. Der Mann, von dem ich nicht wusste, wie er hieß, war nicht mein Typ, zu alt und zu gesetzt, von jugendlichen Muskeln war unter seinem weißen Hemd nichts zu erahnen gewesen. Ich trank mein Glas in einem Zug aus, verabschiedete mich vom glückseligen, inzwischen längst betrunkenen Professor und ging zu Fuß nach Hause, die Hände in den Taschen vergraben und im Kopf den Ohrwurm von einem Lied, dessen Text mir nicht einfiel.
Als ich zwei Tage später kurz vor Ladenschluss in den Supermarkt am Hanuschplatz stürzte, um Milch, Mandarinen, Brot und Tomatensauce fürs Wochenende einzukaufen, lief ich direkt in Günthers Arme. Die Schiebetür öffnete sich und wir standen einander gegenüber, wir stießen nicht zusammen, waren aber dennoch verblüfft.
»Hallo«, sagte ich.
»Gehst du hier einkaufen?«, fragte Günther und lächelte. »Oder bist du auch die Geliebte von dem Typ in der Wurstabteilung?«
»Nicht so laut, seine Freundin sitzt an der Kasse.«
Wir grinsten, Menschen bahnten sich schimpfend ihren Weg um uns herum.
»Ich muss allerdings auch wirklich einkaufen, fürs Frühstück morgen«, sagte ich und wollte an Günther vorbei den Supermarkt betreten. Er hielt mich am Arm zurück und beugte sich zu meinem Ohr:
»Frühstück kann ich nicht anbieten, aber ich lade dich zum Abendessen ein.«
Ich bekam eine Gänsehaut im Nacken und fand den Druck seiner Hand auf meinem Arm angenehm. Er ließ mich los, deutete mit dem Kopf nach rechts Richtung Getreidegasse und fragte:
»Sushi?«
Ich nickte, drehte mich um und folgte ihm. Er hatte eine kleine Flasche Wasser gekauft, die er im Gehen austrank und in den Mülleimer warf, und Kaugummi. Ich wunderte mich, was er vorgehabt hatte an diesem Samstagabend, ob er nicht nach Hause musste oder zu einer Veranstaltung. Ich wollte ihm viele Fragen stellen, mindestens sieben.
»Ich mag Sushi«, sagte ich.
Vor dem japanischen Restaurant Nagano angekommen, blieb er kurz stehen, reichte mir sehr förmlich die Hand und sagte:
»Ich heiße Günther.«
»Nathalie«, entgegnete ich und lächelte, als er einen altmodischen, aber charmanten Kuss auf meinen Handrücken andeutete. Es war ein ganz neues Körpergefühl, neben einem so großen Mann zu stehen. Ich messe gerade einmal 1,70 Meter, und ich ging beschwingter neben ihm, aufrechter.
Als wir vor unseren Bento-Boxen saßen, nahm Günther den gegrillten Lachs mit den Stäbchen und ließ mich kosten, er fütterte mich mit einer Selbstverständlichkeit, die in kürzester Zeit eine große Vertrautheit herstellte. Ich verzichtete darauf, ihm ebenfalls etwas von meinem Thunfisch zu reichen, zu kindlich erschien mir die Geste, wäre sie von meiner Seite gekommen.
Es erzeugte ein merkwürdig schiefes Gefühl in mir, dass wir nicht über Günthers Frau sprachen, mir war ein wenig schwindlig davon. Wir taten so, als wüssten wir nicht beide, was wir wussten, und das hatte einen ungekannten Reiz.
»Ich leite eine Eventagentur«, erklärte Günther, »zusammen mit einem Partner, wir haben neun Mitarbeiter. Wir organisieren Sport-Events, aber auch Konzerte, Happenings, Ausstellungen. Wir haben ein gutes Netzwerk in ganz Österreich, wir waren auch schon in der Schweiz und in Italien.«
Im Sushi-Lokal war es laut und warm, ich spürte, dass meine Wangen sich röteten. Ich trug dunkelblaue Jeans und einen hellbraunen Pullover, keine Halskette, nur die kleinen Perlenohrringe, kein Make-up außer Wimperntusche. Ich hätte mich an diesem Abend auf der Couch breitgemacht und durch das Programm gezappt, zwei dick belegte Käsebrote gegessen und ein paar Lebkuchen. Die Planänderung war mir willkommen wie ein Wetterumschwung zum Positiven, hatte sich doch in den letzten Wochen kaum etwas bewegt in meinem Leben.
Ich arbeitete seit einem halben Jahr in einer Salzburger Werbeagentur und hatte eine kleine Wohnung in der Steingasse gemietet, die, da mein fast siebzigjähriger Vermieter nicht gierig und außerdem meinem Charme erlegen war, nicht so teuer ist, wie man annehmen könnte. Sie ist 40 Quadratmeter groß und liegt mitten im Zentrum Salzburgs, sodass ich zu Fuß oder mit dem Rad alles erreichen kann, nur der Weg zur Arbeit ist recht weit. Deshalb hatte ich mir den roten Mini Cooper zugelegt, den ich in der Garage des Vermieters, der selbst kein Auto besaß, unterbringen durfte. Diese Notwendigkeit, damit zur Arbeit fahren zu müssen, war eigentlich eher eine unglaubwürdige Rechtfertigung für diese verrückte Anschaffung, denn wenige Gehminuten von meinem Zuhause entfernt befindet sich eine Bushaltestelle. Der Mini war mein Geheimnis, von dem weder meine beste Freundin Luise noch meine Mutter etwas ahnten, meine Mutter schon gar nicht, sie dachte, ich hätte die von der Großmutter geerbten 30.000 Euro gut angelegt.
»Ich habe mir vor zwei Wochen ein Auto gekauft. Es ist knallrot. Ein Mini Cooper.«
Günther nahm ein Lachs-Maki mit den Fingern, steckte es in den Mund.
»Sexy«, sagte er.
Seiner Stimme fehlte die Ironie, und sein Blick rutschte absichtlich zu meinem Ausschnitt. Ich strich in einer automatisierten Bewegung verlegen eine imaginäre Haarsträhne hinters Ohr.
»Er hat eine tolle Sonderausstattung«, sagte ich.
Günther betrachtete immer noch meinen Busen und nickte.
»Oh ja. Eine prächtige Sonderausstattung. Die würde ich gern mal aus der Nähe sehen.«
»Ich zeige sie dir«, sagte ich leise.
Ich stieg auf das Spiel ein und konnte ein Lachen kaum unterdrücken, es sprudelte in meinem Bauch. Weiter unten vibrierte die Aufregung, ich presste die Beine zusammen und drückte mich gegen die Tischkante.
»Mein Auto dagegen ist sehr groß«, sagte Günther und grinste, jeglicher Ernst war verflogen, aber die Erregung blieb. Er schob die Hand unter den Tisch und berührte mein Knie. Ein derart verrücktes und gleichzeitig anturnendes Gespräch hatte ich noch nie geführt.
»Ich mag große und wendige Autos«, antwortete ich, »wenn sie geschmeidig in der Kurve liegen. Und im entscheidenden Moment ordentlich Gas geben können.«
»Ich treibe den Motor immer bis zum Äußersten«, sagte Günther, »am liebsten auf einen Berg, immer höher …«
Und dann musste ich lachen, Günther stimmte ein, er griff nach meiner Hand, die Stimmung entspannte sich, ich fand ihn gut.
»Ich könnte mein Auto heute im Hotel Stein parken«, sagte Günther und hob fragend die Augenbrauen. Er hatte auffallend dunkle Wimpern und schmale Lippen, am Morgen hatte er sich nicht rasiert, ein Schatten lag auf seinen Wangen. Seine Hände waren weich, ich betrachtete sie, die Haut sehr gepflegt, die Fingernägel kurz geschnitten. Ich dachte an mein hellblaues Sofa und die Fleecedecke mit den grün-gelben Enten darauf, an meinen leeren Kühlschrank.
»Ich wohne gleich dahinter in der Steingasse«, sagte ich.
»Gehen wir zu mir«, hätte ich noch sagen können, aber ich traute mich nicht, es auszusprechen, und klar war es ohnehin. Günther zahlte und wir verließen das Restaurant, der Weg war nicht weit, acht Minuten nur, wir hielten uns die ganze Zeit an der Hand, obwohl es schneite und unsere Finger kalt wurden. Unten an der Haustür ließ ich Günther los, holte den Schlüssel aus meiner Tasche und rannte lachend die Treppe hinauf wie ein Kind, das sich fangen ließ.
»Ich krieg dich«, rief Günther, und als er mich einholte, war ich schon in der Wohnung, zog gerade die Schuhe aus und streifte den hellgrauen Wintermantel ab. Günther warf die Tür mit dem Fuß zu und drückte mich vor der Garderobe gegen die Wand, die Kleiderbügel stießen klimpernd aneinander, als wir uns zum ersten Mal küssten. Günthers Kinn kratzte, er schmeckte nach Lachs und Ingwer, die Aufregung wirbelte durch meinen Magen, ich fühlte mich ganz leicht. Seine Lippen waren kühl und weich, er küsste fordernd und spielerisch, biss in meine Unterlippe und dann in meinen Hals, wir standen eng aneinander gedrängt in meinem kleinen Flur. Günthers Haar roch nach Schnee, er schob die kalten Hände unter meinen Pullover.
»Ich finde dich so unsagbar geil«, flüsterte er und zog mir den Pullover über den Kopf, dann schlüpfte er aus seiner schwarzen Jacke.
»Als ich dich vorgestern zum ersten Mal gesehen habe in deinem Kleinmädchenkleid, wollte ich dich sofort flachlegen«, murmelte er, während ich den Gürtel seiner Hose öffnete. Als wir nackt waren, stellte ich ein Bein auf mein flaches Schuhregal, und wir liebten uns im Stehen, umgeben von meinen Jacken und Schals, die über unseren Köpfen hingen, ab und an fiel scheppernd ein Kleiderbügel zu Boden. Ich hatte noch nie mit einem Fremden geschlafen, keinen One-Night-Stand gehabt, mich niemandem hingegeben, den ich erst einmal zuvor gesehen hatte.
Ich genoss das Gefühl, zwischen Günther und der Wand eingepfercht zu sein, ich presste mich gegen ihn und stöhnte ihm vorsichtig ins Ohr. Das schien ihm zu gefallen, wir fanden trotz des Größenunterschieds einen gemeinsamen Rhythmus und ich war erstaunt, wie nass ich war. Das Schuhregal wackelte, ein paar Schuhe fielen heraus, das lenkte mich ab, ich sah kurz zu Boden. Einer meiner schwarzen High Heels mit den zwölf Zentimeter hohen Absätzen, die ich noch nie getragen hatte und vermutlich niemals anziehen würde, war auf Günthers Fuß gelandet, ich kickte ihn weg. Ich war mir meiner selbst sehr bewusst in diesem Moment, ich spürte meinen Körper, meine Gänsehaut, meine zitternden Finger, mein Rücken rieb am rauen Mauerwerk, und noch ehe ich mich richtig gehen lassen konnte, überrollen lassen von der Lust, war es auch schon vorbei. Günther umklammerte mich, Schweiß überzog seine Brust, er keuchte.
»Das war das Beste überhaupt«, sagte er, sank rücklings an die gegenüberliegende Wand und streifte das Kondom ab. Ich sah ihm dabei zu und wunderte mich, dass er überhaupt eines dabeigehabt hatte, leiser Zweifel über die Spontanität unserer Begegnung regte sich in mir. Günther hatte die Augen geschlossen, nackt stand er da und ließ sich betrachten, frei von Scham, und ich wanderte mit den Augen über seinen Körper, über die gekräuselten Brusthaare und den weichen Bauchansatz, sein Penis lugte frech aus dem Schamhaarnest heraus. Ich fröstelte und bückte mich nach meinem Pullover, unsicher, ob ich dieses sexuelle Abenteuer als befriedigend bewerten sollte oder nicht.
»Setz dich«, sagte Günther und schob mich auf das schmale Schuhregal, »und mach die Augen zu.«
Er drückte meine Beine auseinander, und während ich mit dem Gefühl, entblößt zu sein, rang und kurz davor war, mich zu genieren, legte er zwei Finger auf meine Klitoris, zwickte sie zusammen und streichelte sie dann in kreisenden Bewegungen. Ich hörte das Glitschen und lächelte entspannt, es kribbelte in meinen Zehen, an der Innenseite der Oberschenkel, an den Brustwarzen, auf den Wangen. Ich vergaß meine Zurückhaltung, Günther strich mit den Fingernägeln über meine Schamlippen, ich wand mich vor Genuss. Das Atmen fiel mir schwer, die Erregung schnürte mich ein wie ein wunderschönes Bustier mit zarten Spitzen. Günther zog mein Becken ein wenig zu sich, und etwas drang ohne Vorwarnung in meinen Po ein, langsam und elektrisierend. Ich riss erstaunt die Augen auf, und als ich sah, dass Günther mir den langen dünnen Absatz meines schwarzen Stilettos in den Arsch geschoben hatte, kam ich mit einer Heftigkeit, die mich laut aufschreien ließ.
Grinsend stellte Günther den Schuh auf den Boden, umfasste meine Brüste und küsste mich lange.
Später standen wir am Kühlschrank und tranken eiskalten Kirschsaft aus der Packung, ich trug Günthers Hemd und darunter nichts, wie ich es oft in Filmen gesehen hatte, es reichte kaum über meinen Hintern.
»Ich möchte eine Affäre mit dir haben«, sagte Günther und sah mir in die Augen.
Ich nickte, erhitzt noch und zufrieden.
Und mir war es recht, eine Geliebte zu sein, ich empfand eine solche Liaison als sehr vorteilhaft, gab sie mir doch ein garantiertes Recht auf Sex, ohne mir Verpflichtungen aufzuerlegen.
In den folgenden Monaten genoss ich meinen Status als heimliche Zweitfrau, ich musste nicht für Günther kochen, seine Socken nicht waschen und ihn nicht zu langweiligen Vorträgen begleiten, ich saß nie schweigsam beim Fernsehen neben ihm und bekam ihn nicht zu Gesicht, wenn er verrotzt und fiebrig im Bett lag. Ich konnte mir die Rosinen herauspicken, ich ließ mich zum Essen einladen und im Hotel verführen, ich zog mich schön an und vergaß den Alltag, ich konnte allein sein, wenn ich es wollte, und ich konnte mit jemandem schlafen, wenn mir danach war.
Das Arrangement war perfekt, und ich dachte nicht daran, mich schlecht zu fühlen oder mehr zu wollen. Ich war eine gute Geliebte, verschwiegen, weil ich Geheimnisse sammle, weil ich es mag, Wissen zu besitzen, das keiner mit mir teilt, das mir allein gehört. Und selbst als die Leidenschaft so unerwartet rasch nachließ, war es mir immer noch lieber, ab und an schlechten Sex zu haben als gar keinen. Als Geliebte musste ich mich nicht wie eine Freundin um jemanden kümmern, ich musste niemanden lieben, war aber trotzdem nicht einsam. Es hätte gut so weitergehen können, doch nach dem Abend mit dem Autounfall wusste ich, dass Günther mich nicht mehr mit seinem geheimen Prepaid-Handy anrufen würde. Genauso wenig wie ich ihn.
Tage wie dieser
Am Morgen weckt mich mein Handy, es liegt am Boden und piepst, abends habe ich meine Klamotten einfach fallengelassen und mich im Bett vergraben, erschöpft und genervt. Ein Blick auf meinen rostroten Vintage-Wecker zeigt, dass es kurz vor halb sieben und somit Zeit zum Aufstehen ist, weil ich autolos bin und mit dem Bus fahren muss. Eineinhalb Stunden hat der Abschleppdienst mich warten lassen, und als der Typ im Blaumann endlich da war, hat er sich lustig gemacht über meine Lage und mich mit den gierig zu Schlitzen verengten Augen ausgezogen. Den Minirock habe ich zum dritten Mal an diesem Abend verflucht. Er wollte eine Erklärung für den Unfall, die ich ihm verweigerte, ich murmelte Unverständliches und musste das Hysterische in meiner Stimme nicht spielen. Mein roter Mini ächzte anklagend, als er ans Abschleppseil gehängt und den Hügel hochgezogen wurde, ich stieg in die Fahrerkabine ein und ließ mich nach Kuchl fahren, in das Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, wo meine Mutter bereits, eine Zigarette rauchend, vor der Autowerkstatt wartete. Der Abschlepper berührte beim Gangschalten ständig meinen Oberschenkel mit seinen nikotingelben Fingern, ab und zu saugte er mit der Zunge an seinen Zähnen und machte schmatzende Geräusche. Ich beachtete ihn nicht und hielt den Blick stur nach vorn gerichtet, einmal aber schüttelte der Ekel mich, und ich bekam eine Gänsehaut, die ich bis zum Schlafengehen nicht mehr loswurde.
»Soll ich dich nachher nach Hause fahren?«, fragte der ungewaschene Kerl.
»Nein, danke, meine Mutter steht dort vorn. Wir stellen das Auto bei der Werkstatt ab, und sie bringt mich heim.«
»Hm«, knurrte er und sagte nichts mehr. Nachdem ich meine Mutter erwähnt hatte, hielt er seine Grapschfinger im Zaum. Eine gärende Übelkeit saß in meinem Bauch, ich hatte Lust, dem Drecksack zwei Finger ins Auge zu bohren. Er lud den Mini ab, und ich unterschrieb seine Protokolle. Wir verabschiedeten uns nicht.
Meine Mutter klemmte einen Zettel an den Scheibenwischer, mit der vorher aufgeschriebenen Bitte an den Werkstattbesitzer, den Schaden zu überprüfen und sich bei mir zu melden. Kuchl ist eine kleine Gemeinde, in der man sich kennt, den Schlüssel legte ich auf den linken Vorderreifen. Meine Mutter rieb mir kurz über beide Oberarme, was für sie einer Umarmung gleichkam, und sagte dann verärgert:
»Erzähl mir nichts, das Auto hast du doch nicht gebraucht bekommen. Der Mini ist nagelneu und scheißteuer.«
Ich trottete zu ihrem grauen Peugeot und stieg ein. Geschätzte 20 Kilometer und somit 20 Minuten hatte meine Mutter dann Zeit, auf ihre direkte Art ihre Meinung kundzutun. Es war schon beinahe Mitternacht, ich lehnte mich im Autositz zurück und hielt die Augen geschlossen.
»Schäm dich«, sagte meine Mutter, »du alte Geheimniskrämerin. Lässt mich glauben, du hättest das Geld auf ein Sparbuch gelegt. Ich hätte es dir nicht geben sollen! Du weißt doch nicht, was kommt, das wäre ein gutes Polster gewesen. Für die Zukunft. Denkst du mal daran? Ich kann dir nicht viel geben, das weißt du, nur das Haus hab ich, aber wenn ich einmal nicht mehr …«
»Mama«, warf ich ein.
»So hat sich die Oma das sicher nicht vorgestellt.«
»Weißt du’s? Der Mini hätte ihr bestimmt gefallen. Ich mag nicht streiten, Mama. Es tut mir leid, dass ich’s dir verschwiegen hab.«
Meine Mutter blieb stumm, ich betrachtete sie von der Seite. Im vorbeiflirrenden künstlichen Licht der orangefarbenen Straßenlaternen konnte man ihr Alter erkennen, ihre Lippen waren von vielen kleinen Falten umzingelt, die vom Rauchen kamen, und über ihrer Nase saß eine kleine Kerbe, die von all den skeptischen Blicken geblieben war. 45 Jahre zählte meine Mutter erst, nur vereinzelt blinzelten graue Strähnen aus ihren glatten braunen Haaren, die Augen kniff sie ein wenig zusammen, sie konnte beim Autofahren in der Nacht nicht so gut sehen.
»Danke, dass du mich nach Hause fährst«, sagte ich und legte die kalten Finger auf meine pochende Nase.
»Tut dir was weh?«
»Der Kopf. Das Herz vielleicht auch ein bisschen.«
»Ach«, meinte meine Mutter nur.
Von Herzschmerz hielt sie wenig, vom Verliebtsein auch nichts, sie hatte, so schien es mir, jeden Gedanken daran mit großem Kraftaufwand verscheucht, seit mein Vater vor 25 Jahren gegangen und nicht mehr wiedergekommen war. Das war passenderweise kurz vor meiner Geburt geschehen, zumindest glaube ich das, denn gesprochen wird darüber nicht, meine Mutter hat dazu nie eine Erklärung abgegeben, die Oma auch nicht.
Nur Frauen gab es in unserem Haus, denn mein Opa starb, als ich vier war, überfahren nach einer Sauftour, weil er betrunken mitten auf der Straße ging. Sie ließen nie ein gutes Haar an ihm, meine Oma und meine Mutter, aber sie redeten wenigstens über ihn, während es so wirkte, als sei ich ohne die Beteiligung eines Mannes auf die Welt gekommen, wie Jesus. Von den Nachbarn wäre vielleicht etwas zu erfahren gewesen, aber sie tratschten nur außerhalb meiner Hörweite, da konnte ich die Ohren spitzen, so viel ich wollte, und irgendwann gab ich es auf. Männer waren nicht erwünscht in unserem Haus, unabhängig sollte ich werden, nicht angewiesen auf irgendwen. Meine Mutter hat mich deshalb stets in allem unterstützt, hat mir beigebracht, einen Schrank aufzubauen und eine Lampe anzuschließen, hat mich mitgenommen zum Gokartfahren und mir das Studium finanziert. Sie legte großen Wert auf das Praktische, als seien nur jene Dinge verlässlich, die man selbst mit den Händen zusammengeschraubt hatte.
Wir haben lange Zeit zu dritt gelebt, im Tagesablauf eng miteinander verbunden, mit der Oma unter dem Dach, sodass wir uns, seit ich vor zwei Jahren ausgezogen bin, beide ein wenig verloren fühlen. Miteinander zu reden, ist auf einmal schwierig geworden, die räumliche Distanz schafft viel Platz für Missverständnisse, unsere Sätze greifen nicht mehr ineinander wie flott rotierende Zahnräder.
»Ich weiß, das war dumm von mir, Mama«, sagte ich beim Aussteigen.
»Kommst du am Sonntag?«, fragte meine Mutter durch das offene Seitenfenster.
»Ja«, nickte ich, »ich fahre mit dem Zug.«
Zu Hause putzte ich mir noch die Zähne und wusch die Blut-spuren von meinem Kinn, schminkte mich aber nicht ab. Schon im Bett liegend, tippte ich noch eine SMS an Luise: Mit Gü ist es aus. Er ist ein 1,90 Meter großer Arsch. Das Handy warf ich auf den Kleiderhaufen am Boden und ließ mich vom Schlaf mitreißen in ein Abenteuer, das wir beide am Morgen vergessen haben würden.
Das Handy piepst erneut, ich schrecke hoch, es ist zwanzig nach sieben. Hastig setze ich mich auf und werde von einem schmerzhaften Knirschen im Kopf begrüßt, meine Nase tut weh, auf meiner Lippe schmecke ich erneut Blut. Ich muss den Bus in 25 Minuten erwischen, damit ich wenigstens um zwanzig vor neun in der Agentur bin, viel zu spät eigentlich, normalerweise beginne ich um acht, um abends nicht gar so viele Überstunden machen zu müssen. Es gehört in Werbeagenturen ja meist zum guten Ton, das Büro nicht vor neun Uhr abends zu verlassen. Als ich meine Nase abtaste, schießen mir Tränen in die Augen, ich habe entsetzlichen Durst und möchte mich zurück auf die Kissen legen, noch einmal in den Schlaf sinken und nicht an Günther denken. Seufzend stolpere ich ins Bad, trinke Wasser aus dem Hahn und betrachte dann im Spiegel das Übel, das aus einer Beule auf der Stirn und zwei Schnitten quer über die Unterlippe besteht, deren Ursprung mir ein Rätsel ist. Die Nase schmerzt, sieht aber nicht geschwollen aus.
Erleichtert ziehe ich meine Kleider vom Vortag wieder an, allerdings nicht den Minirock vom Abend, ich sollte ihn wegwerfen, sondern die schmale schwarze Hose und das dunkelgrüne Oberteil mit der kleinen roten Masche auf der rechten Schulter. Natürlich werden sie es merken, die Modefreaks in der Agentur, Ines vor allem, aber ich habe keine Zeit, mir ein neues Outfit rauszusuchen. Kaffee kann ich mir auch keinen machen, sehnsüchtig betrachte ich die kleine graue Nespresso Citiz, die ich mir von meiner Mutter zum 25. Geburtstag gewünscht habe und derentwegen ich morgens für gewöhnlich zehn Minuten früher aufstehe, damit wir uns einander in Ruhe widmen können, sie, ich und die Arpeggio-Kapseln.