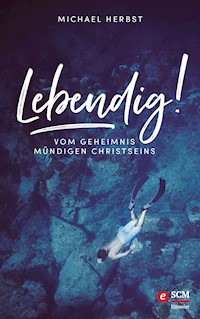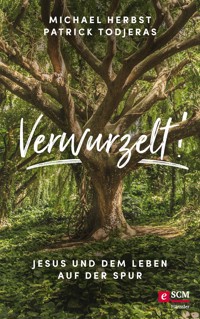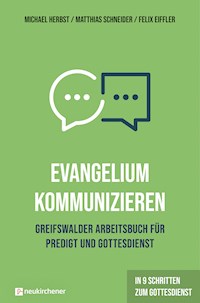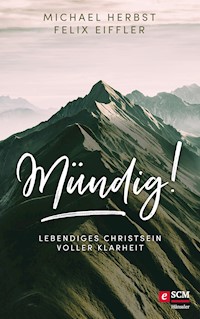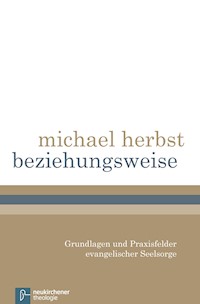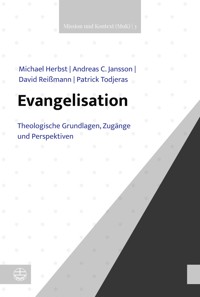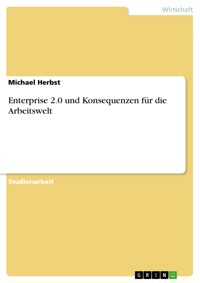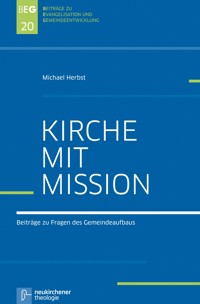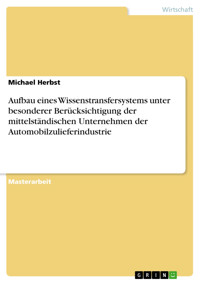
Aufbau eines Wissenstransfersystems unter besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Unternehmen der Automobilzulieferindustrie E-Book
Michael Herbst
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Führung und Personal - Sonstiges, Note: 2,0, Wissenschaftliche Hochschule Lahr, Sprache: Deutsch, Abstract: Globalisierung ist heute als Begriff und fortschreitender Prozess aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Für viele Wirtschaftsunternehmen bedeutet dies jedoch, dass sie zunehmend neuen Kräften und Erwartungen ausgesetzt sind. Neben der Verschärfung des Wettbewerbs stehen Kundenerwartungen, die zur Innovation zwingen, und hohe Kapitalgebererwartungen vermehrt im Vordergrund. Dies alles schafft ein Umfeld, in dem es für Unternehmen und deren Mitarbeiter immer schwerer wird, relevantes Wissen zu bündeln und dieses nachhaltig zu transferieren. Wissen wird somit zur strategischen Ressource, die es Unternehmen ermöglicht, sich nachhaltig von Konkurrenten zu differenzieren und dadurch Wettbewerbsvorteile aufzubauen. Von den dargestellten Rahmenbedingungen sind vor allem die Hersteller und Zulieferer der Automobilindustrie und der Mittelstand betroffen. Obwohl Wissen bereits frühzeitig als entscheidende Ressource unserer Wirtschaft erkannt wurde , ist ein systematischer und effektiver Umgang damit noch längst keine Selbstverständlichkeit. Beispiele aus der mittelständischen Automobilzulieferindustrie sollen dies verdeutlichen. Während der Einsatz von Wissensmanagement bei den Fahrzeugherstellern (sog. OEMs) bereits weitläufig dokumentiert ist, sehen Zulieferbetriebe nur zögerlich die Notwendigkeit von Wissensmanagement: knappe zeitliche und finanzielle Kapazitäten führen besonders bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) dazu, dass diese eine Beschäftigung mit dem Thema „Wissensmanagement“ scheuen. Den Entscheidungsträgern der Unternehmen mangelt es zudem oftmals an einem klaren Überblick über das vorhandene Wissen und der Kenntnis über Möglichkeiten und Einflussfaktoren des Wissenstransfers. Darüber hinaus bereitet die praktische Implementierung von Wissensmanagement im Unternehmen Probleme. Bei der Frage, welche Art von Wissensmanagement für das eigene Unternehmen relevant ist, stoßen besonders KMU schnell an ihre Grenzen, da häufig keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung stehen, um sich mit dem komplexen Themenfeld Wissensmanagement auseinander zu setzen. Der vorliegenden Arbeit sollen diese aufgezeigten Problemfelder – insbesondere im Bereich der KMUs – als Ansatzpunkt dienen. Eines der primären Ziele der Arbeit ist es, mittelständischen Automobilzulieferern die wirtschaftliche Bedeutung von WM im Allgemeinen, sowie den Wert von Wissenstransfer – als Baustein des Wissensmanagements – aufzuzeigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Page 1
Masterthesis - Fachgebiet Personalmanagement und Organisation
Studiengang: Master-Management (M.A.)
Aufbau eines Wissenstransfersystems unter besonderer
Berücksichtigung der mittelständischen Unternehmen der
Automobilzulieferindustrie
Michael Herbst
Vorgelegt am:
18. April 2011
Page 3
Page 6
Abkürzungsverzeichnis
Abb. Abbildung
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
BRIC
BITKOM
CEN/ISSS
CRM
CoP
et al. und andere
f. folgende
ff. fortfolgende
F&E Forschung und Entwicklung
FMEA
IAO Institut für Arbeitswissenschaft und Organisation, Stuttgart
Kap. Kapitel
KM Knowledge Management
KMU kleine und mittelständische Unternehmen.
NAFTA
o. ä. oder ähnliche
OEM
sog. sogenannte
u. a. unter anderem
VDA Verband der Automobilindustrie
WM Wissensmanagement
WT Wissenstransfer
www World Wide Web
z. B. zum Beispiel
Page 7
Page 8
Abb. 5.9: Implizites/explizites Wissen im untersuchten Unternehmen
(eigene Darstellung) 67
Abb. 5.10: Potenzial durch Wissenszusammenlegung im untersuchten
Unternehmen (eigene Darstellung) 67
Abb. 5.11: Kenntnisse über Wissenstransfermethoden und deren
Abb. 5.12: Kulturfaktorpotenzial im untersuchten Unternehmen (eigene
Darstellung) 70
Abb. 5.13: Unternehmenskulturelemente im untersuchten Unternehmen
(eigene Darstellung) 71
Abb. 5.14: Führungsverhalten im untersuchten Unternehmen (eigene
Darstellung) 72
Abb. 6.1: Der idealtypische Prozess des Wissenstransfers. Eigene Dar-
Page 9
Tabellenverzeichnis
Tab. 2.1:
Tab. 2.2:
Tab. 2.3: Wissensprobleme von KMU (eigene Darstellung) 23
Tab. 3.1:
Tab. 3.2:
Tab. 3.3:
Tab. 3.4: Anwendbarkeit der Wissenstransfermethoden zur
Problemlösung (eigene Darstellung) 39
Tab. 3.5:
Tab. 5.1: Bedeutung von Wissen je Wissensdomäne (eigene Darstellung) 60
Tab. 5.2:
Tab. 5.3:
Tab. 5.4: Barrieren des Wissenstransfers im untersuchten Unternehmen
(eigene Darstellung) 62
Tab. 5.5:
Tab. 5.6: Unternehmenskultur im untersuchten Unternehmen
(eigene Darstellung) 63
Tab. 5.7:
Tab. 5.8:
Tab. 5.9:
Page 10
1. Einleitung: Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Globalisierung ist heute als Begriff und fortschreitender Prozess aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Für viele
Wirtschaftsunternehmen bedeutet dies jedoch, dass sie zunehmend neuen
Kräften und Erwartungen ausgesetzt sind.2Neben der Verschärfung des Wettbewerbs stehen Kundenerwartungen, die zur Innovation zwingen,
und hohe Kapitalgebererwartungen vermehrt im Vordergrund.3
Dies alles schafft ein Umfeld, in dem es für Unternehmen und deren Mitarbeiter immer schwerer, aber auch immer wichtiger wird, relevantes Wissen zu bündeln und dieses nachhaltig zu transferieren.4Wissen wird somit zur strategischen Ressource, die es Unternehmen ermöglicht, sich nachhaltig von Konkurrenten zu differenzieren und dadurch Wettbewerbsvorteile aufzubauen.
Von den dargestellten Rahmenbedingungen sind vor allem die Hersteller und Zulieferer der Automobilindustrie, die als Schlüsselbranche unseres
Wirtschaftssystems gelten5, und im Besonderen der Mittelstand, der mit seiner Innovationskraft das„Rückgrat der deutschen Wirtschaft“bildet6, betroffen.7
ObwohlWissenbereits frühzeitig als entscheidende Ressource unserer
Wirtschaft erkannt wurde8, ist ein systematischer und effektiver Umgang
1Vgl. Yuva (2002).
2Durch den Wettbewerb mit sog. Niedriglohnländern, vgl. BMWi (2007), S.1.
3Vgl. Europäische Kommission (2005), S.5.
4LautBMWi (2010)wird das im Unternehmen vorhandene Wissen zum
zentralen Entscheidungsträger der Unternehmen. Vgl. auch North (2005), S. 7ff.
4Vgl. VDA (2010), S.16.
5Vgl. VDA (2010), S.16.
6BMWi (2007), S. 1.
7Vgl. Reichhuber (2010), S.2, 23.
8Vgl. Drucker (1992).
Page 11
damit noch längst keine Selbstverständlichkeit. Beispiele aus der mittelständischen Automobilzulieferindustrie sollen dies verdeutlichen: Wenn Kundenwissen, das beim Kundenkontakt gebündelt benötigt wird,
nur „verzettelt“ vorliegt9, wenn Projektwissen nicht konsequent in Neuprojekte transferiert wird10oder aber wenn erfahrene Mitarbeiter aus dem Unternehmen ausscheiden, ohne dass deren Wissen rechtzeitig
weitergegeben wurde11, geht Wissen verloren oder bleibt ungenutzt. Während der Einsatz vonWissensmanagement(im nachfolgendenden als WM abgekürzt) bei den Fahrzeugherstellern (sog. OEMs) bereits weitläufig dokumentiert ist, sehen Zulieferbetriebe nur zögerlich die Notwendigkeit von WM: knappe zeitliche und finanzielle Kapazitäten führen besonders bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)
12dazu, dass diese eine Beschäftigung mit dem Thema
„Wissensmanagement“ scheuen.13Den Entscheidungsträgern der Unternehmen mangelt es zudem oftmals an einem klaren Überblick über das vorhandene Wissen und der Kenntnis über Möglichkeiten und Einflussfaktoren des Wissenstransfers.14
Darüber hinaus bereitet die praktische Implementierung von Wissensmanagement im Unternehmen Probleme. Bei der Frage, welche Art von Wissensmanagement für das eigene Unternehmen relevant ist, stoßen besonders KMU schnell an ihre Grenzen, da häufig keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung stehen, um sich mit dem
komplexen Themenfeld Wissensmanagement auseinander zu setzen.15
Der vorliegenden Arbeit sollen diese aufgezeigten Problemfelder-insbesondereim Bereich der KMUs-als Ansatzpunkt dienen. Eines der
9Beispiel Auto GmbH, Vgl. Staiger (2008), S. 220ff.
10Beispiel B&W Fahrzeugentwicklung, vgl. BMWi (2007), S.38+39.
11Hierbei spricht man von mangelndem „Knowledge Retention“, vgl. o.V. (2011).12Der Begriff der „kleinen und mittelständischen Unternehmen“ (KMU) wird in
Deutschland meist synonym mit „mittelständischen Unternehmen“ verwendet.Im Rahmen dieser Arbeit sollen die Begriffe bedeutungsgleich verstanden werden. Im internationalen Sprachgebrauch existiert hingegen keinentsprechendes Wort für „mittelständisch“. Im Englischen wirddaher meist von„Small and Mid-sized Enterprises“ oder „Small and Medium-sizes Enterprises“, kurz „SME“ gesprochen. Vgl. Europäische Kommission (2005).
13Vgl. BMWi (2007), S.1.
14Vgl. Staiger (2008), S.220 oder auch North (2005), S. 201ff.
15Vgl. VDA (2010), S.51.
Page 12
primären Ziele der Arbeit ist es, mittelständischen Automobilzulieferern die wirtschaftliche Bedeutung von WM im Allgemeinen, sowie den Wert
von Wissenstransfer-als Baustein des Wissensmanagements16-aufzuzeigen.17Inden folgenden Abschnitten werden die Ziele der Arbeit genauer erläutert:
1.Übergeordnetes Zielist es, ein mögliches Handlungskonzept für den Umgang mit Wissensproblemen innerhalb eines KMUs zu generieren sowie Ansatzpunkte herauszuarbeiten, anhand derer die Entwicklung und der Aufbau eines Wissenstransfersystems für mittelständische Zulieferunternehmen der Automobilindustrie ermöglicht werden.
2.Inhaltliches Zielist es, durch die Ausarbeitung theoretischer Erkenntnisse die Vorteile des Wissenstransfers herauszustellen, dessen Einflussfaktoren einschließlich Barrieren und Risiken zu identifizieren, um schließlich konkrete Handlungsempfehlungen für den Einsatz und Aufbau von Wissenstransfersystemen in einem KMU/Automobilzulieferunternehmen geben zu können. Der Wissenstransfer kann so einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen Unternehmen der Automobilzulieferindustrie leisten.
Aus den zuvor dargestellten Problemfeldern und Rahmenbedingungen für das heutige Wirtschaftsleben sind die nachfolgenden Fragestellungen entstanden, die den thematischen Bezugsrahmen für diese Arbeit ergeben:
Hauptforschungsfrage
Welche Wissensprobleme ergeben sich in Unternehmen allgemein, für Unternehmen der mittelständischen Automobilzulieferindustrie im Besonderen und kann der Aufbau eines Wissenstransfersystems mit seinen Methoden einen Beitrag zur Problemlösung bzw. zur
Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen leisten?18
16Vgl. Probst et al. (2006), S.32, siehe Erläuterung in Kap. 3.2.
17Vgl. Zitat vonYuvaauf S.1 oben.
18Der Wissenstransfer bezieht sich dabei ausschließlich auf den unternehmensinternen Wissenstransfer.
Page 13
Nebenforschungsfragen
- Welchen konkreten Einflussfaktoren, unter denen KMU leiden, lassen sich identifizieren und welche möglichen Problemlösungen sind daraus ableitbar?
- Die in der Literatur vorhandenen Erkenntnisse über Methoden und Konzepte beziehen sich überwiegend auf Großunternehmen. Sie unterstellen per se die Übertragbarkeit auf KMU, ohne die spezifischen Gegebenheiten angemessen zu berücksichtigen. Die Praxistauglichkeit der verschiedenen Wissensmanagement-Ansätze im Hinblick auf KMU ist weitestgehend unerforscht. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Methoden und Formen des Wissenstransfers es gibt und welche davon für KMU relevant sind.
Wissenschaftstheoretische Einordnung
Die Arbeit lehnt sich an verschiedene wissenschaftliche Positionen an. Neben einer deduktiven Vorgehensweise hat die Arbeit auch einen induktiven Teil, mit dem Schwerpunkt der Prüfung einer in Kapitel 2 theoriebasiert entwickelte Hypothese. Dabei wird mit der Untersuchung auch die Identifikation von Ansätzen zur Ableitung weiterer Hypothesen
angestrebt. Diejenigen Hypothesen, die den empirischen Test bestehen19, bilden die Ausgangsbasis für die Ableitung konkreter Handlungs- und Gestaltungsempfehlungen.
Forschungsmethodik
Bei allen Vorüberlegungen zu einer angemessenen wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Thematik Wissensmanagement und Wissenstransfer wurde deutlich, dass das Wissensmanagement ein stark praxisrelevantes Thema ist. Bei der Festlegung der Untersuchung wurde eine Kombination aus verschiedenen Forschungsmethoden herangezogen. Die nachfolgende Abbildung 1.1 zeigt den forschungslogischen Zusammenhang der Arbeit.
19In Abhängigkeit der Erfüllung der Gütemaße wie bspw. des Signifikanzniveaus. Vgl. Schnell et al.(2008), S.447f.
Page 14
Abb. 1.1: Forschungslogischer Aufbau der vorliegenden Arbeit. Eigene Darstellung.
Vorgehensweise
Nachstehend wird die gewählte Vorgehensweise zur Realisierung der angestrebten Ziele beschrieben. Kapitel 2 analysiert die für das Untersuchungsgebiet relevante Fachliteratur im Kontext der Branche und der KMU. Es wird erarbeitet, welche Bedeutung der Faktor Wissen im Allgemeinen und für die Automobilindustrie im Besonderen hat und worin die Probleme im Umgang damit bestehen, speziell unter Berücksichtigung der Unternehmensgröße, die hier überwiegend vorzufinden ist. Das Kapitel endet mit der Ableitung der Hypothese.
Kapitel 3 erarbeitet die Aufgaben und den Aufbau eines organisationalen Wissensmanagementsystems und konzentriert sich dabei auf den Baustein des Wissenstransfers. Zunächst werden Formen und Ansätze
Page 15
des Wissenstransfers erarbeitet und anschließend wird auf Methoden des Wissenstransfers eingegangen. Das Kapitel endet mit der Betrachtung von Barrieren, die sich im Unternehmen gegenüber Wissensmanagement und Wissenstransfer aufbauen können. Diese stellen einen wichtigen Einflussfaktor für den Aufbau des Wissenstransfersystems dar.
Aus der Analyse werden am Beispiel eines mittelständischen Zulieferunternehmens der Automobilindustrie Fragen für eine empirische Fallstudie abgeleitet, die die Relevanz der erarbeiteten wissenschafts-theoretischen Erkenntnisse prüft (Kapitel 4).
Im nachfolgenden Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Fallstudie deskriptiv, quantitativ, qualitativ und schließlich aus einer Kombination der verschiedenen Analysen ausgewertet. Die Daten dienen der Verifizierung oder Falsifizierung der Hypothesen.
Basierend auf den Erkenntnissen werden schließlich in Kapitel 6 Empfehlungen für Wissenstransfer als solchen bzw. für die Gestaltung des Aufbaus eines Wissenstransfersystems gegeben.
Die Arbeit schließt in Kapitel 7 mit der Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse sowie mit der kritischen Würdigung und einer Ableitung von zukünftigem Forschungsbedarf ab.
Page 16
2. Wissen in der Automobilindustrie
Um die Voraussetzung für die empirische Untersuchung und die abzuleitenden Gestaltungsempfehlungen zu schaffen ist es notwendig, die relevanten Begrifflichkeiten näher zu bestimmen. Dazu werden zunächst die BegriffeWissenundWissensmanagementerörtert.Bahrsbeschreibt Wissen als„Basis jeglichen betrieblichen Handelns und Entscheidens, dessen Vorhandensein sowie dessen Art und Qualität maßgeblich über das Prozessergebnis und den Prozessverlauf entscheiden“20. Dieser Einfluss auf die Effizienz und Wirksamkeit der (Wissens-) Prozesse sollte in einem sog.Wissensmanagementoptimiert werden21, worunterBahrsdie„Gestaltung der Informationsversorgung und der Entwicklung bzw. Beschaffung, Verteilung22und Nutzung von Wissen“versteht,„mit dem Ziel dieses für die Entwicklung von
Wettbewerbsvorteilen im Unternehmen einzusetzen“.23