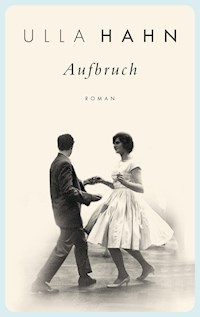Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2009 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Hafen Werbeagentur, Hamburg
Covermotiv: © ullstein bild - Oscar Poss; © Mark Owen - Trevillion Images
Typografie und Satz: DVA /Brigitte Müller
ISBN : 978-3-641-02998-2
V003
www.dva.de
www.randomhouse.de
»… Genk âne wek »… Geh ohne Weg den smalen stek …« den schmalen Steg …«
VOLKSLIED AUS DEM 14. JAHRHUNDERT MEISTER ECKHART ZUGESCHRIEBEN
»Schreibe, was du siehst und hörst!«
SCIVIAS VON HILDEGARD VON BINGEN
LOMMER JONN, hatte der Großvater gesagt, lasst uns gehen!, in die Luft gegriffen und sie zwischen den Fingern gerieben. War sie schon dick genug zum Säen, dünn genug zum Ernten?
Wie freudig war ich ihm alle Mal gefolgt, das Weidenkörbchen mit den Hasenbroten in der einen, den Bruder an der anderen Hand. Aus dem kleinen Haus in der Altstraße 2, wo die Großmutter regierte und der liebe Gott, der Vater op de Fabrik ging und die Mutter putzen, zogen wir vorbei an Rathaus, Schinderturm, Kirchberg, durch Rüben-, Kohl- und Porreefelder an den Rhein, ans Wasser. Dorthin, wo keine Großmutter Gott und Teufel beschwor, kein Vater drohte, keine Mutter knurrte, wo ich mich losriss von der Hand des Großvaters und loslief, auf und davon und weit hinein ins Leben, durch Kindergarten und Volksschule, Mittelschule und erste Liebe, eine Lehrstelle auf der Pappenfabrik, die Flucht in den Alkohol und die Erlösung daraus. War Beichtkind, Kommunionkind, Firmling gewesen, hatte mich von Hildegard in Hilla umgetauft, mir das schöne Sprechen beigebracht, das Essen mit Messer und Gabel.
Lommer jonn, hätte der Großvater an einem Tag wie heute gesagt, frostklare Sonne, ein krisper Wind, ventus, venti, masculinum, ich hatte die Zeit seit der Kündigung meiner Lehrstelle genutzt, carpe diem, hatte mein Pensum intus, mit der Sprache, der lingua Gottes, auf tu und du. Ich hatte die Prüfung bestanden. Das Aufbaugymnasium erwartete mich. Das Wilhelm-von-Humboldt-Aufbaugymnasium.
Lommer jonn, hätte er gesagt, und ich wickelte mich in Mütze und Schal, machte mich auf, an den Rhein, ans Wasser, dorthin, wo die Wellen mir mein erstes Buch vor die Füße gespült hatten, einen weißen, von grauen und schwarzen Linien geäderten Kiesel. Der Stein ist beschrieben!, hatte das kleine Mädchen gejauchzt. Beinah wie das Schreibheft der Cousinen, die Zeilen im Märchenbuch der Schwester im Kindergarten.
Ich zog die Mütze fester über die Ohren. »Verjess de Heische1 nit!«, rief mir die Mutter nach, »komm nit ze spät noh Huus, denk an morjen!« Hinter mir fiel das Gartentor ins Schloss, ich vergrub die Hände in den Manteltaschen. Da war er, der Stein, den der Großvater lange in der Hand gewogen hatte, da waren sie wieder, seine lieben Großvateraugen, die nachdenklich abwechselnd mich, dann den Stein betrachtet hatten. Und da war sein warmes, dunkles Großvaterbrummen, das sich so friedfertig abhob von den schrillen Stimmen der Mutter, der Großmutter, den knappen, widerwilligen Sätzen des Vaters.
Es gab einmal, hatte der Großvater damals erklärt, einen Stein, der alles verwandelt. Er leuchtete im Dunkeln und im Hellen. Als er aber auf die Erde gefallen sei, vor vielen Millionen Jahren, gleich nachdem Gott Himmel und Erde erschaffen habe, seien tausend und abertausend Steinchen abgesplittert und hätten sich über unsere Welt verstreut. Sie alle enthielten nun winzige Bruchteile dieses Himmelssteins. Dies seien die Buchsteine, de Boochsteen. Wer diese Splitter finde, sei selbst ein Licht und leuchte in der Welt. Sei gut und schön und ein Mensch, den alle lieben. Schon das kleinste Teilchen des Steins mache die Menschen selber gut und schön.
Ich rollte den Stein in meiner Handfläche. Die Geschichte vom Pückelsche stand da noch immer. Pückelsche, hatte der Großvater uns aus dem Buchstein vorgelesen, ein kleiner Junge, aus dessen Buckel sich Flügel entfalteten, wann immer es nottat. Kälte spannte meine Lippen, die sich zu einem Lächeln verzogen und den Großvater grüßten, aber auch die kleine Hildegard, das kleine Mädchen, das ich einmal gewesen war. Ich ballte die Faust um den Stein. Unermüdlich hatte ich damals mit dem Bruder Buchsteine gesammelt, ihm aus den Steinen die Welt erklärt; das Geheimnis von Großvaters Wutstein verraten. Hatte man sich über einen Menschen so richtig geärgert, konnte sich aber nicht wehren, musste man nur einen dunklen, dreckigen Stein in die Hand nehmen, ihn ansehen und an nichts anderes denken als an den Bösewicht und die eigene Wut. So lange, bis das fiese Gesicht aus dem Stein heraufstieg. Dann weg damit, in den Rhein. Mit sich herumschleppen durfte man Wutsteine nie, sie gehörten ins Wasser.
Wie viele Steine hatte ich seither aufgelesen, immer neue Gesichter im Wutstein ertränkt. Dass ich mehr als einmal dem Stein mitten ins Gesicht gespuckt hatte, erlebte der Großvater nicht mehr. Auch nicht, dass ich vor noch gar nicht langer Zeit einen letzten Wutstein zusammen mit den letzten Fläschchen Underberg und einer Flasche Schnaps versenkt hatte. Kurz nach Beginn meines ersten Schuljahrs auf der Realschule war der Großvater gestorben.
Vorbei an Rathaus und Gänsemännchenbrunnen ging ich die Dorfstraße hinauf. In den Vorgärten krümmten sich schwarzgefrorene Stauden. Nadelnde Tannenbäume, im ärmlichen Schmuck vergessener Lamettafäden, warteten auf die Müllabfuhr. Dreikönigstag war vorüber; unser Baum schon zu Brennholz zerhackt. Die Straße lag winterstill, der Asphalt hie und da gerissen vom Frost. Nur ein paar Frauen, vermummt in Mützen, Schals und Tücher, huschten aus Metzger- und Bäckerläden nach Hause. Morgen, hätte ich ihnen am liebsten entgegengeschrien, geht das Leben weiter, vorbei die Zeit von Debit und Kredit, vorbei die Ohnmacht des Industriekaufmannsgehilfenlehrlings Hilla Palm vor Stenographie und Schreibmaschine, die Kapitulation vor Soll und Haben. Ich fühlte mich leicht, frei, freigekämpft. Industriekaufmannsgehilfenlehrling – welch ein Ungetüm von Wort, genau passend für das, was sich dahinter verborgen hatte; die bösartige Herrschaft meiner Lehrherrin, die schweißlauen Finger des Prokuristen, meine Flucht in den Alkohol.
Mehr als einen Stein hatte ich für alle gefunden, die mir das Leben schwergemacht hatten, und auch mein Underberg-Gesicht lag auf dem Grunde des Rheins. Für immer. Das hatte ich Rosenbaum geschworen. Und mir.
Rosenbaum, Biologielehrer an der Realschule. Einer meiner Schutzengel. Wie Pastor Kreuzkamp, der mich mit meiner Liebe zum schwarzen Fritz, einer Negerpuppe, vor Eltern und Großmutter in Schutz genommen hatte. Wie die Kinderschwester Aniana, die nicht müde geworden war, der Mutter von meinem reinen Herzen zu erzählen. Wie Lehrer Mohren mit seinem »Steh auf«, als ich nicht aufstand mit denen, die auf Gymnasien und Realschule gehen wollten. Und Friedel, die mir siebzehn alte Brockhausbände geschenkt hatte. Sie alle hatten bei mir einen Stein auf dem Brett, hinter den Büchern versteckt; auf dem Regal in meiner Zuflucht, dem Holzstall, meinem eigenen Reich. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Bücherbrett.
Dem I-Dötzchen Hildegard hatte der Großvater einen Stein geschenkt, darauf mit goldenen Lettern ihr Name. Genauso hatte ich jedem meiner Schutzengel ein Denkmal auf Stein geschrieben.
Der Schindertum lag schon hinter mir, vor mir der Turm der Georgskirche, ein gedrungenes Rechteck, nach dem Krieg nicht wieder zu schlanker Höhe aufgebaut. Kreuzkamp, Mohren, Rosenbaum: Ohne sie liefe ich heute nicht hier durch die Straßen, säße vielmehr bei Steno und Schreibmaschine in einem vollgequalmten Büro. Gemeinsam waren der Pastor und die beiden Lehrer – wie die Heiligen Drei Könige, hatte der Bruder gespottet – in der Altstraße aufgetaucht. Ihrer Übermacht war der Vater, war sein Nein zum Gymnasium für ein Mädchen, nicht gewachsen. Wie verloren hatte er am Ende den dreien gegenübergesessen.
Mit kurzen, schnellen Schritten kam ich rasch vorwärts, die Eisen, vom Vater unter die Sohlen geschlagen, klapperten wie aufgeregte Ponyhufe auf das steinerne Pflaster. Ganz so war ich vor Jahren an einem eisigen Tag wie diesem an den Rhein gerannt, Sigismund entgegen. Eisschollen knirschten, als wir im ersten Kuss zusammenfroren. Sommermöwen kreischten, als ich sein Gesicht mit den kleinen roten Ohren in unzähligen Wutsteinen versenkte. Die Tochter des Fabrikbesitzers Maternus, für den ich in den Schulferien Pillen packte, passte wohl besser zum Sohn des höheren Angestellten als die Tochter vom Hilfsarbeiter Palm.
Nie wieder verliebt, hatte ich mir damals geschworen, froh, »mein Kapital«, wie Mutter, Tante und Cousinen den Zustand jungfräulicher Unversehrtheit nannten, nicht an einen Unwürdigen verschleudert zu haben. »Dat is ding Kapital« – und das sollte es auch bleiben. »Mir han nix zu verschenke.«
Vom Kirchturm schlug es zweimal. Halb drei, die Sonne sank früh. Über Feldern und Wiesen lag dünngestäubter Schnee, feine glitzernde Flocken, das Eis in den Pfützen zersprungen. Kaum Wind strich durch Pappeln und Weiden, die harten Zweige standen starr, grau wie Schotter das Schilf. Still war es, still. Wie ein entferntes Echo knackte der Frost im Schilf. Und dann lag sie endlich vor mir, die dunkel funkelnde Wasserbahn, mein Wassermann: Sorgenschlucker, Trauertröster, Wutverschlinger, mein treuer Vagabund, mein verlässlicher Stromer, mein Rhein.
In meiner Manteltasche war es warm zwischen Hand und Stein, als führte der Großvater mich hin zu unserer Weide, wo wir im Sommer so oft eine Decke ausgebreitet, gespielt und geträumt hatten. Der Rhein, das Wasser, die Steine. Die Großvaterweide. Dä Rhing, dat Wasser, de Steen. Alles war, wie es sein sollte.
Schneewolken zogen heran, schoben sich vor die Sonne, es wurde rasch dunkel. Kein Mensch in Sicht. Bis auf einen. Auf dem eisharten, steinigen Ufer holperte ein Fahrrad langsam näher, darauf ein klobig verpacktes Rechteck mit Mützenkopf, den Schal über Mund und Nase. Der Bruder hatte mich aufgespürt. Ein guter Schüler auch er, war für ihn der Übergang aufs Gymnasium, das Möhlerather Schlossgymnasium, leicht gewesen; er war ein Junge, und die Patentante, eine Schwester des Vaters, bezahlte das Schulgeld. Sie hatte den elterlichen Bauernhof übernommen und mit dem Verkauf der Felder als Bauland jet an de Föß. Sie hatte Geld.
Welch eine Freude hatte es Bertram in den vergangenen Monaten gemacht, mir, der älteren Schwester, die sonst immer alles besser wusste, Latein beizubringen. Reines Spiel war es für uns beide, unsere Welt in der Sprache Gottes neu zu erschaffen, Dinge unseres Alltags, von denen sich die alten Römer nichts hatten träumen lassen, in deren Kosmos zu entrücken. Ein Kilometerzähler wurde zum chiliometrorum mensura, der Stromausfall zum fluoris electrici abruptio, und der Kölner FC schoss: porta! Toor!
Mühsam brachte Bertram das Fahrrad auf dem glattgefrorenen Sand zum Halten, rappelte sich über Sattel und Querstange und wischte den Schal von Mund und Nase. Seine Hände steckten in roten Fäustlingen, auf dem Rücken eingestrickt ein weißer, angeschmuddelter Schneestern.
»Amo, amas, amat! Dacht ich mir doch, dass ich dich hier finde«, stieß er aus kältesteifen Lippen in die Luft, die ihm sekundenlang in kurzen weißen Wölkchen vorm Mund stehen blieb.
»Amamus, amatis, amant«, erwiderte ich. »Ja, wo soll ich denn sonst sein?«
Amo, amas, amat – ich liebe, du liebst, er, sie, es liebt. So beginnt ein jedes Studium der Sprache Gottes. Seit unserer ersten gemeinsamen Lateinstunde war dies unsere Losung. Zauberworte, die der Bruder mir zum ersten Mal beim Besuch der Heiligen Drei Könige in der Altstraße zugeflüstert hatte.
Bertrams Gesicht war rotgefroren wie meines, seine braunen Augen, den meinen verwandt; alle anderen in der Familie hatten helle Augen, grün die Mutter, nassblau der Vater, die Großmutter ein altersverschleiertes Grau. Während meine Kleider, meist aus dem Sack des Oberpostdirektors, dessen Tochter in meinem Alter war, immer schlotternd an mir herunterhingen, doppelt gesäumt, hinten gerafft, in der Taille geschoppt – oh, wie hasste ich den Ausdruck für diesen Handgriff geübter Verkäuferinnen, wenn sie kleingewachsenen Menschen weismachen wollten, der Rock, unter den Hüften hängend, sitze exakt in der Taille -, während ich also geschoppt und gerafft in Wohltätigkeitsspenden einherging, stammte die Kleidung des Bruders von C&A, neugekauft, sah jedoch binnen kurzem wie eingelaufen aus. Dann musste er warten, bis die Mutter ausrief: »Alles ald widder ze spack!«2, und eine Reise nach Köln fällig wurde. In diesem Winter hatte er wieder einmal ne Schoss jedonn, einen Schuss getan, aber für einen neuen Anorak hatte es nicht gereicht. Bertram stak in der wattierten Jacke wie in einer Gießkanne mit zwei Tüllen. Nur an Mützen hatten wir keinen Mangel. Tante Berta, die ältere Schwester der Mutter, versorgte damit höchstselbst die gesamte Familie, und niemand, nicht einmal ihre resolute Tochter Hanni, wagte es, die tütenförmigen Eins-rechts-eins-links-Gebilde gegen modischere Kopfbedeckungen zu vertauschen.
»Freust du dich denn auch?« Bertram schickte unseren Atemschiffchen noch ein paar hinterher.
»Na klar!«
»Ja, wenn jetzt der Opa hier wär!« Bertram ruckte einen Fäustling mit den Zähnen herunter. Öffnete seine schmalgefrorene Jungenhand, darin ein runder, flacher Kiesel, zwei rote Punkte am oberen Rand, darunter ein in Richtung der Punkte geschwungener Halbkreis. Der Stein lachte mich an.
»Da, nimm«, lachte der Bruder. »Er ist sogar noch ein bisschen warm. Lapis risus. Lachstein. Direkt aus dem Forum Romanum.«
»Tibi gratias, frater! Mensch, Bertram!« Ich griff nach seinem Arm, fasste eiskaltes Nylon mit bloßen Händen, es brannte.
»Hilla«, Bertram legte den Stein in meine Hand, »wo sind denn deine Handschuhe?«
»Vergessen.«
»Hier, nimm meine.«
»Die brauchst du doch auf dem Fahrrad. Ich hab tiefe Taschen. Hier.« Ich zog auch die andere Hand aus der Tasche und nahm die Hand des Bruders in die meinen. Dazwischen der Lachstein.
»Ich dachte mir«, hob Bertram an, und ich erkannte am Tonfall, dass er es ernst meinte, »also, ich hab mir gedacht, einen Wutstein hat man ja nicht immer zur Hand, aber den Lachstein, den kannst du überall mit hinnehmen. Und dann ist er bei dir, auch wenn dir mal nicht zum Lachen ist. Und dann denkst du an den Opa. Und an mich.«
»Aber nur, wenn dir vorher nicht die Hände abfrieren. Keine Widerrede.« Bedächtig streifte ich dem Bruder den Fäustling über die Hand, die sich in meiner ein wenig erwärmt hatte. »Jetzt aber ab nach Hause. Oder brauchst du noch einen Wutstein?«
»Eher einen Stein der Weisen«, grinste Bertram. »Morgen geht es gleich mit Mathe los.«
»Owei«, seufzte ich. »So viele Steine könnt ich gar nicht mit mir rumschleppen, wie ich für Mathe bräuchte.«
»Denk an den Lachstein.« Bertram wischte sich die Nase. Überzeugend klang er nicht.
Ein Stück weit schob er das Fahrrad neben mir her, dann schraubte er sich auf den Sattel und rumpelte davon; sein Tischtennispartner wartete schon.
Die Großmutter hatte schon Feuer gemacht, war pünktlich wie jeden Morgen ins Kapellchen beim Krankenhaus zur Frühmesse aufgebrochen, Vater und Bruder schliefen noch, als ich an diesem ersten Schultag in die Küche kam. Die Mutter war nirgends zu entdecken, hatte aber ein Käsebrötchen aufs Brettchen gelegt, ein zweites in Cellophanpapier lag daneben. Brötchen, die es sonst nur sonntags gab! Aufgehoben, extra für mich! Lächelnd nickte ich hinauf zum Christuskreuz, das der Großvater geschnitzt hatte, und machte die Haustür leise hinter mir zu.
Niemand stieg an der Pappenfabrik aus. Zu früh fürs Büro, für die Frühschicht zu spät. Doch solange ich bei ausgerenktem, rückwärtsgedrehtem Hals die beiden rußschwarzen Schornsteine noch im Blick hatte, durfte sich meine Zungenspitze zwischen meine Lippen drängen, im Triumph, hier nicht aussteigen zu müssen; nie mehr hier aussteigen zu müssen, nie wieder überquellende Aschenbecher und ab vor ad und 22. nach 21., nie mehr verstohlene Blicke auf nicht vorrücken wollende Uhrzeiger, nie mehr Sehr geehrte Herren und Prokuristenhände wie feuchte Lappen im Nacken.
Ich dachte an Rosenbaum, und wie er mich vom Alkohol zurück in die Wahrheit der Wörter gerettet hatte. Kurz nachdem er mit Pastor Kreuzkamp und Lehrer Mohren für mich gekämpft hatte, war er mit seiner Frau nach Israel gezogen, zu seinem Sohn. Den Brief aus dem Kibbuz hatte ich wieder und wieder gelesen, so, wie früher Die kleine Meerjungfrau. Ich kannte ihn auswendig.
»Glaub daran, dass Du wirklich das bist, was du fühlst zu sein«, hatte Rosenbaum geschrieben. »Trau Deiner inneren Sicherheit, egal, wie andere Dich sehen, oder was andere wünschen, was aus Dir werden soll. Du kannst Dich Dir selbst erzählen. Du bist Deine Geschichte. Lass nicht zu, dass andere Deine Geschichte schreiben. Folge Deiner Phantasie. Aber folge ihr mit Vernunft.
Lerne zu schweigen. Schweigen ist Macht. Behandelt man Dich ungerecht, beleidigt man Dich, sag kein Wort, schau sie nur an – und denke. Denke, was Du willst! Lass Dich nicht hinreißen. Es gibt nichts Stärkeres als Wut – außer der Kraft, die sie zurückhält, die ist stärker.«
Mit wem der Lehrer sprach, mit sich, mit mir, mit keinem und jedem, das war nicht herauszulesen. Ich nahm den Brief als sein Vermächtnis. Was der Großvater mir mit meinem Namen in goldenen Lettern auf einem Stein hatte mitteilen wollen, suchte Rosenbaum in Wörter zu übersetzen. Die Botschaft war dieselbe.
Im spiegelnden Fenster der Straßenbahn sah ich mein Gesicht, die Dunkelheit draußen nur hin und wieder von fernen Lichtpunkten unterbrochen. Erst in Hölldorf waren Häuser zu erkennen, hier und da schon helle Fenster, die Schornsteine der Brauerei, grüne und rote Lampen an den Seilen eines Kahns im Hafen nahe der Haltestelle. Leute stiegen aus, andere, dick vermummt, stiegen zu, dampften weißen Atem, zogen Handschuhe aus, bliesen warme Luft hinein und zogen sie wieder an. Niemand sprach, alle starrten aus dem Fenster oder vor sich hin.
Wie anders war es morgens auf der Fahrt nach Großenfeld zugegangen, wenn wir uns in der Straßenbahn getroffen hatten, Jungen und Mädchen aus Strauberg, Rheinheim, Hölldorf und Dondorf, jeder von uns voller Neuigkeiten, die man sich tuschelnd anvertraute.
Vorbei. Ich seufzte, schob die Mütze zurück und presste meine Stirn gegen die Scheibe.
Auch in diesem Jahr hatte ich Weihnachten ein Alpenveilchen zum Bürgermeister getragen. Es war das siebente. Das erste hatte ich ihm im ersten Realschuljahr auf seine spiegelblanken Lochmusterschuhe fallen lassen – ach, das arme Blümchen, ach, du armes Kind -, hatte ihm diese Pflanze, die wir uns zu Hause nicht leisten konnten, einfach nicht gegönnt. Trotzdem: Auch in den folgenden Jahren wurde ich am zweiten Weihnachtsfeiertag stets mit Blumentopf und Tausenddank für das Schulgeld der Gemeinde in Grebels Villa geschickt. Hatte beobachten können, wie Grebels Frau Walburga immer dicker und gedunsener wurde, während der Bürgermeister zu vertrocknen und zu schrumpfen schien. Dies sei ja nun der letzte Blumengruß und Dank, hatte er gescherzt, bevor ich meine Bürolehre antrat, mir ein Fünf-, statt des üblichen Zwei-Mark-Stücks in die Hand gedrückt und alles Gute für den Ernst des Lebens gewünscht.
Diesem Ernst war ich noch einmal entkommen. Gnädig, wenngleich ein wenig säuerlich lächelnd, hatte der Bürgermeister in diesem Jahr nun wieder sein Alpenveilchen entgegengenommen. Doch verlor er kein Wort darüber, dass ich der Gemeinde erneut auf der Tasche liegen würde; wünschte mir vielmehr wie die Jahre zuvor alles Gute, diesmal für meinen Start als »Jüngerin der Wissenschaft«, und dass ich der Gemeinde weiterhin Ehre machen solle.
Die Straßenbahn schaukelte mich durch das behaglich warme Wohnzimmer des Bürgermeisters, um den Christbaum herum, vom Kamin zu den tropischen Pflanzen im Blumenfenster, schaukelte mich durch die Dunkelheit am Rhein entlang, ich döste, träumte, Endstation Rheinheim.
Kalt war es draußen, schneidend kalt, stockfinster noch immer. Der Bus kam erst in zwanzig Minuten. Kein Wartehäuschen. Kein Unterstand. Ich gesellte mich zu der Menschentraube an der Haltestelle, dichtgedrängt wie die Schafe, nur wagten wir nicht, einander zu berühren. Doch unsere Atemstöße vermischten sich zu einer eisigweißen Wolke, die wie ein feiner Nebel zwischen und über uns lag.
»In der Schweiz«, ließ sich eine Männerstimme nahe dem Haltestellenpfosten vernehmen, »ist sogar der Züricher See zugefroren.«
Ein enormer Ausstoß weißgefrorener Luft unterstrich diesen Befund, den eine kältebebende Frauenstimme mit einem knappen »Der Bodensee auch« verstärkte. Jemand fing an, mit den Füßen aufzustampfen, eine zweite Person tat es der ersten nach, ein Stampfen und Mit-den-Armen-um-sich-Schlagen begann, wir rückten auseinander und wuchsen doch in diesem Stampfen und Schlagen noch näher zusammen. Aus unseren Mündern stiegen die weißen Nebel wunderbar, und wir lachten hinter hochgestellten Kragen einander an.
Der Bus wurde in Rheinheim eingesetzt. Kalt und leer. Einzeln in die Sitze gekauert, fiel unsere Heizgemeinschaft wieder auseinander, jeder zog sich in sich zusammen, machte sich klein, als böte er so der Kälte weniger Angriffsfläche. Ab Ruppersteg wurde der Bus voller, Jungen und junge Männer, meist Schüler, die wie ich zum Gymnasium fuhren. Der Tonfall ihrer Stimmen, die Lässigkeit ihrer Gesten, die bessere Kleidung zeigten, mit welcher Selbstverständlichkeit sie ihren Platz nicht nur im Bus von Ruppersteg nach Riesdorf oder im Franz-Ambach-Gymnasium einnahmen, im ganzen Leben ergriffen sie so von ihren reservierten Plätzen Besitz. Mussten sich weder beeilen noch anstrengen, das Klassenziel zu erreichen. Generationen, oder doch wenigstens die Eltern, hatten längst für eine Erneuerung des Abonnements der ersten Ränge gesorgt. Mein Blick fiel auf einen hochgeschlagenen Kragen, an den Rändern von schwarzem Pelz überlappt. Ich, Hilla Palm, würde es ihnen zeigen, sie bezwingen, meinen Platz in ihrer Abonnementsvorstellung erobern. Ich grinste: Der kurzgeschorene Kopf überm Pelz erinnerte an ein schlachtreifes Karnickel.
»Die Naturgewalt des Lachens ist das allergrößte Wunder«, hatte Rosenbaum in seinem Brief geschrieben. »Der Mensch kann auf seinem Weg alles verlieren: Jugend, Gesundheit, Kraft, Glauben, Gedächtnis, Namen. Bewahrt er sich sein Lachen, bleibt er Mensch. Der Anlass Deines Lachens spielt keine Rolle. Oft fragst Du Dich hinterher, worüber Du eigentlich gelacht hast. Du kannst Dein eigenes Lachen nicht enträtseln. Lachen ist Selbstverteidigung. Durch Lachen überwindest Du, was über Dir steht, stärker ist als Du. Lachen ist Philosophie. Selbstbestätigung. Du kannst in auswegloser Lage sein. Das Lachen drängt von innen herauf und hebt Deine Bürde an. Schützt Deine Würde. Lachen ist Befreiung.« Ich tastete nach dem Lachstein. Und lachte.
Der Verkehr wurde dichter, eine glitzernde Strecke an erleuchteten Schaufenstern, Neonreklamen vorbei. In Riesdorf stiegen die Gymnasiasten aus, ich reihte mich in die Schülerschar ein, über die Straße, durch den Park, es dämmerte nun, und ich spürte die Blicke, die mich, offenbar das einzige Mädchen, trafen. Kaum hatten wir den Schulhof erreicht, ertönte ein Gong, man ordnete sich klassenweise, nur die Älteren blieben in Gruppen zusammen. Ich schob mich hinter einen Baum.
Kein Lehrer in Sicht. Es gongte zweimal, ein Mann stieß das Portal des Backsteingebäudes auf. Ich trat aus der Deckung, marschierte in meinen Stiefeln aus Seehundsfell durch die Reihen der Schüler dem Mann entgegen, Pfiffe und Anrufe kaum wahrnehmend. Der Mann war auf der oberen Treppenstufe stehen geblieben, so, dass ich hinaufstapfen musste, um ihn, zwei Stufen unter ihm stehend, mit einem Blick wie die Engel im Himmel gen Christus, zu fragen, wo bitte denn die Klasse des Aufbaugymnasiums sei. Drei weitere Schläge tat der Gong, die Schüler setzten sich in Bewegung.
»Halt!«, donnerte der Mann vor mir und hob die Hand am gestreckten Arm, um dem Schwarm Einhalt zu gebieten. Unwillkürlich duckte ich mich, trat – nicht leicht auf einer Treppe – einen Schritt zurück, wäre gestürzt, hätte die Hand mich nicht gepackt und auf den Füßen gehalten. »Aha, Sie sind also das Wunderkind«, sagte er mit freundlichem Spott. »Fest auf beiden Beinen bleiben. Und keinen Schritt zurückweichen! Trotzalledem! Kommen Sie, ich bringe Sie hin.«
Seine Hand, noch immer auf dem Ärmel meines Wintermantels, von Cousine Hanni, zwei Nummern zu groß, drehte mich langsam um. Er trat auf die Stufe neben mich, und so, seine Hand auf meinem Oberarm, gingen, nein, schritten wir die Stufen hinunter, an den glotzenden Schülern vorbei, die sich widerwillig in Richtung Klassenräume bewegten, wartendes Lehrpersonal schon warnend in den Fenstern.
»Fräulein Palm, nehme ich an«, ergriff mein Führer das Wort. »Melzer, Geschichte und Philosophie. Ich habe schon von Ihnen gehört. Na, bei uns haben Sie ja jetzt endlich gut lachen.«
Der Lehrer ließ meinen Arm fahren, ging voran und deutete über den Schulhof hinaus: »So, da sehen Sie’s schon.« Er blieb stehen. »Da vorne. Und jetzt entschuldigen Sie mich, meine Klasse wartet.«
Vor mir stieg eine langgestreckte, graue Baracke mit kleinen, hellstrahlenden Fenstern wie ein Geisterschiff aus dem Morgendunst. Ich suchte ein Gymnasium. Das Aufbaugymnasium. Doch weit und breit war kein anderes Gebäude zu sehen. Nur ein Sportplatz und die weiten Auen um den Lauf eines Flüsschens.
Vielleicht, dachte ich, zog man sich in der Baracke gerade für den Sportunterricht um; aber in dieser Kälte? Ich schob die Tantenmütze hoch, legte ein Ohr an die Bretterwand. »Quid est«, fragte eine Männerstimme, »in homine ratione divinius?« Ganz klar: Was ist im Menschen göttlicher als seine Vernunft? Die Stimme klang eintönig, gleichmäßig, artikulierte mit äußerster grammatikalischer Genauigkeit, die jede Vorsilbe, Endsilbe, jeden Schlusslaut geradezu zelebrierte, wobei sie keinen Unterschied machte zwischen Haupt- und Nebensätzen, geschweige denn zwischen Vor-, Haupt- und Endsilben, was dem Vortrag etwas Zwingendes, beinah Hypnotisierendes gab. Ich stand gebannt, versuchte zu übersetzen, versuchte zu folgen, vergaß die Kälte über einem gewissen Kritolaus, der in die eine Schale die Güter der Seele, in die andere die des Körpers legt. Was, ja, was hindert ihn, auf der Tüchtigkeit das glücklichste Leben aufzubauen? Ich klinkte die Tür auf, Hitze verschlug mir das Atmen. Runter mit der Mütze, dem Schal, raus aus dem Mantel. Die Innentür ging auf. Der Lateinlehrer. Groß, dürr, knochig; schwarzes, ölig glänzendes Haar fiel ihm in die Stirn, ein breiter, blasser Mund im fahlen Gesicht, später erfuhr ich, sein halber Magen sei wegen Geschwüren herausgeschnitten.
»Salve!«, sagte er und hielt mir einladend die Tür auf.
»Salve!« Verwirrt sah ich den Lehrer an.
»Nomen mihi est Sellmer. Quid est tibi nomen?«3
»Vocor Hilla Palm.«4
Ich fühlte, wie ich wieder zu Atem kam. Heiß nur noch von den bullernden Heizkörpern.
»Hic quid vis?«,5 ging das Verhör auf Latein weiter.
Ich antwortete, ohne zu zögern. Die Stunden mit dem Bruder und seinen Lateinbüchern am Küchentisch, die Nachmittage im Holzstall mit Stowasser und Nota, die langen Abende in der Küche über Atrium Linguae Latinae mit Fabeln, Sagen, bunten Geschichten aus der Alten Welt, bis im Herd das Feuer ausging, machten sich bezahlt.
»Tiro in chartaria laboravi, Emeritus.«6 Das hatte ich mir zu Hause zurechtgelegt. »Discam et scholae et vitae«,*6 antwortete ich, sicher und vergnügt, als hätte ich nie etwas anderes gesprochen als die Sprache Gottes, die Sprache der römischen Dichter und Krieger, die nun die meine werden würde. Klare Fragen, klare Antworten. Subjekt, Objekt, Prädikat. Ich war am Ziel. Das Wilhelm-von-Humboldt-Aufbaugymnasium war eine Baracke; ein Behelfsgebäude. Etwas Vorübergehendes. Was ich hier lernen würde, hatte Bestand. Hatte Bestand gehabt und würde Bestand haben. Plusquamperfekt und Futurum I. Ein Konjunktiv, den ich verwandeln würde in einen Indikativ. Und niemals Futurum II: Es wird Bestand gehabt haben.
»Vos instruam!«, rief Sellmer. »Audite! Vorstellung, bitte!«
»Monika Floraevallis, Monika Blumenthal«, sagte das dunkelhaarige Mädchen neben mir; erklärte, dass sie »in silvae domo«, in Waldheim, wohne, und lächelte mich an. Ihr folgten Anke Sutor und Astrid Faber, klar, Schuhmacher und Handwerker. Anke hieß wirklich so. Astrid hieß Kowalski. Ihr Vater war Werkzeugmacher. Auch der männliche Teil der Klasse wartete mit den merkwürdigsten Familiennamen und Ortschaften auf. Zwar begriff ich, dass es sich um verwegene Übersetzungen handelte, behalten konnte ich fast nichts, außer den Vornamen der Mädchen und den Namen eines großen Blonden, um etliches älter als wir. Nikolaus Opulentus, vulgo Clas Reich, reich an Gütern, Geld und Einfluss – das schien auf ihn zu passen.
Wir waren vierzehn mit mir, der Neuen. Aus weitem Umkreis kamen wir hier zusammen. Angefangen, erfuhr ich später, hatten zweiunddreißig. Zehn Jungen und vier Mädchen saßen wir in Hufeisenform an sieben Zweiertischen.
»Hilla, das meint doch wohl Hildegard?«
Ich nickte.
»Hildegardis also. Und nun zu Palm. Die Palme. In der Antike das Zeichen des Sieges. Im Christentum Symbol für das Leben. Steckt allerhand drin in so einem Dattelkern. Palmes, palmatus, palmetum, palmifer, palmosus, palmula, palmaris«, spulte Sellmer herunter.
»Palmes – der Schössling, der Zweig«, schrieb der Lehrer an die Tafel, »palmatus – mit Palmenzweigen bestickt; palmetum – der Palmenhain; palmosus – palmenreich; palmifer – palmentragend; palmula – 1. das Ruder, 2. die Dattel; palmaris – vorzüglich.«
Der Lehrer setzte die Kreide ab. »Nun, Fräulein Palm?«
»Palmaris!«
»Vorzüglich!«, bestätigte der Lehrer. »Fräulein Hildegard Vorzüglich. Discipula Hildegardis Palmaris. Nomen est omen. Wollen wir hoffen. Sind Sie zufrieden mit diesem Namen?«
Ich nickte. Warum nicht?
»Sie dürfen sich nämlich auch einen Namen erfinden. Das dürfen alle hier. Wie die freigelassenen Sklaven in Rom. Die übernahmen den Namen ihres Herrn. Aber wir leben ja in einer Demokratie. Also wählen Sie. Oder warten Sie«, Sellmer fasste mich ins Auge, »Ursula zum Beispiel. Was meinen Sie? Oder Stella? Rosa?«
Ursula? Die kleine Bärin. Kam nicht infrage. Auch so ein Name, den die Verwandtschaft, genau wie Hildegard, nicht richtig hätte aussprechen können und in ein Orsela verwandelt hätte. Bestimmt hätte ich mich als Ursula in Ulla umgetauft.
»Petra«, entschied ich. »Petra Leonis.«
Sellmer zog die Brauen zu zwei spitzen Dreiecken hoch. »Stein des Löwen. Zwei wahrhaft königliche Symbole. Der Stein: In der griechischen Sage warfen Deukalion und Pyrrha Steine hinter sich, aus denen ein neues Menschengeschlecht wuchs. Im Christentum Symbol der Standhaftigkeit und Unerschütterlichkeit, siehe Petrus, der Felsenapostel. Nur zwei von vielen Bedeutungen. Und der Löwe? Er steht, kurz gesagt, für das Verschlingende wie für das Siegende. Für Tod und Auferstehung.«
Sellmer zog den Kopf auf die Brust und dehnte die Schultern nach hinten. Auf seinem fahlen Gesicht bildeten sich rote Flecken der Begeisterung. Anders als bei den lateinischen Vorträgen, deren hypnotische Wirkung von ihrer Monotonie herrührte, riss uns, wenn es auf Deutsch um Leben und Literatur seines geliebten Römervolkes ging, seine Begeisterung mit. »Übrigens: Auch in Rom konnte man seinen Namen frei wählen. Aber nur als Mann. Und nur als Mann von Stand. Gaius Iulius Caesar nannte man meist Caesar; aber Augustus’ Stiefsohn und Nachfolger Tiberius Claudius Nero war als Tiberius bekannt. Doch nun genug davon.« Sellmer stellte die Beine zusammen, schob die Daumen in die Armlöcher seiner Weste, was seiner schlaksigen Gestalt nolens volens eine Straffheit verlieh, die er seiner verehrten, von allem Firlefanz gereinigten Sprache schuldig zu sein glaubte.
»Saluto vos initio anni novi. Novus annus nobis praebeat: PACEM.« Sellmer ergriff die Kreide und schrieb den Satz an die Tafel. »Discipula Floraevallis!«
»Ich grüße euch am Beginn des neuen Jahres«, übersetzte meine Nachbarin schleppend. »Das neue Jahr bringt uns Frieden.«
»Nun, das wollen wir hoffen, discipula Floraevallis. Zunächst aber habe ich es etwas bescheidener beim Konjunktiv belassen, der Wunschform: bringe uns Frieden, das neue Jahr. Ja, es bringe uns Frieden. Und was wird von Ihnen noch weiter gewünscht?«
»Ut feriae longae sint!«7, strahlte Tim Wottrich, offenbar der Spaßvogel der Klasse.
»Ut valeamus!«8
»Portae multae per FC Colonia!«9 Tim stupste seinen Nachbarn in die Rippen.
»Na, die Tore möchte ich nicht schießen«, lächelte Sellmer. »Ut FC Köln manus pedifollica saepissime follem in portam inferat!«10
»Da ist der Ball ja im Gegentor«, feixte Clas. »So lange, wie der braucht.«
Sellmer tat, als habe er nichts gehört. »Und was wünschen Sie sich, discipula Leonis? Müsste übrigens korrekt Leaena heißen, die weibliche Form.«
Ja, was wünschte ich mir für das neue Jahr? Gute Noten. Wie übersetzen? »Omnem honorem, äh, ornamentum …« Mir wurde heiß. »Multos libros bonos!«, schob ich hinterher.
»Ehre und Auszeichnung«, Sellmer deutete ein Lächeln an, »und viele gute Bücher, na dann. Omnia bene eveniant. Viel Erfolg!«
Es kam noch einiges an Wünschen, äh, optationes, zusammen: eine Reise nach Rom, Gottes Segen für das Zweite Vatikanische Konzil, das wünschte sich Alois, genannt Pius, der Fromme, uno opus sculptile Viennae magnus, das war wieder Clas, der, ungefragt, dennoch für die phantasievolle Übersetzung eines Wiener Schnitzels gelobt wurde, worauf wir dann alle in Wortschöpfungen wetteiferten.
Schließlich brach Sellmer ab. »Na also«, das Lächeln hatte sich von den Mundwinkeln bis in seine Augen ausgebreitet. »Da sage nun noch einer, Latein sei eine tote Sprache. Na, das glaubt ja nun ohnehin von Ihnen keiner mehr. Und Sie, discipula Leonis, bleiben nach der Stunde noch kurz bei mir.«
Sellmer griff in seine Aktentasche und stellte einen grünlichen Kopf auf den Tisch. »So, da ist er wieder. Es wird ernst. Erkennen Sie ihn?«, wandte sich Sellmer an mich.
Na klar, da wir De bello Gallico, den Gallischen Krieg, lasen, das hatte man mir gleich nach der Aufnahmeprüfung mitgeteilt, musste dieser Kopf dessen Verfasser gehören. »Heute«, Sellmer rieb sich die Hände, »wollen wir einmal sehen, was uns Caesar im siebenundzwanzigsten Kapitel seines sechsten Buches zu sagen hat. Herr Fromm, discipule Pius, bitte lesen Sie.«
Pius begann: »Sunt item, quae appellantur alces.« Ich erkannte die Stelle auf Anhieb. Bertram hatte mich vor dieser Geschichte gewarnt. Meist nehmen die Lehrer sie an Karneval, hatte er hinzugefügt, gern aber auch am Anfang eines Jahres oder Schuljahres. Gute Stimmung und so.
Während Pius las, schrieb Sellmer die neuen Vokabeln lateinisch und deutsch an die Tafel: »Alces – Elche; capra – Ziege …«
»Discipula Sutor, ea transfer!«
»Auch gibt es solche, die Elche genannt werden«, begann Anke. »Sie sind ähnlich der Figur der Ziegen und haben verschiedene Häute.«
»Consiste! Stopp!«, rief Sellmer. »Verschiedene Häute … Wie heißt das genauer?«
»Scheckige Felle!«, sagte ich, war doch klar. »Varius«, fügte ich hinzu, »bunt, scheckig.«
»Dann machen Sie doch gleich weiter, discipula Leonis!«
Fließend und frei – strenge lateinische Grammatik durch rheinische Lust am Fabulieren zu besiegen, sollte mein Markenzeichen werden – brachte ich meinen Klassenkameraden die hanebüchene Geschichte von den Tieren mit stumpfen Hörnern und ohne Gelenkknöchel zu Gehör. Daher, so Caesar, schliefen die Tiere im Stehen, an Bäume gelehnt, und würden gefangen, indem Jäger diese Schlafbäume an den Wurzeln untergrüben oder so weit anschnitten, dass die Tiere, lehnten sie sich dagegen, mitsamt dem Baum umkippten, wehrlose Beute.
Von Satz zu Satz war das Raunen lauter geworden. Monika kicherte.
»Tace!«, gebot Sellmer Ruhe. »Discipuli«, wandte er sich an alle, »was haltet ihr davon?«
»Insanum est!«11 Armbruster, pardon, Pauperpectus, warf den Kopf in den Nacken.
»Caesar insanus non est«,12 widersprach Pius.
»Sermone nativo utere!«,13 befahl Sellmer schmunzelnd. »Oder auch: sermone patrio.14 Sprechen Sie, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist, discipule Pauperpectus!«
»Völlig irre Übersetzung«, hielt der nicht hinterm Berg. »So etwas schreibt doch kein Caesar!«
Die Klasse murmelte Zustimmung. Ich lehnte mich zurück. Genau so hatte mir Bertram die Reaktion in seiner Klasse geschildert.
»Discipula Leonis?«, wandte sich Sellmer an mich.
»Totum emendatum est!«, beharrte ich. »Alles richtig.«
»Nun, dann wollen wir mal sehen.«
Geduldig ließ der Lehrer nun Wort für Wort übersetzen. Und es stellte sich heraus, was ich wusste: Ich hatte den Text etwas blumig, aber durchaus emendatus, in der Sache richtig, wiedergegeben. Schon mit Bertram hatte ich die Geschichte hin und her gewendet. War Caesar beim Met von einem germanischen Spaßvogel auf den Arm genommen worden? Oder hatte der Feldherr mit seinem Bericht den eigenen Landsleuten einen Bären aufbinden wollen?
Wie auch immer. Sellmer teilte die Ansicht, dass es sich hier im sechsten Buch des Gallischen Krieges um das erste Jägerlatein der Weltliteratur handelte, dass seitdem jedes jägerische Phantasieerzeugnis als »Latein«, »Jägerlatein« bezeichnet wurde.
»Und da wir schon mal bei den Tieren sind«, fuhr er fort: »Weiß jemand, woher die ›Zeitungsente‹ kommt?«
»Aus den acta publica?«, wagte Pius eine Vermutung.
Der Gong zur Pause ertönte. Niemand machte Anstalten, den Raum zu verlassen.
»Nun«, sagte Sellmer, »das hat nicht direkt etwas mit unserem Pensum zu tun. Nur so viel: Früher musste eine nicht völlig gesicherte Pressemeldung mit n.t. gekennzeichnet werden. N.t., was nichts anderes heißt als? Na, ich sag’s Ihnen: non testatum heißt das. N.t. Nicht bezeugt. Omnia bene?« Sprach’s und verstaute seinen Caesarenkopf wieder in der Aktenmappe. »Discipula Leonis, auf ein Wort.«
Erwartungsvoll blieb ich sitzen, während die anderen sich zögernd erhoben. Bei der Kälte hatte es niemand eilig.
»Sie können noch einsteigen.« Sellmer reichte mir den Abzug einer Matrize: »Hier. Würde mich freuen, wenn Sie mitmachten, in currum currentem saliens, auf den fahrenden Zug aufspringend, sozusagen.«
Ich sah den Lehrer verständnislos an. Der schaute auf die Uhr. »Die Oberprima drüben wartet. Sie finden alles in diesem Papier. Das hat Zeit bis zu Hause.«
Es war ein Liebesbrief. Sellmers Liebesbrief an die lateinische Sprache. Die Beschwörung ihrer Einzigartigkeit. Von ihrem Ursprung, ihrem Wachsen, ihrer Meisterschaft, sich des Griechischen zu bedienen, war da zu lesen; von den Dichtern, die sie genutzt, geformt und entwickelt hatten; vom Siegeszug des Lateinischen als Sprache der abendländischen Wissenschaft für mehr als anderthalb Jahrtausende; von ihrer Fähigkeit, die Sprachen der unterworfenen Völker zu bereichern: das Englische, Deutsche, Französische; mehr als drei Viertel aller Fremdwörter im Deutschen stammten aus dem Lateinischen.
»Das Lateinische – eine tote Sprache?«, schloss das Plädoyer, und ich glaubte, Sellmers höhnisch triumphierende Verneinung zu hören. »Wir alle sprechen Latein, ohne es zu wissen. Wenn wir Augen und Ohren offenhalten, stoßen wir überall auf lateinische Redewendungen und Schlagwörter.«
Diese galt es aufzuspüren. Nolens volens und tabula rasa, cui bono und in medias res …
Aber Sellmer ging es um mehr. Auch einzelne lateinische Wörter, die im Deutschen so taten, als gehörten sie seit den Urgermanen dazu, sollten aufgestöbert werden, Wörter, unverändert seit Augustus’ Zeiten, wie Zirkus, Alibi, Datum, Globus, Interesse, Luxus, Motor, Propaganda, Terror, Universum … Dazu deutsche Wörter lateinischer Abstammung, wie Ziegel aus tegula, Mauer aus murus. Und schließlich deutsche Wörter, die aus dem Lateinischen übersetzt worden waren, Sellmer nannte sie Lehnübersetzungen, etwa Barmherzigkeit, ein Wort, das findige Mönche aus miser i cordia geformt und damit nicht nur ein neues Wort, sondern auch ein dem Christentum verbundenes, neues Gefühl verkündet hatten. Für den erfolgreichsten Sammler war am Ende des Schuljahres ein Preis ausgesetzt. Seit den Sommerferien – ich brütete da noch über Stenokürzeln – war die Klasse schon mit dieser Sammlung beschäftigt.
»Eine Art Ahnenpass«, hatte Sellmer unter die blasslila Matrizenbuchstaben gekritzelt, und: »Sie sind doch katholisch. Fangen Sie doch da einmal an.«
Wörter hatten eine Geschichte! Nicht wie Sonne und Mond, eine Rose, ein Baum einen ewigen Sinn, eine unveränderliche
Bertrams Begeisterung hielt sich zunächst in Grenzen. Er zog das Übersetzungsspiel vor, war voller Anerkennung für das große Wiener Schnitzel, das opus sculptile Viennae magnus. Dann aber packte es auch ihn. Unsere Suche wurde unermüdlich, fanatisch. So, wie wir als Kinder nach Buchsteinen gefahndet hatten, scheuchten wir nun die alten Lateiner aus ihren neuhochdeutschen Verstecken, schälten ihnen die germanischen Kleider vom antiken Leib. So, wie ich mit Wörtern und Buchstaben gespielt hatte, aus der Tante Tinte, dem Hund eine Hand, dem Leid ein Lied gemacht und den Pappa in Pippi ertränkt hatte, ging ich jetzt, ein wahrer Sherlock Holmes im Dienste der deutsch-lateinischen Beziehungen, bewaffnet mit dem Kleinen Stowasser, dem lateinisch-deutschen Schulwörterbuch, auf Enttarnung. An meiner Seite Bertram, ein rechter Watson, der sich insbesondere darauf verlegte, Familienmitglieder für unsere Forschungen zu begeistern.
»Weiß de«, überfiel er eines Sonntagmorgens die Großmutter beim Kartoffelschälen, »dat du Latein spreschen kanns, Lating, wie dä Pastur?« Bertram machte es seit langem wie ich: reines Hochdeutsch nur außer Haus.
Die Großmutter griff nach einer Kartoffel. »Isch? Nä«, sagte sie. »Wie küs de dann do drop? Dat is doch nix für usserens. Dat is die Sprache Jottes.«
»Rischtisch«, sagte Bertram. »Aber mir sind doch alle Jottes Kinder. Da könne mir doch auch seine Sprache spreschen. Sonst verstehe mir den ja nit.«
Die Großmutter ließ Kartoffel und Messer sinken. In einer langen, hauchdünnen Spirale hing die Schale von der Knolle herab. Sie sah den Bruder liebevoll an. Bertram, seit fast zehn Jahren Messdiener, besaß, anders als ich, der Düwelsbrode, ihr Vertrauen. Gut, dass sie nicht wusste, wie es um mich und den lieben Gott stand. Mit drei Kerzen in der Kirche und einem Gebet vor allen Worten, inbrünstig wie in Kindertagen, als ich noch an Wunder glaubte, hatte ich Ihm draußen bei der Großvaterweide für meine Erlösung aus dem Lehrlingsdasein gedankt. Danach ließ ich es wieder beim Besuch der Sonntagsmesse bewenden, und Er schien damit zufrieden.
»Nur en bissjen anders is dat«, fuhr Bertram fort, »so wie wenn de Platt un Hochdeutsch sprischst. Da hören sisch de Wörter ja auch en bissjen anders an. So wie Boom un Baum oder Bruut un Brot, so sacht der Pastor angelus, und du sachst Engel. Altare ist der Altar, Kloster kommt von claustrum, Monstranz von monstrare. Und da jibet noch viel mehr Wörter wie die.«
Die Großmutter nickte. »Un Amen?«, fragte sie. »Sacht der liebe Jott auch Amen? Un Halleluja? Un Hosianna? Un Christ? Un Kirche?«
»Nä, Oma«, sagte ich. »Dat kommt aus dem Hebräischen, sozusagen von Gottvater. Und Christ und Kirche, die kommen aus dem Griechischen. Aber Pastor zum Beispiel, das heißt Schäfer, wie der gute Hirte. Und Petrus. Der Fels, auf dem die Kirche gebaut ist.«
Das war zu viel. Die Großmutter nahm die Kartoffel wieder auf. Setzte das Messer exakt da an, wo sich die Spirale aus der Schale wand, hielt dann aber noch einmal inne und blinzelte listig. »Pengste15«, sagte sie. »Jesus hat uns doch den Heilijen Jeist jeschickt. Wer zu Jott betet, der kann dat in jeder Sprache tun. Jott versteht alles. Un er sprischt zu jedem so, dat der dat versteht. Jott sprischt alle Sprachen.«
Und Bertram und ich waren mit unserem Latein am Ende.
Verblüffenden Erfolg hatten wir dagegen, als wir am Nachmittag die Mutter gemeinsam mit Tante Berta und Cousine Hanni im sonntäglich geheizten Wohnzimmer antrafen. Berta war die ältere Schwester der Mutter, resolut in dem Maße wie die Mutter zaghaft. »Et kütt, wie et kütt«, sagte man in Dondorf. So weit waren sich die Schwestern einig. Doch dann schlussfolgerte die Tante: »Et es noch immer jutjejange«, während die Mutter überzeugt war: »Dat dicke Äng kütt noch«,16 woran sie ihre klammheimliche Freude hatte. Hanni, früher Arbeiterin in der Weberei, war verheiratet; Rudi, ihr Mann, Reitlehrer, hatte einen Hof geerbt, Land verkauft, also jet an de Föß.17
Die Frauen beugten die Köpfe über eine Zeitungsbeilage; der Winterschlussverkauf stand bevor.
»Die feminine Linie in der Mode«, Hannis Stimme klang beschwingt, fast frohlockend. »Hier kuckt mal, die Kostümschen. Der reine Luxus.«
Bertram stieß mich in die Rippen. Die Frauen sahen auf.
»Wat wollt ihr denn hier?« Die Mutter machte eine Handbewegung, als wolle sie uns verscheuchen, doch Hanni rückte schon auf dem Sofa für Bertram und mich zur Seite. »Wie jeht et denn in der neuen Schul?«, fragte sie beiläufig, und ich antwortete ebenso unverbindlich: »Jut«, und das reichte uns allen.
»Dat interessiert die Kenger doch nit.« Tante Berta, aus ihrer Strickjacke dampfend, schnippte auf die Zeitung und fasste uns über ihre Brille hinweg, die sie neuerdings zum Lesen brauchte, tadelnd ins Auge.
»Von wejen.« Bertram zog Hanni das Faltblatt aus der Hand. »Hier! Die feminine Linie in der Mode. Luxus pur und exklusiv für die elegante Dame. Wisst ihr überhaupt, wat ihr alles könnt? Dat hier ist Latein! Und ihr könnt dat lesen! Und verstehen!«
Die Frauen sahen Bertram an, als hätte der den Verstand verloren. Jetzt war ich dran. »Feminin, das kommt von lateinisch femina, die Frau, Linie kommt von linea, die Linie«, dozierte ich, »Mode von modus, die Art und Weise, Luxus haben schon die alten Römer gesagt und pur und exklusiv auch. Dame kommt von domina, die Herrin, und elegant, das sagte man auch schon vor Christi Geburt, wenn jemand anständig angezogen war. Ist das nicht einfach wunderbar? Dass wir so alte Wörter gebrauchen für ganz neue Sachen?« Ich biss mir auf die Lippen. Zu viel des Gutgemeinten.
Betretenes Schweigen.
»Un so wat lernt ihr?« Hannis Stimme hatte ihre selbstgewisse Fröhlichkeit, mit der sie die Annonce! vorgelesen hatte, verloren. Aber ich glaubte auch, einen Unterton zaghafter Bewunderung herauszuhören.
Nicht einmal die Tante wagte, ihr Lieblingswort hervorzustoßen, das sie für alles parat! hielt, was ihr nicht passte, sagte nicht: Kokolores!, holte tief Luft, senkte das vielfache Kinn in den V-Ausschnitt und murrte, wenn auch ungewohnt verhalten, beinah kleinlaut: »Un wat has de davon, dat de dat all weißt?« Doch mit jeder Silbe gewann die Tante ihre Courage! zurück. Hämisch sah sie die Mutter an: »Dofür jibt dir doch keiner ne Penne. Wenn dat alles es, wat se ösch beibrenge!« Und dann kam sie doch noch, die Verdammnis: »Kokolores!«
Aber Hanni hatte Feuer gefangen, und die Mutter schlug sich ohnehin stets auf die Seite der Gegner ihrer älteren Schwester.
»Wat wisst ihr denn noch für Wörter, die mir von de alte Römer haben?« Trotzig sah die Mutter der Tante ins schadenfrohe Gesicht.
»Alle Wörter«, sagte Bertram, »die mit -at aufhören, kommen aus dem Lateinischen. Zum Beispiel privat, separat …«
»Parat?«, fragte die Mutter zögernd.
»Rischtisch!«, schrien Bertram und ich.
»Adveniat«, sagte die Mutter mit fester Stimme. Das musste stimmen, es kam aus der Kirche.
»Kandidat«, platzte Hanni heraus.
»Resultat«, rief die Mutter.
»Diktat!«
»Sabbat!«
»Kamerat!«
»Inserat!«
»Schluss jitz!« Die Tante schwenkte das Zeitungsblatt, als wollte sie die lästigen Lateiner wie Ungeziefer herausschütteln. »Maria, mach uns ens en Botteramm! Met Kies!18 Kütt dat och von dinge ahle Römer?« Die Tante sah mich an wie die Katze die Maus vorm letzten Hieb.
»Ganz genau! Ausgezeichnet! En Botteramm mit Kies! Tante«, sagte ich, »das ist reines Latein!«
Die Tante schnaufte ungläubig.
»Butter, das hieß bei den Römern butyrum«, erklärte ich unbeirrt, »hört sich doch ganz so an wie Botteramm. Und Käse hatten die auch schon, caseus.«
Als sei ihr ein Geschenk in den Schoß gefallen, breitete sich ein scheues, ungläubiges Lächeln auf dem Gesicht der Tante aus, das ihren derben Zügen eine mädchenhafte Anmut verlieh; so mochte sie als Schulkind ausgesehen haben, wenn der Lehrer sie lobte.
»Salat!«, sagte sie versöhnlich. »Spinat. Muskat. Prummetat. 19«
Bertram holte schon Luft, ein Rippenstoß brachte ihn zum Schweigen.
»Tante«, sagte ich, »du haset im kleinen Finger! Pflaume, da sagten die Römer prunum.«
Geschmeichelt blies die Tante die Backen auf.
»Fehlt nur noch de Höppekrat20!«, kicherte Hanni.
»Kokolores!«, wies die Tante die Tochter zurecht. »Maria, mach uns ens en Buttürum met Kaseus!«
Kurz darauf steckte mir die Tante einen Zettel zu. »Automat«, las ich, »Monat, Prälat, Ornat, Muskat, Diktat, Kitekat.«
Meinem Punktsieg in Latein folgte gleich am ersten Schultag ein K.o. in Mathematik. Meyer, so der harmlos tuende Name des Zahlengelehrten, war klein und rund, und jeder Geste, ja, noch dem Lidschlag der hellen, spähenden Augen in seinem kupferroten Gesicht, haftete etwas Lautes, Polterndes an. Ein vorstehender Bauch, jäh aufwärtsstrebend, ließ die Knöpfe der Weste sommers wie winters breit hervortreten und zeugte von prächtigen Siegen über Braten, Kuchen und Bier. Im Profil hatte sein Kopf die Umrisse eines Quadrats.
Händereibend spazierte Meyer vor der Tafel auf und ab und fragte, wer denn ein Fahrrad besitze. Alle Finger gingen in die Höhe. Wann sie zuletzt damit gefahren seien, rief er Clas und Achim auf, die sich, um Zeit zu schinden, gespielt mühsam zu erinnern suchten. Ob die Fahrräder eine Rücktrittbremse hätten, wollte er dann wissen, und wieder bejahten wir.
»Dann sind Sie wohl auch schon alle einmal einen Berg hinaufgefahren und wieder hinunter.«
Zustimmendes Gemurmel. »Nun, dann wollen wir mal.« Meyer straffte sich. Offenbar gewillt, den pädagogischen Triumph, den Sellmer im Lehrerzimmer verkündet haben mochte, zu übertrumpfen, bestellte er mich an die Tafel und drückte mir ein Stück Kreide in die Hand. »Ein Radfahrer durchfährt einen Höhenunterschied von dreihundert Metern mit Rücktrittbremse. Sein Gewicht einschließlich Rad beträgt neunzig Kilo.«
Der Lehrer machte eine Pause. Sah mich an.
»Dreihundert, neunzig«, murmelte ich. »Radfahrer durchfährt, kein gutes Deutsch, sollte ›durchquert‹ heißen, auch nicht gut, besser: Ein Radler durchfährt, ja, dann ist die Wiederholung weg.«
»Nun, Fräulein Palm«, unterbrach der Mathematiklehrer meine Korrekturbestrebungen, »darum geht es hier nicht. Ich komme nun zu meiner Frage: a) Welche Wärmemenge entsteht in der Rücktrittbremse? b) Wie heiß wird diese bei einer Masse von achthundert Gramm Stahl und fünfzig Prozent Wärmeabgabe?«
Eingeschüchtertes Schweigen im Zimmer.
»Ich gebe eine Hilfestellung.« Meyer nahm mir die Kreide aus der feuchten Hand und haute eine Formel an die Tafel.
Schlimmer hätte es nicht kommen können. Ich hörte die Wörter, am Satzbau war nichts zu bemängeln, der Radfahrer ist ein Radfahrer ist ein Radfahrer, wusste doch jedes Kind, was der tut, Rad fahren, Höhenunterschiede durchfahren und die Rücktrittbremse bedienen.
Ich spürte, wie mir eine beträchtliche Wärmemenge in die Wangen stieg, hätte gern mehr als fünfzig Prozent Wärme abgegeben; heißer als meine durchdrehende Gehirnmasse konnte die Masse von achthundert Gramm Stahl gar nicht werden, ich stierte auf die »Hilfestellung« an der Tafel, mechanisch ergriff ich die Kreide, die Meyer mir auffordernd entgegenstreckte.
Schon wurde rechnendes Gemurmel laut, ich spitzte die Ohren, Armbruster am Ende des Hufeisens murmelte betont vernehmlich: »Dreihundert mal neunzig«, und ich beeilte mich, das Aufgeschnappte zu fixieren, sogar das Ergebnis kriegte ich noch hin. Was es aber damit auf sich hatte, was die Zahlen bedeuteten und wie es weitergehen sollte, konnte ich dem hilfsbereiten Zischeln des Klassenkameraden nicht entnehmen.
Verzweifelt flehten meine Blicke, und Meyer, weit davon entfernt, sich an meiner Unfähigkeit zu weiden, schickte mich betrübt auf meinen Platz. Wunderkind hatte versagt. Die widerliche Mischung aus Zahlen und Wörtern, in denen die Zahlen von vornherein die Oberhand hatten und auch behalten mussten, kickte mich wieder mal auf die Matte. Mein wisperndes Gegenüber indes schob den Pulloverärmel in die Höhe, ein blasses, dicht und dunkel behaartes Handgelenk enthüllend, und quietschte in null Komma nix die Lösungen an die Tafel, dabei Zeichen verwendend, die ich noch nie gesehen hatte.
Doch Meyerlein, wie er allgemein genannt wurde, ließ so schnell nicht locker. Wie wir wüssten, sei er in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen. Nichts sehnlicher als einen Hammer hätten sie sich damals gewünscht in dem elenden Unterstand, einen Hammer und Nägel, Holz sei ja genug dagewesen, wenn man es nur hätte nutzen können. Ach, einen Hammer und Nägel. Die eisige Tundra, der Hunger, die Knochenarbeit, Meyerlein kam in Fahrt, und ich schickte ein Stoßgebet gen Himmel, dass der Gong mich erlösen möge von allem Übel, all den perfiden mathematischen Folgeerscheinungen, die Hammer und Nägel unweigerlich mit sich bringen würden. Und da waren sie auch schon:
»Energie!«, rief Meyerlein. »Energie war, was uns fehlte. Nix zu essen im Bauch. Kalt wie Hund. Aber wie Schlittenhund, haha. Und alles mit bisschen Energie zu beseitigen.«
»Kniebeugen«, brummte es neben mir. Aber Meyerlein hatte spitze Ohren. »Kniebeugen! Jawohl. Reife Leistung! Und was ist das: Leistung?«
»Leistung, äh. Wenn ich etwas tue. Äh. Etwas leiste eben.«
»Gib’s auf, gib’s auf, Pütz.« Meyerlein winkte ab. Heinz Pütz, ein zarter, zappliger Junge, kaum größer als ich, machte sich noch schmaler und zog den Kopf ein.
»Beschränken Sie sich auf Ihre Kniebeugen. Also: Was ist Leistung? Wer hat noch nicht, wer … Ja, Fräulein Schuhmacher?«
Anke, alles war lang und dünn an ihr, von den aschblonden Haaren über die Nase bis zu Kinn und Mund, setzte sich aufrecht und rasselte eine Formel herunter, Leistung schnappte ich auf, Quotient und Zeitintervall.
Bescheiden, den Kopf gesenkt, sackte Anke wieder zusammen, als schäme sie sich ihrer Leistung über die Leistung.
»Fräulein Palm! Ein neues Spiel, ein neues Glück. Also, wenn ich bitten darf.« Meyer machte eine einladende Geste zur Tafel hin. »Aufgepasst!«
Ein unmerklicher Ruck ging durch die Klasse. »Welche Kraft wirkt auf einen Nagelkopf beim Aufschlag eines Hammers mit der Masse ist gleich ein Kilogramm, wenn man annimmt, dass der Hammer in 0,001 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von fünf Metern pro Sekunde zur Ruhe kommt?«
Verständnisloses, empörtes Raunen.
»Noch mal. Zum Mitschreiben.« Der Lehrer wiederholte die Aufgabe, unterstrich jedes Wort mit ausdrucksvollen Bewegungen beider Hände, formte Bögen, die Anfang und Ende genau aufeinanderlegten, dergestalt die unbezweifelbare Exaktheit mathematischer Vorgänge optisch verifizierend.
Ich beeilte mich nachzukommen, und dann hatte ich es weiß auf schwarz und armer Tor und war so klug als wie zuvor. Was blieb mir übrig? Mein Gedächtnis. Bis zum Wort Hammer konnte ich der Frage folgen. Die Kraft des Dreinschlagenden, die Kraft der Hand, des Muskelspiels trifft auf den Nagelkopf, wenn er ihn dann trifft, gar nicht auszudenken, wenn er danebenhaut mit aller Kraft, nicht auf den Nagelkopf, sondern den Daumenkopf … wo die meisten Nerven, oje, wenn der Hammer da zur Ruhe kommt, dann ist es aus mit der Ruhe, in Sekunden erfolgt dann der Aufschlag des Hammers in der Ecke.
Von einer Ecke aber war in der Aufgabe nicht die Rede, weg mit den Wörtern und her mit den Zahlen, die sich einzelner Buchstaben bemächtigt hatten, des K, des W und des N, ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Und traurig war ich auch.
Meine Niederlage vom rücktrittbremsenden Radfahrer wiederholte sich beim Aufschlag des Hammers auf den Nagelkopf. Mathematik, Physik, Chemie entzogen sich Wundern und Gebeten, entzogen sich Kerzen und hochheiligen Opferversprechungen. Und dabei blieb es. Daran konnte auch Meyerlein, so leid es ihm tat, nichts ändern.
In der Mathematik gab es kein Vielleicht, kein Wenn-und-aber, kein Sowohl-als-auch, nur wenn und dann, wenn dann. Keine Zweideutigkeiten, von Mehrdeutigkeiten ganz zu schweigen. Diese Schlichtheit des Ja-Nein jedoch tarnte sich mit den absonderlichsten Behauptungen, die jedes gesunden Menschenverstandes spotteten und ohne die das ganze Ja-nein-Konstrukt in sich zusammenbrach. Warum sollte a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat sein? Wie konnte DF gleich EB sein? Wie BE gleich FD? Dass Gott zu Beginn Himmel und Erde schuf, das Feste vom Flüssigen, das Dunkle vom Hellen trennte, war mit Händen zu greifen, jedenfalls wurden die Folgen göttlicher Schöpferkraft jedermann Tag für Tag vor Augen geführt. Die Sonne ging auf und unter, es wurde Licht wie seit Menschengedenken und davor, und es gab, was da kreucht und fleucht wie am dritten alttestamentlichen Tag. Wo aber irgendwo in der Welt von Dondorf über Großenfeld, Langenhusen, Köln; von Düsseldorf bis Ploons oder Möhlerath hatte ich jemals eine Mittelsenkrechte gesehen? Eine Winkelhalbierende? Einen Inkreis? Wo die Diagonale eines Rhombus? Eine vierte Proportionale? Wo war ich jemals einer Tangente begegnet? Ich sah das arme Tier mit den Algen im Parkteich kämpfen, erliegen und geriet über einem »freien Schenkel« ins Grübeln. Dennoch: Ich tat, was ich konnte, Schritt zu halten mit dem Durchschnitt, was mir mehr schlecht als recht gelang. Fürs erste Zeugnis reichte es sogar für eine Drei. Und in Physik gab es meine erste und letzte Zwei. Meyer, im Physikunterricht berühmt für temperamentvolle Vorführungen, die oftmals eher Zirkusvorstellungen glichen als wissenschaftlichen Experimenten, hatte sich, hingerissen von seiner Ankündigung der dramatischen Folgen eines Blitzschlags, den er mit Hilfe zweier Drähte auszulösen gedachte, selbst in den Stromkreis geschlossen. Ich zog den Stecker. Meyer, blau bis in die Lippen, stammelte etwas von ewig dankbar sein und blieb es auch. Unter eine Drei sank ich nie.
Doch noch regierten Hammer und Nagel, und Clas, der aussah, als habe er auch im wirklichen Leben keine Mühe damit, warf seine schlaksige Gestalt vom Stuhl und klopfte den Nagelkopf mit fünfhundert Watt an die Tafel.
Der Pausengong erlöste mich von einem dritten Anlauf, stellte mich aber vor die nächste Prüfung: Ich war die Neue.
Offenbar war mir ein Gerücht außerordentlicher Befähigung vorausgeeilt. In der Lateinstunde hatte ich das Gerücht bestätigt, in der Mathestunde widerlegt. Was für eine war das denn nun?
Draußen hatte sich der Nebel kaum gelichtet, und nur eine dünne Spur vom Backstein-Hauptgebäude, dem Franz-Ambach-Gymnasium, zur Wilhelm-von-Humboldt-Baracke war gestreut. Wir hatten die Erlaubnis, drinnen zu bleiben. Trotzdem: Ich musste hier raus. Frische Luft. Auch Monika schob den Stuhl zurück. Sekundenlang starrten die anderen sie an, mir schien, beinah hätte sie sich wieder gesetzt, aber da machte sie auch schon die Tür hinter uns beiden zu und schlüpfte in einen Mantel, lang und auf Taille, mit einem schwarzen Fellkragen, den sie hochschlug wie Greta Garbo. Da stand ich in Hannis Wintermantel, musste den Gürtel festzurren, die Stoffbahnen hochziehen und verstauen, bis meine Seehundstiefel wieder zum Vorschein kamen, und hätte mich am liebsten unter meinem Tisch verkrochen. Monika putzte sich derweil bemüht umständlich die Nase.
»Mach dir nichts aus Meyerlein.« Monika hakte mich unter, und wir stelzten ein paar Schritte durch den seit Tagen gefrorenen Schnee, der unter unseren Schritten knirschend barst. »Er war eben bei den Russen und ist erst als einer der Letzten rausgekommen. Herzkrank auch. Kriegt bei der kleinsten Aufregung blaue Lippen. Ich glaube, er war enttäuschter als du. Hast du wirklich nichts verstanden?«
»Nichts!«
»Aber Latein! Da bist du doch so gut! Sellmer sagt immer: ›Abstraktes Denken ist überall dasselbe. Wer Latein kann, kapiert auch Sinus und Cosinus.‹«
»Ich nicht«, antwortete ich und hackte mit der Stiefelspitze in die Schneedecke. »Ich kapier nichts, was nicht mit Wörtern zu tun hat. Dieser Mischmasch aus Wort und Zahl ist mir zuwider. Geht nicht in meinen Kopf.«
»Naja«, beruhigte mich Monika, »ist ja heute der erste Tag. Der Rolf dir gegenüber hilft dir bestimmt, uns einzuholen.«
Ich schwieg, und Monika ermunterte mich: »Jetzt haben wir erst mal Deutsch! Bei Rebmann!« Sie blieb stehen, wandte sich mir zu und packte meinen Arm noch fester: »Du wirst sehen: ein Fä-nohmen.« Monika betonte das Wort auf der zweiten Silbe, und ich verbiss mir gerade noch die Korrektur. »Und dabei nur ein Arm. Den anderen hat er in Afrika verloren. Gott sei Dank den linken.« Monika ließ mich los und machte sich auf den Rückweg, dann, die Hände in den Manteltaschen vergraben, blieb sie noch einmal vor mir stehen, so dicht, dass unsere Mäntel sich berührten und ich ihren warmen Atem spürte: »Was glaubst du, wie das wohl ist, wenn der einen umarmt? So richtig, meine ich? Mit nur einem Arm? Diese Kraft …« Den Rest verschluckte der Pausengong, und ohne meine Antwort abzuwarten, stapfte Monika los, ihrem Fänohmen entgegen.
Fast gleichzeitig mit uns betrat der kaum mittelgroße Endvierziger die Klasse. Sein Gesicht ein längliches, schmales Oval; weiches Kinn, scharfe Nase, die Lider verhangen, melancholische, beinah schwermütige Züge. Fest lagen die schmalen Lippen über einem starken Zahnbogen. Aschiges Haar, locker nach hinten gekämmt, setzte ein wenig zu hoch an über der Stirn. Der linke Ärmel des dunkelgrauen Flanellanzugs stak nachlässig in der Jackentasche, die Aktenmappe flog unterm rechten Arm hervor aufs Pult, wo eine kräftige Hand die Schlösser mit energischem Daumendruck aufschnappen ließ und einen Stapel Papiere hervorzog, offensichtlich Klassenarbeiten. Ich lehnte mich zurück. Ging mich nichts an.
»Spät kommt Ihr – doch Ihr kommt.« Rebmann trat vor meinen Tisch. Am Revers seines Anzugs entdeckte ich ein feines Bändchen, das dem Knopfloch Farbe verlieh und den Blick anzog wie ein drittes magisches Auge. Ein Orden, wusste Monika später dieses Fädchen zu erklären; die Medaille lege man zu Hause ins Geheimfach.
»Gestatten: Rebmann«, verbeugte sich der Lehrer vor mir wie in der Tanzschule und streckte mir seine Rechte entgegen.
Falsch, durchzuckte es mich: Der Herr wartet, bis die Dame ihm die Hand reicht. Für meinen neuen Lebensabschnitt hatte ich mich mit einem Buch versorgt, anders, als all meine Bücher zuvor. Zu undeutlich gaben Romane in Fragen des Alltags Auskunft, zu mühsam war die Spurensuche nach Anleitungen zu korrektem Wandel in der Welt, zu perfekten Manieren, Manieren à la Bürgermeister. Mein Großenfelder Buchhändler, Maier, konnte ein ungläubiges, gleichwohl verständnisvolles, wenn nicht gar anerkennendes Lächeln nicht verbergen, als ich ihm das