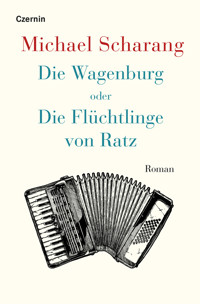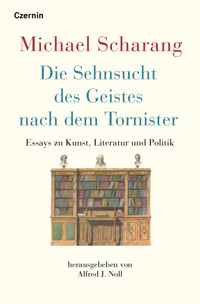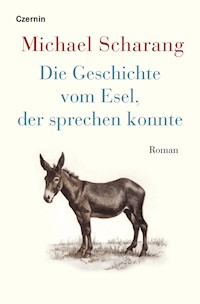20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
»Diese Geschichte begann in New York, fand ihre Fortsetzung in Wien und endete damit, dass die österreichische Regierung ins Ausland flüchtete.« So lautet der erste Satz in Michael Scharangs neuem Roman, Aufruhr. Was ihm folgt, ist nicht die Revolution, aber 21 so witzige wie polemische und herausfordernde Kapitel, in denen von nichts Geringerem als der Möglichkeit einer besseren und gerechteren Welt erzählt wird.
Maximilian Spatz, Oberarzt in Brooklyn, zögert keine Sekunde, als ihm ein Jahr bezahlter Urlaub angeboten wird. Schon am nächsten Tag fliegt er nach Wien. Dort lernt er Anna Berg kennen, die als Verkäuferin in einem großen Modehaus arbeitet; außerdem ist sie Betriebsrätin. Die beiden verlieben sich ineinander, und um Anna näher zu sein, heuert Maximilian als Schaufensterdekorateur an. Als Anna nach einer Lohnkürzung zur Betriebsversammlung einlädt, unter dem Druck der Geschäftsführung aber niemand erscheint, ist es Maximilian, dem es mit einem Trick gelingt, die Kampfkraft der Belegschaft zu wecken. Es kommt zum Streik, der schließlich in ein großes Fest übergeht – immer mehr Menschen feiern mit. Das wirkt ansteckend: Im ganzen Land finden Arbeitskämpfe statt, und bald erweckt die Aufstandsbewegung den Anschein, übermächtig und eine Gefahr für die Regierung zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Ähnliche
Übersicht
Inhalt
Cover
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
– 1 –
– 2 –
– 3 –
– 4 –
– 5 –
– 6 –
– 7 –
– 8 –
– 9 –
– 10 –
– 11 –
– 12 –
– 13 –
– 14 –
– 15 –
– 16 –
– 17 –
– 18 –
– 19 –
– 20 –
– 21 –
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Michael Scharang
Aufruhr
Ein Roman
Suhrkamp
– 1 –
Diese Geschichte begann in New York, fand ihre Fortsetzung in Wien und endete damit, dass die österreichische Regierung ins Ausland flüchtete. Da die ganze Welt daran Anteil nahm, teils schockiert, teils belustigt, braucht man sich nicht zu wundern, dass diese Geschichte nun auch hier zur Sprache kommt. Zumal sie sich in unseren Tagen zugetragen hat, einer Zeit, in der sich vieles zum Besseren wendete.
Wenigstens für Dr. Maximilian Spatz. Dass er zu Beginn der Geschichte, am Abend des 12. Februar 2019, noch am Leben war, empfand er als Glücksfall. Er entschied sich für dieses Wort. Glück schien ihm ein zu großes Wort zu sein, Zufall empfand er als zu klein. Also Glücksfall. Viel hatte nicht gefehlt, und Spatz wäre an jenem Abend in einer Bar in Brooklyn erschossen worden.
Am Nebentisch saßen zwei Männer, sie waren Ende fünfzig, nahmen sich aus wie alte Freunde und redeten über ihre Kindheit. Über die schöne Kindheit, die herrlichen Sommer damals in Bowling Green, die Ausflüge zum Erie-See. Maximilian Spatz stärkte sich mit einer großen Portion Spaghetti für den Nachtdienst in der Klinik. Und er hörte dem Gespräch der Männer aufmerksam zu. Es kreiste um eine kleine Straße in dem kleinen Ort Bowling Green und fand schließlich sein Ziel: eine Konditorei. Die wurde von den beiden Männern so begeistert, so lange und so genau beschrieben, bis es keinen Zweifel gab, dass sie dieselbe Konditorei meinten. Sie war der Ort des Glücks. Der Name des Konditors fiel ihnen allerdings nicht ein, und da jeder eine andere Spur verfolgte – der eine sagte, der Name habe mit K begonnen, der andere meinte, dass der Name mit O anfing –, gaben sie die Suche auf. Der Name sei nebensächlich. Eine vorschnelle Einigung – mit tödlicher Folge, wie sich bald zeigte.
Dass sie als Kinder unabhängig voneinander jene Konditorei geliebt hatten, versetzte sie in Jubelstimmung. Spatz merkte, wie sein Gemütszustand, während er aß, sich bereitwillig der Stimmung der beiden anpasste. Die Fröhlichkeit, die ihn mittags beflügelt hatte, setzte sich fort in den Abend. Zu Mittag beim Kaffee hatte die Fröhlichkeit von der Musik hergerührt, den Vier Stücken für Geige und Klavier von Anton Webern. Nun verdankte sie sich dem Gespräch am Nebentisch. Schon ein paar solche Stunden empfand Maximilian Spatz als einen geglückten Tag.
Geglückter Tag?, fragte er sich und seufzte. Von allem, was ihm in den letzten Wochen gelungen sei, habe er das Empfinden, es gelinge zum letzten Mal. Und das im Alter von fünfzig. Er habe keine Kraft mehr. Er überspiele die Erschöpfung mit Essen. Er koche sogar. Und noch nie habe er so viel Wein getrunken. Nach Jahren greife er wieder zu Zigarillo und Pfeife. Dennoch fühle er sich am Ende. Der Psychiater Spatz scheute davor zurück zu sagen, dass er tatsächlich am Ende war. Er vertraute darauf, dass er sich das nur einbildete. Auf keinen Fall wollte er den Befund zulassen, dass er nicht wie früher zu viel, sondern dass er viel zu viel arbeitete.
Zum Glück gab es noch das Wetter. Es war schlecht. Im Jänner zu kalt. In den ersten beiden Februarwochen zu warm. Kein Wunder, sagte sich Spatz, dass es mir schlecht geht. Diesen Befund ließ er gelten.
Das Gespräch der beiden Männer am Nebentisch drehte sich im Kreis. Der eine erinnerte sich an Tische im Freien, der andere behauptete, es habe vor der Konditorei eine Bank gegeben. Der eine erinnerte sich an eine Markise, die einen Schatten auf das Schaufenster warf, der andere redete von einem Sonnenschirm. Spatz fürchtete, der Ort des Glücks würde sich in nichts auflösen, und so hörte er nur mit einem Ohr hin.
Das Gespräch verflachte, geredet wurde über die Frau des Konditors, eine kleine, rundliche Person, die, wenn ihr Mann nicht im Geschäft war, mitunter einem Kind ein Bonbon schenkte, niemals aber ein Eis. Das war in der Sommerhitze das Kostbarste.
Nein, korrigierte sich Spatz, das Gespräch verflachte nicht. Er lächelte. Nichts freute ihn mehr, als wenn er, der Menschenkenner von Beruf, sich in den Menschen irrte. Der Konditormeister, sagte gerade der eine, war großgewachsen und hatte einen ansehnlichen Bauch. Zweimal in der Woche fuhr er von Bowling Green nach Toledo. Spatz kannte die Namen dieser Ortschaften.
Wenn der Konditormeister auf dem Motorrad saß, erzählte der andere, wölbte der Bauch sich über den Scheinwerfer, die Knie ragten über die Lenkstange hinaus. Das wirkte majestätisch. Nein, sagte der andere, das sah komisch aus. Ich habe gefürchtet, dass der Konditor jeden Augenblick stürzt. Einig waren die beiden sich, dass der Konditormeister aus der Stadt Toledo Zutaten für das Eis brachte, rätselhafte, wunderbare Sachen.
Ein neuer Gast trat in die Bar, er musste gewusst haben, dass die beiden hier saßen, schnurstracks ging er auf sie zu, überhörte den Gruß des Barbesitzers, begrüßte seine Bekannten und bestellte ein Bier. Spatz fiel auf, dass einer der beiden kurz und unfreundlich zurückgrüßte, während der andere den Neuen herzlich willkommen hieß und hinzufügte: Ich habe gedacht, du bist nicht mehr in New York, sondern wieder in Bowling Green.
Spatz drehte sich um und betrachtete die drei. Der Neue, der sich noch nicht gesetzt hatte, trug eine Schlosserhose und einen grauen Anorak, derjenige, der kurz und unfreundlich gegrüßt hatte und dem Ankömmling gegenüber ein abweisendes Gesicht machte, war mit einem roten Anorak bekleidet, der Freundliche mit einem Trenchcoat. Spatz wandte sich wieder dem Essen zu.
Das Bier wurde serviert. Ich wäre gern in Bowling Green, sagte der Neue. Das ist kein Leben hier. Die Wirtschaftskrise bringt mich um. Ich verdiene so viel, dass ich nicht weiß, wohin mit dem Geld. Wenn früher ein Auto einen größeren Schaden hatte, wurde es verschrottet und durch ein neues ersetzt. Es gab nur kleine Schäden zu reparieren, eine Beule hier, einen Kratzer dort. Dafür war mein Betrieb ausgerüstet. Das habe ich den Arbeitern, den dreien, die ich hatte, beigebracht. In der Krise sparen die Leute, fuhr er fort, sie bringen mir Autos, bei denen das Dach eingedrückt, die Tür herausgerissen, die Motorhaube zerbeult ist. Ich muss große Teile kaufen, montieren, lackieren. Am Ende ist das ein paar Dollar billiger als ein neues Auto.
Deine Sorgen möchte ich haben, sagte der Unfreundliche. Ich schenke sie dir, antwortete der Neue, mitsamt der Firma. Her damit, erwiderte der Unfreundliche. Es muss sich sowieso was ändern. Ich habe nur Pech, seit ich in New York bin. Du übertreibst, sagte der Freundliche. Nichts wie Pech!, wiederholte der andere. Ein Honiglecken, sagte der Neue, ist die Firma aber nicht. Wir haben zusätzlich fünf Arbeiter aufgenommen. Die müssen angelernt werden. Wir arbeiten in zwei Schichten, zweimal zehn Stunden. Ich schlafe nur mehr im Büro.
Du hast doch eine Frau, wandte der Freundliche ein. Gehabt, sagte der Neue. Die hat mich schon vor der Krise verlassen. Wusste ich nicht, sagte der Freundliche, schade. Meine Frau hat sich gut verstanden mit deiner Frau, nicht nur weil sie beide in einer Putzerei gearbeitet haben – sehr schade. Traurig, sagte der Neue, sehr traurig. Sie hat mir vorgeworfen, dass ich das Geld, das ich in der Firma erwirtschafte, verschenke. Egal. Es gibt Dinge, die kann man ändern, und es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Ich bin Arbeiter, und ich bleibe Arbeiter. Auch wenn ich eine Firma habe.
Die drei Leute, fuhr der Neue fort, die von Beginn an bei mir arbeiten, sind Miteigentümer, es gibt keinen Unternehmer und keinen Chef. Alle sagen, dass so etwas nicht funktioniert. Bei uns hat es vom ersten Tag an geklappt. Ich habe schon als Kind von meinem Vater gelernt, dass niemand das Recht hat, sich über den anderen zu stellen.
War dein Vater Pfarrer?, fragte der Unfreundliche. Du Scheißkerl, sagte der Neue, du weißt sehr gut, wer mein Vater war. Jeder in Bowling Green hat ihn gekannt, den Gewerkschafter von den Jeep-Werken. Er war keiner der berühmten Arbeiterführer der USA, aber der bekannteste, den es bei uns gegeben hat. Er hatte einen Blick für den Kleinkram im Betrieb. Nicht für das große Unrecht, die Kluft zwischen den Arbeitern und den Besitzern und Direktoren der Fabrik. Die zu beseitigen, hat der Vater gesagt, ist eine feine Sache. Aber nicht meine. Ich bin nicht der Karl Marx.
Man darf nicht zulassen, hat er gesagt, dass von zwanzig Arbeitern einer ausgewählt wird, die anderen zu kontrollieren. Der Kontrolleur, der nicht mehr arbeitet, bekommt natürlich mehr Lohn. Ich war ein Kind und saß dabei, wenn der Vater mit den Arbeitskollegen debattiert hat. Mehr als acht Leute hatten in der Küche nicht Platz. Wenn fünf da waren, setzte die Mutter sich dazu, wenn acht kamen, ging sie zur Nachbarin. Es wäre gelacht, hat mein Vater gesagt, wenn ihr das, was ich verstehe, nicht versteht. Die Arbeiter hassen den Kontrolleur, ihren ehemaligen Kollegen, und der Kontrolleur hasst deshalb die Arbeiter. Wir zerfleischen uns gegenseitig.
Mit solchen Reden hat mein Vater erreicht, dass die Arbeiter ihn zum Sprecher wählten. Bald darauf wurde er, wie das ungeschriebene Gesetz es vorschreibt, liquidiert. Quatsch, sagte der Unfreundliche. Du hast recht, antwortete der Neue. Mein Vater sollte erschossen werden. Er wurde nur angeschossen. Dann saß er im Rollstuhl. Wir wohnten im ersten Stock, es gab keinen Lift. Die Türen ins Bad und ins Klo waren zu schmal für den Rollstuhl. Nicht gehen zu können, hat der Vater gesagt, ist für einen Rollstuhlfahrer das kleinste Problem. Die Arbeitskollegen sammelten Geld. Auch in den Fabriken in Detroit und Cleveland wurde gesammelt. Nicht lange. Es war nicht notwendig.
Weil der Präsident der Vereinigten Staaten sich um deinen Vater gekümmert hat, redete der Unfreundliche dazwischen. Es war nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, sagte der Neue, sondern der Präsident aller Präsidenten, der Maler Edward Hopper, das Genie aller Genies.
Der Unfreundliche lachte abschätzig. Nie gehört, sagte der Freundliche. Natürlich nicht, erwiderte der Neue. Den richtigen Amerikaner, hat mein Vater gesagt, erkennt man daran, dass er den bedeutendsten Amerikaner nicht kennt, den größten Maler des zwanzigsten Jahrhunderts.
Versteh ich nicht, sagte der Freundliche. Hopper, fuhr der Neue fort, ist zu uns gekommen. Er wusste alles über meinen Vater. Der Neue bestellte eine Runde Bier.
Sie, mein Herr, hat Hopper zum Vater gesagt, haben erkannt, wie es in der Fabrik zugeht. Das wird nicht geduldet. Die Wirklichkeit darf man nicht erkennen, das ist seit Jahrtausenden so. Schon gar nicht darf man sie als das bezeichnen, was sie ist. Man darf den König Wohltäter nennen, aber nicht Tyrann, den Fabrikbesitzer Menschenfreund, aber nicht Ausbeuter.
Maximilian Spatz stockte der Atem. Freddy servierte das Bier.
Man darf die Dinge nicht sehen und nicht benennen, hat Hopper gesagt. Wer es dennoch tut wie Sie, wird vernichtet. Zum Glück leben Sie noch. Und zum Glück habe ich in der Zeitung von dem Mordanschlag gelesen. Und noch was: Sie können hier nicht bleiben, im ersten Stock ohne Lift, in dieser Wohnung mit zu schmalen Türen.
Wollen Sie sich nicht setzen?, hat meine Mutter gefragt. Gern, sagte Hopper. Sie kredenzte ihm Kaffee und die Reste von Karotten und Lauch, die vom Mittagessen übriggeblieben waren. Hopper ließ es sich schmecken. Ich bin Maler, sagte er zum Vater, und in einer ähnlichen, wenngleich besseren Situation als Sie. Ich bemühe mich, die Wirklichkeit zu erkennen und zu sehen. Und dann zu malen. Das darf nicht sein. Der Baum darf kein Baum sein, der Mensch kein Mensch, das Kino kein Kino, die Bar darf keine Bar sein. Ich schere mich nicht darum. Meine Bilder nennt man realistisch und verachtet sie. Das ist besser, als angeschossen zu werden.
Ich muss den Mann vom Nebentisch kennenlernen, dachte Spatz, mit Hilfe von Freddy wird das gelingen. Dieser Mann hat Hopper gesehen. Unfassbar. Hopper hat den Vater dieses Mannes in Bowling Green aufgesucht. Unfassbar. Wenn Spatz mit sich oder anderen über Hopper sprach, geriet er stets in Begeisterung.
Dann hat der Lopper, oder wie er heißt, deinen Vater gemalt, sagte der Unfreundliche. Trottel, erwiderte der Neue.
Sie begleiten mich nach New York, hat Hopper zu meinem Vater gesagt. Ich habe für Sie in New York eine Wohnung gefunden, in der man als Rollstuhlfahrer, ohne Hilfe beanspruchen zu müssen, leben kann. Fürs Erste. Vielleicht findet sich später in Bowling Green eine brauchbare Wohnung. Geld ist vorhanden. Wenn meine Bilder auch nicht geschätzt werden, so gibt es doch Leute, die sie kaufen.
Hopper hat sich an meine Mutter gewandt. Es wäre gut, sagte er, wenn Sie mitkommen. Das geht nicht, antwortete sie. In den ersten Wochen, sagte Hopper, wäre es gewiss von Nutzen, wenn Sie bei Ihrem Mann wären. Und Sie, fragte die Mutter, Sie werden doch auch in New York sein? Sie werden sich, hoffe ich, um meinen Mann kümmern. Hopper schwieg. Oder nicht? Es gehört nicht zu meinen Stärken, sagte Hopper, mich um andere zu kümmern. Sie kümmern sich doch jetzt schon um ihn, wandte Mutter ein. Nein – das ist etwas anderes, antwortete er.
Und das Kind?, hat die Mutter gefragt. Es geht hier zur Schule. Schulen, sagte Hopper, gibt es auch in New York. Da mischte ich mich ein. Nein, sagte ich, ich bleibe hier. Ich auch, sagte die Mutter. Ich bin Verkäuferin in einem Stoffgeschäft. Wenn ich länger als eine Woche wegbleibe, ist jemand anderer an meiner Stelle. Hopper entgegnete, dass es auch in New York Stoffgeschäfte gibt. Da meldete ich mich nochmals zu Wort. Ich bleibe auf jeden Fall hier, habe ich gesagt. Nach der Schule mache ich eine Lehre. Ich habe bereits eine Lehrstelle. Mein Onkel ist mir im Wort. Und ich bin meinem Onkel im Wort. Hopper wandte sich über meinen Kopf hinweg an meine Mutter. In New York, sagte er, gibt es tausendmal mehr Lehrstellen als hier. Sie irren sich, erwiderte ich. Wie alt bist du?, fragte er. Zehn, sagte ich und wiederholte: Sie irren sich. So eine Werkstatt wie die meines Onkels gibt es kein zweites Mal.
Hopper hat mich gemustert. Das glaube ich dir, sagte er. Mein Onkel, fuhr ich fort, und seine Arbeiter sind Autospengler. Vor der Werkstatt steht ein Auto mit einem verbeulten Kotflügel. Man kann sich nicht vorstellen, dass aus diesem Blechhaufen jemals wieder ein Auto wird. Und doch ist es so. Mein Onkel schafft das. So ähnlich hat Gott die Welt erschaffen. Gewiss, sagte Hopper, so ähnlich hat Gott die Welt erschaffen.
Der Vater und der Maler sind nach New York gefahren, sagte der Neue, Mutter und ich blieben in Bowling Green. Wir besuchten den Vater regelmäßig, anfangs mit dem Bus, bald mit dem Flugzeug. Vater konnte das bezahlen. Er arbeitete für Hopper als Sekretär. Vater nannte sich Sekretär. Hopper nannte ihn Professor. Er verfasste gemeinsam mit Hopper Briefe, er unterzeichnete sie mit seinem Namen, und darunter schrieb er: Sekretär.
Hopper nannte diese Texte über Malerei Briefe, mein Vater nannte sie Rundschreiben. Die Empfänger waren Maler, Kunstkritiker, Museumsdirektoren, Galeriebesitzer. Es ging um die Wirklichkeit und die Kunst. Ob diese ratlos und feindselig der Wirklichkeit gegenüberstehe oder ob sie fragend, kritisch und freundlich auf die Wirklichkeit zugehe.
Mein Vater hat auf ein Bild gewiesen, das neben dem Rollstuhl stand. Es zeigt eine Frau, sagte er. Das Bett, auf dem sie sitzt, ist ihr so fremd wie das Zimmer, in dem sie sich befindet, und ebenso fremd ist ihr das Buch, das sie in Händen hält, und das Meer, auf das sie blickt. Die Frau ist sich selbst fremd.
Das ist das Geheimnis von Hoppers Bildern, hat Vater gesagt: Die Teile stehen nebeneinander und ergeben kein Ganzes. Wahrscheinlich gibt es dieses sprichwörtliche Ganze gar nicht.
Ein Thema variierte Hopper in den Rundschreiben immer wieder. Warum er realistisch, gegenständlich malt. Weil er sich die Gegenstände nicht nehmen, weil er sich nicht enteignen lässt. Das Haus, das ein Bild werden soll, löst sich nicht dadurch auf, dass er das Haus malt. Die künstlerische Auflösung eines Gegenstands ist dessen Vernichtung und die Vernichtung der Kunst.
Ein Rundschreiben dieser Art ist an einen Kunsthändler in Paris gegangen, der gab es weiter an seinen Freund Picasso, dem Hopper nicht fremd war. Picasso hatte über jenen Händler ein Bild von Hopper erworben. Immer wieder saß er davor.
Und jetzt ist Schluss mit diesem Quatsch, sagte der Neue. Eine Runde zahle ich noch, dann gehe ich. Er winkte Freddy herbei und bestellte drei Bier. Reden wir von der Firma, sagte der Unfreundliche. Ich möchte bei dir einsteigen. Freddy brachte drei Bier, und der Neue zahlte. Freddy wollte zurück in die Küche, wo ein Küchengerät einen Alarmton von sich gab, Maximilian Spatz hielt Freddy am Arm fest, Freddy setzte sich an den Tisch von Spatz und deutete in die Küche, wo der Alarmton immer noch schrillte, Spatz beugte sich zu ihm und flüsterte: Du musst mich mit diesem Mann bekanntmachen, er hat Hopper gekannt.
Freddy nickte, rannte in die Küche, stellte den Alarmton ab und räumte den Geschirrspüler aus. Wie war das mit Picasso, fragte der Freundliche. Der Neue überlegte, trank einen Schluck Bier, überlegte wieder und sagte: Es war so. Picasso hat auf das Rundschreiben geantwortet. Hopper und mein Vater waren wie vor den Kopf geschlagen.
Hochgeschätzter Freund, hat Picasso geschrieben, ich liege Ihrem Werk zu Füßen. Es spornt mich an, in der Malerei die Suche nach dem Gegenstand nicht aufzugeben. Sie müssen aber wissen, dass in Europa der Gegenstand tatsächlich zerstört wurde, zerschossen, zerbombt – im Spanischen Bürgerkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Diese Tragödie für die Menschheit und für die Kunst wird vom Kunstbetrieb genutzt, um die zerstörte Welt als hübsche, abstrakte Tapete zu zeigen. Da machen wir beide nicht mit.
Der Unfreundliche fuhr mit der Frage dazwischen: Hast du das auswendig gelernt? Ich habe, antwortete der Neue, den Briefwechsel oft gelesen, ich habe ihn vom Vater geerbt, dieser Briefwechsel ist übrigens ein Vermögen wert. Ich könnte um das Geld eine dritte Hebebühne kaufen. Und mich, sagte der Unfreundliche, könntest du in dein Büro setzen. Hättest weniger Arbeit. Keine schlechte Idee, antwortete der Neue.
Ich würde euch zum Essen einladen, fuhr er fort, aber ich muss in die Werkstatt. Er bezahlte alles, was getrunken worden war. Du hast, sagte der Unfreundliche, in dem Haus gewohnt, in dem sich die Konditorei befand. Erinnere mich nicht daran, erwiderte der Neue. Wir haben im ersten Stock gewohnt, direkt über der Konditorei. Ich konnte das Fenster meines Zimmers nicht aufmachen. Unten wurde rund um die Uhr gebacken und Teig gerührt, ich habe den Gestank nicht ertragen.
Ich erinnere dich, sagte der Unfreundliche, dass du mich in deine Firma nehmen willst. Das geht nicht von heute auf morgen, antwortete der Neue. Darüber reden wir das nächste Mal. Das nächste Mal ist nie, erwiderte der Unfreundliche. Ich muss gehen, sagte der Neue.
Geh nur. Vorher sagst du mir den Namen des Konditors, sagte der Unfreundliche laut. Der Neue lachte. Und wenn du mich erschießt, sagte er, diesen Namen habe ich aus meinem Kopf getilgt.
Sei mir nicht bös, sagte der Freundliche, mein Kompagnon und ich haben vorhin von dieser Konditorei geschwärmt, aber der Name des Konditors ist uns nicht eingefallen. Du hast oberhalb gewohnt, du musst doch diesen Namen wissen. Wie gesagt, sagte der Neue, diesen Namen weiß ich zum Glück nicht mehr. Der Unfreundliche sprang auf. Zum Glück, schrie er, hast du gesagt: zum Glück? Der Freundliche hob beschwörend die Arme.
Der Neue wandte sich an die beiden Männer: Es ist so, wie ich gesagt habe: Diesen Namen habe ich vergessen. Und dass du mich in deine Firma nehmen willst, hast du auch vergessen, schrie der Unfreundliche. Dein Pech! Er zog eine Pistole und schoss auf sein Gegenüber. Der Mann fiel vom Sessel und blieb regungslos liegen.
Maximilian Spatz, der Menschenkenner, war von diesem Gewaltausbruch überrascht und sprang auf. Der Schütze, seinerseits erschrocken von dieser Reaktion, richtete die Pistole auf Spatz. Doch die Gefahr währte nur Sekunden, dann nahm der Freundliche dem Schützen die Waffe aus der Hand. Der starrte zu dem blutenden Mann auf dem Boden, als könne er nicht fassen, was er getan hatte.
Spatz kniete sich neben den Mann, untersuchte ihn, stellte den Tod fest und teilte das dem Barbesitzer mit. Der nickte und informierte den Schützen. Dr. Spatz, sagte Freddy, ist Arzt, er weiß, wovon er redet. Warten Sie auf die Polizei, aber draußen.
Folgsam verließen der Todesschütze und sein Freund die Bar und setzten sich auf eine Bank, auf welche die letzten Sonnenstrahlen fielen. Der freundliche Mann im Trenchcoat kam zurück in die Bar und fragte Spatz, ob er das Gespräch an ihrem Tisch verfolgt habe. Kein Wort, sagte Spatz, ist mir entgangen. Der Name des Konditors, sagte der Freundliche, ist mir endlich eingefallen. Er hieß Kottlan. Kottlan. Danke, sagte Spatz.
– 2 –
Als die Polizei kam, war die Sonne bereits untergegangen. Bald waren auch die beiden Männer verschwunden. Der Tote lag, zugedeckt und bewacht, auf dem Gehsteig. Freddy hatte die Polizisten aufgefordert, den Toten ins Freie zu tragen, er müsse das Blut vom Boden wegwischen, man stelle sich vor, es komme ein Gast und sehe die Blutlacke.
Er hatte die Lacke mit einem Fetzen beseitigt, ärgerte sich, weil vom Fetzen Bluttropfen auf den Terrazzo fielen, und pflanzte sich vor Spatz auf, um seinen Ärger loszuwerden, doch der war so in Gedanken versunken, dass Freddy es nicht wagte, ihn anzusprechen.
Noch ein Glas Chianti, sagte Spatz, um es Freddy leichter zu machen, sich zu entfernen. Lauter Irre, sagte Freddy, hier geht es zu wie in deiner Klinik. Im Gegenteil, erwiderte Spatz laut, damit Freddy, der in die Küche ging, es hören konnte. In den fünfzig Jahren in New York bin ich nie, auch nicht in der Klinik, mit Kriminalität in Berührung gekommen. Wie vermutlich die meisten New Yorker.
In der Küche fiel ein Glas zu Boden, Freddy zertrat die Scherben. Und seit zehn Jahren, dachte Spatz, habe ich außerhalb der Klinik keinen Kontakt zur Wirklichkeit. Das wurde mir erst bewusst, als ich die drei am Nebentisch reden hörte. Alles spielt sich in der Klinik ab. Weiß ich überhaupt, in welchem Land ich lebe?
Freddy brachte ein Glas Chianti. Maximilian fragte ihn: Lässt sich das noch ändern? Freddy schaute ihn ratlos an. Spatz laut: Nein. Freddy fragte erschrocken: Willst du den Wein nicht? Doch, sagte Spatz. Freddy stellte das Glas auf den Tisch und fragte: Was lässt sich nicht ändern? Mein Leben, antwortete Spatz. Jede Änderung wäre ein Verrat an den sogenannten Patienten. Sie sind zu meinem Leben geworden. Ich könnte allerdings meinen Beruf aufgeben. Noch einmal? Zum vierten Mal? Mit fünfzig? Ich könnte meine Behandlungsmethode aufgeben. Und alles preisgeben, was ich erarbeitet habe. Und mich dem Gespött der Fachwelt aussetzen. Und dem Gelächter der Welt. Das wirst du nicht tun, sagte Freddy.
Vor Jahren habe ich der Öffentlichkeit eine These anvertraut, fuhr Spatz fort: Der Mensch ist kein Patient. Diese These ist nicht neu. Die Frage ist, ob man sie beherzigt. Tut man es, wird die Theorie zur Praxis. Jemand kommt in die Klinik. Er sagt: Ich werde verfolgt. Ich antworte: Ich verfolge Sie nicht. Wenn Sie verfolgt werden, kann ich Ihnen helfen. Er entgegnet: Genau das haben meine Freunde auch gesagt. Ich traue ihnen aber nicht. Ich pflichte ihm bei: Trauen Sie niemandem. Auch mir nicht. Er fragt: Was habe ich hier zu suchen? Meine Antwort: Ich behaupte, dass ich Sie vor Verfolgung schützen kann. Wir müssten zusammenarbeiten. Ich müsste wissen, wer Sie verfolgt. Sie müssen mir aber nicht trauen. Und Sie können, wenn Sie wollen, so lange in der Klinik bleiben, bis Sie nicht mehr verfolgt werden.
Der Mensch ist kein Patient – das ist, sagte Spatz, nicht nur eine riskante These, es kann auch ein gutes Geschäft sein. Die These muss nur erweitert werden. Der Mensch ist kein Patient, sondern eine Fallstudie. Der Psychiater wird zum Autor, der aus der Krankengeschichte eine Story macht. Was für eine Gaudi, all diese Verrückten. Was für ein Lesestoff. Was für Gauner, diese Psychologen, Psychiater, Psychoanalytiker, die aus dem Leiden der Menschen spaßige Geschichten machen.
Dagegen steht unsereins mit seiner armseligen Arbeit. Jemand sagt: Ich bin der amerikanische Präsident, oder: Ich bin der Sänger Elvis Presley, oder: Ich bin Gott. Ich antworte: Das sehe ich. Und werde von meinem Gegenüber gefragt: Was sehen Sie? Ich sehe, dass Sie Gott sind; Sie behaupten das nicht von ungefähr. Dieser Mann ist nicht das Problem, sondern seine Familie, seine Arbeitskollegen, sein Chef. Mit all denen muss ich reden. Manchmal fruchtet es. Meistens nicht.
Freddy stand auf und schaute auf die Straße. Ein Leichenwagen war vorgefahren. Hast du dich schon einmal gefragt, sagte Freddy, ob du nach und nach verrückt wirst? Sicher, antwortete Spatz. Mein Weg ist dennoch kein Irrweg. Aber er ist nicht gangbar. Weil ich zu schwach bin. Meine Kräfte lassen nach. Vor fünf Jahren habe ich der Welt gezeigt, wie man mit Menschen menschlich umgeht. Ich habe aber auch die Frage gestellt: Wie verhält man sich menschlich in einer unmenschlichen Welt? Heute zeigt die Welt mir die lange Nase. Ich übertreibe; es mangelt nicht an Anerkennung. Die schützt davor, dass man abgeschafft wird.
Der Tote wurde vom Gehsteig getragen. Freddy setzte sich wieder zu Spatz. Er tat, als wäre er ein Ausbund an Verzweiflung, und sprach in der Art eines Propheten. Das ist das Ende, sagte er. Wenn die Zeitungen berichten, was in meiner Bar passiert ist, bin ich erledigt. Im Gegenteil, antwortete Spatz. Mord unter Freunden, das ist es, was der New Yorker schätzt. Drei Freunde geraten in Streit, einer schießt, einer ist tot. In dieser Bar ist man sicher. Mord passiert nur unter Freunden. Oder in bestimmten Straßen unter Drogenhändlern. Nur unter Drogenhändlern. Diese Straßen gelten als ebenso sicher wie deine Bar.
Was in letzter Zeit seltener vorkommt, fuhr er fort, ist der Mord innerhalb der Familie. Wahrscheinlich gibt es in New York immer weniger Familien. Mein Großvater, der alte Spatz, ein Wiener, hat mir erzählt, dass in Österreich Morde ausschließlich in Familien begangen werden. Ein gesegnetes Land.
Freddy fühlte sich nicht ernst genommen. Kennst du jemanden, fragte er, der für eine Zeitung arbeitet oder für das Fernsehen? Meine Mutter, antwortete Spatz. Freddy war begeistert. Natürlich, rief er, Cornelia Spatz. Die berühmte Cornelia Spatz. Sie muss siebzig sein. Dreiundsiebzig, korrigierte Spatz. Würdest du sie anrufen?, fragte Freddy. Nein, war die Antwort. Sie hasst Interventionen – und ist doch die korrupteste Reporterin der Welt. Jedenfalls die beste, sagte Freddy. Hast du Kontakt zu ihr? Nein, sie zu mir, antwortete Spatz. Hin und wieder ruft sie an und fragt: Brauchst du was? Und fügt hinzu: Sag bitte nicht Mutterliebe.
Sie hat Humor, sagte Freddy, deshalb ist sie so populär. Leider, antwortete Spatz. Früher, als ich ein Kind war, hatte sie Witz. Der ist im Journalistenmilieu zum Humor verkommen. Sie hatte selten Zeit für mich. Das war mir egal, ich hatte den Großvater. Wenn sie aber Zeit erübrigen konnte, dann spielten wir miteinander. Sie war die Bärenmutter, ich das Bärenkind. Das Spiel begann in der Wohnung und setzte sich vor dem Haus fort. Meine Mutter wollte von den Leuten gesehen werden – als Bärenmutter mit dem Bärenkind. Sie ist eine Exhibitionistin. Alles, was sie tut, will sie der Öffentlichkeit zeigen. Ich bin übrigens nicht frei davon. Es war lustig, als Bärenkind mit der Bärenmutter vom Haus hinüber in den Park zu gehen, auf allen vieren, und sich zwischendurch auf dem Gehsteig zu balgen. Ich weiß nicht, ob jemand die Polizei gerufen hat, sie kam jedenfalls. Die Polizisten lachten.
Heute, sagte Freddy, gilt deine Mutter als moralische Instanz. Das ist ein übler Witz, antwortete Spatz, noch dazu über eine Person, die einmal Witz hatte. Meine Mutter ist eine wirtschaftliche Instanz. Sie ist unbestechlich. Das ist im Journalismus die höchste Form der Korruption. Sie lässt sich nicht beeinflussen. Sie macht ihre Arbeit. Sie veröffentlicht ihre Reportagen. Sie ist objektiv. Vor und während der Arbeit fließt kein Geld, gibt es keine Bestechung. Das Geld fließt nachher. Wenn jemand nach der Berichterstattung, nach einer ihrer gefürchteten Reportagen, gut dasteht, dann ist das Goldes wert. Dementsprechend füllt sich Mutters Konto. Beziehungsweise das ihrer Anwälte.
Würde sie mir helfen, fragte Freddy, indem sie einen ihrer Kollegen auf mein Problem aufmerksam macht? Nein, sagte Spatz, denn du hast kein Problem. Das würde deine Mutter anders sehen, antwortete Freddy. Sie tritt in ihren Sendungen auf als Engel der Problembeladenen, der Armen und Unterdrückten. Wie du in der Klinik. Ihr solltet zusammenarbeiten. Das Telefon in Freddys Schürze meldete sich mit dem Geräusch eines Motorrads. Freddy rannte in die Küche, wo er seinen Namen in das Telefon schrie.
Meine Problembeladenen!, dachte Spatz. Zurzeit gehen in der Klinik einige aus und ein, Frauen und Männer, allen voran David, welche die Fähigkeit haben, sich über ihre Probleme lustig zu machen. Wer das kann, will, was ihn belastet, abwerfen. Sie haben die Fähigkeit zum Aufstand. Nicht zur Revolution, aber zum Aufstand. Sie kennen einander nicht. Ich müsste mich also an die Spitze des Aufstands stellen.
Spatz glaubte herausgefunden zu haben, welches Problem am schwersten auf den Menschen lastet und welche Last sie unbedingt abwerfen wollen: die Angst. Das Teuflische an der Angst heutzutage oder, wie Spatz das in seinen Aufsätzen genannt hatte: an der modernen Angst ist, dass man Angst vor der Angst hat. Für diese Erkenntnis erntete er eine Schaufel voll Anerkennung und eine Wagenladung Spott.
Es gibt Einsichten, dachte er, die jedermann einsichtig sind und die doch niemand einsehen will. Weil es um Einsichten geht, die den Herrschenden verhasst sind. Jemand hat Angst, dachte Spatz, den Arbeitsplatz zu verlieren. Früher hat derjenige mit anderen, die in dem Unternehmen gearbeitet haben, geredet, hat sich mit ihnen beraten. Er stieß auf andere, die ebenfalls fürchteten, die Arbeit zu verlieren. Als Arbeiter schlossen sie sich einer Partei an, der Arbeiterpartei, und im Unternehmen berieten sie sich mit jemandem von der Gewerkschaft.
Heute, dachte Spatz, wird derjenige, dem die Entlassung droht, durchaus nicht alleingelassen. Fliegt er aus dem Unternehmen, wird er aufgefangen von einem Sozialplan, der den sozialen Abstieg des Betroffenen festlegt. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Wer dennoch Angst hat, stört. Immer mehr Menschen kommen in die Klinik, die sagen, sie hätten schreckliche Angst, wüssten aber, es gebe keinen Grund dafür. Mit der Angst, wovor immer, dachte Spatz, kommt man zurecht, mit der Angst vor der Angst nicht. Darunter bricht der Mensch zusammen.
Um ihn auch noch auszulöschen, erklärt man ihm, er sei krank. Er leide an einer seelisch-geistigen Störung. Das Leiden wird mit Medikamenten kuriert. Das Geschäft damit ist riesig. Nicht nur aus denen, die arbeiten, wird Geld herausgepresst, auch aus denjenigen, die nicht mehr arbeiten können oder dürfen.
Dennoch, dachte Spatz, ist der Mensch nicht umzubringen. Nicht aber, wie behauptet wird, wegen seiner geistigen Widerstandskraft, sondern wegen seiner biologischen – wegen seiner Natur, die viel älter und robuster ist als sein Geist.
Das beste Beispiel, dachte Spatz, ist David Intrator. Er hat im ersten Gespräch mit mir gesagt, er habe Angst vor der eigenen Angst. Er leide zwar unter der Angst vor der Angst, akzeptiere sie aber nicht. Er sei von Kindheit an äußerst ängstlich gewesen, ein lautes Wort habe genügt, um ihn zusammenzucken zu lassen.
Niemand, nicht seine Eltern, nicht seine Lehrer, auch nicht seine Freunde hätten sich daran gestoßen. Es sei ihm sogar gelungen – diese Geschichte erzählte er ein anderes Mal –, seine Angst vor Gewalt zu kontrollieren, indem er sich im Kampf ohne Waffen, im Kampfsport, zum unübertroffenen Meister heranbildete. Mit diesen Fähigkeiten habe er in der Armee Karriere gemacht, aber diese Laufbahn sei abgeschlossen. Er habe nach dem Abschied vom Militär Biologie studiert und leite nun den Botanischen Garten von Brooklyn.
Freddy hatte immer noch das Telefon am Ohr, als er aus der Küche in die Bar rannte und rief: Maximilian, ich bin gerettet. Bestellung für Samstagabend. Dreißig Leute! Vom Botanischen Garten. Das kann, sagte Spatz, nur David Intrator gewesen sein. Nein, sagte Freddy, es war eine Frau. Dann war es, erwiderte Spatz, seine Sekretärin. Intrator hat mir erzählt, dass er ein Firmenjubiläum feiern wird. Er war zweimal mit mir in der Bar. Erinnerst du dich? Der Drahtige?, fragte Freddy. Spatz nickte. Er schaut wie ein Luchs, sagte Freddy, und geht wie ein Tiger.
Und redet, sagte Spatz, wie ein Volkstribun. Er hat sich vor mich hingestellt und eine Ansprache gehalten. Herr Doktor Spatz, hat er gesagt, ich habe Ihre Artikel gelesen, sonst wäre ich nicht hier. Sie müssen aber deutlicher werden und klarer. Ich halte immer noch Gastvorlesungen an der Militärakademie, deren Absolvent ich bin, und besuche, wenn meine Zeit es erlaubt, die eine und andere Vorlesung. Dort höre ich, was man sonst nur in Regierungskreisen hört und in den Clubs der Reichen: dass eine Ära zu Ende geht.
Herr Doktor Spatz, die Herrschenden, die neunzig Prozent dessen besitzen, was das Land hervorbringt, diese wenigen wissen, dass ihre Zeit zu Ende geht. Und sie wissen, dass sie nur so lange an der Macht sind, wie die anderen das nicht wissen.
Herr Doktor Spatz, ich weiß es, und Sie wissen es. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dieses Wissen weiterzugeben. Sie offenbar auch nicht. Eine Ära geht zu Ende. Nach dem Untergang der antiken und der feudalen ist nun das Ende der bürgerlichen Epoche gekommen. Wenn man das nicht begreift, versteht man die Welt nicht, weder die kleinen noch die großen Geschehnisse, nicht die materiellen und nicht die geistigen und seelischen Katastrophen.
Und man versteht die eigene Katastrophe nicht. Aber auch wenn man alles begreift, nützt einem das nichts. Deshalb komme ich zu Ihnen. Die Welt, die zugrunde geht, setzt alle, auch alle militärischen Mittel ein, um nicht zugrunde zu gehen. Das ängstigt mich. Doch diese Ära sagt von sich – nie zuvor in der Weltgeschichte hat man sich zu einer solchen Behauptung verstiegen –, dass niemand Angst haben darf. Für alle ist gesorgt, für den Arbeitslosen, den Obdachlosen, den Hoffnungslosen, den Glaubenslosen. Du brauchst keine Angst zu haben – mit diesem Versprechen beginnt es. Du darfst keine Angst haben – mit diesem Verbot endet es. Das Schlimmste: Rede ich mit jemandem darüber, werde ich angeschaut, als wäre ich verrückt.
Ich glaube nicht, dass man mein Leiden heilen kann, hat Intrator gesagt. Die Angst vor meiner Angst ist ein Frosteinbruch, der mich zum Erstarren bringt. An den äußersten Fasern lebe ich noch. Und das Leben wird in mich zurückkehren. Was dadurch leichter wird, dass ich mit Ihnen rede.
Ich habe, sagte Spatz, geantwortet: Sprechen Sie über Angst nur mit mir, nicht mit anderen. Schon gar nicht über die Angst, dass Ihnen das Recht abgesprochen wird, Angst zu haben. Das haben Sie schön gesagt, hat Intrator erwidert. Entschuldigen Sie, habe ich gesagt, das war nicht meine Absicht.
Ich habe nichts gegen das Wort schön, hat Intrator entgegnet. Ich versuche hin und wieder, meine Gedanken aufzuschreiben. Das Ergebnis ist erbärmlich. Die Sätze sind hässlich. Ich vermute, es ist eine eigene Kunst, das, was man im Kopf hat, zu Papier zu bringen. Sie, Herr Doktor, können das. Sie schreiben viel und gut. Irrtum, habe ich entgegnet. Viel, aber nicht gut. Und ich habe ihn gefragt: Was wäre, wenn Sie beide Formen der Angst, die Angst selbst und die Angst vor der Angst, abstreifen könnten? Was, wenn wir zusammenarbeiten, nicht ausgeschlossen ist.
Leider, hat Intrator geantwortet, leider denke ich daran. Es rumort in mir. Mehr weiß ich nicht. In mir liegt eine Schicht kalte Schlacke – die Angst – über einer Schicht von kochender Lava. Wenn die Angst weg ist, dann gnade mir Gott. Dann bricht es aus mir heraus.
So ist es, habe ich gesagt. Und Sie sind zu mir gekommen, damit ich das verhindere. Sie sind mir unheimlich, hat Intrator geantwortet. Das ist gut so, habe ich erwidert, ein Psychiater muss unheimlich wirken. Das ist die einzige Wirkung, die er ausübt. Karg ist unser Wissen über die Seele. Umso effektvoller müssen wir dieses Nichtwissen zur Schau stellen.
Ich habe, hat Intrator gesagt, Ihre Schriften nicht genau gelesen. Ich habe sie nämlich verschlungen. Mein Empfinden beim Lesen war, dass die seelische Last kleiner wurde, ja, dass ich weniger Angst hatte. Und nun sagen Sie, dass die Angst nicht aus mir herausdarf.
Ich bin kein Exorzist, habe ich geantwortet, der den Teufel, der in Sie gefahren ist, austreibt. Ihre Vorstellung, dass in Ihnen eine Angst sitzt, die herausmuss, ist nicht ungewöhnlich. Sie entspricht durchaus der Vorstellungswelt der Psychologie, der Psychotherapie, der Psychoanalyse, der Religion. Irgendetwas sitzt in irgendjemandem, Verfolgungswahn, Angst, Größenwahn. Kriegt man das aus demjenigen heraus, ist alles wieder in Ordnung. Kriegt man es nicht heraus, ist der Mensch gestört. Permanent ist die Rede vom gestörten Kind, vom gestörten Jugendlichen. Und so weiter. Wer fühlt sich gestört? Der gesunde Normalbürger. Läuft der Tag nicht immer gleich ab, kommt es also zur Störung des immer gleichen Lebens, der immer gleichen Arbeit, wird der Normalbürger wahnsinnig. Er ist ein Psychopath. Deshalb brandmarkt er jeden, der seinen Tagesablauf stört, als verrückt.
Und es gibt kein Entrinnen aus der tödlichen Normalität, Herr Intrator. Wir kommen aus dieser Gesellschaft nicht heraus, auch nicht, wenn wir sie umstürzen. Im Augenblick des Umsturzes winkt uns jedoch die Freiheit aus der Ferne einen Gruß zu, der uns zuversichtlich und fröhlich stimmt – so jedenfalls stelle ich mir den Umsturz vor.
Das Wissen, so habe ich weitergeredet, dass wir der krankhaften und krankmachenden Normalität nicht entfliehen können, lastet als Depression auf uns. Und doch ist dieses Wissen das einzige Medikament, das wir haben. Wir müssen übrigens das Gespräch für heute beenden, es wartet schon jemand auf mich, wir setzen es morgen fort. Und ehe wir eine Behandlung beginnen, überlegen Sie, wie Sie sich selbst behandeln können.
Das weiß ich bereits, hat Intrator geantwortet. Wenn der Hass gegen mich selbst, gegen meine Angst, gegen die Angst vor der Angst, mich zu überwältigen droht, wenn der Körper zu zittern beginnt, wenn der Schweiß einem Bach gleich aus meinem Körper rinnt, wenn meine Finger sich ineinander verkrallen, in der Hoffnung, auf diese Weise Halt zu finden, dann drängt es mich in einer ersten Aufwallung zu äußerster Gewalt. Ich will jemanden erschießen, ich will ein Gebäude in die Luft sprengen. In Wirklichkeit mache ich etwas ganz anderes. Das erzähle ich Ihnen später.
Freddy hatte ein Blatt Papier genommen und eine Kolonne von Zahlen neben die andere geschrieben. Die Dame, sagte er, wartet auf einen Kostenvoranschlag. Welche Schmach, dachte Spatz, dass ich David Intrator, diesem wunderbaren Menschen, in diesem weißen Fetzen gegenübergesessen bin. Ich werde nicht nur keinen Arztkittel mehr tragen, ich werde, wenn meine Mutter anruft, auf ihre immer gleichen Fragen, wie es mir geht, ob ich was brauche, nicht antworten, dass es mir gut geht, ich brauche nichts, ich werde sagen: Mein Freund Intrator und ich planen einen Aufstand. Wir brauchen Waffen. Was wird sie antworten?
Sie hat angerufen, erinnerte sich Spatz, aber nicht die gewohnten Fragen gestellt, sondern, was sie noch nie getan hat, sich erkundigt, wie ich mit der Arbeit in der Klinik zu Rande komme – was mich derart verwirrt hat, dass ich antwortete: Ich brauche nichts. Aber mein Boxlehrer. Worauf die Mutter gelacht hat, so unbändig und ausdauernd, dass ich fürchtete, das Lachen werde nie aufhören. Endlich wurde es vom Raucherhusten gestoppt. Maxi, hat sie gesagt, du warst als Kind sehr witzig. Nun, mit vierzig, ist dieser Witz wieder da. Mit fünfzig, habe ich erwidert.
Freddy schrie in der Küche ins Telefon und kam strahlend zurück. Kostenvoranschlag akzeptiert, sagte er, es geht bergauf. Spatz nickte ihm aufmunternd zu. Mit der Boxschule hoffentlich auch, erwiderte er. Ich habe meiner Mutter gesagt, dass die Sache mit der Boxschule ernst ist. Den Boxlehrer gibt es nicht mehr lange. Seine Existenz ist bedroht. Was mich nicht kümmern würde, wäre ich nicht fünfundzwanzig Jahre Mitglied in seiner Boxschule gewesen. Gestern habe ich zu boxen aufgehört. Man soll einen Witz, hat sie geantwortet, besonders einen guten, nicht wiederholen. Boxen, habe ich gesagt, ist nicht das richtige Wort. Ich habe am Sandsack trainiert, also gegen einen Sack geboxt. Wie übrigens die meisten in der Boxschule. Wer hat schon Lust, jemandem auf den Schädel zu hauen, selbst wenn der durch einen Helm geschützt ist. Außerdem wird man auch als Sandsackboxer stets vom Trainer in Boxtechnik unterwiesen. Boxen ist Technik und hat nichts zu tun mit dummer Fitness.
Boxen ist Technik, hat die Mutter gespottet, und Technik soll was mit Intelligenz zu tun haben. So ist es, habe ich gesagt. Einer haut dem andern auf den Schädel, hat sie geantwortet, bis das Hirn kaputt ist. Völlig richtig, habe ich gesagt, das ist das Geheimnis der Intelligenz.
Du musst es wissen, hat sie entgegnet. Ich weiß es, habe ich gesagt, auch wenn ich nur am Sandsack boxe. Nun aber, mit fünfzig, sehe ich selbst aus wie ein Sandsack. Ich höre auf. Mein Boxlehrer nicht. Er ist über siebzig, kann aber nicht aufhören. Er hat keinen anderen Beruf. Er hat aber auch bald keine Boxhalle mehr. Die ist baufällig. Die Boxschule wirft so viel ab, dass er leben kann. Aber die Halle zu renovieren, wie es die Baubehörde fordert, kostet so viel Geld – Nimm einen Bleistift, hat die Mutter mich unterbrochen, schreib diese Telefonnummer auf – ich habe sie mir gemerkt: 0660 31 35 360. Es wird sich ein Anwalt melden, der wird dem Boxer unter die Arme greifen.
Spatz erinnerte sich, seine Mutter noch gefragt zu haben, ob sie in ihrem Leben schon einmal erschöpft gewesen sei, vollkommen erschöpft. Darüber reden wir das nächste Mal, hatte sie gesagt und gefragt, ob man einem Boxer, der es gewohnt ist, dass man ihm auf den Schädel haut, unter die Arme greifen kann.
In diesem Augenblick traten zwei Männer in die Bar, die Spatz hier noch nie gesehen hatte. Freddy ging ihnen hoffnungsfroh entgegen und begrüßte sie wie alte Bekannte.
– 3 –
Der Ältere der beiden stellte sich vor: Er sei Beamter der Mordkommission, den Jüngeren bezeichnete er als seinen Assistenten. Der Kriminalbeamte suchte den Boden der Bar ab und fragte nach dem Mann, der angeschossen worden war. Freddy korrigierte: Erschossen. Der Beamte nickte nachsichtig und fragte noch einmal, wo jener Mann sich befinde.
Der ist, sagte Freddy, hinausgetragen und abtransportiert worden. Von der Polizei?, fragte der Beamte. Freddy nickte. Die Polizei von New York, sagte der Beamte, ist der Todfeind der New Yorker Mordkommission. Er setzte sich an den Tisch neben Maximilian Spatz, nach einer Minute nahm auch der Assistent Platz.
Ich bin froh, sagte Freddy, dass die Polizei die Leiche weggetragen hat. Leiche?, fragte der Beamte, woher wissen Sie, dass die Person tot ist? Freddy sagte feierlich: Dieser Mann, Dr. Spatz, hat den Tod festgestellt. Der Beamte wandte sich mit einer kleinen, respektvollen Verbeugung an Spatz. Sind Sie Amtsarzt?, fragte er. Spatz lachte. Ich bin Gast, antwortete er, und habe hier zu Abend gegessen.
Ein Auto mit Blaulicht hielt vor der Bar, eine Frau und ein Mann in weißen Mänteln traten ein, wahrscheinlich Mitarbeiter der forensischen Abteilung der Mordkommission, der Kriminalbeamte bedeutete ihnen mit beiden Händen, nicht weiterzugehen, sondern umzukehren, da hier jede Mühewaltung vergebens sei. Die Frau fragte dennoch: Brauchen wir keine Blutspuren? Der Kriminalbeamte antwortete: Wir haben Tatzeugen. Die beiden in den weißen Mänteln verließen unwillig die Bar.
Der Beamte kam zur Sache. Erzählen Sie, sagte er zu Freddy. Der, unangenehm berührt von dem strengen Ton, lud die drei auf ein Bier ein. Der Kriminalbeamte lehnte ab, der Assistent schloss sich unterwürfig an, Spatz nickte Freddy zu. Der rief: Maximilian, du trinkst Bier? Und den beiden anderen erklärte er: Dr. Spatz kommt seit vielen Jahren zu mir. Er hat noch nie Bier getrunken. Immer nur Wein und dazu Wasser. Weißwein oder Rotwein, je nachdem, was ich für ihn koche. Er kommt vor Dienstbeginn oder nach Dienstende. Dr. Spatz arbeitet um die Ecke in der Psychiatrischen Klinik. Die Klinik ist durch ihn weltberühmt geworden.
Auch meine Bar, erklärte Freddy den beiden Beamten, wäre heute weltberühmt, aber leider hat die Frau von Dr. Spatz die USA verlassen. Zerlina. Was für eine Sängerin. Er servierte Spatz das Bier. Ich nehme an, sagte er zu den beiden anderen, Sie leben wie ich in Brooklyn. Sie nickten. Geht auch nicht anders, fuhr er fort. Sie werden mitten in der Nacht angerufen, ein Mord ist passiert, Sie müssen zur Stelle sein. Wie jetzt. Da können Sie nicht zwei Stunden außerhalb von New York wohnen.
Ich habe eine Frage, sagte der Kriminalbeamte. Das eine noch, erwiderte Freddy. Damit Sie wissen, wo Sie hier sind. Für uns, die in Brooklyn leben, ist Manhattan nicht einer der Stadtteile von New York, sondern ein anderer Kontinent. Dort, in Manhattan, sitzen die Könige, denen Amerika gehört. Wir sind keine Monarchie mit einem König, wir sind eine Demokratie mit vielen Königen. Nicht mit zu vielen – damit sich jeder die Namen merkt.
Wir sind hier, sagte der Kriminalbeamte –. Sie haben recht, unterbrach ihn der Barbesitzer, Sie sind hier. In einer Bar, die weltberühmt geworden wäre. So weltberühmt wie die Sängerin, die hierherkam. Zerlina Spatz. Metropolitan Opera Manhattan. Für uns in Brooklyn existiert diese Oper nicht. Und so wissen wir auch nicht, was dort gespielt wird und wer dort singt. Und ausgerechnet Peggy aus Brooklyn wird dort ein Star. Peggy aus der Nachbarschaft.
Wir haben nie telefoniert, fuhr Freddy fort. Ich bin über die Straße gelaufen, wenn viel Arbeit war und ich Hilfe brauchte, ich habe hinaufgerufen zu ihrem Fenster, sie hat heruntergerufen: Ich habe keine Lust. Zwei Minuten später war sie da und hat gearbeitet für fünf. Ich habe so was noch nie gesehen. Das Geld hat sie gebraucht für Gesangsstunden. Das habe ich nicht gewusst. Dr. Spatz hat es gewusst. Die beiden haben sich hier kennengelernt. Vier Wochen später haben sie geheiratet. Hier. Das schönste Paar, das es je gab. Die größte Liebe dieses Jahrhunderts.
Sie sind nicht geschieden. Ich habe gesagt, wenn ihr euch scheiden lasst, erschieße ich euch. Das ist eine gute Gelegenheit, sagte der Kriminalbeamte. Ja, sagte der Barbesitzer, das ist eine gute Gelegenheit, Ihnen zu erklären, wo Sie sich befinden. Als Peggy ein Star war und alle sie Zerlina nannten, weil sie mit der Rolle der Zerlina, ich weiß nicht, aus welcher Oper, weltberühmt geworden ist, kam sie nach jeder Vorstellung hierher, um zu feiern. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen von der Metropolitan Opera. Können Sie sich das vorstellen? Die große Oper kommt aus Manhattan hierher in die kleine Bar in Brooklyn.
Für mich ein Geschäft, eine Freude, eine Ehre. Das wäre ein Fressen für jeden Journalisten gewesen. Doch als der erste hierherkam, um über das Ereignis zu berichten, gab es das Ereignis nicht mehr. Zerlina hat die USA verlassen. Meine Herren, können Sie sich das vorstellen? Zerlina geht weg. Eine Katastrophe. Die logische Folge ist eine Naturkatastrophe. In Brooklyn bricht ein Vulkan aus und begräbt alles unter heißer Asche.
Der Barbesitzer hielt den Kriminalbeamten seine Hände hin. Verbranntes Land, sagte er. Schauen Sie sich die Brandspuren an meinen Händen an. Damit meine Bar nicht in Flammen aufgeht, habe ich mit bloßen Händen die glühende Asche hinausgeworfen. Und so gibt es diese Bar noch, in der Sie jetzt sitzen.
Wir sind hier, sagte der Kriminalbeamte leise und geduldig, um den Eindruck zu vermeiden, er wolle den Barbesitzer unterbrechen – wir sind hier, um den Tathergang zu rekonstruieren. Der Tathergang, sagte Freddy – große Rätsel gibt er nicht auf. Insgesamt waren, außer Dr. Spatz und mir, drei Personen in der Bar. Der Assistent des Beamten zog einen Notizblock aus der Jackentasche.
Von diesen drei Personen, sagte Freddy langsam und inhaltsschwer, erschrak aber vor seiner Wichtigtuerei und fragte, ob jemand einen Espresso wolle. Der Kriminalbeamte sagte: Gern, und fügte hinzu, da er es gewohnt war, auch für seinen Assistenten zu sprechen: Zweimal. Freddy machte vier kleine Espressi, servierte sie und stellte eine Flasche Grappa auf den Tisch. Nur Spatz goss ein wenig Schnaps in den Kaffee.
Drei Personen, wiederholte der Beamte. Nein, zwei, erwiderte Freddy. Anfangs nur zwei. Sie kommen regelmäßig in die Bar, alle paar Wochen, manchmal alle paar Tage. Wer ist der Täter?, fragte der Kriminalbeamte. Einer der beiden, antwortete Freddy. Und zwar der Unzufriedene. Der eine war immer gut gelaunt, der andere stets grantig. Er grüßte nicht, wenn er hereinkam, er schnauzte mich an, als hätte ich ihm etwas getan. So benahm er sich auch gegenüber seinem Freund.
Und der Tathergang?, fragte der Kriminalbeamte. Der Assistent hielt den Bleistift bereit, in der Hoffnung, endlich etwas zu hören, was notierenswert sei. Es war mir völlig klar, sagte Freddy, dass dieser Mann eines Tages schießen wird. Unklar war, auf wen. Auf sich oder auf jemand anderen. Der Mann wurde immer unfreundlicher. Ich habe mir gedacht: Wenn das so weitergeht, endet es in einer Katastrophe. Und die ist heute eingetreten. Hat der Mann, fragte der Beamte, eine Mordabsicht geäußert? Eine Mordabsicht?, fragte Freddy zurück. Haben Sie je einen Mörder getroffen, der eine Mordabsicht geäußert hat?
Selbstverständlich, antwortete der Kriminalbeamte. Die sind innerhalb der Mörder sogar eine große Gruppe. Die Gruppe derjenigen, die jede Auseinandersetzung, jeden noch so kleinen Streit mit dem Ausruf beenden: Dich bringe ich um! Diese Leute gelten als besonders aggressiv und besonders harmlos. Mit der Drohung: Ich bringe dich um, so die gängige Meinung, sei ihre Aggression verpufft. Gar nicht so wenige von diesen Leuten aber bringen eines Tages tatsächlich jemanden um.
Schon möglich, sagte Freddy, das ist aber nicht das Problem. Sondern?, fragte der Kriminalbeamte laut und gereizt. Das Problem ist, sagte Freddy, dass die Menschen ausnahmslos gut sind und dass sie, wenn sie etwas tun, stets Gutes tun. Aber auch das ist nicht das Problem. Das wirkliche Problem ist, dass jemand, der Böses tut, der einen Mord begeht, in seinem Innersten überzeugt ist, dass er Gutes tut.
So kann nur jemand reden, sagte der Kriminalbeamte, der noch nie ermordet worden ist. Nein, erwiderte Freddy, er hatte Mühe, in dem Rededuell nicht in die Defensive zu geraten – nein, nein, sagte er, so redet jemand, der sich seit Jahren mit Dr. Spatz, dem berühmtesten Psychiater der USA, über das Wesen der menschlichen Seele und des menschlichen Geistes unterhält. Das beruhigt mich, sagte der Beamte, das Wesen der Dinge ist das Einzige, was mich nicht interessiert. Ich bin in meinem Beruf auf Fakten angewiesen.
Ich auch, sagte Spatz. Der Mensch, der zu mir kommt und Hilfe sucht, ist ein Faktum. Freddy schnitt ihm das Wort ab. Maximilian, sagte er, das Faktum, das zu dir kommt, leidet an einer geistigen oder seelischen Störung oder an beidem, und du musst, um helfen zu können, das Wesen dieser Krankheit erkennen. Im Gegenteil, sagte Spatz und wandte sich zum Kriminalbeamten und dem Assistenten: Ich habe mit meinem Freund Freddy tatsächlich hin und wieder über meine Arbeit geredet. Wie schwierig, ja geradezu aussichtslos diese Unterhaltung ist, zeigt sich daran, dass Freddy automatisch das Gegenteil von dem heraushört, was ich sage. Wie es fast alle tun.
Das Wesen der Dinge, fuhr Spatz fort, versteckt sich nicht in den Dingen, im Gegenteil, das Wesen ist den Dingen ins Gesicht geschrieben. Das lehren Philosophen seit Jahrtausenden – ohne Erfolg. Die Konkurrenz, die Religionen, blieben erfolgreich. Sie lehren, dass in jedem Ding, hinter jedem Ding ein Geheimnis steckt, ein göttliches Geheimnis, letztlich das göttliche Wesen. Die Philosophie hatte gegen die Religion bislang keine Chance.