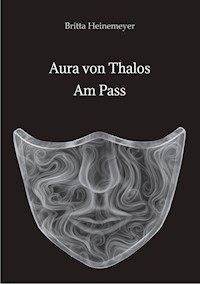
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Aura von Thalos
- Sprache: Deutsch
Wie alle Waisenkinder in Neramah wird die fünfzehnjährige Aura als Sklavin zum Verkauf angeboten. Das aufmüpfige Mädchen rechnet sich keine guten Chancen für ihre Zukunft aus. Dennoch hofft Aura darauf, von irgendwem gekauft zu werden, denn die Alternative wäre noch schlimmer. Umso größer ist ihre Überraschung, als ein Krieger sie erwirbt. Ausgerechnet sie! Dabei weiß doch jeder, dass Krieger sich nur begabte und folgsame Sklaven und Sklavinnen kaufen. Ob es sich um ein Versehen handelt? Aber Aaron Thalos nimmt Aura mit zum Pass, wo die Gefahr der Kreaturen aus dem Anderen Land allgegenwärtig ist. Schon bald stellt Aura fest, dass ihr neuer Herr nicht wie die anderen Krieger ist. Und auch die Aufgabe, die er ihr auferlegt, ist alles andere als gewöhnlich. Was zunächst wie eine glückliche Fügung des Schicksals aussieht, bringt schon bald jede Menge Probleme mit sich. Aura muss beweisen, was in ihr steckt - denn Gefahr lauert nicht nur außerhalb der Landesgrenzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Aura von Thalos
Am Pass
Britta Heinemeyer
Britta Heinemeyer wurde 1986 in Gladbeck geboren. Nach dem Abitur zog sie nach Bückeburg, wo sie eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-Technischen Assistentin absolvierte.
2010 schrieb sie sich für Komparatistik und Medienwissenschaft an der RuhrUniversität Bochum ein. 2015 beendete sie die Rohfassung ihres ersten Romans. Nach dem erfolgreichen Studienabschluss zog sie mit ihrem Mann nach England, wo sie an zwei weiteren Romanen arbeitete.
Seit 2021 lebt sie mit ihrem Mann und Hund Ponyo in den Niederlanden und schreibt an ihrem vierten Roman.
Weitere Informationen gibt es auf brittaheinemeyer.com
britta_heinemeyer_autorin
Weitere Titel der Autorin:
Halber Vollmond (Band 1 der Lorenberg-Reihe)
Aura von Thalos
Am Pass
Band 1 der Aura von Thalos Trilogie
Britta Heinemeyer
© 2022 Britta Heinemeyer
Lektorat: Carolin Ruthenbeck
Coverdesign von: Mink - the Drawing Researcher
(https://linktr.ee/Mink_tDR)
ISBN Softcover: 978-3-347-61630-1
ISBN Hardcover: 978-3-347-61631-8
ISBN E-Book: 978-3-347-61632-5
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Für Maman
1
Ich rede mir ein, dass ich nur aufgrund der Kälte dermaßen zittere. Es hat nicht im Geringsten damit zu tun, dass ich in den nächsten Stunden verkauft werde. Mir ist so schlecht wie schon lange nicht mehr, aber ich habe mir geschworen, stark zu bleiben und mir keine Blöße zu geben.
Der Weg zum Marktplatz von Naarel, der Stadt, in der ich mein bisheriges Leben verbracht habe, kommt mir heute wesentlich länger vor als sonst. Vielleicht liegt es an meinen winzigen, unsteten Schritten. Ich halte meinen Blick auf den vereisten Boden vor mir gesenkt. Zum einen will ich auf dem glatten Untergrund nicht wegrutschen, was einen großen Teil meiner Konzentration in Anspruch nimmt. Zum anderen, und das ist der wichtigere Punkt, habe ich keine Lust, in die Gesichter der Menschen zu blicken, die uns auf unserem Weg anstarren. Fenster werden geöffnet, und ich kann mir vorstellen, wie sich die Bewohner von Naarel aus ihnen hinauslehnen, um einen besseren Blick auf uns erhaschen zu können. Sie machen sich nicht die Mühe, ihre tratschenden Stimmen zu senken, sondern kommentieren uns mit einer hämischen Freude, die mir egal sein sollte, es aber nicht ist. Die Verkaufstage lösen in dieser Stadt eine schon fast festtägliche Stimmung aus und sorgen bei denen, die nicht betroffen sind, für gern gesehene Abwechslung zum Alltag.
Ich weiß, dass ich keine Wahl habe, trotzdem würde ich am liebsten davonrennen. Es ist ja nicht so, als wäre ich jemals in meinem Leben frei gewesen. Allerdings bevorzuge ich das bekannte Übel dem Unbekannten, das nun auf mich lauert. Einen Schritt vor den anderen setzen. Später am Tag wird sich die Frostschicht auf dem Boden in zähen Matsch verwandeln, aber noch ist es dafür zu früh, also passe ich weiter auf, wo ich hintrete.
Ich höre Tilly hinter mir schniefen und muss mich nicht umdrehen, um zu wissen, dass sie weint. Ich kann sie nicht ausstehen, habe in diesem Moment jedoch zum ersten Mal Mitleid mit ihr. Tilly hat die meiste Zeit ihres Lebens damit verbracht, mein Leben anstrengender zu machen. Sie ist hinterhältig und gemein, dennoch habe ich das Bedürfnis, sie in den Arm zu nehmen und ihr zu sagen, dass alles nicht so schlimm wird.
Wir haben alle versucht, uns auf diesen Tag vorzubereiten, aber ich bin überzeugt, dass es niemanden in unserer elenden Gruppe gibt, der nicht nervös und unsicher ist.
In ganz Neramah werden Waisenkinder als Sklaven verkauft. Die Jungen mit vierzehn Jahren und die Mädchen mit fünfzehn. Ich habe meine Eltern nie gekannt, da ich als Baby ausgesetzt wurde und dann im Heim aufgewachsen bin. Seit frühesten Kindertagen wusste ich, dass der Tag kommen würde, an dem ich verkauft werde. Ich dachte immer, er wäre weit weg, aber hier bin ich nun. Wenige Schritte von dem großen Holzpodium entfernt, auf dem wir gleich ausgestellt werden. Dasselbe Podium, auf dem an anderen Tagen Tiere zum Verkauf angeboten werden.
Es gibt einen Steckbrief zu jeder von uns, in dem unsere Stärken und Schwächen aufgelistet sind. Wir haben diese nie zu Gesicht bekommen, allerdings kann ich mir denken, was in meinem steht. Ich bin nicht gerade für Folgsamkeit und Höflichkeit bekannt. Dafür kann ich mir gut Dinge merken und bin ausdauernd, aber ich glaube kaum, dass diese Eigenschaften meine negativen ausbügeln können.
Yvon war stark. Viel stärker als die meisten anderen Jungen, die mit ihm zusammen verkauft wurden. Eigentlich hätten sie mir nicht erzählen dürfen, wo er gelandet ist, aber ich habe damals keine Ruhe gegeben. Yvon und ich haben so gut wie keine Chance, uns jemals wiederzusehen. Ich musste nur wissen, wo er war. Sie hatten ihn an einen der Schiffsbauer verkauft, also war er nach Lumios gezogen, und nun lag das halbe Land zwischen ihm und mir. Seit einem Jahr habe ich nichts von ihm gehört. Ein stilles Jahr, in dem die Frage an mir nagte, was genau zwischen Yvon und mir eigentlich ist. Wir sind beste Freunde gewesen, all die Jahre, die wir zusammen im Heim gelebt und überlebt haben. Das wäre immer noch so, wenn da nicht die Ereignisse in der letzten Nacht gewesen wären, bevor er verkauft wurde.
Nel vor mir hält an, und ich muss aufpassen, nicht in sie hineinzulaufen. Der abrupte Stopp lenkt meine Gedanken von der Vergangenheit auf das Geschehen um mich herum. Wir sind am Podium angekommen, und eine nach der anderen klettern wir empor. Das Konstrukt unter meinen Füßen weist deutlich Spuren von Blut und anderen Körperflüssigkeiten auf, die das Holz überziehen. Ich versuche mich daran zu erinnern, wann das Podium das letzte Mal komplett erneuert wurde, um nicht über den Verkauf nachdenken zu müssen. Mein Gedächtnis gibt mir jedoch keine Antwort, sosehr ich auch darin grabe, was ungewöhnlich ist, weil ich mir sonst immer alles merken kann. Aber heute ist eben nichts normal.
Wir stellen uns in mehreren Reihen auf, wobei ich etwa in der Mitte der Plattform lande. Ich habe mir vorgenommen, gerade zu stehen, so stolz ich kann, und meinem Schicksal mutig entgegenzublicken. Der Wind bläst allerdings scharf und eisig, sodass ich die Schultern anziehe und meinen Kopf, soweit es geht, in meinem Halstuch verstecke. Wir finden nicht alle einen Platz, daher müssen etliche Mädchen in der Reihe darauf warten, aufrücken zu können, sobald eine vom Podium verkauft wird.
Vor uns hat sich bereits eine große Menschenmenge versammelt. Zu den potenziellen Käufern haben sich die schaulustigen Bewohner gesellt, um nichts von dem Spektakel zu verpassen. Es ist laut und in der Menge herrscht eine ausgelassene Stimmung. Ich versuche über die Köpfe hinwegzusehen und zu ignorieren, dass ich angestarrt werde. Ein schlaksiges Mädchen mit struppigen, blonden Haaren und dunkelgrauen Augen, die einem Himmel voller Sturmwolken ähneln. Zumindest ist das die Beschreibung von Yvon.
Ich bete darum, dass ich in dieselbe Stadt wie er verkauft werde. Dann hätte ich eine winzige Chance, ihn wiederzusehen. An diesen Gedanken klammere ich mich fest, als ginge es um mein Leben.
Im Vergleich zu den Verkäufen der letzten Jahre sind wir eine große Gruppe, weswegen die Käufer sich Zeit lassen können und nicht das erstbeste Mädchen nehmen müssen, auf das ihr Blick fällt. Sie sehen sorgfältig die Papiere durch und kommen aufs Podium, um uns genau in Augenschein zu nehmen. Also, die anderen Mädchen. Mich sieht keiner der Käufer an, was mich nicht verwundert.
Es sind etwa zwei Stunden vergangen, als eines der Mädchen hinter mir versucht zu fliehen. Ich kann schnelle Schritte übers Holz und direkt darauf laute Rufe hören. Instinktiv schließe ich die Augen. Jede von uns weiß genau, was passiert, wenn man etwas Derartiges versucht. Es gibt genug Erzählungen darüber, und ich habe es selbst vor einigen Jahren erlebt, als Yvon und ich uns den Verkauf im Sommer angesehen haben. Ich will gar nicht wissen, wer dumm genug war, einen Fluchtversuch zu wagen. Ich kann die Schreie in der Menge hören und dann ein schrilles und kaum mehr menschliches Aufheulen. Natürlich wurde sie erwischt, schließlich ist noch nie jemand entkommen. Und selbst wenn, wo sollten wir auch hin? Niemand würde uns aufnehmen, und ohne Herrn sind wir vogelfrei.
Ich kneife die Augen weiterhin zusammen. Traurigerweise kann ich mir genau ausmalen, was gerade passiert. Sie werden ihr eine Schlinge um den Hals legen und an der Mauer hinter uns hochziehen, bis ihre Hände aufhören, panisch an dem Seil zu zerren, und ihre Füße nicht mehr zucken. Ein weiteres Mädchen, das als Abschreckung für alle anderen dient. Erst als ich sicher bin, dass es vorüber ist, öffne ich die Augen wieder. Ich werde mich nicht umdrehen. Ich werde nicht nachsehen, welche von uns es ist. Stattdessen starre ich weiter geradeaus, über die Menge hinweg, und versuche, meinen verkrampften Magen zu beruhigen und den Schmerz in meinem Inneren zu unterdrücken. Der Verkauf geht nach dem Vorfall normal weiter, als wäre nichts geschehen.
Nach etlichen Stunden ist es mir fast egal, wer mich kauft, solange ich nur endlich hinunterdarf, um mich irgendwo zu wärmen, meine Blase zu leeren und etwas zu essen. Mein Magen knurrt mittlerweile laut und vernehmlich. Während um mich herum die Mädchen verkauft werden, stehe ich immer noch an derselben Stelle wie zu Beginn. Meine Nase gleicht einem Eiszapfen und meine Finger sind schon lange taub. Ich habe Geschichten von Mädchen gehört, die niemand haben wollte und die dann im Freudenhaus gelandet sind. Ich versuche, nicht darüber nachzudenken. Ganz gelingt es mir nicht.
Die Zuschauerzahl hat sich merklich verringert. Dadurch fällt der Krieger, der sich seinen Weg über den Platz sucht, umso mehr auf. Ich kann keine Waffe an ihm sehen, aber das macht ihn nicht weniger respekteinflößend. Seine weiße Maske glänzt hell im Licht der frühen Nachmittagssonne, lässt ihn fast ein wenig unmenschlich wirken. Er überragt die meisten anderen um mindestens eine Kopflänge, fast schon zwei. Ich habe bisher kaum Krieger gesehen, allerdings kennt jedes Kind die Geschichten über die außergewöhnlich großen und starken Männer, die am Pass oder am Südtor dafür sorgen, dass Neramah nicht von den Kreaturen des Anderen Landes überrannt wird. Ohne Zögern kommt er zum Podium und beginnt damit, sich die Beschreibungen der übrig gebliebenen Mädchen durchzulesen.
Ich kann nicht länger stehen. Meine Glieder sind völlig verkrampft, und ich habe das Bedürfnis, mich in einer Ecke zu verkriechen. Stattdessen zwinge ich mich dazu, weiter unbeweglich auszuharren. Das Auftauchen des Kriegers hat für einigen Tumult gesorgt, sowohl bei den Schaulustigen als auch bei den verbleibenden Mädchen. Ich ignoriere die gezischten Kommentare um mich herum.
Als der ganz in schwarz gekleidete Krieger vor mir steht, kann ich es mir allerdings nicht verkneifen, zu seinem Gesicht aufzublicken. Er ist die kleine Treppe hinaufgekommen und direkt zu mir. Ich weiß, dass es ein Versehen sein muss. Wenn ein Krieger eine Sklavin kauft, dann wählt er diejenige, die am folgsamsten ist, die jedem Befehl ohne Zögern folgt. Das bin nicht ich.
Er dreht sich um, und ich kann nicht anders, ich atme tief aus. Dabei hatte ich gar nicht gemerkt, dass ich die Luft angehalten habe.
»Ich nehme sie«, sagt der Krieger, und seine dunkle Stimme dringt in mein Ohr, ohne dass sie mein Bewusstsein erreicht.
Erst als die anderen mich schubsen, wird mir klar, dass ich ihm folgen muss. Mein Magen zieht sich erneut zusammen. Vielleicht sind die Geschichten von den strengen Kriegern, die ihren Sklaven alles abverlangen, nicht wahr. Vielleicht werden sie nur erzählt, um unartige Kinder wie mich zu erschrecken.
Wie in Trance trete ich an den Rand des Podiums und muss aufpassen, nicht die Treppe hinunterzufallen. Es ist leicht, dem Krieger zu folgen, denn die Menge teilt sich respektvoll vor ihm. Ich werfe einen Blick zu den letzten Mädchen zurück, die mich alle überrascht anstarren. Ich sehe, wer an der Mauer hängt, und muss mich beherrschen, nicht zu schreien. Dann wende ich mich um und kehre meinem bisherigen Leben den Rücken zu.
Meine Füße tragen mich automatisch vorwärts, kribbeln unangenehm nach all dem Stehen, aber bewegen sich, worüber ich dankbar bin. Plötzlich geht mir etwas auf und ich muss dieses Mal tatsächlich die Tränen zurückhalten. Egal ob der Krieger am Pass oder am Südtor dient, zwischen diesen Orten und Lumios, wo Yvon wohnt, liegt das gesamte Land. Meine Hoffnung, ihn doch noch wiederzusehen, ist mit einem Schlag zerstört. Mit hängendem Kopf und stechenden Schmerzen in meinem Brustbereich schleiche ich meinem neuen Herrn hinterher.
2
Vor dem Gasthaus mit Namen Das Schwarze Pferd hält der Krieger an und deutet auf die Gasse daneben. Ich weiß, dass sich hinter dem Gebäude die Latrinen befinden, und flitze ohne ein Wort los, wundere mich jedoch darüber, dass der Krieger das auch zu wissen scheint. Vielleicht ist es nicht das erste Mal, dass er in Naarel ist. Zumindest hat er sich eins der besseren Gasthäuser ausgesucht. Als ich zurück zum Eingang komme, steht der Krieger noch davor und wartet auf mich. Gemeinsam betreten wir das Gasthaus, wo er sich an einen kleinen Tisch in der Nähe des Fensters setzt, das auf die Straße hinauszeigt. Mit seiner Hand bedeutet er mir, ebenfalls Platz zu nehmen. Ich bin darum bemüht, mich nicht wie ein Sack Mehl auf den Stuhl fallen zu lassen. Ich habe auch meinen Stolz.
Nach der Kälte kommt mir der große Raum viel zu warm und stickig vor. Ich löse mein Tuch und bin mir des Blickes bewusst, mit dem der Krieger mich gründlich mustert. Dann entschuldigt er sich und geht zur Theke. Ich reibe meine Hände aneinander, um das Gefühl in ihnen wieder zu erlangen. Meine Fingerspitzen sind blau angelaufen, aber zumindest kann ich sie noch bewegen, wie ich erleichtert feststelle.
Der Krieger kommt zurück und stellt einen dampfenden Becher vor mir ab. Ich kann den starken, traditionellen Tee riechen, den ich gerne mag, aber den wir im Heim nur selten bekommen haben. Er hat sich ebenfalls einen Tee mitgebracht und sitzt mir nun wieder gegenüber. Ich strecke meine Hände nach dem Becher aus und muss aufpassen, mich nicht zu verbrennen. Wie gut die Hitze tut!
»Ich heiße Aaron Thalos«, sagt der Krieger mit seiner tiefen Stimme, ohne den Blick von mir abzuwenden.
Seine Augen sind von einem dunklen Blau und stechen hinter der weißlichen Maske deutlich hervor. Seine schulterlangen, dunkelbraunen Haare trägt er zu einem lockeren Zopf gebunden.
Ich nicke. Soll ich ihm meinen Namen sagen? Schließlich weiß er diesen bereits aus dem Bericht über mich. Ich entscheide mich zu schweigen.
Ein junger Mann stellt zwei große Schüsseln mit Eintopf vor uns ab. Ich kenne ihn flüchtig, weil auch er ein Heimkind gewesen ist und einige Jahre vor mir verkauft wurde. Seine Augen wandern zwischen mir und dem Krieger hin und her, als könnte er nicht glauben, was er sieht.
»Das ist alles«, sagt Aaron bestimmt, und der junge Mann, der auf den Namen Ovin hört, zieht ab.
Ich klammere mich an meinen Becher, weil mir nichts Besseres einfällt. Meine Hände sind mittlerweile rot, dennoch lasse ich nicht los. Die ganze Situation erscheint mir irreal, und ich habe keine Ahnung, wie ich mich verhalten soll.
»In deinem Bericht steht nichts über deine Reitkünste«, sagt Aaron nach einer Weile.
Er ist bereits mit seinem Eintopf beschäftigt, während ich noch versuche, das Geschehen zu verarbeiten und warm zu werden. Ich würde gerne auf meine schnippische Art antworten, aber alles, was ich hervorbringe, ist: »Ich kann nicht reiten.«
Aaron nickt und isst weiter. Es ist mir unmöglich, von seinem maskierten Gesicht abzulesen, was er von meiner Antwort hält.
Ich hoffe bloß, dass er nicht vorhat, die Strecke zum Pass oder zum Südtor auf dem Rücken eines Pferdes zurückzulegen. Nicht nur, dass ich nicht reiten kann, ich habe panische Angst vor den Viechern. Vor einigen Jahren hat ein wild gewordenes Kutschenpferd ein Heimkind vor meinen Augen niedergetrampelt. Der Anblick hat mich wochenlang verfolgt. Wenn ich darüber nachdenke, treten die Bilder viel zu deutlich wieder vor mein inneres Auge, also lenke ich mich mit den realen Dingen vor mir ab.
Es ist faszinierend, wie sich Aarons Maske beim Essen bewegt. Ich habe bisher noch nie eine Kriegermaske aus der Nähe gesehen und ich kann nicht anders, als sie wieder und wieder anzustarren, wobei ich versuche, es nicht allzu offen zu zeigen. Die Maske wirkt wie aus Glas, in das ein feiner, weißer Nebel eingesperrt ist. Sie ist bis zu einem gewissen Grad beweglich und passt sich den darunter liegenden Zügen an. Und was mich wirklich interessiert: Wächst eigentlich keinem der Krieger ein Bart?
»Iss«, sagt Aaron, aber klingt nicht unfreundlich. Ich wende den Blick ab und kann nicht verhindern, dass mir das Blut in die Wangen schießt. Mein Starren war wohl doch offensichtlicher, als ich dachte. »Wir haben einen langen Weg vor uns, Aura.«
Er rollt das R beim Sprechen ganz leicht, was meinem Namen einen exotischen Klang verleiht. Ich nehme meinen Löffel und beginne zu essen. Für einen Moment hatte ich vergessen, wie hungrig ich bin, aber jetzt muss ich mich beherrschen, nicht die Schüssel aufzunehmen und die Brühe direkt daraus zu trinken.
Wo Nel und Tilly und die anderen wohl gerade sind? Ich wünsche mir, ich könnte Yvon davon berichten, dass ich von einem Krieger gekauft worden bin. Ich, die aufmüpfige Aura, der seit Monaten gesagt wurde, dass mich kein respektabler Mann kaufen wird, wenn ich mein Verhalten nicht bessere. Ich kann mir gut vorstellen, wie Yvon bei dieser Neuigkeit den Kopf schütteln würde, ein leichtes Grinsen auf seinen Zügen.
Mir liegt auf der Zunge, Aaron zu fragen, warum er sich ausgerechnet für mich entschieden hat, allerdings bin ich nicht in der Position, diese Frage zu stellen.
»Sind das alle Kleidungsstücke, die du besitzt?«, will er wissen, nachdem er seine Schüssel geleert hat.
Ich nicke und fische mit meinem Löffel ein Stück Gemüse aus meiner Suppe. Ich bin nicht sicher, worum es sich dabei handelt, aber bei Essen bin ich noch nie wählerisch gewesen. Dann sehe ich an mir herunter auf meine Kleidung. Alles aus meiner Kiste, was ich mir heute Morgen nicht angezogen habe, hat die Heimleitung an sich genommen, um es einem anderen Kind zu geben. Inklusive der Kiste.
»Ist dir nicht kalt?«
»Gerade nicht. Draußen auf dem Podium war es eisig«, antworte ich ehrlich und muss bei der Erinnerung ein Schaudern unterdrücken.
Der Verkauf war erniedrigender gewesen, als ich es mir vorgestellt hatte, und ist nichts, woran ich je wieder denken möchte. Auch wenn ich weiß, dass das unmöglich sein wird, denn dieser Tag hat sich bereits in mein Gedächtnis gebrannt.
Ich schaffe meinen Eintopf nicht. Entweder liegt es an der Aufregung oder daran, dass ich eine derart große Portion nicht gewohnt bin. Mit Bedauern sehe ich in meine Schüssel, kann mich aber beim besten Willen nicht zu einem weiteren Bissen bewegen.
»Bist du fertig?«, fragt Aaron, als ich nur noch Gemüsestücke hin und her schiebe. Ich nicke und lege den Löffel zur Seite. »Dann komm.«
In meinem Körper hat sich eine angenehme Wärme ausgebreitet, und ich habe keine Lust, wieder hinaus in die Kälte zu müssen, aber ich bin auch neugierig, wohin es nun für mich gehen wird, also springe ich von meinem Stuhl auf und folge meinem neuen Herrn.
Ich habe damit gerechnet, dass wir uns direkt auf den Heimweg machen, aber Aaron führt mich durch die Stadt zu Warm und Weit, einem Bekleidungsgeschäft, das ich bisher nur von außen gesehen habe. Dort verlangt er nach einem Umhang für mich. Ich erwarte, dass mich der angesprochene Mann naserümpfend anschauen wird, jedoch behandelt er mich, als wäre ich ein Mitglied der gehobenen Gesellschaft. Er hat etliche wollene Umhänge vorrätig, die mir von der Länge her passen würden.
»Such dir den aus, der dir gefällt«, sagt Aaron und ich traue meinen Ohren nicht. Ich sehe zu ihm, um mich zu vergewissern, dass ich richtig verstanden habe. »Sieh nicht mich an, sondern die Umhänge. Ich will heute noch los«, meint er, aber es liegt keine Strenge in seiner Stimme.
Also lasse ich meine vor Aufregung zitternden Hände über die Stoffe gleiten und entscheide mich für einen dunkelgrünen Umhang, der mit einer bronzenen Schnalle zusammengehalten wird. Aaron kauft mir passend dazu Handschuhe. Dann darf ich mir in einem weiteren Laden feste Stiefel aussuchen. Nur zu gerne lasse ich meine abgelaufenen und löchrigen Schuhe zurück.
»Das muss für den Weg reichen. Alles andere kaufen wir dir am Pass«, bestimmt Aaron, und wir laufen gemeinsam in Richtung des östlichen Stadttores.
Ich versuche mich zu bedanken, aber die Worte kommen verquer aus meinem Mund. Sprachlich bin ich nicht die Beste. Aaron winkt ab. Der Preis für die Kleidung, der mir unglaublich hoch vorkommt, scheint ihn kaum zu interessieren. Die Freude über meine neuen Schätze hält so lange an, bis sich Aaron sein Pferd aus dem Stall in der Nähe der Stadtmauer holen lässt. Das Tier ist pechschwarz und so riesig, dass ich das Gefühl habe, ohne Probleme unter dessen Bauch hindurch laufen zu können. Nicht, dass ich das jemals ausprobieren würde.
»Das ist Donnerschlag«, erklärt Aaron und streicht dem Pferd über die Flanke. Sein Stolz ist deutlich zu hören. Ich hingegen spüre den Eintopf langsam wieder hochkommen. »Da du nicht reiten kannst, werden wir beide zusammen reiten«, sagt er, verstaut etwas in den Satteltaschen und wendet sich dann wieder zu mir. »Bist du bereit?«
Nein. Ich bin für nichts bereit, was heute passiert ist, nicke trotzdem und trete neben Donnerschlag. Im Stillen bete ich darum, dass er mich nicht direkt niedertrampelt. Aaron umfasst meine Hüfte und hebt mich ohne Mühe auf den Rücken des Biestes. Donnerschlag wiehert und schüttelt seinen Kopf, was meine Panik steigert. Mein Kleid ist für den Sitz auf dem Pferd völlig unpraktisch. Ich versuche, meinen Umhang über die Stellen zu ziehen, an denen mein Kleid hochgerutscht ist. Wenn ich doch wenigstens eine Hose darunter tragen würde! Selbst über eine Strumpfhose hätte ich mich gefreut, auch wenn ich diese normalerweise verabscheue. Jedoch hat der Heimleiter es nicht für nötig gehalten, uns Mädchen damit auszustatten. Nicht einmal im Winter, wenn wir es bitter nötig haben.
Aaron schwingt sich hinter mir in den Sattel, greift nach den Zügeln und treibt sein Pferd voran. Ich halte mich in der Mähne fest, so gut es geht. Allerdings sitzen wir derart nah beieinander, dass ich nicht das Gefühl habe in Gefahr zu sein, hinunterzufallen. Die gesamte Situation ist mir furchtbar unangenehm.
»Versuche, dich der Bewegung von Donnerschlag anzupassen«, sagt Aaron.
Der hat gut reden. Kaum sind wir durch das Stadttor geritten, wird mein Hintern schon taub. Mein Magen rumort bedenklich, und ich schließe für einen Moment die Augen, um mich zu beruhigen. Das gibt mir jedoch das Gefühl, gar keine Kontrolle über meine Situation zu haben, also öffne ich sie rasch wieder und befehle meinem Magen, Ruhe zu geben.
Außerhalb der Stadtmauern wuchert Naarel weiter wie ein unbehandeltes Geschwür. Schon lange ist nicht mehr genug Platz innerhalb der Mauern, und daher entstehen Häuser und Hütten um die ursprüngliche Stadt herum. Mittlerweile würde es sich lohnen, eine neue Mauer zu bauen, so groß sind die Außenbezirke geworden. Als wir sie hinter uns lassen, bin ich weiter weg von meinem ehemaligen Zuhause, als ich es jemals war.
»Wie lange dauert es bis zum Pass?«, wage ich nach einer Weile zu fragen.
Ich habe keine Ahnung, ob ich Aaron einfach ansprechen darf, aber er antwortet mir prompt: »Es sind drei Tagesreisen. Eigentlich würde es länger dauern, wenn Donnerschlag nicht ausdauernder und schneller als die meisten gewöhnlichen Pferde wäre«, erklärt er.
Ich möchte weinen. Oder meinen Frust laut hinaus in die Welt schreien. Drei Tage auf diesem Biest kommen mir jetzt schon vor wie drei Tage zu viel. Warum gerade ich? Hätte er nicht ein anderes Mädchen kaufen können? Ich klammere mich in die Mähne und beiße die Zähne zusammen. Ich habe schon einiges in meinem Leben ausgehalten. Da werde ich diesen Ritt doch auch schaffen. Oder nicht?
3
Eigentlich hätte ich begeistert sein müssen, immerhin kann ich mir endlich ein Bild davon machen, wie die Welt außerhalb von Naarel aussieht. Mehrere Gründe hindern mich allerdings daran. Erstens ist mir schon wieder kalt. Da hilft auch mein neuer Umhang nicht, wenn mir der Wind von vorne ins Gesicht bläst und meine Nase einfrieren lässt, egal wie hoch ich mein Tuch ziehe. Zweitens hocke ich noch auf diesem riesigen Biest, von dem ich überzeugt bin, dass es mich, würde ich allein auf ihm sitzen, innerhalb von Sekunden in den Dreck befördern würde. Drittens bin ich schrecklich müde. Es ist ein langer Tag gewesen, und die Aussicht auf viele weitere Stunden auf der Straße deprimiert mich. Und als letzten Grund kann ich nur Aaron nennen. Zuerst habe ich gedacht, nach ein oder zwei Stunden würde es mir nichts mehr ausmachen, so nah bei ihm zu sitzen, aber da lag ich falsch. Seine Präsenz lässt sich nicht verleugnen. Er umschließt mich mit seinen Armen und hält die Zügel locker in der Hand, als wäre das alles ein Kinderspiel.
Ich versuche mich mit der Landschaft und den anderen Reisenden um uns herum abzulenken, was nicht funktioniert. Anstatt meine Gelegenheit zu nutzen, endlich mehr von diesem Land zu sehen, starre ich auf Aarons Hände vor mir und wünsche mich weit weg. Ans Meer zum Beispiel, auch wenn ich das nur aus Geschichten kenne. Ich kenne so vieles nur aus Erzählungen und habe mich damit abgefunden, dass ich Dinge und Orte niemals mit eigenen Augen sehen werde. Nur der Gedanke ans Meer füllt mich mit Bedauern. Zu gerne würde ich die endlose Weite des blauen Ozeans selbst erleben können, aber das wird nun nie geschehen.
Wie die Berge um den Pass herum aussehen werden? Natürlich habe ich auch von Gebirgen nur gehört, aber diese haben mich nie so angesprochen, wie es die Erzählungen vom Meer getan haben. Ob Yvon den Ozean mag? Oder träumt er von Bergen? Ich schüttele den Gedanken ab, weil ich nicht darüber nachdenken will, dass ich Yvon nie wiedersehen werde, sondern konzentriere mich stattdessen wieder auf meine Umgebung.
Meine Hände schmerzen von meinem verkrampften Griff, dennoch wage ich es nicht, ihn zu lösen. Wie peinlich es wäre, wenn ich abrutschen würde und Aaron mich auffangen müsste! Ich bin sicher, dass wir bereits einen merkwürdigen Anblick für alle anderen Reisenden bieten, da muss ich nicht noch Aufmerksamkeit auf uns lenken, indem ich vom Pferd stürze.
Drei Tagesreisen. Ich frage mich, wie Yvon damals zur Küste gelangt ist. Hatte er auch reiten müssen? Oder konnte er in einer Kutsche fahren? Hätte das Schicksal nicht ein bisschen netter zu uns sein können? Und warum sind meine Gedanken schon wieder zu Yvon gewandert, wenn ich das doch gar nicht will? Ich unterdrücke ein Seufzen und starre weiter auf meine Hände.
Als die Sonne untergeht, halten wir für eine kurze Pause. Anstatt elegant vom Pferd zu steigen, wie Aaron es macht, falle ich mehr oder minder hinunter und habe keine Ahnung, wie ich jemals wieder auf dieses Biest aufsteigen soll. Meine Beine zittern unkontrolliert, meine Arme sind verkrampft und über mein Hinterteil will ich gar nicht erst reden.
»Beweg dich ein bisschen«, rät Aaron. »Das lockert die Muskeln.«
Ist der Ritt für ihn überhaupt nicht anstrengend? Ich schätze seinen Rat, aber so wie es sich gerade anfühlt, werden sich meine Muskeln nie wieder lockern. Trotzdem versuche ich seinem Beispiel zu folgen und hampele unbeholfen herum. Seine Maske zeigt es nicht an, aber ich vermute, dass er mich gerade auslacht. Oder ist etwas Derartiges unter der Würde eines Kriegers? Aaron reicht mir einen Schlauch mit schwachem Wein, ein Stück Brot und ein ebenso großes Stück Hartkäse.
»Es tut mir leid, dass die Reise für dich derart unkomfortabel ist«, sagt er.
Ich bin maßlos verwirrt. Alles, was ich bisher über das Sklavendasein gelernt habe, wirft er über den Haufen. Ich habe wunderschöne neue Kleidung bekommen, genauso wie ausreichend Nahrung. Und nun entschuldigt sich mein Herr bei mir?
»Wenn ich vorher gewusst hätte, dass du nicht reiten kannst, hätte ich eine Kutsche organisiert.«
Kriegern wird doch nachgesagt, völlig gefühllos und eiskalt zu sein. Gibt es noch mehr, was ich mein Leben lang als Tatsache akzeptiert habe und das überhaupt nicht wahr ist?
»Mir tut es leid, dass ich nicht reiten kann. Bitte verzeiht mir, dass ich Euch bei der Reise behindere.«
Etwas Besseres fällt mir nicht ein. Ich bin nicht sonderlich gut im Austauschen von Höflichkeiten, aber offensichtlich reicht Aaron meine hölzerne Antwort. Ich nehme mir vor, zumindest meine Angst vor Donnerschlag in den nächsten Tagen zu verlieren. Sobald ich dem blöden Vieh zu nahe komme, fängt es an, unruhig zu werden. Sicher bemerkt es meine Panik und benimmt sich mit Absicht furchterregender als es ohnehin schon ist. Können Pferde so gemein und berechnend sein? Donnerschlags massiger Kopf fährt herum, als ich neben ihn trete. Er schnappt nicht richtig nach mir, trotzdem fühle ich mich bedroht. Das kann ja was werden mit uns beiden.
Richtig schlimm wird es allerdings erst, als Aaron mir hilft, wieder aufs Pferd zu steigen. Meine Beine sind vom ersten Teil der Reise völlig unbrauchbar, und ich stelle mich wirklich ungeschickt an. Es dauert eine Weile, bis wir beide auf Donnerschlag sitzen und weiterreiten können. Glücklicherweise kommentiert Aaron meine Unfähigkeit mit keinem Wort.
Ohne die Sonne ist es wesentlich kälter, und ich ziehe den Kopf ein, um dem Wind möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Obwohl ich erschöpft bin, habe ich das Gefühl, ich könnte niemals einschlafen, aber auch da liege ich falsch.
Ich wache auf, als der Himmel sich langsam aufhellt. Ich lehne an Aaron,der einen Arm um mich gelegt hat, damit ich nicht wegrutschen kann. Für einen winzigen Moment ist mein Leben in Ordnung. Dann trifft mich die Kälte, und meine schmerzenden Gliedmaßen melden sich lautstark. Ich zucke zusammen und versuche, Abstand zwischen uns zu gewinnen, was auf dem Pferderücken unmöglich ist.
Aaron wartet, bis ich meine zitternden Hände wieder in der Mähne vergraben habe, dann lässt er mich los und greift nach dem Zügel. Zum Glück kann er mein rotes Gesicht nicht sehen. Das einzig Positive an der ganzen Sache ist, dass ich den größten Teil der Nacht verschlafen habe. Ich muss weitaus erschöpfter gewesen sein, als ich gedacht habe.
»Heute Nacht schlafen wir in einem richtigen Bett«, sagt Aaron, und ich frage mich, ob er überhaupt nicht müde ist.
Während die Sonne langsam über den Horizont kriecht, kann ich nicht verhindern, dass mich der Anblick unserer Umgebung verzaubert. Naarel ist eine der größten Städte des Landes. Dort kenne ich mich im Gewirr der Gassen perfekt aus. Ich bin den Rauch der Kamine gewohnt, der insbesondere im Winter die Stadt in eine niemals endende Wolke hüllt. Ich kenne alle Gerüche, die guten wie von frisch gebackenem Brot sowie jegliche schlechten, schließlich leben in Naarel tausende Menschen auf engstem Raum zusammen. Es ist stets laut, auch bei Nacht. Obwohl ich fünfzehn Jahre dort gelebt habe, entdeckte ich bis zum Schluss immer etwas Neues an der Stadt.
Jetzt sehe ich nur Natur. Wir reiten über einen breiten Weg, der links und rechts von brachliegenden Feldern gesäumt ist. Gelegentlich reckt sich ein kahler Baum in den Himmel, die leeren Äste ausgestreckt wie um Hilfe flehende Hände. Ein leichter Nebel liegt über den Feldern und gibt der ganzen Szenerie einen gespenstischen Anblick. Es ist still, abgesehen von dem Getrappel Donnerschlags und den Rufen einiger Vögel, die über uns kreisen.
»Hast du Naarel zuvor schon einmal verlassen?«, fragt Aaron. Er muss meinen umherschweifenden Blick bemerkt haben.
»Noch nie«, gebe ich zu Antwort.
Wieviel er wohl schon von der Welt gesehen hat? Reisen Krieger viel oder bleiben sie die meiste Zeit am Pass oder Südtor, je nachdem, wo sie stationiert sind? Am liebsten würde ich Aaron all diese Fragen stellen, aber ich halte meinen Mund und sehe mich weiter um. Auch wenn er bisher freundlich zu mir gewesen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er es begrüßen würde, wenn ich ihn mit Fragen löchere.
Ich kann nicht glauben, wie friedlich es ist. Auch wenn ich unsere Art der Reise mit jeder Sekunde verfluche, bin ich mit einem Mal dankbar, dass ich von niemandem in der Stadt gekauft wurde. Ohne Yvon hängt mein Herz nicht an Naarel, und die meisten meiner Erinnerungen an die Stadt sind von negativer Art. Hatte ich am Tag zuvor keinen Blick für die kühle Schönheit um mich herum übriggehabt, versuche ich jetzt, alles ganz genau zu betrachten.
»Bist du traurig, dass du deine Heimatstadt verlassen musst?«, fragt Aaron.
»Nein. Dort gibt es nichts, wofür es sich zu bleiben gelohnt hätte.«
Ich frage mich, wo er aufgewachsen ist. Außer seinem Namen und seiner Berufung weiß ich nichts über ihn. Wie seltsam, einem komplett Fremden körperlich so nahe zu sein.
Bei Yvon hat mir das nie etwas ausgemacht. Wir waren einander so vertraut, als wären wir zwei Hälften einer Person. Ich wusste stets, was in seinem Kopf vorging und umgekehrt. Als er die Stadt vor einem Jahr verließ, hatte ich das Gefühl, nicht nur ihn, sondern auch einen Teil von mir zu verlieren.
Yvon wurde erst mit fünf Jahren ins Heim gebracht, nachdem seine Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen waren. Damals war ich neidisch gewesen, weil er sie wenigstens ein bisschen gekannt hatte, während ich an meine eigenen Eltern keinerlei Erinnerungen besaß.
Als ich älter wurde, ist mir aufgegangen, dass es für ihn vermutlich wesentlich schlimmer gewesen sein musste als für mich. Mir war, seit ich denken konnte, bewusst gewesen, was aus mir werden würde, während Yvon das Versprechen eines normalen Lebens hatte, bis der Unfalltod seiner Eltern ihm diese Möglichkeit entrissen hatte. Er hat nie darüber gesprochen, und ich habe nicht gefragt, wie er sich in Bezug auf seine Familie fühlt. Ändern konnten wir an unserer Situation ja doch nichts, also verschwendeten wir wenig Zeit mit Grübeleien darüber, wie unser Leben ausgesehen hätte, wenn wir nicht als Waisen geendet wären.
Ich weiß noch ganz genau, wie Yvon einige Tage nach seiner Ankunft im Heim von einem der größeren Jungen auf einen Botengang mitgenommen wurde. Zum Dank erhielt er einen Apfel, den er wie einen Schatz ins Heim trug. Ich war im Garten damit beschäftigt, Unkraut aus der Erde zu reißen, eine Arbeit, die kaum jemand erledigen wollte. Mir machte es nichts aus, ich war gerne im Garten. Dort gab es immer viel zu sehen! Auch später habe ich mich oftmals freiwillig für die Gartenarbeit gemeldet, denn dort ließen sie mich wenigstens in Ruhe. An diesem Tag kam Yvon mit dem Apfel zu mir. Wir hatten zuvor kein Wort miteinander gewechselt, dennoch lief er ohne zu zögern auf mich zu und hielt mir den Apfel hin.
»Möchtest du mit mir teilen?«, fragte er mit seiner damals glockenhellen Stimme, und natürlich wollte ich das.
Damit fand ich den besten und eigentlich einzigen Freund, den ich habe. Und von dem ich mich mit jeder Sekunde auf Donnerschlag weiter entferne. Großartig. Jetzt hat der Wind meine Augen so sehr gereizt, dass sie zu tränen beginnen.
Die letzten Bauernhäuser, die ich in einiger Entfernung von der Straße sehen konnte, haben wir lange hinter uns gelassen, und auch die Felder werden weniger. Dafür nimmt der Baumbestand zu, und bald reiten wir durch einen dichten Tannenwald. Es beginnt, sacht zu schneien, aber unter den Bäumen kommt kaum Schnee bei uns an.
Der Geruch in der Luft ändert sich ständig. Nach dem Gestank der Stadt gewöhnt sich meine Nase langsam an andere Gerüche. Der Nadelwald ist in dieser Hinsicht überwältigend, also schließe ich meine Augen und atme tief ein. Der Duft von Harz. Der Geruch von Donnerschlag und von meinem neuen Mantel. Aaron, der nach verschiedenen Dingen riecht, nach Leder und Gewürzen und ein wenig nach Mann, um es höflich auszudrücken. Außerdem kann ich Feuer riechen, oder eher gesagt, den beißenden Rauch davon.
»Feuer?« Ich öffne verwirrt die Augen. »Gibt es hier in der Nähe eine Siedlung?«
Der Baumbestand ist so dicht, dass ich mir in dem Wald kein Dorf vorstellen kann, aber ich sehe durch die Bäume nicht viel, also kann sich dahinter alles Mögliche verbergen.
»Nein. Vielleicht sind es andere Reisende.«
Vielleicht auch nicht, ist alles, was mir einfällt, als ein Pfeil dicht an meinem Kopf vorbeischwirrt. Ich bin nicht sicher, ob es ein Warnschuss ist oder das Anzeichen für einen unfähigen Schützen. Wer ist denn dumm genug, einen Krieger anzugreifen? Mehr Zeit für Überlegungen habe ich nicht, denn Aaron drückt mir die Zügel in die Hand und rutscht von Donnerschlag. Dann versetzt er dem Biest einen Schlag und es galoppiert los, mit mir auf dem Rücken.
»Verschwinde von hier!«, ruft er mir hinterher.
Ich klammere mich panisch an die Zügel und finde, dass sie mir überhaupt keinen Halt geben. Der eben noch friedliche Wald rast nun an mir vorbei, und ich sehe mich im Geiste in einem hohen Bogen vom Pferd fliegen und gegen einen Baum klatschen.
Habe ich mich nicht immer damit gebrüstet, die Taffe zu sein? Diejenige, die niemals Angst zeigt? Ich kann deutlich Kampflärm hinter mir hören und dankenswerterweise setzt mein Verstand wieder ein. Ich ziehe an den Zügeln, aber Donnerschlag schüttelt nur unwillig den Kopf und galoppiert weiter. Na schön, du blödes Vieh. Mein Plan war, anzuhalten, langsam umzudrehen und zu Aaron zurückzureiten, um ihm zu helfen, aber Donnerschlag lässt mich nicht. Dann eben eine Kurve durchs Unterholz.
Ich reiße am linken Zügel,worauf Donnerschlag in die vorgesehene Richtung ausbricht. Ein Ast schlägt mir quer durchs Gesicht, und ich kann nicht verhindern, vor Schmerz aufzuschreien. Dem Gaul scheint das alles nichts auszumachen. Er prescht vorwärts, glücklicherweise zurück auf den Weg und zu Aaron. Blut läuft mir in die Augen, und ich versuche, es mit meinem Arm wegzuwischen, ohne die Zügel loslassen zu müssen. Ich bin nicht sonderlich erfolgreich und gebe auf. Blinzelnd stürmen wir auf mein Ziel zu. Aaron ist von drei Personen umringt, eine vierte liegt blutend auf dem Boden.
Ich schreie. Etwas Besseres fällt mir nicht ein, und ich kann nur hoffen, dass Aaron geschickt genug ist, um aus dem Weg zu springen. Ich kann nichts sehen, als Donnerschlag jemanden überrennt, ich höre nur dessen schmerzerfülltes Schreien. Das Vieh rast einen Moment weiter, dann stellt es sich auf die Hinterbeine und wirft mich zu Boden. Ich schlage mit dem Kopf auf, und alles wird schwarz um mich herum, allerdings nicht bevor ich merke, wie ein brennender Schmerz in meinem Arm explodiert.
Als ich aufwache, wünsche ich mir im selben Augenblick, ich würde wieder ohnmächtig werden. Die Wunde in meinem Gesicht sendet stechende Schmerzen, und mein Hinterkopf ist genauso schlimm. Meinem Hinterteil und Rücken ging es auch schon besser. Mein rechter Arm fühlt sich an, als wäre er gebrochen. Übelkeit steigt in mir auf.
»Das war ganz schön dumm von dir.« Aaron drückt mir eine Ladung Schnee ins Gesicht, was mich erneut aufschreien lässt. »Sei still. Ich will die Wunde säubern.«
Also beiße ich mir auf die Lippe.
»Wie heißt du?«, fragt er dann.
»Was?«
»Ich will deinen Namen wissen, um zu testen, dass deinem Kopf nichts passiert ist.«
»Aura«, antworte ich. Meinem Gedächtnis geht es gut.
»Wie heiße ich?«, fragt er weiter.
»Aaron Thalos.«
»Und mein Pferd?«
»Donnerschlag. Ich bin fünfzehn Jahre alt, Ihr habt mich in Naarel gekauft, und wir sind auf dem Weg zum Pass. Der Kopf tut nur weh, ansonsten ist mit ihm alles in Ordnung.«
Der Boden ist eisig kalt, daher rappele ich mich auf, was sich mit dem kaputten Arm als echte Herausforderung entpuppt. Meine Übelkeit nimmt schlagartig zu. Ich bin nicht sicher, ob es an den Schmerzen liegt oder an dem Anblick, der sich mir bietet. Die Angreifer liegen in Blutlachen am Boden, einige von ihnen haben im Kampf Gliedmaßen verloren, die nun abgetrennt von den Körpern zu finden sind.
Es ist nicht so, als hätte ich noch nie eine Leiche gesehen. Yvon und ich haben uns oft zu dem Platz geschlichen, an dem sie die zum Tode Verurteilten nach deren Bestrafung ausstellten, als Warnung für alle anderen. Die abgetrennten Köpfe und kopflosen Körper übten eine morbide Faszination auf uns aus. Die ganze Angelegenheit war jedoch meist viel weniger blutig als das, was sich gerade vor mir befindet.
»Wer sind diese Männer?«
»Heimatlose. Diebe und Mörder. Mit denen wäre ich auch allein fertig geworden.« Natürlich wäre er das. Wieso bin ich auf die dumme Idee gekommen, nicht seinem Befehl zu folgen?
»Es tut mir leid«, nuschele ich beschämt. Aaron lässt meine Entschuldigung unkommentiert, was meine Schuldgefühle steigert.
Donnerschlag steht an einen Ast gebunden in der Nähe und beäugt mich. Ihm scheint die ganze Aktion nichts ausgemacht zu haben. Aaron legt die Männer in einer Reihe an den Wegesrand und macht nicht den Eindruck, als würde ihn das viele Blut stören. Wahrscheinlich ist er derartige Anblicke gewohnt. Aaron holt eine weitere Leiche aus dem Unterholz. Ich weiß nicht, wie er auch diesen Mann getötet hat, aber er hat es getan. Dann wirft er eine simple Armbrust neben den leblosen Körper.
»Damit hat er auf dich geschossen. Sie müssen ziemlich verzweifelt gewesen sein, einen Krieger anzugreifen.«
Aaron wirkt eher nachdenklich als verärgert oder aufgewühlt.
Mit zwei Ästen und seinem Schal bringt er meinen rechten Arm in seine korrekte Stellung zurück, was von einem fiesen Knacken begleitet wird. Ich beiße mir wieder auf die Lippe, bis sie zu bluten beginnt. Trotzdem kann ich ein Wimmern nicht verhindern, das er glücklicherweise unkommentiert lässt.
»Wenn ich dich das nächste Mal wegschicke oder dir sage, dass du rennen sollst, dann machst du das auch, verstanden?«
Ich nicke mit hängendem Kopf.
»Das war wirklich dumm von dir. Aber auch mutig. Du hast mich überrascht, Aura.«
Ich mich selbst auch. Vielleicht war meine Aktion doch gar nicht so schlecht. Kurz darauf bereue ich jedoch alles, was in den letzten Minuten geschehen ist. Als ich nämlich wieder auf Donnerschlag hocke, möchte ich nur noch weinen, weil mir alles wehtut und der Pferderücken so unbequem ist.
Ich muss gestehen, dass ich auf dem weiteren Weg mehrfach das Bewusstsein verliere. Der Sturz auf den Kopf scheint schlimmer gewesen zu sein, als ich zunächst angenommen habe. Übergeben muss ich mich auch zweimal, glücklicherweise beide Male zur Seite weg, aber ich schäme mich trotzdem und wäre nicht im Geringsten erstaunt, wenn Aaron mich ohne Erklärung am Straßenrand zurücklassen würde. Ich an seiner Stelle hätte es getan.
Der Schneefall wird stärker und ich ziehe die Kapuze meines Umhangs so weit ins Gesicht, wie es möglich ist. Jetzt bin dankbar dafür, dass Aarons Arme mir Halt geben, da ich meinen rechten Arm nicht nutzen kann und ich das Gefühl habe, meine linke Hand allein kann mich nicht auf dem Pferd halten.
Das Leben im Heim ist nicht gerade von wunderbaren Momenten und der Leichtigkeit des Seins geprägt gewesen, trotzdem habe ich mich noch nie so schrecklich gefühlt wie zu diesem Zeitpunkt.
»Wir sind bald da«, versucht Aaron mich aufzumuntern, der vermutlich an meiner zusammengesunkenen Gestalt meinen Zustand ablesen kann, und erklärt mir, wohin wir eigentlich reiten.
Zwischen den einzelnen Städten des Landes gibt es nur wenige Straßen. Auf dem Weg zum Pass existiert eine Schnittstelle, an der sich mehrere solcher Straßen kreuzen. Dort ist ein kleines Dörfchen entstanden, das im Grunde nur aus Gasthäusern und anderen Einrichtungen besteht, die der Unterhaltung von Reisenden dienen.
»Ein Höllenloch. Allerdings sinnvoll, um Neuigkeiten aus dem Land zu erfahren«, erklärt Aaron vergnügt.
Ich kann nicht behaupten, dass ich mich sonderlich freue, ausgerechnet dort die Nacht zu verbringen. Dann fallen mir wieder die leblosen Körper ein, die wir am Straßenrand zurückgelassen haben. Solange ich in Aarons Nähe bleibe, sollte alles in Ordnung sein. Das rede ich mir zumindest ein, denn mein Kopf kann sich nicht mit wilden Gedanken über mögliche Ausgänge des Abends beschäftigen. Dafür bin ich zu erschöpft.
Rauch kündigt die Nähe des Dörfchens an, das nicht einmal einen richtigen Namen trägt, sondern von allen nur Durchgang genannt wird. Eine große Trauerweide steht einsam am Wegesrand. Erst auf den zweiten Blick bemerke ich ihren grausamen Schmuck. In ihren Ästen hängen an dünnen Seilen abgetrennte Hände, die sacht im Wind baumeln, während Schneeflocken um die Weide wirbeln.
»Durchgang besitzt seine eigenen Gesetze. Diebe können sie hier nicht ausstehen. Das sind alles Hände von denen, die beim Stehlen erwischt wurden«, erklärt Aaron und treibt Donnerschlag voran.
Längst ist der angenehme Duft nach Natur und Freiheit von dem Geruch des Dorfes verdrängt worden. Es stinkt nach vielen Menschen auf kleinem Raum, aber im gleichen Moment riecht es auch wunderbar nach Holzfeuer und warmem Essen.
Durchgang ist eine wilde Ansammlung von Gebäuden, die alle windschief wirken und auf mich den Eindruck machen, als hätte ein Kind sie entworfen und dann nach Lust und Laune weitere Teile angebaut. Es ist kaum jemand auf der Straße, denn mittlerweile ist der Schneefall zu einem Sturm geworden, daher beeilen wir uns, dass Donnerschlag einen Platz im Stall findet, und machen uns dann auf den Weg in das größte Gebäude.
Kaum sind wir durch die Tür, die bedenklich quietscht und über den Boden schabt, als jemand Aarons Namen ruft und er von mehreren Leuten umringt wird. Ich frage mich, wie oft er sich in dieser Gegend herumtreibt.
Ich folge ihm zum Wirt, bei dem Aaron Getränke für uns bestellt.
»He, Aaron, wer ist die Kleine?«, nuschelt einer der Männer betrunken und greift nach meinem Hinterteil. Ich hätte ihm eine gelangt, aber mein festgebundener Arm hindert mich an meinem Plan. Dafür reagiert Aaron.
»Das ist meine Sklavin. Also lasst die Finger von meinem Besitz, wenn Ihr nicht Eure Hand verlieren wollt.«
Er sagt es mit einer Kälte in der Stimme, die ich bisher bei ihm nicht gehört habe. Der Mann wird blass, als würde ihm erst jetzt aufgehen, was er da eigentlich macht. Rasch entschuldigt er sich und verschwindet in der Menge.
Ich lasse mich von Aaron in eine Ecke an einen schiefen Tisch verfrachten, kämpfe mich aus Umhang, Tuch und Handschuhen und freue mich darüber, dass die Wärme zurück in meinen Körper gelangt. Stimmen füllen den großen Raum. Aaron spricht mit einigen Männern, die alle danach aussehen, als könnten sie dringend ein Bad gebrauchen. Dann blickt er zu mir.
»Komm«, sagt er und bringt mich in ein kleines Zimmer. Dort waschen wir mir das restliche Blut aus dem Gesicht und den Haaren.
»Du musst noch ein wenig wachbleiben. Ich will sicher sein, dass mit dir alles in Ordnung ist,aber das geht nur, wenn du ansprechbar bleibst.«
Dabei bin ich hundemüde. Einigermaßen sauber, aber noch mit zotteligen Haaren und der Wunde im Gesicht laufen wir zurück. Viele Leute kommen zu Aaron an den Tisch, um mit ihm zu reden, aber ich kann ihnen nicht folgen. Ich halte meinen Becher mit heißem Wein in der linken Hand, während der rechte Arm unangenehm pocht und Schmerzwellen durch meinen Körper schickt. Wortfetzen dringen an meine Ohren, sie reden über Angriffe und Krieg, über den Pass, über die Diebesbanden, die sich im Land ausbreiten, über Ernten und Missstände in der Gesellschaft. Ich persönlich finde, der Tisch sieht verlockend und bequem aus. Ich werde meinen Kopf für einen winzigen Moment ablegen und die Augen schließen. Nur ganz kurz. Dann höre ich wieder zu. Versprochen.
4
Ich habe einen merkwürdigen Traum. Das allein ist schon bemerkenswert, denn eigentlich träume ich nie. Vielleicht ist mir deshalb sofort bewusst, dass ich unmöglich wach sein kann. Ich sitze in einer dunklen Kutsche, deren Fenster mit schweren roten Stoffen verhängt sind. Die Sitzbank ist aus Holz und daher sehr glatt. Ich werde unangenehm auf ihr umhergeschleudert und brauche einen Moment, um mein Gleichgewicht zu finden. Dann rutsche ich zu einem Fenster, schiebe den Stoff und das Glas zur Seite und strecke den Kopf hinaus.
Die Kutsche wird von einem dunkelbraunen, fast schwarzen Wesen gezogen, das nur geringfügig mit einem Pferd verglichen werden kann. Es verfügt über sechs Beine, und dort, wo die Hufe auf den steinernen Boden auftreffen, schlagen rote Funken in die Höhe. Aus dem Rücken der Bestie stechen weiße Knochenstücke empor, als hätte sie einmal Flügel gehabt, die dann abgerissen wurden. Der Kopf wirkt seltsam entstellt, als wären die Schädelknochen gebrochen und anschließend in der falschen Position wieder zusammengewachsen. Außerdem hat das Vieh zwei Hörner auf dem Kopf, dicht hinter den Ohren. Als es wiehert, stößt es dabei orangefarbenen Qualm aus dem Maul.
Bevor ich darüber nachdenken kann, wohin mich diese Höllenbestie verschleppt, höre ich einen durchdringenden Schrei vom Himmel. Ich habe Geschichten von Drachen gehört, mächtigen geflügelten Wesen, die angeblich vor hunderten von Jahren das Land terrorisiert haben. Jetzt fliegt einer davon genau über uns. Er bewegt seinen massigen Körper mit einer Leichtigkeit vorwärts, die ich ihm nicht zugetraut hätte. Mit dem nächsten Schrei stürzt er sich auf uns, öffnet sein Maul, und hüllt die Kutsche in eine Säule aus blauem Feuer. Ich brenne, alles um mich herum brennt! Gerade als ich das Gefühl habe, die Hitze nicht länger aushalten zu können, wache ich auf.
Unglücklicherweise brenne ich immer noch. Ich teile es Aaron mit, weil es mich zutiefst beunruhigt. Er gibt mir eine wirre Antwort, die ich nicht verstehe. Er wird schon merken, wenn ich in seinen Armen in Flammen aufgehe. Das hat er dann davon, dass er mir nicht zuhört. Ich schließe lieber wieder die Augen und versinke in Dunkelheit.
Als ich sie das nächste Mal öffne, frage ich ihn, wo eigentlich das Pferd mit den Hörnern und der große Drache hin sind. Aaron ist davon überzeugt, dass ich sie mir nur eingebildet habe, was nicht sein kann, denn sonst würde ich ja nicht brennen. Der hat gut reden! Im nächsten Moment habe ich schon vergessen, warum ich eigentlich sauer auf ihn bin. Der Himmel glüht blutrot. Ob der Drache dort oben seine Runden fliegt und ihn in Brand setzt? Dann müsste der Himmel allerdings blau sein. Ich bin schrecklich durcheinander.
»Halte durch, Aura. Wir sind bald da.«
Bevor ich fragen kann, wo wir dieses Mal ankommen, verliere ich wieder das Bewusstsein.
Und dann ist mir kalt. So lange habe ich innerlich gebrannt, dass ich diese Hitze nun vermisse. Es ist dunkel um mich herum, mein Bett fühlt sich nicht wie mein Bett an und ich brauche eine ganze Weile, um zu realisieren, dass ich nicht im Heim bin. Abrupt setze ich mich auf. Meine Augen gewöhnen sich langsam an das Schummerlicht, so dass ich zumindest meine Umgebung erkennen kann. Ich befinde mich in einer kleinen Kammer, in der außer dem Bett eine Kleidertruhe, ein Tisch mit Stuhl und eine Feuerstelle sind, in der die Reste eines Feuers glimmen. Diese tragen kaum dazu bei, den Raum zu erhellen, geschweige denn zu heizen. Eine hölzerne Tür führt wer weiß wohin, und ihr gegenüber liegt ein Fenster.
Nachdem ich mich umgesehen habe, so gut das in dem schlechten Licht geht, wende ich mich meinem Körper zu. Mein rechter Arm hängt in einer Schlinge, aber wenigstens hat der Schmerz nachgelassen. Mein Kopf pocht, aber das mag daran liegen, dass ich so lange geschlafen habe. Die Wunde in meinem Gesicht brennt zumindest nicht mehr. Zurückgeblieben ist nur eine verkrustete Stelle, die ich vorsichtig mit meiner linken Hand ertaste.
Ich klettere aus dem Bett, ohne den gebrochenen Arm zu benutzen, und zucke zusammen, als meine Füße den kalten Boden berühren. In wenigen Schritten bin ich am Fenster und ruckele mit der linken Hand, bis ich den Hebel aufbekomme. Das Fenster öffnet nach innen, und jetzt muss ich nur die hölzernen Fensterläden nach außen stoßen, um hinaussehen zu können. Ich kann den Sturm hören, bevor er mir ins Gesicht schlägt. Schneeflocken wirbeln dicht vor dem Fenster entlang, sodass ich in der weißen Masse nichts erkennen kann. Der Wind lässt die Fensterläden wild umherschlagen, daher brauche ich eine ganze Weile, um sie wieder zu schließen. Danach das Fenster, damit der Raum nicht weiter abkühlt.
Ich trage nur ein langes Nachthemd und frage mich mit heißem Gesicht, ob es Aaron war, der mich umgezogen hat. Schnee schmilzt langsam auf meinem Arm und ich schüttele ihn ab. Unschlüssig drehe ich mich auf der Stelle und weiß nicht, was ich machen soll. Zurück ins Bett klettern, wäre die sicherste Alternative, aber mir ist nicht mehr nach Schlafen. Viel lieber will ich herausfinden, was hinter der Tür liegt.
Bevor ich mich in Bewegung setze, überkommt mich ein beunruhigender Gedanke. Was ist, wenn ich gar nicht bei Aaron bin? Wie viel Zeit ist seit dem Abend in Durchgang vergangen? Einige Stunden? Tage? Mein Gedächtnis lässt mich vollkommen im Stich. Eigentlich habe ich ein gutes Gefühl für Zeit, aber gerade bin ich verloren.
Ich stehe in Gedanken versunken am Fenster, als die Tür aufgeht. Licht dringt zusammen mit einer schmalen Person ins Zimmer. Es ist eine junge Frau mit langen braunen Haaren, die sie zu Zöpfen geflochten trägt. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, läuft sie zur Feuerstelle und hält die Hand darüber, als würde sie die Reste des Feuers erfühlen wollen. Dann beginnt sie, schwarze Steine aufzuschichten, und wundersamerweise beginnt das Feuer dadurch wieder aufzulodern.
Ich frage mich, wer sie ist, und warum sie mich völlig ignoriert. Ob ich mich bemerkbar machen sollte? Ich beobachte, wie sie sich aufrichtet und zum Bett geht. Vorsichtig streckt sie die Hand aus und zuckt zurück, als sie feststellt, dass ich nicht länger dort liege.
»Aura?«, fragt die junge Frau, ohne sich umzusehen. Mir dämmert etwas.
»Ich bin hier drüben. Am Fenster.«
Erst jetzt wendet sie sich in meine Richtung und ich erkenne ihre Maske. Diese ist allerdings kleiner als Aarons und reicht nur bis zur Hälfte über ihr schmales Gesicht. Es wirkt, als hätte sie sich einen Schal bis über die Nase gezogen. Der Rand der Maske ist glatt, abgesehen von den Stellen unter ihren Augen, wo die Maske nach oben hin zu zerfasern scheint.
»Es freut mich, dass du das Bett verlassen kannst. Mein Name ist Mila. Ich bin ebenfalls eine Sklavin von Aaron.«
Ich gehe auf sie zu, und erst als ich kurz vor ihr bin, kann ich im Schein des aufflackernden Feuers sehen, dass ihre Augen nicht nur ungewöhnlich hell, sondern von einem milchigen Schleier überzogen sind.
»Ich hoffe, ich habe dich nicht erschreckt«, redet Mila weiter. Ihre Stimme hat einen sanften Klang. »Hast du Hunger?«
Darüber muss ich nicht nachdenken. Mein Magen knurrt wie auf Kommando, was sie zum Lachen bringt.
»Bist du schon angezogen?«
Ich verneine, worauf sie in Richtung der Kleidertruhe deutet. Ich hebe den massiven Deckel an und sehe hinein. Mila lacht erneut auf, als ich scharf die Luft einziehe.
»Ist das alles für mich?«, frage ich ungläubig und wage kaum, die Hand nach all den Kostbarkeiten in der Truhe auszustrecken.
»Ja. Schließlich hatten wir genug Zeit, Kleidung für dich anfertigen zu lassen. Du hast eine ganze Woche im Fieberschlaf gelegen. Zwischendurch hatte ich Angst, du würdest sterben, bevor ich dich kennenlernen kann.«
Eine Woche. Ich habe eine Woche verschlafen. Kein Wunder, dass sich mein Körper steif und mitgenommen anfühlt. Das erklärt außerdem, warum ich noch dünner geworden bin als ohnehin schon. Nicht gerade der beste Start, den ich mir für mein Sklavendasein wünschen kann.
Ich suche ein schlichtes Wollkleid hervor, dazu dicke Socken und einfache Schuhe. Darüber hänge ich ein warmes Tuch. Mila versucht erfolglos, mir bei dem Kleid zu helfen. Letztlich entscheiden wir uns dafür, dass ich den gebrochenen Arm unter dem Kleid trage und nicht versuche, ihn durch den Ärmel zu stopfen.
»Meinst du, Aaron ist sauer auf mich, weil ich so lange krank war und nun immer noch einen gebrochenen Arm habe?«
»Ich denke nicht. Du hast Glück gehabt, dass er dich gekauft hat. Aaron ist ein guter Herr.«
Ganz überzeugt bin ich nicht, kann es im Moment jedoch nicht ändern, also versuche ich den Gedanken zur Seite zu schieben. Ich folge Mila aus dem Zimmer. Im Gang hängen Fackeln an der Wand, in denen blaues Feuer lodert. Es erinnert mich unangenehm an das aus meinem Traum.
»Was sind das für Fackeln?«
»Wir nennen sie Drachenfeuer. Sie geben Licht ab und brennen im Grunde unendlich, aber sie sind nicht heiß.«
»Dann ist Drachenfeuer doch ein ziemlich unpassender Name, oder?«
Mila zuckt mit den Schultern. »Irgendeinen Namen brauchte diese Art von Flamme. Frag mich nicht, ich habe mir das nicht ausgedacht.«
Ich kann nicht anders, ich stelle mich auf die Zehenspitzen und strecke meinen gesunden Arm nach einer Fackel aus. Nach kurzem Zögern halte ich die Hand in die Nähe der Flamme. Mila hat Recht. Das Feuer brennt, ohne heiß zu sein.
»Bist du fertig?«
Auch wenn sie nicht sehen kann, was ich mache, scheint sie eine gute Idee davon zu haben. Ich beeile mich, ihr zu folgen. Sie fährt mit einer Hand an der Wand entlang.
»Bist du schon immer blind gewesen?«
»Nein«, sagt Mila knapp und belässt es dabei.
Ich beweise genug Feingefühl und frage nicht weiter nach, während ich darüber nachdenke, dass ich mit dieser Frage wirklich hätte warten sollen, bis wir uns besser kennen.
Mila stößt eine große Holztür auf, etwas heftiger, als ich es für nötig halte, und dahinter erstreckt sich die Küche. Der Raum ist angenehm warm, und ich weiß sofort, dass er einer meiner neuen Lieblingsplätze werden wird. Durch die großen Fenster kann ich den Schneesturm ausmachen, aber für den Moment habe ich nicht das Bedürfnis, die Welt draußen zu entdecken, weil es hier drinnen genug zu sehen gibt. Mila tritt zum Herd und rührt in einem Topf. Im Heim wurde über offenem Feuer gekocht, aber hier befindet sich ein riesiges, eisernes Monstrum, welches das Feuer in seinem Inneren trägt und Kochen auf den erhitzen Platten auf dem Herd ermöglicht. Für Mila muss es eine große Hilfe sein, nicht ständig neben einem offenen Feuer arbeiten zu müssen. Ich habe mir beim Küchendienst oft genug Verbrennungen geholt, und ich kann sehen.
Ein großer Holztisch nimmt die Mitte des Raumes ein. Darauf stehen und liegen die verschiedensten Dinge. Ich erblicke frische Kräuter in kleinen Töpfen, Schneidemesser, Schalen, Becher, einen Laib Brot, Krüge, Teller, Besteck und kleine hölzerne Kistchen, deren Inhalt ich nur erraten kann. Ich mache neugierig einen Schritt darauf zu und wundere mich im nächsten Moment, wie Mila es schafft, genau zu wissen, wo ich mich befinde.
»Tu mir einen Gefallen und räum auf dem Tisch nichts um. Sonst finde ich die Sachen nicht wieder«, sagt sie.
Ihre Stimme klingt wieder normal und freundlich. Ich frage mich ernsthaft, wie sie in dem Chaos überhaupt etwas finden kann, aber bemühe mich dennoch, alles an seinen Platz zurückzustellen. Ich kann es nämlich nicht lassen, die Kräuter genauer zu untersuchen, in die kleinen Kistchen zu schauen, in denen sich zum größten Teil Gewürze befinden, daran zu riechen und all die neuen Eindrücke aufzunehmen, die auf mich einströmen.
An den Wänden hängen Töpfe und Pfannen, weitere Gewürze und getrocknete Fleischstücke. Mila hält mir einen Apfel hin, den sie aus einem Fass in einer Ecke geholt hat. Gierig beiße ich hinein, sodass mir der Saft über die Finger läuft. Ich bin froh, dass sie mich nicht sehen kann. Ich lecke den Saft auf und verschlinge den restlichen Apfel. Er ist schon etwas schrumpelig, aber ich habe selten etwas Besseres gegessen. Ich lasse mich auf der hölzernen Bank vor dem Tisch nieder, ohne meinen Kopf stillhalten zu können. Es gibt so viel zu entdecken!
Ich frage mich, wohin die Falltür im Boden führen mag. Ich möchte wissen, was die Fässer beinhalten, die sich an der Wand aufreihen. Ich muss mich zurückhalten, um nicht aufzuspringen und alles zu durchsuchen. Dafür werde ich noch genügend Zeit haben. Ich bin gespannt, wie der Rest des Hauses aussieht.
Bevor ich daran einen weiteren Gedanken verschwenden kann, stellt Mila mir eine Schüssel mit dampfendem Eintopf auf den Tisch. Ich ziehe sie zu mir und suche einen Löffel. Ich nehme außerdem das Brot, das Mila mir reicht. Sie sitzt vor ihrer eigenen Schüssel. Für eine Sekunde habe ich Angst, dass ich ihren Löffel genommen habe, allerdings tastet sie über den Tisch und findet mit scheinbarer Leichtigkeit einen anderen.
Ich picke mir zunächst die Fleischbrocken aus der Schüssel. Danach folgt das Gemüse, und letztlich sauge ich die verbliebene Flüssigkeit mit meinem Brot auf, um keinen Tropfen zu verschwenden. Der Eintopf hat eine würzige Schärfe und meine Wangen beginnen zu glühen. Ich lege mein Tuch zur Seite.

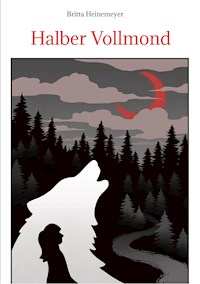













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













