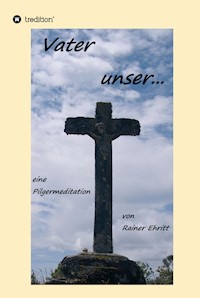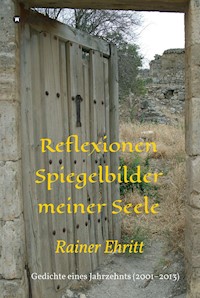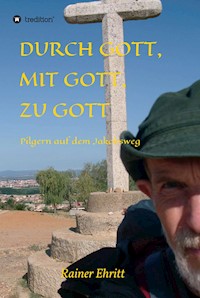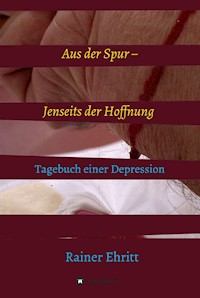
3,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Depression - eine psychische Krankheit, die jeden treffen kann und deren Fallzahl wächst. Der Autor begleitet einen depressiv erkrankten Menschen durch seine schwersten Stunden. Mittels Beschreibung der Lebensgeschichte und individueller Umstände sucht er Ursachen aufzuzeigen, die in diese Krankheit führen können. Eindringlich erzählt er vom Absturz in die Finsternis des Lebens und vom langen Weg zurück ans Licht. Detailliert beschrieben wird der Alltag in der Depression, die selbstzerstörerische Kraft, die dieser Krankheit innewohnt, und der langwierige Therapieverlauf. Tagebuchaufzeichnungen und Gedichte dieser Zeit lassen Interessierte teilhaben an einer inneren Welt der Hoffnungs-, Mut- und Sinnlosigkeit. Unzähliger kleiner Schritte bedarf es, dieses dunkle Tal des Lebens zu durchwandern. Den Gefühlen und Empfindungen, denen sich der Erkrankte jeden Tag aufs Neue stellen muss, wird viel Raum gegeben. Die Einbeziehung persönlichster Aufzeichnungen malt ein authentisches Bild und wirbt um Verständnis. Der lange Beobachtungszeitraum von fast sieben Jahren verdeutlicht nachhaltig, dass es keine schnelle Heilung gibt und dass eine solche auch nicht erwartet werden kann. Es wird um Akzeptanz geworben, weil es nicht eine Frage des Willens ist, ob und wann eine Genesung gelingt, sondern es einer auf jeden Erkrankten individuell abgestimmten Psychotherapie bedarf. Das vertrauensvolle Gespräch über Wochen, Monate und Jahre ist ein entscheidender Schlüssel zur Genesung. Die unterstützende medikamentöse Therapie ist heute nicht mehr wegzudenken. Das Buch schließt nicht mit der Heilung der Depression, jedoch lässt die Entwicklung ahnen, wohin der Weg führen kann. Niemand hat eine hundertprozentige Sicherheit, nicht selbst an einer Depression zu erkranken, oder dass bei einmal Erkrankten Rückfälle auftreten. Aber wenn es gelingt, Leserinnen und Leser im Umgang mit der Depression und den betroffenen Menschen zu sensibilisieren, hat dieses Buch sein Ziel erreicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Rainer Ehritt
Aus der Spur – jenseits der Hoffnung
Weitere Titel des Autors im Verlag tredition:
2018 – „Reflexionen – Spiegelbilder meiner Seele“
Titel als Hardcover, Paperback und E-Book erhältlich
2018 – „Durch Gott, mit Gott, zu Gott“ (2. Auflage)
Titel als Hardcover, Paperback und E-Book erhältlich
Über den Autor:
Rainer Ehritt, Jahrgang 55, verheiratet, studierte an der Humboldt Universität zu Berlin Zahnmedizin und praktiziert bis heute gemeinsam mit seiner Frau, in der Nachbarstadt seines Wohnortes Bad Freienwalde, in freier Niederlassung. Erlebnisse, Erfahrungen und Lebenskrisen fanden nach Jahrzehnten der Stummheit ihren Niederschlag im geschriebenen Wort. In Versen verdichtete er seine Gedanken. Lyrik wurde sein ständiger Begleiter. Mehr und mehr entbrannte seine Leidenschaft für die Schriftstellerei. Mit dem vorliegenden Buch tritt er nun erneut, nachdem er bereits durch eine Vielzahl öffentlicher Lesungen aus seinen anderen Werken Sicherheit gewonnen hat, an die Öffentlichkeit und setzt sich darin mit einem höchst aktuellen und brisanten Thema auseinander.
Aus der Spur– jenseits der Hoffnung
Tagebuch einer Depression
***
Rainer Ehritt
1. Auflage 2018
© Copyright Autor: Dr. Rainer Ehritt
Coverdesign: Dr. Rainer Ehritt
Gestaltung: Dr. Rainer Ehritt
© Kleinplastiken: Dr. Rainer Ehritt
Fotos: Dr. Rainer Ehritt
Verlag & Druck: tredition GmbH Hamburg
978-3-7469-2672-8 (Paperback)
978-3-7469-2673-5 (Hardcover)
978-3-7469-2674-2 (e-Book)
www.tredition.de
Gewidmet all denen,
die ein Licht in der
Finsternis
suchen
und all denen,
die den Suchenden
beistehen.
R.E.
Zur Beachtung,wichtiger Hinweis des Autors!
Alle durch den ProtagonistengetroffenenAussagen zu Personen und derenHandlungensowie Einschätzungen, Beurteilungenund Bewertungenvon Erlebnissen und Ereignissensind rein subjektivund müssen nicht derobjektiven Realität entsprechen!
Prolog
Kraftlos
Er hat keine Kraft mehr; lässt alles nun laufen.
Er hat keine Kraft mehr; ist alles zu viel.
Er hat keine Kraft mehr; was soll er noch sagen.
Er hat keine Kraft mehr; und sieht auch kein Ziel.
Er hat keine Kraft mehr; für Sinnlosigkeiten.
Er hat keine Kraft mehr; gegen die tägliche Not.
Er hat keine Kraft mehr; immer wieder zu kämpfen.
Er hat keine Kraft mehr; selbst, wenn die eigene Existenz bedroht.
Er hat keine Kraft mehr! Wo findet er Frieden?
Er hat keine Kraft mehr; zu beantworten Fragen, die gestellt.
Er hat keine Kraft mehr; die neuen Wege zu beschreiten.
Er hat keine Kraft mehr; dass seine Zukunft wird erhellt.
Er hat keine Kraft mehr; um auszubrechen.
Er hat keine Kraft mehr; zu fliehen den Verstrickungen seines Lebens.
Er hat keine Kraft mehr; sich aufzuopfern.
Er hat keine Kraft mehr; weil so vieles scheint vergebens.
Er hat keine Kraft mehr; er ahnt die Konsequenzen.
Er hat keine Kraft mehr; heißt: „Alles gib auf!“.
Er hat keine Kraft mehr; um festzuhalten.
Er hat keine Kraft mehr; für alles, womit er sich Leben erkauft!
***
geschrieben im Februar 2012
“Die Depression ist die am häufigsten auftretende psychische Erkrankung. Das deutsche Bundesgesundheitsministerium schätzt, dass in Deutschland vier Millionen Menschen von einer Depression betroffen sind und dass gut zehn Millionen Menschen bis zum 65. Lebensjahr eine Depression erlitten haben.” (Depression-Wikipedia 2013 – RKI – Daten und Fakten)
Eine genetisch bedingte Disposition, die bestimmt ob und in welchem Umfang Menschen auf psychosoziale Belastungen reagieren, ist wahrscheinlich. „Als gesichert gilt, dass gestörte Prozesse der Signalübertragung …“ insbesondere mittels der „Neurotransmitter Serotonin, Dopamin und Noradrenalin – bedeutende Faktoren darstellen.“ In der Summe kann die Kumulation der verschiedensten begünstigenden Umstände eine Depression auslösen.
Sie “ist eine psychische Störung mit Zuständen psychischer Niedergeschlagenheit als Leitsymptom.
… Die Diagnose wird nach Symptomen und Verlauf gestellt.
… Die Depression ist charakterisiert durch … den Verlust der Fähigkeit zur Freude oder Trauer, … dem “Gefühl der Gefühllosigkeit” bzw. dem Gefühl anhaltender innerer Leere. Schwer depressive Erkrankte empfinden oft eine völlige Sinnlosigkeit ihres Lebens. Häufig führt dieser qualvolle Zustand zur latenten oder akuten Suizidalität. … Bei der Depression handelt es sich daher um eine ernste Erkrankung, die umfassender Therapie bedarf.”
(Depression-Wikipedia 2013 - S. Ripke u. a.)
Sie schleicht sich an, nistet sich ein und tarnt sich so gut, dass Betroffene oft die Letzten sind, die sie als Krankheit anerkennen. Leider geschieht das oft erst sehr spät, manchmal fast zu spät.
In einer Gesellschaft die Leistung als oberstes Lebensziel definiert, wird das Erkennen möglicher erster Zeichen einer beginnenden Depression, durch den Erkrankten selbst, von Gefühlen der Schuld und Scham erstickt. Es wird immer mehr Energie aufgewandt, um den eigenen Leistungsansprüchen und den vermeintlichen Erwartungen anderer gerecht zu werden. Der Erkrankte will nicht wahrhaben, dass diese Energie, die jeden Tag mühevoller aufgebracht werden muss, seinen Leistungsverfall beschleunigt und ihn tiefer in die Krankheit treibt. Nach seinem Empfinden hat nicht er sich verändert, sondern seine Umgebung, die ihm liebloser, banaler, aggressiver, härter, kälter, farbloser erscheint und vor der er sich durch Rückzugsverhalten schützen will. Kontakte brechen ab, er wird gemieden, ihm wird eine „dunkle Aura“ nachgesagt und der Weg führt ihn immer weiter in die Isolation, bis sein scheinbarer Selbstschutz zusammenbricht und Dunkelheit das Leben flutet.
Chronologie des Scheiterns
Stunde Null
Es ist die Zeit vom 24. zum 25. Januar 2011.
Es ist Nacht, er ist allein, es ist dunkel und er sollte in seinem Bett liegen und schlafen. Aber da ist etwas in ihm, das das verhindert. Er schläft nicht, sonder er tobt und schreit, schlägt gegen die Wände, wieder und wieder. Sein Körper zuckt und er fühlt einen nie gekannten Kontrollverlust. Tränen netzen seine Augen und da ist diese rasende Wut, geboren aus einer Hilflosigkeit, die ihn schutzlos und angreifbar macht und der er nichts als seine Aggressivität entgegenzusetzen hat.
Stunde um Stunde kommt er nicht zur Ruhe, sondern wellenartig fluten ihn wieder und wieder Angst, Aggression, Hilflosigkeit und Endzeitsehnsüchte. Kein Gedanke mehr an Gott, nur noch abgrundtiefe Einsamkeit.
Irgendwann, mitten in diesem Gefühlschaos, wächst eine Hoffnung wie ein frischer Keimling, der Rettung oder wenigstens Hilfe verspricht.
Er greift zum Telefon und wählt die Nummer eines lieben Menschen der ihm, so hofft er, verzeihen wird, dass er ihn gleich aus dem Nachtschlaf reißt. Sie hatten sich versprochen, dass jeder den anderen anrufen kann, wenn er in Not sei und seine Not ist riesengroß. Sein Gefühl sagt ihm, dass er morgen früh seinen Dienst nicht antreten kann, ohne eine Gefahr für die Menschen zu sein, die sich ihm anvertrauen. Aber da ist auch noch ein Rest Verantwortungsbewusstsein sich selbst gegenüber.
Plötzlich sieht er es klar vor sich, er braucht Hilfe.
Statt zur Arbeit zu gehen, muss er sich diese suchen.
All das, wie es ihm gehe, wie zerrissen er sei, wie hilflos und gleichzeitig aggressiv er sich fühle und dass er nicht mehr weiter wüsste und dass er einen Arzt aufsuchen werde, vertraut er diesem Menschen an.
Seine Schilderung wird als beunruhigend empfunden, gleichzeitig wird er in seinem Entschluss bestärkt, der Arbeit fernzubleiben und um therapeutische Beistand zu bitten; wo auch immer.
Es ist die Angst um ihn, die aus der Empfehlung spricht!
Schwer schläft er trotz dieses Gespräches ein und sein Schlaf ist unruhig.
Immer wieder schreckt er auf und fühlt dann, wie Dunkelheit und Einsamkeit ihn in nie gekannte Tiefen seiner Seele treiben wollen, wie sie immer wieder verzweifelte Ausweglosigkeit in ihm aufbrechen lassen, die ihn vernichten will. Er wandelt auf einem schmalen Grat zwischen Wahnsinn und Vernunft, der ihn keine Zukunft mehr sehen lässt.
Das Leben ist zu einer Last geworden, die er kaum noch zu stemmen vermag und die er in diesem Moment eigentlich nicht mehr stemmen möchte. Er sieht nur noch einen Weg der zwar tiefer in die Finsternis und seine Verlorenheit führt, der aber gleichzeitig Erlösung zu versprechen scheint.
Es ist ein Rufen im Kopf alles loszulassen, denn alles ist nichtig, woran er bisher sein Leben fest gemacht hatte. Er hatte vielleicht schon vor langer Zeit eine vorgezeichnete Spur verlassen und befindet sich nun in einem Sumpf, in dem jeder weitere Schritt tödlich enden könnte. Nicht unterscheidet er mehr zwischen dem Licht, das ihn leiten soll und dem Irrlicht, dem zu folgen er bereit zu sein scheint. Es ist eine Nacht, in der er sein physisches Existenzrecht, massiv, wie noch nie, infrage stellt. Er hofft auf irgendeine Hilfe und weiß gleichzeitig nicht wozu sie gut sein sollte, ob er sie überhaupt annehmen möchte.
Er spürt nur noch Enge und seine Machtlosigkeit, sein Ausgeliefertsein und seine Zerrissenheit; und er kann dem nicht entfliehen. In seinem Denken sind ihm nahestehende Menschen fast ausgeblendet, aber eben nur fast. Denn da gibt es seine Tochter, ihr Schmerz hätte ihn am meisten getroffen und auch seine Frau, die er mit vielen Problemen allein gelassen hätte. Außerdem ist da noch eine Freundschaft durch die er sich gebunden fühlt. Und darüber hinaus ist da noch seine Feigheit, den letzten Schritt zu wagen. All das wirft er in die Waagschale seines Lebens und die Nacht geht vorbei.
Früh steht er auf, isst kaum etwas und hat unsägliche Angst vor dem Schritt, zu dem er sich entschlossen hat. Es sind die Fragen danach, was er eigentlich erwarte und warum er sich so anstelle und was man von ihm denken würde und und und. Letztlich ringt er sich durch, setzt sich ins Auto und fährt nicht zur Arbeit, sondern zu einem psychiatrisch orientierten Krankenhaus in einer Nachbarstadt.
Er hat ein seltsames Gefühl, war doch in der landläufigen Meinung der Bevölkerung, einer der dort eingeliefert oder dort entlassen wurde mit dem Makel behaftet, “nicht ganz dicht zu sein”, “ein Rad ab zu haben”; und da will er nun hin.
Während er fährt, telefoniert er nochmals mit dem ihm zugewandten Menschen und ruft auch in seiner Praxis an, um mitzuteilen, dass er heute wohl nicht kommen werde.
Aber dann steht er auf dem Parkplatz der Klinik. Er hat Angst, ihm ist schlecht, mühsam versucht er sich Worte zurechtzulegen, sein Erscheinen zu begründen, sie wieder zu verwerfen, um nach stichhaltigeren Argumenten zu suchen. Seiner Schwäche wegen verachtet er sich und weiß gleichzeitig, dass er so nicht weiter kann. Lange Minuten grübelt er, verwirft seine Gedanken, startet den Motor und bleibt dann doch da.
Endlich nach langem Hin und Her steigt er aus, gebeugt, ein alter Mann ohne Kraft und wendet sich dem Haupteingang der Klinik zu.
An der Rezeption wird er nach seinem Begehren gefragt und ob er eine Überweisung hätte.
Mühsam, mit einem unsagbar schlechten Gewissen, ohne nähere Erklärung sagt er nur:
“Ich brauche psychiatrische Hilfe!”
Dabei zittert er wie, im tiefsten Winter. Dieser eine Satz ist das Eingeständnis seiner Niederlage, seiner Schwäche, seines zusammengebrochenen Selbstbewusstseins.
Er schämt sich dafür und möchte ihn am liebsten ungesagt machen. Doch tief im Innern weiß er, da ist keine Kraft mehr zu kämpfen, nicht gegen sich, nicht gegen seine Lebensumstände. Jeder Widerstand in ihm, scheint zerbrochen zu sein. Es gibt nichts mehr was er will, nichts mehr woran er hängt, nichts mehr was ihn berührt. Es gibt nur noch die Dunkelheit in ihm, die seine Seele ersticken will.
Nach einigen Telefonaten der Rezeptionskraft wird er in ein Wartezimmer geleitet und wenig später erscheint ein Notarzt, der aber feststellt, dass er nicht der Richtige sei und dass er ihm jemand anderen schicken würde. Ob er ihn allein lassen könne, fragt ihn dieser besorgt.
Zwischenzeitlich werden seine Personalien aufgenommen und dann betritt eine freundliche, ihm zugewandte Ärztin das Wartezimmer und stellt sich als Chefärztin der 1. Psychiatrischen Klinik vor. Sie nimmt ihn mit in ihr Sprechzimmer und bittet darum, ihr zu erzählen, was ihn in ihr Haus geführt hätte und welche Nöte ihn plagten. Unsicher fühlt er sich und klein und fast wie ein Simulant, als er beginnt von der Nacht zu berichten, von der in seinen Augen aussichtslosen Situation in der er sich befinde, von seinen seelischen Schmerzen und seiner alles verzehrenden Müdigkeit am Leben.
Sie hört zu, stellt Fragen zur aktuellen Situation und schreibt ihn bis auf weiteres, mit der Diagnose einer depressiven Verstimmung, arbeitsunfähig. Auch ein Medikament verordnet sie ihm.
„Cipralex“, ein Antidepressivum, soll seine Stimmung aufhellen. Sie bedauert, dass sie jetzt zur Visite müsse, die eigentlich schon hätte stattfinden sollen.
Im Verlauf des Gespräches merkte er bereits, wie er ruhiger wurde. Vielleicht ist es ein Stück zurückgewonnene Sicherheit, dass er ihre Frage, ob sie ihn jetzt nach Hause zurückkehren lassen könne, bejaht. Für den übernächsten Tag vereinbaren sie einen neuen Konsultationstermin.
Die Wärme und das Verständnis das ihm entgegengebracht wurde, nimmt ihm etwas von seiner Angst. Das Gefühl, eine bewertungsfreie Akzeptanz seiner inneren Wahrheit erfahren zu haben, ist erleichternd für ihn. Es hält vor bis er daheim ist.
Er müsste nochmals in der Praxis anrufen und Bescheid geben, dass er einige Tage ausfallen werde. Aber es erscheint ihm schwierig und unsäglich mühevoll das Telefon zu nehmen, die Nummer zu wählen und mit einem Menschen zu sprechen. Er möchte sich klein machen, unauffällig verschwinden, möchte nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Irgendwann tätigt er den Anruf, fährt auch zur Apotheke, des Medikamentes wegen, das jedoch erst am nächsten Tag verfügbar sein wird und dann sitzt er zu Hause im Sessel, in seinem Arbeitszimmer und tut nichts. Selbst das Denken fällt ihm schwer. Alles kreist nur noch um diese innere Mattigkeit und den Wunsch, in Ruhe gelassen zu werden, zu verschwinden.
Er ist so müde, lebensmüde im wahrsten Sinne des Wortes. Die Welt dort draußen geht ihn nichts mehr an und er möchte nur noch in die innere Stille einer selbstgewählten, alles ausblendenden Einsamkeit entfliehen. Es ist wie das Kappen von Verbindungen zum Leben, als würde eine Signalleitung nach der anderen getrennt werden. Nichts soll mehr zu ihm durchdringen - er atmet noch, aber etwas in ihm ist scheinbar schon gestorben.
Wenig isst er an diesem Tag, wie auch an vielen anderen die folgen werden. Alles ist Last, nichts will schmecken, jedes Nahrungsbedürfnis fehlt. Es geht nur noch um das Dahindämmern, Stunde um Stunde im Halbdunkel der herabgelassenen Jalousie sitzend, einfach nur wartend die Zeit verrinnen lassen.
Der Tag bis zum Arzttermin vergeht irgendwie. Er erträgt weder Fernsehen noch Radio, keine Musik, keine Bilder, keine Filme. Das Leben erscheint ihm, wie ein endlos ermüdender Lauf durch einen Tunnel, aus dem er keinen Ausweg findet.
Bald geht er zu Bett, aber der Schlaf flieht ihm, nur die Hoffnungslosigkeit bleibt und deckt alles zu.
Wieder steht er früh auf. Es ist der 27. Januar 2011. Er ist sehr müde und innerlich angespannt. Was wird ihn erwarten? Was wird er erzählen? Wie verständlich machen, was er selber nicht versteht?
Mit dem Gefühl einer Prüfungsangst im Bauch setzt er sich ins Auto und fährt zur Klinik.
Heute geht es dennoch einfacher als bei seinem ersten Besuch. Er hat einen Termin, er weiß wohin er gehen muss, er hat eine Ansprechpartnerin.
Die Chefärztin nimmt sich Zeit. Sie erkundigt sich nach seinem gegenwärtigen Befinden, erläutert ihm die geplante Therapie. Sie denkt an zeitweiliges Herausnehmen aus dem Arbeitsprozess, an die Verordnung von Antidepressiva, deren Wirkung erst nach frühestens zwei Wochen zu erwarten ist und an intensive Gespräche mit einem Psychologen.
Er versucht Ihre Fragen nach den möglichen auslösenden Ursachen, soweit sie ihm naheliegend erscheinen, zu beantworten. Es gibt nicht das eine Thema, sondern es ist die Summation mehrerer Faktoren. Er beginnt in der unmittelbaren Vergangenheit, spricht von Ereignissen, die „das Fass zum überlaufen brachten“.
Ein Todesfall in der Familie. Im Dezember war sein Vater verstorben. Auf seinem Weg durfte er ihn die letzte Stunde begleiten. Als Folge seines Ablebens kam es, womit er nie gerechnet hätte, zu einer Erbauseinandersetzung, initiiert von seinem einzigen noch lebenden Bruder.
Aber auch bereits lang schwelenden Konflikten trug sein Zusammenbruch Rechnung.
Unzufriedenheit mit seiner Partnerschaft, die aber vielleicht Folge seiner schon viele Jahre verborgen wirkenden Krankheit war. Gesundheitliche Probleme des letzten Jahres, die wenig befriedigend gelöst werden konnten.
Eine Schuld- und Schuldenlast, die ihn über viele Jahre schon knechtet.
Ein mangelndes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl - beides war und ist, solange er denken kann, nicht vorhanden.
Ängste vor den Herausforderungen des Tages. Die Furcht vor jeglichen Entscheidungen.
Ein über die Maßen angewachsenes Arbeitspensum und ein Streben nach Perfektion, dem immer die eigene Begrenztheit entgegenstand und so, nach seinem Empfinden, bis heute steht.
Ein Ausbruchversuch aus seinem bisherigen Leben scheiterte.
Er war auf einem der Jakobswege durch Spanien gepilgert und zer-brach fast an seinem Unvermögen, Träume die er dort geträumt hatte, nach seiner Rückkehr mit Leben zu erfüllen.
Es war ein harter Aufschlag in der Realität.
Nicht zuletzt raubte ihm auch eine Auseinandersetzung mit einem Bauamt unsäglich Kraft und schürt seitdem eine diffuse Furcht. Er berichtet der Ärztin von seinen Selbstzweifeln, seiner Niedergeschlagenheit, seiner inneren Wut; diese richtet er vor allem gegen sich selbst. Von seiner vermeintlichen Unfähigkeit und seinen Ängsten spricht er.
Er berichtet, wie er in seiner Praxis, er ist medizinisch tätig, in den Pausen zwischen dem Wechsel der Patienten, mit seinen Fäusten gegen Wände schlüge, wie er im Auto, während der Fahrt laut schreie. Alles um diese zerstörende Aggressivität in sich zu vermindern, um Spannungen abzubauen, die verhindert hätten, dass er anderen Menschen verständnisvoll, voller Mitgefühl, sanft und freundlich gegenübertreten konnte. Diese Fähigkeit hatte er spätestens am Montag den 24. Januar 2011 völlig eingebüßt. Kein Mitgefühl mehr zu empfinden, machte jeden einzelnen Patienten nur noch zum Objekt. Ihre legitimen Forderungen an ihn, wertete er, wie Angriffe und reagierte mit einer entsprechenden Verteidigungshaltung. Nicht, dass er etwas tat oder unterließ, das den Patienten zum Schaden gereichte, aber sein Puffer jedem, auch seinem Personal, mit der ihnen gebührenden Freundlichkeit zu begegnen, war einfach erschöpft.
Das alles berichtet er und es ist erleichternd für ihn, endlich einmal alles auszusprechen. Gleichzeitig hasst er sich für seine Schwäche. Anderthalb Stunden sind wie im Fluge vergangen. Er fühlt sich angenommen und verstanden und getröstet.
Mit Terminen bei einem Psychotherapeuten und einem weiteren bei der Chefärztin verlässt er das Krankenhaus und fährt wieder heim. Er ist allein, seine Frau ist auf Reisen, und er hat keine Eile, zu den unangenehmen Dingen seines Lebens zurückzukehren.
Das Testament
Sie waren Brüder. Ihr Vater war gestorben. Um die Zeit der Geburt Christi verließ er diese Welt. Es gab Menschen, die sie des gestörten Weihnachtsfestes wegen, bedauerten. Andere sahen, bei allem Schmerz des Verlustes, die Weihnachtszeit als eine Zeit der Hoffnung an. Hoffnung auch für den Dahingegangenen. Hoffnung auf Erlösung.
Ihm war es vergönnt, die letzte Stunde bei und mit dem Sterbenden zuzubringen. Er sah das Sterben, sah, wie der andere immer weiter aus seinem Jetzt in die unbekannte Welt hinüberglitt, gleich einem, der auf einer Leiter Sprosse um Sprosse in die Tiefe stieg, unterbrochen von kurzen Pausen, bis er dieses Leben wieder ein Stückchen weiter verlassen hatte. Ihm kam es wie eine Ewigkeit vor, der Moment als der Atem aussetzte und dem akustischen Warnsignal, welches den Herzstillstand unüberhörbar machte. Er hatte die Hand des Scheidenden gehalten, mit ihm geredet und für ihn gebetet. Vielleicht ist es Einbildung, aber er war sich sicher, sein Vater verließ dieses Dasein in Frieden.
Nichts war geschehen, das ihn ängstigte. Später wünschte er sich so manches Mal, ihm wäre es vergönnt gewesen, an dessen Stelle zu treten, war der Verstorbene doch ein Mensch, der sehr am Leben gehangen hatte.
Er dagegen betete schon seit Monaten: “Herr, lass es nicht mehr so lange dauern!”
So müde war er seines Lebens und konnte oder wollte doch noch nicht von ihm lassen.
Es war ein kalter Tag, der Tag der Beerdigung. Seine Frau und er hatten alles zusammen mit Hilfe eines Beerdigungsinstitut vorbereitet. Was wichtig schien, war da, die Kränze, die Gebinde, die Handsträuße.
Feierlich, so wie der Vater es sich gewünscht hatte, sollte es sein. Als sie in die Leichenhalle kamen, saßen sein Bruder und dessen Familie bereits in der ersten Reihe, links des Sarges. Seine Familie nahm rechts Platz. Hier lag auf jedem Stuhl der ersten drei Reihen je eine Rose. Die für den Blumenschmuck verantwortliche Gärtnerei hatte diese Zeichen der Liebe und Trauer in Eigenregie dort plaziert.
Zu diesem Zeitpunkt ahnte er noch nicht, welche Katastrophe sich damit anbahnte.
Die Pfarrerin kam und begrüßte die zur Rechten des Sarges sitzenden, während sie die zur Linken scheinbar ignorierte. Es verwunderte ihn. Erst bei der Zusammenkunft zum Beerdigungskaffee wurde er darüber aufgeklärt, dass rechts immer die nächsten Angehörigen säßen und somit auch nur diese persönlich begrüßt werden würden. Jetzt verstand er, weshalb sein Bruder und dessen Familie, im wahrsten Sinne des Wortes, links liegen gelassen worden waren. Er verstand auch, dass sie das gekränkt haben musste. Obwohl er sich also für dieses Missverständnis aus Unwissenheit nicht verantwortlich fühlte, entschuldigte er sich für das Versäumnis der Pfarrerin.
Als ihm aber dann sein Bruder erklärte, er hätte das vorher vom Bestatter gesagt bekommen, aber „ER“ (gemeint ist der Protagonist) hätten ja mit seinen Blumen auf den Stühlen die Plätze der rechten Seite blockieren lassen, fehlten ihm die Worte. Der Vorwurf, dass er ja schließlich gewusst hätte, dass sie ihre eigenen Blumen mitbrächten, machte ihn gänzlich sprachlos.
So begann ein Krieg, den er sich nicht in seinen traurigsten Träumen hätte vorstellen können.
Nach dem Jahreswechsel stand die Nachlassauflösung auf der Tagesordnung. Ämter, Behörden, Lieferanten, Telefondienste und viele andere mussten über den Todefall ihres Kunden informiert werden. Es galt Unterlagen zu sichten, Versicherungen zu kündigen, sich einen Überblick über all die Dinge zu verschaffen, die notwendig waren, um die Wohnung ihres Vaters freizuräumen. Die Brüder hatten vereinbart, sich diese Arbeit zu teilen.
In den Unterlagen befand sich die Kopie eines Testamentes, das notariell beglaubigt beim Amtsgericht hinterlegt worden sein sollte. Da er es für meine Pflicht hielt, übergab er diese Kopie seinem Bruder. Der wollte es in Ruhe studieren und sie verabredeten einen neuen Termin, zu einem weiteren gemeinsamen Treffen.
Als sie sich dann wiedersahen, war sein Bruder völlig außer sich über die, nach seinem Empfinden, “Ungerechtigkeit” der Erbschaftsteilung.
Dem konnte er weder zustimmen noch widersprechen, zu viele Gedanken, zu viele Sorgen, zu viel Trauer war in ihm und es war sein älterer Bruder der da sprach, einer, zu dem er immer aufgeschaut hatte. Vielleicht hatte der ja auch recht und ihr Vater hatte ungerecht verfügt.
Die Teilungsanordnung der gefundenen Testamentkopie war eindeutig. Alle geldlichen Werte fallen seinem Bruder zu, alles Grundeigentum geht an ihn. Der Verstorbene bedachte die jüngste seiner Enkeltöchter und er bedachte seine Urenkel.
Ihm vererbte er das Haus, das er als Erbnehmer, mit Unterbrechungen seit mehreren Jahrzehnten, davon die längste Zeit mit seiner Familie, bewohnt hatte. Seine Eltern und auch er erbauten es in übermenschlicher Anstrengung zum Anfang der siebziger Jahre und er hatte einen wichtigen Teil seiner Jugend dort hineingegeben.
In den achtziger Jahren begann er, sein eigenes Haus, auf einem Grundstücksteil, das ihm von seinen Eltern überschrieben worden war, zu bauen. Als es acht Jahre vor dem Milleniumsereignis fertig wurde, tauschten sie die sich gegenüberstehenden Häuser. Seine Eltern zogen in das neu errichtete und seine Familie und er blieben im Haus seiner Eltern zurück.
Von Grund auf rekonstruierten, modernisierte und renovierten seine Frau und er es. Über viele Jahre floss sehr viel Geld, aber noch mehr Arbeitskraft und Lebenszeit, in dieses Projekt.
Das alles stand zu Disposition und sollte nach dem Willen seines Bruders neu geregelt werden.
Voller Vertrauen stimmte er dem zu.
Was er nicht ahnte war, dass unmittelbar nach ihrem Gespräch ein Rechtsanwalt mit der Angelegenheit betraut wurde, dessen Schreiben man ihm zu Beginn der letzten Januardekade 2011 zustellte.
Sowohl die darin aufgelisteten Forderungen, als auch die Art der versteckten Drohungen, was geschähe, wenn er seine Einwilligung versagen würde, verschlugen ihm die Sprache. Er brauchte und musste sich, entgegen seinem Willen, nunmehr seinerseits anwaltlichen Beistand suchen. Aber dazwischen lag ein gefühlt langes Wochenende an dem er mit seinen Ängsten und Sorgen, mit seiner Hilf- und Fassungslosigkeit allein blieb. Er sah, wenn man so will, seine eigene und die materielle Existenz seiner gesamten Familie bedroht. Er fühlte sich verraten, hintergangen, vor allem aber ratlos.
Diese “Bedrohung” im Hinterkopf habend, fuhr er also am Montagmorgen in die Praxis, um seine Sprechstunde abzuhalten. Er war körperlich dort, aber seine Sorgen und seine Wut konnte er nicht an der Praxistür ablegen. Er nahm sie mit hinein.
Das war der letzte Tropfen, der das „Fass seiner Seele“ zum Überlaufen brachte.
Es war der 24. Januar 2011.
Fehlplanung
Unmittelbar nach der Jahrtausendwende bot sich dem Ehepaar die Möglichkeit, ein kleines Grundstück, in einer wenige Wochenendhäuschen umfassenden Siedlung, an der Ostsee zu erwerben. Darauf stand ein Wohncontainer als Behausung. Sie kultivierten das Gelände und bereiteten einen neuen Standort für ihr Freizeitdomizil vor. Da es immer wieder hineinregnete, beschloss er einen Carport als Unterstand zu errichten. Früher gab es darüber hinaus auch einen Vorbau zum Wohnwagen und diesen plante er nun ebenfalls wiedererstehen zu lassen. Viele Sommer schuftete er daran und es gab ihm eine tiefe innere Genugtuung, was er unter seinen Händen wachsen sah.
So könnte es nüchtern beschrieben werden.
Aber die Bedeutung dieses Projektes für ihn, für seine Seele, lässt sich kaum in Worte fassen. Er spürte etwas von dem „Geist amerikanischer Siedler die gen Westen gezogen waren und irgendwo in der Wildnis sich ihr Heim schufen“. Diese “Wildnis” hatte er dort, auf den wenigen hundert Quadratmetern, gefunden. Nur mit seiner Hände Arbeit hatte er die Fläche urbar gemacht, sich durch den Boden gewühlt, alles eingezäunt, einen befestigten Weg geschaffen. Seinen Vorstellungen entsprechend betonierte er Fundamente, setzte tragende Stiele, verband alles miteinander und baute ein Schutzdach. Einem Fachwerk gleich, schuf er die Grundkonstruktion, kaum eine Schraube, kaum ein Nagel. Bauen in seiner Ursprünglichkeit aus Liebe zum Baumaterial. Anders zu bauen, wäre ihm wie ein Sakrileg vorgekommen.
Dorthinein stellte er Holzwände und Fenster und eine Tür. So entstand, neben der Überdachung für den Wohnwagen, ein zusätzlicher Raum und eine kleine überdachte Terrasse. Bewohner des Ortes und der anderen benachbarten Bungalows sahen ihm zu, erlebten mit, wie er jedes Jahr ein Stückchen weiterkam und sparten nicht mit Lob und Anerkennung. Er nahm die Worte dankbar an, denn er konnte am Abend jedes Bautages sehen und anfassen was entstanden war. Alle konnten über die Jahre verfolgen, was dort unter Mühen wuchs und es verschaffte ihm ein gewisses Maß an Zufriedenheit. Oft war er, nach einem Tag voller Arbeit, zwar erschöpft aber glücklich.
Im Oktober 2010, seine Frau und er waren an die Ostsee auf ihr Grundstück gefahren, um alles winterfest zu machen, sprach sie ein Fremder an. Er stellte sich als Beauftragter des zuständigen Bauamtes vor. Im Verlauf des Gespräches, das mit der Frage eröffnet wurde: “Wissen Sie, dass das ein Schwarzbau ist?“, wurde ihnen dargelegte, dass sie sich im sogenannten “Außenbereich” befänden und damit, trotz der in nur geringer Entfernung angesiedelten Grundstücke, nicht mehr zum Ort gehören würden.
Er erklärte ihnen, „Außenbereich“ heiße, anders als im sogenannten „Innenbereich von Ortschaften“, dass alles, aber auch wirklich alles, der Genehmigung bedürfe. Einen Zaun erneuern, einen Gartenschuppen bauen, selbst den Wohnwagen umzusetzen, bedeute bereits, einen Verstoß gegen die geltende Bauordnung begangen zu haben.
Wenig tröstlich war, dass ihrem unmittelbaren Nachbarn ein ähnliches „Verbrechen“ vorgeworfen wurde.
Waren sie bisher davon ausgegangen, sie könnten einen Carport, wie innerorts nach der Baurechtslage üblich, bis zu einer bestimmten Größe ohne Genehmigung bauen, überraschte sie diese Aussage völlig.
Sollte er sich selbst beschreiben, würde er sich als “unbedarft“ bezeichnen, das heißt, er schaut nach rechts und nach links und fängt dann an, ohne dass ihm je der Gedanke käme, es könnte anders geartete Regelungen geben. Er denkt sich seine Welt zurecht und blendet alles aus, was seinem Schaffensdrang Grenzen setzen könnte.
Ist es Naivität oder schon Dummheit?
Im Laufe seines Lebens sollte er eigentlich gelernt haben, dass in Deutschland alles, aber auch wirklich alles, bis ins kleinste Detail, reglementiert wird.
Mit der Aufforderung einen Bauantrag nachzureichen und dem hoffnungsvollen Zusatz, dass eine Zustimmung zu erwarten sei, verabschiedete sich der Sachbearbeiter.
Die geforderten Unterlagen wurden beigebracht. Mit Schreiben vom Februar 2011 teilte ihnen das Bauamt mit, dass eine Ausnahmegenehmigung abgelehnt worden sei.
Die zu erwartenden Konsequenzen, das heißt, Rückbau des Geschaffenen, Vernichtung dessen, was er in jahrelanger mühevoller manueller und geistiger Arbeit erbaut hatte, wirkten bereits vor der Ablehnung verhängnisvoll destruktiv auf seine Psyche. Ihm war, als drohe man ihm an, einen Teil seiner Selbst vernichten zu müssen.
Auch mit diesen zusätzlichen Sorgen auf seiner Seele lässt sich die Entwicklung, die zum 24. Janauar 2011 führte, erklären.
Traumdämmern
Zu Beginn eines Jahres, das noch vor seiner Erkrankung lag, las er eine Reisebeschreibung über Abschnitte des heute bekanntesten Jakobsweges - vom Fuße der Pyrenäen bis nach Santiago de Compostela. Diese weckte eine Sehnsucht in ihm, die ihn nicht mehr loslassen sollte. Heute weiß er, er war damals schon auf der Flucht vor seinem Leben.
Aber zu jenem Zeitpunkt war ihm das nicht bewusst.
Zweifel beherrschten ihn und Unsicherheit, ob er es überhaupt unternehmen könnte, wie viel Zeit er sich lassen müsste, um alles vorzubereiten und ob es überhaupt legitim wäre, seinem Sehnen nachzugeben.
Es traten Ereignisse ein, die ihn sehr kurzentschlossen handeln ließen. Im gleichen Frühjahr unternahm er bereits alle notwendigen Schritte, um ein Pilger zu werden.
Er wollte ausbrechen aus dem Korsett seines Lebens. Er wollte Zeit nur für sich. Er wollte etwas Außergewöhnliches vollbringen. Er wollte Ruhe finden und er spürte einen Ruf in sich, der, wie er meinte, nur von Gott ausgegangen sein konnte.
Er war egoistisch und bekam eine adäquate Antwort.
Nicht sehen wollte er die Ängste seiner Partnerin, die plötzlich allein mit allen Anforderungen, die Arbeit und Grundstück an sie stellen würden, zurückbleiben sollte.
Er sah es nicht, durfte es nicht sehen, um in seiner Entscheidung nicht wankelmütig zu werden. Er ließ sie allein mit ihren Ängsten und wunderte sich, wie stark der Wind ihm ins Gesicht blies. Selbstgerecht stellte er fest, Helden sind immer die anderen, die sich einer solchen Herausforderung stellen. Er fühlte nur Unverständnis und empfand, dass ihm nur noch mit unausgesprochenen Vorwürfen begegnet wurde. Mehr als einmal war er versucht das Unternehmen abzubrechen und seinen Traum aufzugeben. Aber immer, wenn er sich an diesem Punkt befand, gab es auch Menschen, die ihn ermutigten weiterzumachen.
Nach seinem Empfinden summierten sich die Widerstände, seine Probleme wuchsen und seine seelische Verfassung verschlechterte sich zusehens.
Letztendlich wollte er nur noch fort und sehnte seinen Abreisetag herbei.
Am Abend, es begann die letzten Junidekade, war es soweit. Er verließ sein Heim und trat seine Pilgerschaft an. Ein Bild seiner Familie, Stunden vor seinem Losgehen gegeben, begleitete ihn.
Und dann war er plötzlich 2000 Kilometer weiter westlich, allein, scheinbar für nichts mehr verantwortlich, seinem bisherigen Leben entkommen.
Wie die Perlen einer Kette reihten sich die Kilometer zu Tagen, die Tage zu Wochen und er durfte eintauchen in sein fremdes Leben, in dem er etwas von seinen wahren Bedürfnissen erspüren lernte. Lasten der Seele, die ihn beschwert hatten, konnte er am Wegrand ablegen. Er durfte Teil dieses Landes werden, das ihn mit offenen Armen empfing. Viel Gnade hatte er dort erfahren dürfen. Tagtäglich meinte er, Gottes Gegenwart zu spüren und konnte sich an dessen Schöpfung erfreuen. Nie zuvor hatte er sich so viel Zeit gegönnt, ungestört über sein Leben nachzudenken und nie zuvor erlebte er ein derartiges Wechselbad seiner Gefühle, sich bewegend zwischen tiefster Trauer und höchster Freude. Er kam sich und seiner Vorstellung vom Leben näher. Der Gedanke an Rückkehr war ihm, als er nach Wochen der Wanderung auf der Klippe von Fisterra stand, fast unerträglich.
Einerseits wollte er nicht zurück. Nicht zurück in sein altes Leben, nicht zurück in den Lärm und die Enge, nicht zurück zu all den Problemen, denen er auf Zeit entkommen zu sein schien. Andererseits gab es auch Ideen und Vorstellungen, wie er sein Leben ändern könnte, was er verändern würde, wenn er erst einmal wieder daheim wäre, denn er hatte, so empfand er es in jenen Momenten, „wahrlich göttliche Zusagen“ erhalten.
Die Trennung von diesem Land, als er sich dann Anfang August auf die Heimreise machte, hinterließ eine tiefe Verzweiflung in ihm. Zwar hatte er die Pläne für sein neues Leben mitgenommen, aber auch nur Teile umzusetzen sollte ihm, was er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte, schon unsagbar schwer fallen. Er scheiterte an den banalsten Dingen.
Er wollte zu viel und zu schnell und bewegte nichts.
Seine Tage waren trübe und von selbstzerstörerischer Verzweiflung geflutet. Nur sein Körper hatte die Rückkehr in den Alltag geschafft, seine Seele sollte noch Wochen und Monate brauchen, um wieder in diesem realen Leben anzukommen.
So groß die Freude während des Pilgerns war, so tief war sein Absturz, als er wieder in sein gewesenes Leben zurückmusste. Er scheiterte auch, weil er nicht über seinen eigenen Schatten springen konnte und seine Träume, die in der Ferne erdacht und so leicht umsetzbar schienen, an seinem eigenen Unvermögen zerbrachen. Er richtete seine Wut darüber gegen sich, provozierte Erbrechen und fand seine eigene Unfähigkeit „zum Kotzen“.
Seine Seele blutete aus einer sich nicht schließen wollenden Wunde. Mit Macht steuerte er auf den 24. Januar 2011 zu.
Im Kloster
Er war von seiner Pilgerreise zurück, hatte monatelang versucht Abstand zu finden und war nie wieder richtig im Hier und Jetzt angekommen. Seine Arbeit forderte ihn über die Maßen, insbesondere das letzte Quartal war, wie jedes Jahr, strapaziös und kraftzehrend. Er schaffte es irgendwie und kam im Jahr 2010 an. Nach wie vor suchte er die Stille und Abgeschiedenheit.
Ein Beruf der viel am und mit dem Menschen zu tun hat, ist natürlich, bei dieser Grundhaltung, zusätzlich beschwerlich. Also vermied er außerhalb der Arbeitszeit menschliche Kontakte, so weit es irgend ging.
Nach dem Jahreswechsel rückte sein Geburtstag immer näher und er wollte den Feierlichkeiten, die damit meist verbunden waren, unbedingt ausweichen. Die Frage war aber: „Wohin?“
Er dachte an einen Rückzug in ein Kloster, geschuldet einer Sehnsucht, die er unmittelbar nach dem Ende seiner Pilgerreise gehabt hatte. Damals äußerte er sich wie folgt:
„Könnte ich frei entscheiden, frei von allen menschlichen und materiellen Verpflichtungen, würde ich mein weiteres Leben in einem Kloster verbringen.”
Aus dem Internet suchte er Klöster heraus, in die er auf Zeit eintauchen könnte. Da ihm bewusst war, dass er sich erst sehr spät, fast zu spät, bemüht hatte, erwartete er nicht unbedingt einen Erfolg.
Das Kloster Münsterschwarzach bot ihm dennoch, für eine Woche, über seinen Festtag eine Bleibe, die er dankbar annahm.
Der Tag und die Stunde seiner Abreise waren herangekommen. Seinem Rückzug geschuldet, lag hinter ihm und seiner Frau eine mit Schweigen geflutete Zeit. Kurz bevor er zu seiner Klosterauszeit aufbrach, gab sie ihm einen Brief mit der Bitte, diesen erst nach seiner Ankunft im Kloster zu lesen.
Stunden später kam er dort wohlbehalten an und wurde herzlich aufgenommen. Er hatte in einem Seitengebäude sein eigenes Zimmer und konnte sich seine Zeit frei gestalten. Jeden Tag bot sich die Möglichkeit, ein seelsorgerisches Gespräch zu führen und gern nahm er diese Chance wahr.
Dem betreuenden Pater schüttete er sein Herz aus, erzählte ihm von seinem Leben, seiner Kinder- und Jugendzeit, seinen Problemen beim Erwachsenwerden, seiner Ehe, von allen Schwierigkeiten, die er mit seinem Leben hatte und noch immer hat; und natürlich von seiner Pilgerreise und seiner Getriebenheit, die ihn letztendlich auch ins Kloster geführt habe. Er berichtete ihm von seinem Weg zu Gott, seinen Ängsten und seinen Zweifeln. Viel sprach er über sein zunehmendes Unvermögen, einerseits positive Elemente in seine Beziehung einzubringen, andererseits aber auch Kraft aus ihr zu beziehen. Er war sich klar, dass er an vielen Unzulänglichkeiten ihres Zusammenlebens nicht schuldlos war. Dennoch klagte er auch über, aus seiner Sicht, Unverständliches. In einem dieser Gesprächsstunden las er dem Pater den bereits erwähnten Brief seiner Frau vor.
Was ihn erstaunte, war dessen Reaktion, denn der sagte:
“Das hätte ich nicht erwartet!”
Der erfahrene Seelsorger hörte das Interesse an seinem Gast, das aus dem Geschriebenen sprach. Für ihn war es ein Brief der Sorge.
Er, aus seiner Betroffenheit heraus, vernahm jedoch nur die Vorwürfe, die vermeintlich aus den geschriebenen Worten sprachen. Sie schrieb ihm, dass sie sein Lachen vermisse, dass er sich zurückziehe, nur negative und schwarze Gedanken hätte, dass sein Schweigen ihr Leben zudecke. Sie warf ihm vor, sie mit seiner kurzentschlossenen Pilgerreise im Stich gelassen zu haben. Das er ihren Ängsten, Sorgen, Selbstzweifeln ignoriert habe, sie nicht genügend einbezogen und zuwenig mit ihr abgesprochen habe. Sie gab ihrer Verletztheit Ausdruck, weil er eher Fremde um Hilfe bat, sie aber nicht beachtet hätte. Er bezöge sie zu wenig in ihre gemeinsame Arbeit ein und beschwere sich am Ende, dass alles bei ihm bliebe, schrieb sie. Sie warf ihm sowohl seine Schuldgefühle und sein Streben nach negativen Gedanken vor, als auch sein Gejammer über seine fehlende Freiheit und sein Selbstmitleid.
Sie riet ihm sich der guten Dinge und Erlebnisse zu erinnern, sich selbst anzunehmen, wie er eben sei. Sein Leben nicht wegzuwerfen. Sich selbst gelte es zu lieben, um seinen Nächsten lieben zu können.
Sie wünschte sich wieder mehr Gemeinsamkeit, mehr “vernünftige” Gespräche, mehr Zukunft und sie wünschte ihm, mehr Seelenfrieden und ein Ende seiner Suche.
Es war ein bewegender, ihm zugewandter Brief, aber er sah nur seine Verletztheit und wertete alles als Angriff. Alles erschien ihm ungerechtfertigt und jedem einzelnen Satz, meinte er, ein Argument entgegensetzen zu können. Aber ihm war auch klar, dass er sich in Ursachenbegründungen, in verletzenden Schuldzuweisungen erschöpft hätte, ohne etwas zu bewegen. Ihm fehlten noch die Worte, um angemessen Antwort geben zu können, ohne neue Mauern zu errichten.
Vor dem Pater fühlte er sich wie ein Narr. Er sah sich zu Rechtfertigungsversuchen veranlasst. Wenigstens ihm, einem Fremden, wollte er verständlich machen, wie viele blockierende Ängste in ihm sind, wie viel Ablehnung er in seinem Leben meinte erfahren zu haben. Er beklagte, wie schwer es ihm fiele auf Menschen zuzugehen und wie viel Schuld, Schulden und Scham er angehäuft hätte. Es schien ihm, als würde all sein Versagen auf seiner Stirn geschrieben stehen, für jedermann zu lesen und nur im Rückzug und im Suchen der Stille sah er die Einzige, für ihn akzeptable, Lösung.
Auch dort im Kloster sehnte er oft die Stille herbei, in der er hoffte Gott würde, wie auf seinem Weg durch Spanien, wieder „zu ihm sprechen“. Er betete viel in dieser Zeit, lag in der Krypta vor dem Altar, wie einst die Ritter in der Nacht vor ihrer Schwertweihe und wartete auf ein Zeichen.
Er hatte nur etwas mehr als eine Woche Zeit und kurz bevor er in sein Leben zurückkehren musste, hatte er eine Eingebung. An diesem Tag schrieb er seinen Brief an seine Frau.
Es war eine Antwort auf ihre Klagen.
Danken wollte er ihr für den Mut und die Sorge die aus ihren Worten sprach. Er argumentierte nicht dagegen, weil er gegen Wahrheiten nicht argumentieren konnte, aber es waren ihre Wahrheiten. Fehler die er gemacht hatte, gab er zu und versuchte gleichzeitig, sein Verhalten zu erklären. Er schrieb ihr von seinen unerfüllten Träumen und Sehnsüchten, von all den Dingen, von denen er meinte, er hätte sie in ihrer gemeinsamen Beziehung Jahr um Jahr mehr vermisst. Gleichzeitig warb er um Verständnis und versuchte mit Worten etwas von der „Trümmerlandschaft“ in ihm widerzuspiegeln, die einer wachsenden Barriere zum „normalen“ Leben glich.
Dass er sich vorstellen könnte, Hilfe zu suchen, um seine Sprache wiederzufinden oder diese neu zu erlernen, schrieb er. Er sah die Chance, die sie ihm bot, um wieder gemeinsam einen liebevolleren Umgang pflegen zu können.
Er schrieb diesen Brief, an einem der letzten Februartage 2010, in der Krypta des Klosters nieder, wortwörtlich, hintereinander weg und wie er meinte, von Gott eingegeben.
Zwei Tage später machte er sich auf die Heimreise.
Er brach auf mit Hoffnung und Angst im Herzen.
Er brach in Richtung des 24. Januar 2011 auf.
Vom Schreiben
So lange er denken kann, ist er der Magie der Worte verfallen. Er lernte sie aus Büchern, spielte mit ihnen in der Schulzeit und versuchte, sie in schulischen Aufsätzen zu formen.
Dann kam ein Lebensabschnitt literarischer Ödnis, er las wenig und schrieb, außer Pflichttexten, gar nichts mehr.
Eine intensive Zeit lag hinter ihm. Sie war angefüllt mit einem enormen Lernpensum während des Studiums. Hinzukamen seine Heirat, die Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit, die Geburt seiner Tochter und der Bau eines Hauses mit seinen eigenen Händen. Das Erleben der “Wende” und die Niederlassung in eigener Praxis gaben ihm zeitweiligen Auftrieb. Der Kampf, gegen einen selbstverursachten wirtschaftlichen Absturz, verbrannte jedoch viel von seinen Kraftreserven.
Seine innere Sonne war im Sinken begriffen.
Irgendwann entdeckte er die Freude am Lesen wieder, etwas, das ihm über die genannten Jahre verloren gegangen war. Bücher boten ihm Rückzugsmöglichkeit, um seiner Realität entrückt, in eine Parallelexistenz einzutauchen. Zusätzlich untermalte er die gelesenen Worte mit Musik, die ihn aus dieser Welt zu entführen schien. Er schuf sich sein eigenes Universum, das nur für ihn da war und ihm jederzeit zur Verfügung stand.
Was ihm die Gegenwart nicht schenken konnte oder wollte, fand er dort, das Gefühl Teil von etwas Großem zu sein, Annahme zu finden, der Enge zu entfliehen.
Und eines Tages entdeckte er sich selbst neu, in Worten, die seine Welt reflektierten. Schüchtern und vorsichtig wagte er erste Schritte, schrieb Gedichte, nur für sich. Ihre Inhalte waren Sachthemen, zumeist unverfänglich, aber schon Stellung zur Gegenwart beziehend. Mit der Zeit drang er immer tiefer in seine innere Welt vor, in ihren Schmerz und ihre Dunkelheit. Verdrängtes offenbarte sich ihm und manches, das er nie hatte wahrnehmen wollen, drängte ans Licht. Dort entdeckte er den Ursprung, der ihn inspirierenden Kraft. Er begann seine Gefühle sichtbar zu machen, sie zu verdichten, um sich selbst besser zu verstehen. Seine Ängste und seinen Schmerz ließ er heraus, tränkte seine Worte mit Tränen und suchte mit ihrer Hilfe nach Lösungen. Er verletzte und offenbarte und bezog die Öffentlichkeit mehr und mehr ein. Seine Gedichte wurden zum chirurgischen Skalpell, mit dem er sich vor aller Augen sezierte. Er kehrte sein Innerstes nach außen und erschreckte sich und andere.
Viele Abende schrieb er bis tief in die Nacht, Gedicht um Gedicht, Jahr um Jahr. Es gab irgendwann kein Thema mehr, das er ausließ. Die Welt, die ihn umgab, reagierte sehr unterschiedlich darauf. Fremde fühlten sich angesprochen, zum Nachdenken angeregt oder verstanden.
Nahestehende Menschen fühlten sich manchmal angegriffen oder verletzt oder missverstanden oder fanden keinen Zugang zu den Inhalten und Aussagen seiner Verse.
Seine Welt war nicht lustig, sie war schwarz und grau, handelte von Kälte und vom Ausgestoßen werden, berührte die Grenzen menschlichen Seins und die Fragen des „Danachs“. Er war auf der Suche nach Liebe, nach Vertrauen, nach Gott. Er stellte Fragen und wünschte sich Antworten. Er schrieb sein Seelentagebuch, Jahr um Jahr, in gereimter Form.
Ein Gedicht über Liebe, wie er sie erträumte, löste fast eine Ehekrise aus.
Als ihm viele Jahre vor seiner Erkrankung, von einem ihm zugewandten Menschen, die Freundschaft angetragen wurde, griff er danach, wie der Ertrinkende nach einem Strohhalm. Es war die Magie der Worte, die sie miteinander verband. Schreiben und antworten, philosophieren und träumen, alles sehr offen, geschuldet einem Urvertrauen, das sofort zwischen ihnen herrschte. Hunderte E-Mails, nur füreinander bestimmt, gingen hin und her. Sie entdeckten eine gemeinsame Welt und weckten bei anderen Verlustängste.
Das Ausmaß dieser Ängste war so groß, dass seine Partnerin um ihre Ehe fürchtete. Zum ersten Mal lernte er die Brisanz von Worten, in ihrer ganzen Gefährlichkeit, kennen.
Er hatte geschrieben, also war er für die Folgen verantwortlich.
Die Wogen glätteten sich.
Ihre Ehe schien aus diesem Streit gewachsen hervorgegangen zu sein und er beobachtete die Entwicklung in und mit seinen Gedichten. Jedoch empfand er die Gemeinsamkeit zunehmend als einen fragilen Burgfrieden, geschlossen aus Angst vor möglichen Konsequenzen.
Erneut zog er sich zunehmend zurück. Er verschloss seine Worte, seine Sprache wurde für seine Partnerin wieder unverständlich, und das Schweigen trat an Stelle gemeinsamer Gespräche.
Fremde Menschen ließ er eher an seinem Leben teilhaben als sie. Aus der Dunkelheit zog er seine Kraft und seine Inspiration. Sie fesselte ihn, fokussierte seinen Blick und wurde seine Muse.
Gott schlich sich in seine Gedanken und er wandte sich ihm zu, doch nie unvoreingenommen, immer vom Stachel des Zweifels getrieben, bis er bereit war Ihn anzuerkennen. Dieser Widerstreit zwischen Glaube und Zweifel gab seinem Sehnen nach „Ausweg“ neue Nahrung und ließ ihn diese „jenseitige Welt“ noch intensiver herbeiwünschen. Er wollte und konnte keine positiven Gedanken zulassen, aus Angst er verlöre die Fähigkeit zu schreiben oder würde sich in Oberflächlichkeiten, Banalitäten und Belanglosigkeiten erschöpfen.
Es war zu einer seiner Urängste geworden, dass die „Stimme in ihm“ verstummen könnte.
Er konnte und wollte „das Licht“ nicht sehen, selbst wenn es da war.
Immer mehr wandte er sich dem „Schatten“ zu.
Seine Gedichte wurden komplexer und vielschichtiger. Die Worte woben Bilder die in ihm waren und ließen Betroffenheit zurück. Man sagte ihm, sie seien gut und ihr Inhalt bedenkenswert. Er legte den Finger immer genau in die Wunde, die ihm am meisten wehtat und erschütterte sich so manches Mal selbst. Die Gedanken kamen oftmals scheinbar aus dem Nichts. Wie ein Gefäß, das sich leerte, ergossen sich die Worte auf das Papier, wurden zu Verse und schließlich zu einem Gedicht, das er oftmals ohne abzusetzen hintereinander schrieb. Kamen sie aus seinem Unterbewusstsein, kamen sie von Gott? Manchmal schien es ihm so, als führte „eine Macht“ seine Hand.
Auf seiner bewegenden Pilgerreise entstand ein ganzer Gedichtzyklus, der die Schöpfung verherrlichte und das Erlebte, als unfassbare Glückserfahrung, widerspiegelte.
Dort war er sicher, dass „Gott zu ihm sprach“.
So hell die Gedichte dieser Zeit waren, so dunkel wurden sie nach seiner Rückkehr. Noch empfindsamer geworden, kamen ihm die Widrigkeiten des Lebens als unsagbare Last vor und diese reflektierte er.
Retten wollte er das Vergangene und so schrieb er sein Leben als Pilger nieder, hielt Vorträge und Lesungen und hoffte, etwas von dem glückhaften Erleben festhalten zu können.
Doch es half alles nichts.
Unaufhaltsam bewegte er sich auf den 24. Januar 2011 zu.
Vom Opportunismus oder der „Ja-Sager“
Wann hatte er das letzte Mal „Nein“ gesagt, wurde eine Bitte geäußert, ein Wunsch an ihn herangetragen oder eine Forderung erhoben? Zu allen lieb sein, ihnen ja nichts abschlagen, sich verbiegen, um einen „guten Eindruck“ zu hinterlassen, Einer der immer bereit war Aufgaben zu übernehmen, so ging er mit sich um.
War es Feigheit, Angst die eigenen Interessen im Auge zu behalten, Angst vor Auseinandersetzungen, Angst sich unbeliebt zu machen, war es Sorge nicht angenommen zu werden?
Sicher spielten viele Faktoren eine Rolle, aber nur selten gelang es ihm dieses erlernte, strapaziöse, nur scheinbar für seine Lebensführung hilfreiche „Ja“, abzulegen.
So war es nicht verwunderlich, dass er seinen Wehrdienst zur vollsten Zufriedenheit seiner Vorgesetzten absolvierte, im Studium nicht auffiel und später, auf der Arbeit, geschätzt wurde, als fleißiger, immer hilfsbereiter Kollege.
Es war die Zeit der Ausbildung zum Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Er verehrte seinen Klinikleiter, wurde von diesem gefördert und bald als möglicher Nachfolger in ferner Zukunft gehandelt.
Leitungskader waren damals in der Regel Mitglied der „SED“ und so wurde ihm irgendwann eine Anwartschaft angetragen.
Konnte er seinen „Chef“ enttäuschen? Er meinte: „Nein“ und sagte: „Ja“!
Er ging einen Schritt, von dem er sich einredete, dass er ihm neue Perspektiven eröffnen würde, er vielleicht auch ein wenig Einfluss auf diese Partei nehmen könne und er Zugang zu mehr Informationen erhielte.
Die Partei „umarmte“ ihn und wies ihm Aufgaben zu, sich zu profilieren.
Anderen die „Ideen und Ideale des Sozialismus“ nahezubringen, in Veranstaltungen, die sich „Schule der sozialistischen Arbeit“ nannten, wurde ihm aufgetragen.
Er befand sich in einem Konflikt.
Einerseits stand er nicht hinter den proklamierten Parteilehren, andererseits sollte er aber gerade diese überzeugend vermitteln. Er übte sich im Spagat einer Parteizugehörigkeit, die er eigentlich nie gewollt hatte und dem Vorbild als sogenannte „Sozialistische Persönlichkeit“, das Vorgesetzte in ihm sahen und die öffentlich geehrt wurde.
Seine Schulungen nutzte er, um kritische Gedanken anzuregen und Fragen aufzuwerfen, ohne jedoch diese Gesellschaftsordnung an sich, infrage zu stellen.