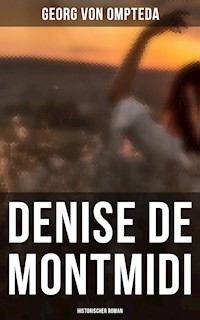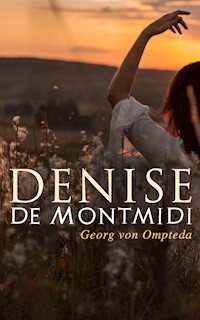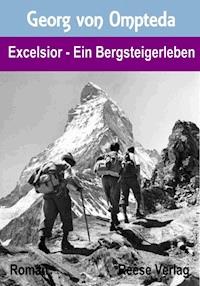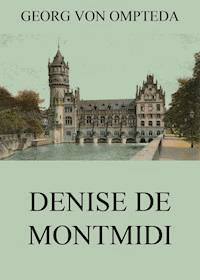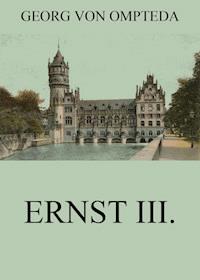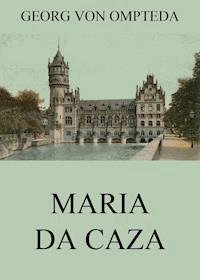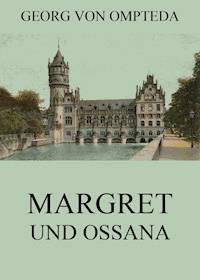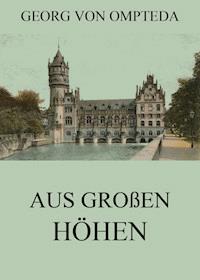
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem Alpenroman "Aus großen Höhen" führt uns der Schriftsteller in die wilde, erhabene Natur der Dolomiten.
Das E-Book Aus großen Höhen wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus großen Höhen
Georg Freiherr von Ompteda
Inhalt:
Georg Freiherr von Ompteda – Biografie und Bibliografie
Aus großen Höhen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Aus großen Höhen, G. von ompteda
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638917
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Georg Freiherr von Ompteda – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 29. März 1863 in Hannover, verstorben am 10. Dezember 1931 in München. Sohn des letzten Hofmarschalls des Königs Georg V., Wilhelm Heinrich von O., war Offizier, nahm 1892 wegen eines Sturzes vom Pferde seinen Abschied, lebte dann längere Zeit in Dresden und jetzt in Meran. Er schrieb, anfangs unter dem Pseudonym Georg Egestorff, eine größere Anzahl erzählender Werke, die alle wiederholte Auflagen erlebten. Wir nennen die Novellen: »Freilichtbilder« (Leipz. 1890), »Die Sünde« (das. 1891), »Vom Tode« (Berl. 1893), »Unter uns Junggesellen« (1894), »Unser Regiment« (1895), »Die sieben Gernopp« (1895), »Leidenschaften« (1896), »Weibliche Menschen« (1898), »Luft und Leid« (1900), »Die Radlerin« (1901), »Das schönere Geschlecht« (1902), »Traum im Süden« (1902), »Nerven« (1903); ferner die Romane: »Drohnen« (1893), »Deutscher Adel um 1900«, erster Teil: »Sylvester von Geyer« (1897, 2 Bde.), zweiter Teil: »Eysen« (1900, 2 Bde.), dritter Teil: »Cäcilie von Sarryn« (1902, 2 Bde.); »Maria da Caza« (1897), »Der Zeremonienmeister« (1898), »Philister über dir!« (1899), »Monte Carlo« (1900), »Aus großen Höhen« (1903), »Denise de Montmidi« (1903), »Heimat des Herzens« (1904), »Herzeloide« (1905), »Normalmenschen« (1906), sämtlich in Berlin erschienen. Außerdem verfaßte er mehrere Schauspiele: »Die Wiedertäufer« (1893), »Nach dem Manöver« (1894) und »Eheliche Liebe« (1898), auch Gedichte (»Von der Lebensstraße«, Leipz. 1890) und eine freie Übertragung von G. de Maupassants »Gesammelten Werken« (Berl. 1898–1903, 20 Bde.). O. besitzt ein kräftiges Erzählertalent, seine impulsive Natur fesselt, seine Charakteristik des Adels (namentlich in seinem besten Werke: »Eysen«) ist vielseitig und anschaulich, aber seinen Werken fehlt die Rundung einer ausgereiften Form.
Aus großen Höhen
1.
Grüß Gott! – klang es; und eine neue Gesellschaft trat in die Dreizinnenhütte.
»Grüß Gott!« antworteten die schon Anwesenden, die an den beiden Tischen in der kleinen Stube sahen und ihr Abendbrot verzehrten.
Die Neueingetretenen – zwei Herren und eine Dame – zögerten einen Augenblick und sahen sich um. Sie mußten sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen, denn draußen war schon Dämmerung eingebrochen, und in der Hütte brannte die Lampe, ihre kargen Strahlen durch dichten Tabaksrauch werfend, der den Raum erfüllte.
Die drei suchten nach einem Platz am Tisch. Professor Hallbauer, der größere der beiden Herren, ein riesiger, kräftiger, breiter Mann mit ein paar auffallend glänzenden, schwarzen Augen, die unter der goldenen Brille blitzten, nahm seinen schweren Führerpickel zugleich mit dem leichten seiner Frau und stellte sie in die Ecke; den vollgepackten Rucksack hing er dazu:
»Dörstling, gib deinen Rucksack her, nein, nein, hier...«
Der andere, einen Kopf kleiner, ein zarter, weicher Mann mit schönen, feinen Zügen, die etwas Weibliches hatten trotz des Schnurrbartes und des modisch spitz geschnittenen am Kinn, reichte dem Professor den langen Bergstock, mit dem er gegangen, und einen ganz neuen, schmächtigen Rucksack. Es wurde zu den übrigen Sachen getan.
Der Professor machte eine kurze Handbewegung auf die eine Tischecke, und an der bezeichneten Stelle nahmen sie Platz.
Frau Hallbauer strich ihr kastanienbraunes, lockiges Haar zurück, das etwas wirr geworden war, und blickte dabei zu Joachim Dörstling, als fürchte sie, er möchte gefunden haben, die unordentliche Frisur stehe ihr nicht.
Nun trat der Hüttenwart, ein großer, starkknochiger Sertener in Hemdsärmeln, wie er war, hinzu und fragte, was die Herrschaften genießen wollten. Frau Hallbauer und Dörstling bestellten eine Konserve: »WÜrstl mit Kraut«. Der Professor dagegen nur eine Erbssuppe.
Dörstling wollte ihn bewegen, Wein zu trinken wie er, doch Klara Hallbauer meinte, während sie über ihren Mann einen flüchtigen Blick gleiten ließ, in dem ein Gemisch lag von Widerstreben und doch ihr abgerungenem Stolz:
»Karl trinkt nie Wein auf Hochtouren!«
»Das heißt, ich meide Alkohol überhaupt. Er regt nur an auf kurze Zeit, um schnell zu ermüden. Ich verwerfe Alkohol in jeder Form, sobald es sich um körperliche oder geistige Leistungen handelt.«
Dörstling hob sein Glas, in dem der rote Tiroler dunkel floß, trank einen Schluck und sagte:
»Du als Arzt mußt es ja wissen. Aber so einem elenden Talwanderer wie mir schadet's doch nichts.«
»Mäßig genossen – nein. Man darf auch nicht Pedant sein. Du bist einmal Wein gewohnt, also magst du ihn nur ruhig weiter trinken...«
Der Professor hielt einen Augenblick inne und blickte den andern freundlich an. Aus seinen Augen schoß zu dem hübschen, weichen jungen Mann ein Strahl der Zuneigung, der fast Liebe war. Klara aber meinte, indem sie dem Gatten die Hand auf den Arm legte:
»Nicht wahr, mit dem Talwanderer ist's doch nicht so schlimm, Männchen? Er ist doch ganz gut gestiegen heute!«
»Gewiß! Gewiß!« und der Professor klopfte Dörstling auf die Schulter.
Während die Suppe kam und die Würstl mit Kraut, zuckte der junge Mann ein paarmal fröstelnd zusammen. Sofort fragte der Professor, ob ihn friere, und als jener es zugegeben, holte er seinen Wettermantel, den er durch die Trageriemen des Rucksacks gezogen, und hing ihn dem Freunde um wie eine sorgende Mutter.
Am selben Tisch wie die drei hatten noch vier andere Bergsteiger Platz genommen. Zwei junge Leute, denen kaum der erste Flaum am Kinn wuchs, und zwei Herren Ende der Dreißiger. Die beiden jungen Leute saßen dicht beieinander, rauchten schweigend aus kurzen Pfeifen und warfen nur ab und zu einmal einen Blick zu den andern am Tisch. Die älteren unterhielten sich eifrig. Am Tonfall erkannte man die Österreicher. Die Unterhaltung drehte sich um Berge, Unterkunft, Führer, Entfernungen, Marschzeiten, schwierige oder gefährliche Stellen.
Während sie sprachen, trat aus dem Nebenraum, der zur kleinen Küche führte, wo der Hüttenwart bei den Vorräten, die dort aufgestapelt waren, seine Lagerstatt hatte, ein schlanker Führer mit blauen Augen und kleinem Schnurrbärtchen und blieb, die Hände in den weiten Taschen seiner Kniehose, schmunzelnd stehen, indem er sich umblickte und die Anwesenden musterte.
Der eine Herr am Tisch rief ihn an:
»Jörgl, was meinen S', wie schaut's mit dem Wetter aus?«
Jörgl Tschurtschenthaler, der beste Sextener Führer, einer der vorzüglichsten Kletterer der Dolomiten, nahm die Pfeife aus dem Mundwinkel, bewegte zweifelnd den Kopf hin und her und meinte:
»Sell kann man nit wissen. Wolken von Nord ischt nit schlecht!«
»Aber was meinen S', gehn tun wir doch sicher?«
»I mein' schon, Herr Rat! I denk, wann uns 's Wetter unterwegens derwuscht, lassn wir uns amol richtig abwaschn. Trocken wird ma wieder. Da fehlt nix. Und wann's morgen in der Früh glei beim Aufstehn tuat reg'n, wartn wir halt, und wird's gar nit besser, leg'n wir uns wieder schlof'n. Aber natierli, ganz wie die Herrn wolln. Mir is alles recht.« Als der Professor Jörgl Tschurtschenthalers Stimme hörte, setzte er seine Teetasse hin und drehte sich um:
»Grüß Gott, Jörgl!«
Der Führer betrachtete ihn eine Sekunde, dann streckte er ihm auch schon die Hand entgegen:
»Taifl! Der Herr Professor! Grüß Ihna Gott! Aber das freit mi! Sein S' a amal wieder bei uns in den Dolomiten?«
Jörgl Tschurtschenthaler trat näher an den Tisch heran. Nun reichte ihm auch Klara die Hand, während Dörstling ihn lächelnd betrachtete, in der halben Zurückhaltung des Dritten, wenn zwei andere, mit denen er zusammensitzt, einen alten Bekannten wiedergefunden haben, den er nicht kennt.
Das Gespräch ging hin und her, eigentlich bloß zwischen dem Professor und dem Führer. Erinnerungen wurden aufgefrischt, wie unter ehemaligen Kriegskameraden, die sich unverhofft wiedersehen und nun des Plauderns kein Ende finden.
Am Gspaltenhorn in der Schweiz hatten sie einmal miteinander in den Felsen die Nacht zugebracht, weil der Schneesturm ganze Steinlawinen auf ihren Weg geschüttet, so daß sie über achtzehn Stunden hatten an einem Fleck bleiben müssen, um nicht erschlagen zu werdem
Dann hatte der Jörgl an der Cima della Madonna seine Pfeife eingebüßt, die ihm ein unvermuteter Ruck des Seiles aus dem Munde geschlagen. Und wieder erinnerten sie sich an den Abbruch einer Eiswand am Großen Elend Ferner, keine halbe Minute, nachdem sie die Stelle überschritten.
»Da hättet ihr aber leicht weg sein können!« meinte Dörstling.
Der Professor antwortete nur nachdenklich, während der Führer zurückgetreten war und mit dem Hüttenwart sprach:
»Wenn man deswegen das Bergsteigen aufgeben wollte, ja, mein Gott, in der Stadt kann einem auch ein Ziegel auf den Kopf fallen, oder man kann überfahren werden. Du glaubst gar nicht, wieviel Menschen jährlich in großen Städten, wie Berlin, Paris, London, totgefahren werden. Ich habe mal die Statistik in der Hand gehabt. Jedenfalls viel mehr, als je in den Bergen verunglückt sind.«
Der eine der beiden Österreicher nickte:
»Sehr richtig, und die Abgestürzten sind noch dazu meist Edelweißsucher ...«
»Oder gänzlich Laien, ohne körperliche und geistige Eignung, ohne sachgemäße Ausrüstung ...« fügte der andere der beiden Herren hinzu. So kam die Gruppe am Tisch ins Gespräch, das sich nun allmählich von einem zum andern weiterspann. Nur die beiden jungen Leute beteiligten sich kaum. Sie hörten eifrig zu, nickten hier und da, verhielten sich aber sonst schweigsam.
Es wurde von den Bergen gesprochen, von schwierigen Besteigungen im allgemeinen und besonders von den Dolomiten, ihren abenteuerlichen, seltsamen Formen, ihrer Schroffheit und Steilheit, wie sie einzig ist in den gesamten Alpen.
Die beiden Österreicher meinten, Dolomitklettereien ohne Führer zu machen, wäre ein sträflicher Leichtsinn, und drüben aus der Ecke tönte eine Stimme herüber:
»Da haben Sie vollkommen recht!«
Die am Tisch blickten sich um nach dem, der gesprochen. Es war ein älterer Herr, der bei seiner Flasche Bier saß und nun wieder in seinem Reiseführer, einem Baedeker oder Meyer, las.
Der Professor hatte geschwiegen. Nun aber ergriff seine Frau das Wort und meinte halblaut, zu den beiden Österreichern gewendet:
»Mein Mann geht meist ohne Führer!«
Der Herr in der Ecke brummte wieder etwas, das man jedoch nicht verstehen konnte. Es entstand eine peinliche Pause. Klara erhob sich und flüsterte, wieder das ungefüge Haar aus den Schläfen streichend, ihrem Manne zu:
»Ich bin müde, Karl, ich möchte schlafen gehen!«
Sofort erhob sich Professor Hallbauer, und Klara verneigte sich leicht gegen die andern Herren am Tisch, ehe sie ging. Dann reichte sie Joachim Dörstling die Hand und blickte ihn flüchtig an:
»Gute Nacht! Auf Wiedersehen morgen mittag, wenn wir wiederkommen!«
Er machte eine Bewegung, als wollte er ihre Hand küssen, doch er unterließ es. Der Professor und seine Frau schritten voran in den Nebenraum, wo die Herren schliefen. Sie gingen durch bis in das letzte kleine Gemach, das Damenzimmer. Es war ein winziger Raum, in dem auf erhöhter Bretterlage vier Matratzen gebreitet waren, das Kopfende etwas höher. Wollene Decken lagen darauf. Ein Spiegel fehlte nicht, und Waschgeschirr stand auf einem Bord an der Wand.
»Brauchst du noch etwas, Klara?« fragte der Professor.
»Nein, danke schön. Aber du weckst mich zeitig genug!«
»Natürlich. Hast du denn immer Angst, du könntest nicht Zeit genug haben, du Närrchen?«
»Ich mag doch nicht unordentlich aussehen!«
Er gab ihr den Gutenachtkuß. Dabei verzog sich sein Mund zu einem Lächeln, und er, dessen Art Scherzen und Kosen fremd und schwer war, flüsterte ihr zu, indem er ihr mit dem Rücken der Hand die Wange strich:
»Meine Kläre ist doch immer eitel!«
Dann ließ er sie allein. Doch er kehrte noch einmal zurück:
»Wenn bis neun Uhr keine Dame mehr kommt, ist's möglich, daß mich der Hüttenwart mit hereinläßt, denn die Betten sind alle besetzt, und ich müßte sonst oben auf dem Heulager schlafen. – Jedenfalls paß auf das Licht auf und vergiß nicht auszulöschen!«
Nun ging er wirklich. Sie aber machte eine ungeduldige Bewegung und zog ein Mäulchen. Lange betrachtete sie sich im Spiegel, ehe sie sich auszog. Die Unterkleider behielt sie an, nur das Flanellhemd wechselte sie. Ihr Mann hatte ihr ein kleines Paket gebracht, das er seinem Rucksack entnommen: es enthielt in Wachstuch eingeschlagen alles, was sie brauchte für Nacht und Morgen.
Dann legte sie sich und wickelte sich in die Decken. Schon wollte sie einschlafen, als sie daran dachte, daß das Licht noch brannte. Bei dem Gedanken, sich aus den warmen Hüllen wieder erheben zu müssen, überschlich sie ein ärgerliches Gefühl gegen ihren, wie sie meinte, pedantischen Mann. Aber als sie sich in der Dunkelheit wieder legte und die Wolldecken zurechtzog, fühlte sie sich bald warm und versank in süße Träume.
Joachim Dörstling hatte dem Freunde gute Nacht gesagt. Er langweilte sich in der räucherigen Hütte und wollte lieber schlafen gehen. Der Professor blieb noch auf, um neun Uhr zu erwarten. Der Jüngere aber trat in den allgemeinen Schlafraum. Er hatte das letzte Lager bekommen, hart an der Wand des Damenzimmers, und als er sich zur Ruhe gelegt und sich noch einmal überzeugt, daß er auch allein im Zimmer sei, klopfte er an der dünnen Holzwand und lauschte mit gespannter Aufmerksamkeit, bis von drüben das gleiche Klopfen antwortete.
»Gute Nacht!« sagte er ganz leise, den Mund an die Wand gepreßt.
»Gute Nacht!« klang es ebenso leise zurück. Und ein glückliches Lächeln auf den Lippen, schmiegte sich Joachim ganz nahe an die harte Holzwand und schloß die Augen.
Als die drei Neuankömmlinge den Eßraum der Dreizinnenhütte verlassen hatten, rief der Österreicher:
»Jörgl! Jörgl!«
Tschurtschenthaler erschien in der Tür:
»Woas wünschen S'?«
Wer der Herr sei, den der Jörgl »Herr Professor« angeredet? Der Führer nannte den Namen. Die beiden jungen Leute, die mit am Tisch saßen, horchten sofort auf. Nun fragten die Österreicher abwechselnd Jörgl aus: ob die Dame seine Frau sei – ja; wer der andere Herr wäre – er wußte es nicht; der Professor müßte wohl ein tüchtiger Steiger sein, da er allein ginge.
Tschurtschenthaler antwortete:
»Der beschte Tourischt ischt er schon, mit dem i gangen bin. Jetzt geht er halt immer allein und macht den Führer für die Frau ...«
Aber da trat der zweite Führer der beiden Herren in die Tür, ein kleiner, schwarzer Kerl mit dunklen Augen, Pacifico Menardi, ein Ampezzaner aus Cortina:
»Jörgl, dei Suppen wird kalt!«
Das Ladinische klang heraus, irgendein fremder Ton, obwohl die Worte gesetzt waren, wie es Jörgl nicht anders getan hätte.
Nun kamen die beiden jungen Leute mit den älteren österreichischen Touristen ins Gespräch. Sie wußten von Professor Hallbauer und redeten von ihm mit größter Bewunderung. Verehrung, fast Liebe klang daraus, hohe Begeisterung, beinahe etwas wie Scheu vor dem Mann, der einen der ersten alpinen Namen der Welt trug.
Sie erzählten, daß Professor Hallbauer in seiner Bergsteigerlaufbahn nahe an tausend Gipfel bestiegen, darunter in den letzten Jahren viele hundert führerlos. Er hatte über sechzig Erstbesteigungen oder doch Besteigungen auf durchaus neuen Wegen gemacht.
Die jungen Leute, die offenbar die alpine Literatur genau kannten, erzählten mehr und mehr von ihm. Einer nahm immer dem andern das Wort vom Mund. Der ältere sagte:
»Bei der Katastrophe vor zwei Jahren am Lyskamm hat er den einen verletzten Führer aus Lauterbrunnen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ganz allein drei Stunden über den Gletscher geschleppt.«
»Er hat zum Beispiel den steinsicheren Felsenweg auf die Eroda rossa gefunden!« fiel der andere ein.
Doch sofort begann der ältere von neuem und fragte, ob die Herren nicht des Professors Beschreibungen kennten aus der Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins und aus dem Jahrbuch des Schweizer Alpenklubs?
Der »Rat«, wie ihn Jörgl genannt, verneinte, zog aber das Notizbuch, um sich den Namen aufzuschreiben. Doch die jungen Bergsteiger rieten, die Herren möchten lieber das Werk Hallbauers lesen: »Tagebuch eines Bergsteigers«. Es sei so tief, so voll heiligsten Naturgefühls, voll gewaltigster Poesie und erhabenster Empfindung, wie nichts jemals über die Berge geschrieben worden. Es könne nur von einem großen, innerlichen Menschen stammen.
Wie so ein Wort das andere gab, stellten sich, als man bekannter und herzlicher wurde, mit einemmal die jungen Leute vor:
» Studiosus medicinae Julius, studiosus juris Eberhard Weber aus Jena.«
Zwei Brüder. Die Österreicher nannten gleichfalls ihre Namen, und im weiteren Verlauf des Gespräches fand sich Stand und Titel dazu: Dr. Lodinger, Statthaltereirat aus Graz, unb Alois Gstatter, Hof- und Gerichtsadvokat aus Wien.
Aber die Unterhaltung dauerte nicht mehr lange. Alle dachten ans Schlafengehen, und bald zog sich einer nach dem andern zurück. Zuletzt auch der ältere Herr vom andern Tisch, der in seiner Ecke gebrummt. Zwei weitere Touristen, die dort gesessen, ein paar Paßwanderer in langen Beinkleidern mit Bergstöcken bewehrt, der eine sogar in gesteiftem, nun natürlich gänzlich zerknittertem Leinenhemd, waren schon vorher zur Ruhe gegangen.
Auch die Führer hatten das Heulager auf dem Boden aufgesucht, das von außen über eine Leiter gewonnen werden mußte.
Der Professor stand vor der Hütte, abgehärtet, wie er war, im bloßen Rock. Für ihn war es frisch und kühl, aber nicht kalt. Er blickte in die brauenden Nebel hinaus, die sich um die drei Zinnen wanden, hin und her gezogen, je nachdem sie einmal ein Windhauch rechts oder links getrieben.
Dort ragten sie auf in jäher Schroffheit, gleich Kirchtürmen, die kleine links, schlank, scheinbar unbezwinglich, die große und westliche in furchtbaren Wänden mauerprall niedersetzend auf das Geröll, das sich an ihrem Fuß in steiler Halde hinabzog, in Jahrtausenden gebildet aus Trümmern, abgebrochenen Blöcken, vom Wasser losgesprengt und herabgestürzt.
Unwillkürlich dachte der Professor an vergangene Jahre, als er den Zinnen dort vor ihm zum erstenmal den Fuß aufs stolze Haupt gesetzt. Er dachte an Gefährten aus der Studentenzeit, wo sie noch mit Führer gegangen oder das erste Führerlose hier und da versucht.
Dieser und jener von den Genossen jener Zeit war nicht mehr. Einer war den Strohtod gestorben zu Haus im warmen Nest bei den Eltern. Einer lag auf dem Friedhof von Zermatt, wo das Matterhorn hereingrüßte auf den kleinen Leichenstein, den es verschuldet. Einen hatten sie in Heiligenblut verscharrt. Der Glockner blickte auf sein Grab und die Glocknerwand, die es gefügt, daß er dort unten zur letzten Ruhe gebettet worden.
Der Gefährten Ringen und Kampf um die Höhen war zu Ende, sein Mühen dauerte noch fort. Er war glücklicher gewesen. Er hatte eine Frau seitdem gefunden, die mit ihm ging, die sich ihm als Führer anvertraute auf seine geliebten Berge, wie er sie führen wollte durchs Leben mit sicherem Tritt, mit fester Hand, frei den Kopf von Schwindel, stark das Herz, das für sie schlug.
Der Professor setzte sich auf die Bank vor der Hütte und blickte in die Ferne hinaus: jetzt waren die Zinnen ganz nebelversteckt. Man konnte nur noch drüben die eine niedrige, vorgeschobene Spitze, einen Seitenturm der kleinen Zinne sehen: die Punta di Frida, und weit drüben rechts die Gruppe des Monte Cristallo, ganz verschoben, ein ungewohnter Anblick. Der Piz Popena, immer noch alleinstehend, als Riesenkegel, der Cristallo dann wie ein langer Rücken.
Hell stand der Mond am dunklen Nachthimmel, eine blendende Scheibe, wie nicht recht geputzt mit ihren Flecken, Gebirge wie hier unten das Dolomitenland, das gespenstische Lichter von ihm empfing, unsicher, die phantastischen, wilden Formen der zerfressenen Felsen durch tiefe Schatten noch phantastischer, unglaublicher machend.
In der Ferne zogen oben, hoch oben dunkle, schwere Wolken langsam hin. Unten über den Tälern lagen silbrige Nebel, Watte gleich. Das Plateau mit der kleinen Hütte von Menschenhand ragte aus dem Dunst, als wäre es eine verlassene Klippe im weiten Meer.
Und das Bild senkte sich tief in des einsamen Beschauers Seele. Ihm war es wie eine heilige Feierstunde. Alles schwieg. Er war ganz allein. Er konnte wähnen, ganz allein auf der Welt zu sein.
Wie in Erstarrung blieb er sitzen, als könnte er sich von dem Anblick nicht trennen.
Endlich riß er sich los. Es mußte zehn Uhr sein, und leise, um die andern nicht zu wecken, schlich er sich in die Hütte.
2.
Als der Morgen noch kaum graute, war in der Dreizinnenhütte schon Licht. Das Feuer brannte bereits auf dem Herd hinten im Anbau. Die Führer waren dabei, die Rucksäcke zu packen, und auf dem Tisch dampften schon Tee und Kaffee.
Im Eßraum saßen die Brüder Weber, Doktor Lodinger und der Wiener Advokat beim Frühstück. Alle waren mehr oder weniger verschlafen, wortkarg und mit sich selbst beschäftigt.
Jörgl Tschurtschenthaler flüsterte Pacifico Menardi zu, er möchte sich beeilen, damit sie zuerst fortkämen. Er wisse nicht, auf welche Hochzinne es die beiden Führerlosen abgesehen hätten, aber wenn sie gleichfalls die große Zinne in Angriff nähmen, so gäbe das eine »verteifelte Kraxelei – oanmal a Stund länger und zum andern der nachfolgenden Partie oane Klafter Stoan aufn Schädel!«
Menardi meinte, er wolle »spekulieren« gehen, wie die Sache stünde.
In diesem Augenblick trat, auf Strümpfen schleichend, die schweren Nagelschuhe in der Hand, der Professor ein. Er wollte die andern, die noch schliefen, nicht wecken. Trotz seiner Vorsicht begann der ältere Herr, der schon gestern abend gebrummt, zu schimpfen. Man hörte etwas von »Rücksichtslosigkeit«, von »ewige Störung« und »auch noch andere Leute hier!«
Professor Hallbauer achtete nicht darauf. Ein Lächeln flog um seine Lippen. Aber der Statthaltereirat ärgerte sich und rief hinüber, während die Tür angelehnt geblieben:
»I bitt schön, machen S' doch gefälligst keine Geschichten. Sie stören die andern. Sie, Sie allein, aber nicht wir!«
Da gewann auch Julius Weber Mut:
»Und die Hütte ist doch eben für die Hochtouristen gebaut, die Zeit gewinnen wollen, um Hochtouren zu machen. Wer nur von Sexten nach Landro will, kann ja bei Tage über den Toblinger Riedel und die Dreizinnenhütte gehen.«
Drinnen blieb alles ruhig. Der Brummbär knurrte offenbar bloß, aber biß nicht.
Doch Doktor Lodinger konnte sich noch nicht beruhigen und schimpfte eine Weile fort. Darüber kamen sie alle ins Gespräch, und die Führer benutzten die Gelegenheit, herauszubekommen, wohin die einzelnen Partien gehen wollten. Es stellte sich heraus, daß es die beiden Studenten richtig auf die große Zinne abgesehen hatten.
Sofort gab Jörgl seinem Herrn das Zeichen zum Aufbruch. Er nahm eiligst gleich die Pickel für Doktor Lodinger und den Wiener Advokaten mit und trat ins Freie. Menardi folgte schnell, und bald huschten die vier Gestalten geradeaus über die zerrissenen Platten und das Geröll davon, den Zinnen zu.
Die Brüder blieben wie in einer Art von Befangenheit zurück, als wagten sie es nicht, vor Professor Hallbauer die Hütte zu verlassen.
Der hatte die Bergschuhe angezogen und wartete auf seine Frau. Da sie noch immer nicht kam, trat er in die Tür und blickte hinaus. Scharf wehte ihm die kalte Luft entgegen. Das tat ihm wohl nach der dumpfigen Atmosphäre in der Hütte. Er streckte die Hand aus, zu fühlen, ob es etwa regnete, denn gesehen hätte man nichts. Es herrschte noch immer Dämmerung draußen. Die Luft war feucht, aber kein Niederschlag zu spüren.
Der Professor blickte zum Himmel empor: nichts zu sehen – die Nebel strichen zu tief. Sie hingen beinahe bis auf das Dach der Hütte herab. Gerade in diesem Augenblick kam ein Windstoß von der Sextener Seite geblasen und fegte die Dünste wie Rauchwolken über den felsigen Boden, daß sie förmlich sich überschlagend, sich wälzend hinrollten in mächtigen Ballen, Spulen, daß sie die andern noch nicht bewegten Luftschichten mitrissen gleich einer Lawine, die allmählich in Schwung kommt und nun in ihre Bahn alles hineinzieht in weitem Umkreis.
Sehr einladend war das Wetter gerade nicht, aber schließlich wollte es nicht viel bedeuten, denn diese Frühnebel gab es fast jeden Tag.
Er wandte sich um: noch immer war Klara nicht erschienen. Ob sie etwa wieder eingeschlafen war? Er ging in den Schlafraum. Joachim Dörstling richtete sich in der Ecke auf und brummte:
»Wollt ihr denn fort bei dem Wetter?«
Der Professor machte ein erstauntes Gesicht:
»Es ist doch ganz schön!«
»So.«
»Kommst du ein Stück mit? Bloß bis an den Einstieg in die Felsen?«
Joachim reckte sich. Er war faul, noch müde, und der Gedanke, heraus zu müssen, begeisterte ihn nicht. Er zögerte, da erschien Klara, schon fertig angezogen, nur in Hausschuhen, in der Tür. Sie sah frisch aus, ihre Augen leuchteten, wie sie sich seitwärts wandte und ein Lichtstrahl aus dem Speiseraum ihr Gesicht traf. Sofort griff sie die eigentlich als Scherz gemeinte Aufforderung ihres Mannes auf:
»Natürlich, Herr Dörstling, Sie kommen mit. Sie wollten doch so eine Kletterei einmal erleben!«
Damit ging sie hinüber, ihren Tee zu trinken, und der Professor fügte noch hinzu:
»Joachim, eine bessere Gelegenheit, die Sache einmal in der Nähe zu sehen, gibt es gar nicht; denn du kannst ohne Mühe, fast eben, bis an den Einstieg mitkommen. Dann steigst du ein Stück das Geröll hinab und kannst uns klettern sehen, oder du kehrst zur Hütte zurück ...«
Er zögerte, er wußte nicht, was er tun sollte; aber durch die Unterhaltung war er vollends wach geworden, schob die Decken beiseite, zog den Kragen seines Wollhemdes zurecht und band die während der Nacht aufgegangene Krawatte. Dann folgte er den beiden andern. Sofort fragte Klara:
»Kommen Sie mit?«
Joachim blickte sie fragend an, und als der Professor gerade wieder in die Tür trat, hinauszuschauen, flüsterte er, indem er sie groß ansah:
»Möchten Sie es?«
Sie schlug die Augen nieder:
»Gewiß, Sie langweilen sich hier auf der Hütte allein.«
»Das täte doch nichts!«
»Aber ... aber dazu sind Sie doch nicht mitgekommen.«
Der Hüttenwart kam mit einer Portion Tee. Joachim sagte nur noch kurz:
»Also, ich gehe mit.«
Dann kam der Professor herein und begann auf dem Tisch seinen Rucksack zu packen. Er tat zwei Paar Kletterschuhe hinein, ein Paar große für sich, ein Paar winzige, zierliche: die seiner Frau. Dann eine Blechtube Vaselin-Lanolin, Handschuhe, eine große Gummiflasche voll Wasser, einen Wettermantel aus Lodenstoff für seine Frau, ein paar Taschentücher, einen zusammenschiebbaren Trinkbecher aus Aluminium, einen Krimstecher, etwas Proviant.
Darauf schnürte er den grün-schilfleinenen Rucksack zu, hing ihn um und nahm ein langes, starkes Führerseil, das zusammengebunden in der Form eines Seerettungsrings auf dem Stuhl lag. Er fuhr mit dem einen Arm hinein und dem Kopf. Dann ergriff er seinen schweren Pickel, gab den kleineren seiner Frau in die Hand und trat in den frischen Nebelmorgen hinaus.
Seine Frau folgte. Zuletzt kam Joachim, der noch allerlei gesucht und nicht fertig werden konnte, weil er unausgesetzt auspackte, um nicht Unnötiges mitzunehmen, und dann wieder in den Rucksack tat, in der Befürchtung, er könnte irgend etwas vergessen, das er später schmerzlich vermißte.
Am längsten hielt ihn die Frage auf, sollte er seinen Wettermantel mitnehmen oder nicht. Er mochte ihn nicht tragen, andererseits hatte er Angst, es könne regnen, und er möchte sich erkälten. Endlich entschloß er sich, als er die brauenden Nebel vor der Hütte gesehen, doch das Kleidungsstück nicht zu entbehren.
Der Professor liebte Unentschlossenheit nicht und haßte die Hüttenbummelei. Er sagte kein Wort, aber an seiner Schweigsamkeit, an seinem Vorwärtsdrängen sah man die Ungeduld. In der Tat eilte er auch so schnell davon, daß nach wenigen Augenblicken seine hohe Gestalt im Nebel nur noch undeutlich, bald gar nicht mehr zu erkennen war. Ein paar Schritte hinter ihm ging seine Frau, die sich immer ab und zu nach Dörstling umdrehte.
Joachim achtete nicht darauf. Er war zu sehr mit dem Weg beschäftigt. Auf den zerkeilten, glattgeschliffenen Steinplatten rutschte er ab und zu aus. Er war nicht berggewohnt wie das Ehepaar. Er mußte immer überlegen, als er jetzt plötzlich am Felsenhang einen deutlich getretenen Pfad hinabging, wie er die Füße setzen müßte, um nicht in den schmalen Tritten hängenzubleiben, sich die Sohlen lockerzutreten, Nägel aus den Stiefeln zu verlieren, die er sich auf Rat des Professors drunten in Schluderbach erst gestern hatte nageln lassen.
Immer meinte er, daß er den nächsten Tritt nicht finden würde. Er stieß sich an die Schienbeine und einmal mit dem rechten eisenbeschlagenen Absatz derartig an den Knöchel des linken Fußes, daß er laut hätte schreien mögen.
Er begriff die beiden andern nicht, die da hinuntersprangen in alter Berggewohntheit, als wäre es der Bürgersteig einer Straße in Berlin, das er, wie sie, doch kaum erst vor einigen Tagen verlassen.
Es kam ihm wie ein Traum vor, die Nacht in der Hütte, und daß er jetzt auf dem Wege war zu den drei Zinnen, den gefürchteten Zinnen, die einen fast klassischen Namen hatten bei den Bergsteigern wie bei gewöhnlichen Talbummlern wie er. Die kleine Zinne hatte lange Jahre für unersteiglich gegolten. Sie standen alle drei in den Reisehandbüchern als »sehr schwierig«, in einigen die kleine sogar als »gefährlich«.
Daß sie Freund Hallbauer überwand, schien Joachim nichts Besonderes, denn er hatte zu oft den Professor als erstklassigen Hochtouristen nennen hören, wenn er auch keinen rechten Begriff damit verband, er, der sich bisher nur immer die Berge von unten angesehen und im Grunde genommen lieber ans Meer ging als in die Alpen.
Im Seebad konnte man flirten, am Strand fühlte er sich in seinem Element, der etwas süße, weichliche Mann mit den schönen Augen. Und wenn seines Freundes Frau nicht gewesen wäre, er säße jetzt heilig und sicher in Helgoland, in Norderney oder noch lieber in Ostende.
Aber Klaras Aufforderung, er möchte mitkommen nach Tirol, hatte er nicht widerstehen können. Er fühlte sich außerstande, ihr eine Bitte abzuschlagen. Das war schon so gewesen fast vom ersten Tage an, als er sie kennengelernt.
Es war vorigen Herbst erst geschehen. Die Freunde hatten sich jahrelang aus den Augen verloren. Joachim lebte meist im Ausland, den Winter in Italien, an der Riviera, in Kairo, den Sommer in eleganten Bädern. Er führte ein Leben ohne Ziel, ohne Beruf. Er war wohlhabend, war ohne Familie und hatte nur, um den für den Deutschen scheinbar notwendigen Titel zu besitzen, den Doktor gemacht. Dann studierte er Kunstgeschichte, doch ohne praktischen Zweck. Ein Examen wollte er nicht machen, einen Lehrstuhl nicht einnehmen, die Museumskarriere nicht einschlagen. Das band, das verpflichtete. Und er wollte ungefesselt sein, an allen Blumen riechen, an jedem Glase nippen. Das Leben wie ein Kunstwerk betrachtend, ein Amateur der Existenz, ein Dilettant, begabt, begeistert, geschickt, glücklich. Ein Mensch der, weil er Zeit, Gesundheit und Geld besaß, alles zu erleben, was das Dasein bot, sich auch berechtigt fühlte, auf dieser Erde zu weilen.
Da hatte er eines Herbsttags auf der Friedrichstraße Professor Hallbauer getroffen. Wiedersehen, Freude, Einladung in sein Haus. Der war verheiratet. Merkwürdig. Wie konnte man nur verheiratet sein! Joachim versprach sich nicht viel von dem Besuch. Sein Freund war ordentlicher Professor an der Universität Berlin, bekannter Operateur.
Der Doktor Joachim Dörstling rechnete auf eine brave Professorsfrau. Er dachte sie sich mit Strickstrumpf und guter Stube. Ein förmlicher Besuch, und er würde abreisen.
Statt dessen fand er eine junge, frische Frau mit braungelocktem Haar, die von allem zu reden wußte, gereist war wie er, mit klugen, hellen Augen in die Welt sah, eine Frau, die ihn fesselte vom ersten Augenblick an.
Er blieb in Berlin. Noch nie war ihm ein Winter so kurz vorgekommen. Bald wurde das Haus seines Freundes, mit dem er zusammen die Schulbank gedrückt, von dem ihn nur dann das Leben getrennt, sein ein und alles.
Den drei Menschen schien durch die Erneuerung alter Freundschaft gleichmäßig geholfen: der Professor freute sich, jemand zu haben, der seiner Frau paßte, seiner Frau, die sonst nicht leicht für einen Menschen eingenommen war, die an allen Kollegen ihres Mannes, überhaupt an jedem noch, der mit ihnen verkehrte, etwas auszusetzen fand.
Klara unterhielt sich harmlos mit Joachim und sah in ihm einen angenehmen Gesellschafter, der ihr erzählte und erzählte, während sie bequem im Lehnstuhl saß, mit einer Blume, einem Papiermesser, irgendeinem Nichts spielend.
Und nicht sie allein ließ ihn schwatzen. Auch dem Professor machte es Spaß, zuzuhören und des Redens enthoben zu sein. Wenn er abends nach Haus kam, pflegte er müde zu sein vom anstrengenden Lauf seines Tages. Vom Beruf teilte er nichts mit. Oberflächlich hätte er von Diagnose und Operation, von Kranken, von klinischen Erlebnissen und Beobachtungen, von seinem Lehramt nicht gesprochen.
Das hatte im Anfang der Ehe Verstimmungen gegeben. Er sollte erzählen – und das war wider seine Natur.
Er war überhaupt nicht leicht mit dem Wort da und deshalb auch kein guter Kathederdozent. »Durch Erleben, durch Sehen lernen wir, nicht durch Reden, durch Hören!« pflegte er zu sagen. Da ließ er denn Joachim erzählen, saß ruhig dabei, oft zerstreut, manchmal durch ein Wort seine Zustimmung andeutend. Wenn er anderer Meinung war, schwieg er. Er fühlte nicht das Bedürfnis, zu widerlegen, seine Ansicht andern aufzunötigen, nicht einmal sie ihnen kundzutun.
Nur wenn das Gespräch auf die Berge kam, richtete er sich im Stuhl auf und nahm reger teil. Seine Frau war es immer, die davon begann, von allem erzählte, was sie »gemacht«, wie ihr Mann sie angelernt, sie zuerst Angst gehabt, aber allmählich gesehen, daß man in seiner Begleitung geborgen sei wie daheim in der warmen Stube.
Dann leuchteten seltsam ihre Augen, wie sie heute früh in der Hütte beim schwachen Schimmer des Lichtscheins geleuchtet, ein förmliches Phosphoreszieren, wie es Joachim nie bei einem andern Menschen, gesehen. Dann blickte sie mit Stolz auf ihren Mann, von dessen Bedeutung als Arzt sie nichts zu ahnen schien.
Immer beredter wußte sie zu erzählen von Bergfahrt und Gefahr, von Anstrengung, von vorbeidonnernden Lawinen, von grausigen Blicken in ungelotete Schlünde und Tiefen, vom Kleben an furchtbarer Felsenwand, vom Klettern auf zersägtem Fels-, vom Schreiten auf messerscharfem Eisgrat.
Es war Gefühl alles; sie warf das Tatsächliche durcheinander, und der Professor verbesserte nur immer die Höhenangaben, Entfernungen, Namen. Er selbst sprach nichts, aber man fühlte, wie er mit allen Sinnen dabei war.
Joachim saß dabei und verstand von den Hochtouren nichts. Er vernahm, wie seine Freunde die Monate, die Wochen, die Tage zählten, bis es, wie alljährlich, hinausging in die Alpen. Er erlebte, wie sie es nicht erwarten konnten, und er fürchtete sich vor dem Augenblick, wo sie in die ewigen Einsamkeiten dort oben stiegen, während er im Tal, in stickiger Tiefe blieb. Es war ihm zumute, als könnten die beiden fliegen, und er kröche und schritte; sie winkten ihm ein Lebewohl zu, dann waren sie droben in den Höhen seinen Blicken entschwunden.
Der Gedanke war ihm entsetzlich. Wem sollte er dann erzählen, bei wem sitzen? Er, der unstet gewesen, hatte bei diesen Freunden endlich ein Heim gefunden. Das wäre nun vorbei? Immer sah er sie vor sich in Gedanken. Klara erblickte er. Die Frau, mit der er stundenlang sprechen konnte, er wußte eigentlich nicht wovon. Die er nie müde ward anzusehen. Die diesen Winter ein Bestandteil seines Lebens fast geworden, das er nicht mehr hinwegdenken konnte.
Je näher die Stunde gerückt war, desto unheimlicher ward ihm zumute. Die scheinbar notwendige Trennung lastete auf ihm, daß er etwas empfand beinahe wie körperlichen Schmerz. Der Professor konnte, wenn es seinen Beruf betraf, seine Kunst, weich werden bis zum Unrecht. Einem Patienten Erleichterung zu schaffen, hätte er sich die größten Anstrengungen auferlegt. Aber bei Hochtouren – das sagte Klara immer und immer wieder – war er wie umgewandelt. Da kannte er keine Rücksicht auf andere Menschen. Eine Störung darin empfand er wie eine Beleidigung.
So konnte Joachim nicht vorschlagen, seine Freunde zu begleiten. Er sprach einmal mit Klara darüber. Er hoffte, sie sollte ihren Mann darum bitten. Doch sie hatte Joachim nur angeblickt wie »ich täte es ja so gern, aber es geht nicht!«
Da hatte er abenteuerliche Pläne geschmiedet: er wollte heimlich ihnen nachreisen, wollte sich trainieren, wollte laufen und laufen und steigen und steigen und mit einem Führer klettern, sich einweihen lassen in alle Geheimnisse der Hochtouristik. Doch ein Bekannter, der Bergsteiger war, machte ihm klar, daß er Jahre der Übung brauchen würde, um dem Professor auf schwierigen Touren folgen zu können.
Joachim gab es auf. Er kannte sich, er war nicht stark. Er war etwas wehleidig sogar: er würde sich blamieren.
Da war etwas ganz Unerwartetes eingetreten: eines Abends, als wieder von den Bergen die Rede war, machte Joachim ein ganz trostloses Gesicht, wurde nervös, ließ sich hinreißen und rief:
»Die verfluchten Berge!«
Der Professor blickte ihn erstaunt an:
»Was haben sie dir getan?«
Joachim ärgerte sich, daß er sich hatte gehen lassen, und sagte traurig:
»Ach, ich weiß schon, die sind nicht schuld. Ich bin nur so traurig, daß wir uns trennen müssen. Dann ist alles vorbei, dann sitze ich ganz, ganz mutterseelenallein!«
Sein Freund antwortete plötzlich, indem er ihm herzlich die Hand bot:
»Komm mit!«