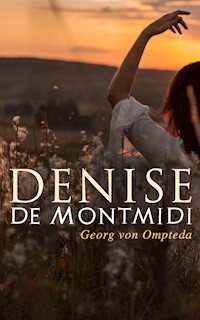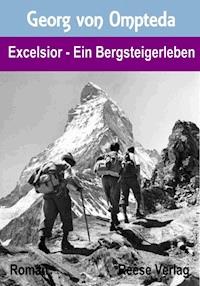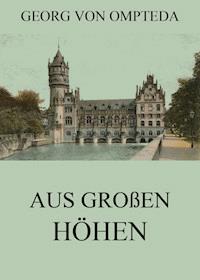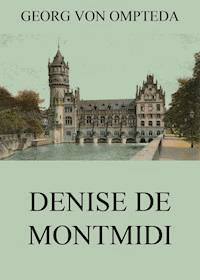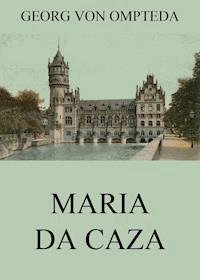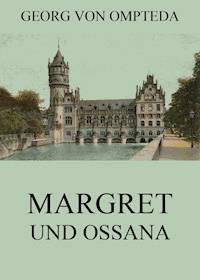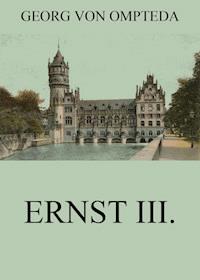
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman aus dem deutschen Adel um die vorletzte Jahrhundertwende.
Das E-Book Ernst III. wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst III.
Georg Freiherrn von Ompteda
Inhalt:
Georg Freiherr von Ompteda – Biografie und Bibliografie
Ernst III.
Ernst der Zweite
Der Kronprinz
Prinzessinnen und der schöne Theodor
Prinz Peters unrühmliches Ende
Prinz Arbogast Ernst Peter Franz von Osterburg-Hilligenstadt
Des Prinzen Arbogast schwere Jugend
Hermundurenzeit
Der arme Rittmeister
Meldung bei Seiner Majestät
Tod des Kronprinzen
Königslos
Des Prinzen Schwadron ist schlecht
Ernst der Dritte
Seine Majestät wird festgenommen
Ministerrat
Empfang der Fürsten
Beisetzung Ernsts des Zweiten
Fröhliche Hoftafel
Piephacke tröstet Seine Majestät
Herr Haafenhaar
Rot, rund und zufrieden
Allerhöchster Verrat
Denkwürdige Fahrt zur Schloßinsel
Und Lore-Lene?
Schach dem König!
Die großen Luftröhren
Im Paradiese
Ernst der Dritte wird vigiliert
Der Rex im Frack
Großfeuer bei der Vaujuwa
Ernst der Dritte und die Scheuerfrauen
Tischlertag
Erster Aufzug
Das Lachkabinett
Salzfest
Herr Schellack
Das Bockbein
Der König und die Maid
›S.M. der König ... ist erkrankt‹
Der Señor
»Ich pflanze«
Im Osterland
Ernst der Dritte auf Brautschau
Prinzessin Ebba von Öland
Majestät zuckt
Im Schwitzkasten
Zwischenspiel
Heil der Königin!
Ernst III., G. von ompteda
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638931
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Georg Freiherr von Ompteda – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 29. März 1863 in Hannover, verstorben am 10. Dezember 1931 in München. Sohn des letzten Hofmarschalls des Königs Georg V., Wilhelm Heinrich von O., war Offizier, nahm 1892 wegen eines Sturzes vom Pferde seinen Abschied, lebte dann längere Zeit in Dresden und jetzt in Meran. Er schrieb, anfangs unter dem Pseudonym Georg Egestorff, eine größere Anzahl erzählender Werke, die alle wiederholte Auflagen erlebten. Wir nennen die Novellen: »Freilichtbilder« (Leipz. 1890), »Die Sünde« (das. 1891), »Vom Tode« (Berl. 1893), »Unter uns Junggesellen« (1894), »Unser Regiment« (1895), »Die sieben Gernopp« (1895), »Leidenschaften« (1896), »Weibliche Menschen« (1898), »Luft und Leid« (1900), »Die Radlerin« (1901), »Das schönere Geschlecht« (1902), »Traum im Süden« (1902), »Nerven« (1903); ferner die Romane: »Drohnen« (1893), »Deutscher Adel um 1900«, erster Teil: »Sylvester von Geyer« (1897, 2 Bde.), zweiter Teil: »Eysen« (1900, 2 Bde.), dritter Teil: »Cäcilie von Sarryn« (1902, 2 Bde.); »Maria da Caza« (1897), »Der Zeremonienmeister« (1898), »Philister über dir!« (1899), »Monte Carlo« (1900), »Aus großen Höhen« (1903), »Denise de Montmidi« (1903), »Heimat des Herzens« (1904), »Herzeloide« (1905), »Normalmenschen« (1906), sämtlich in Berlin erschienen. Außerdem verfaßte er mehrere Schauspiele: »Die Wiedertäufer« (1893), »Nach dem Manöver« (1894) und »Eheliche Liebe« (1898), auch Gedichte (»Von der Lebensstraße«, Leipz. 1890) und eine freie Übertragung von G. de Maupassants »Gesammelten Werken« (Berl. 1898–1903, 20 Bde.). O. besitzt ein kräftiges Erzählertalent, seine impulsive Natur fesselt, seine Charakteristik des Adels (namentlich in seinem besten Werke: »Eysen«) ist vielseitig und anschaulich, aber seinen Werken fehlt die Rundung einer ausgereiften Form.
Ernst III.
Ernst der Zweite
In der Mitte Europas lag einst das alte Reich und in seinem Herzen das Königreich Tillen. Dessen Grenze nach Süden bildete die Munde, eine über hundert Kilometer lange, von West nach Ost streichende Gebirgskette, die nach Norden in fruchtbare Niederungen verlief. Der breite Rücken der Windberge trennte diese von einem sandigen Teil, den das Vorkommen von Steinkohle zum Industriebezirk gemacht.
Ein einziges Flußnetz durchzog das Königreich: die Till, die, in der Munde entspringend, den gewaltigen Tillensee durchströmte. An ihr lag Tillenau, die Residenz und Hauptstadt, mit rund 512000 Einwohnern. Dort waren die Sammlungen, die Hochschule, die berühmten Hoftheater. Dort die Häuser alter Zünfte, der Adels- und Bürgerfamilien, die Regierung, der Hof.
Seit über siebenhundert Jahren regierten in Tillen die Osterburger, erst Herzöge, dann Kurfürsten, endlich Könige. Sie hatten dem Lande eine Reihe von tüchtigen Herrschern gegeben. Einer einzigen bösartigen Erscheinung, Sigismund dem Bedrücker, gegenüber standen rechte Väter des Vaterlandes, deren Gedächtnis, gerade bei kleinen Leuten, noch lebendig war. So Herzog Sigismund der Huldreiche, Kurfürst Sigismund der Erbauer, Sigismund Wolfsrachen, endlich jener Kurfürst Sigismund der Vierte, dem das Volk, weil er unbeweibt geblieben, statt des väterlichen Beinamens den des »Ohm« gegeben. Die Herrscher einzeln aufzuführen, gar mit Regierungszeiten, womit die Tillener Kinder törichterweise gequält wurden, müßte ermüden. Es sei nur noch gesagt, daß die Osterburger, einst Stützen der Reformation, zum lutherischen Glauben sich bekannten.
Seit 1861 war Ernst der Zweite König von Tillen. Der strengste Arbeiter seines Landes, wurde er damit zum Schrecken seiner Umgebung, denn er saß im Sommer bereits um fünf, im Winter um sechs Uhr am Arbeitstisch.
Bei nicht gewöhnlicher Körpergröße (1,96 Meter), die nur im Sitzen weniger auffiel, weil er unverhältnismäßig lange Beine hatte, konnte man um so mehr von königlicher Erscheinung reden, als er unter fast drohender Adlernase einen langen weißen Erzvaterbart trug. Den Apostel Paulus hätte man sich so denken mögen. Nur fehlte den graublauen, forschenden Augen das Werbende, das Gütige eines Gottesmannes. In der Tat kennzeichnete Ernst den Zweiten eine fast bedrückende Klugheit, ein beinahe unheimliches Wissen. Für Kunst brachte er dagegen nicht mehr auf als pflichtmäßige Gunst. Der Gegenpunkt solcher Vorherrschaft des Hirnes schien freilich eine kränkend geringe Meinung von der Geistesschärfe anderer, womit er bei seiner nächsten Umgebung nicht unrecht gehabt haben mag. In einem Versagen der Kräfte erblickte er aber Faulheit oder gar Übelwollen. So ist jenes Scherzwort, er bringe alljährlich zwei Hofschranzen und drei Minister zur Strecke, nicht ohne Hintergrund. Der Hofdienerschaft sah er dafür manches nach. Überhaupt nahm er wirtschaftlich Schwächere in Schutz, und nichts konnte derart seinen Zorn wecken, wie Ungerechtigkeit gegen Niedrigergestellte.
Nun hätte man meinen sollen, solches Eintreten für die Kleinen müsse dem Könige das Herz gerade der unteren Schichten erobert haben. Im Gegenteil: Seine Majestät erfreute sich einer erstaunlichen Unbeliebtheit. Die Industriearbeiter und Bergleute des Kreises Stangenberg, die Erzknappen aus der Munde, vernahmen nicht seine Stimme, sondern jene ihrer Führer, die ihnen weit schönere Dinge versprachen an kommender Glückseligkeit, an Wohlleben wie Faulenzertum, als dieser finster blickende Schlagetod von König. Dazu lag dem Herrscher die derbe Redeweise nicht, die das sogenannte Volk versteht. Ebensowenig freilich gebot er über gewinnende Herzlichkeit. Er hatte die Menschen nur immer von einer Seite kennengelernt: alle wollten sie etwas von ihm. Statt nun ihre Schwächen zu belächeln, stimmte Menschenverachtung seinen Ton. Kein Wunder, daß er so weder beim Bürger noch bei den obersten Klassen beliebt war. Hatte er nicht einst seinem Jugendfreunde, dem Oberhofmarschall von Flimmer erklärt: »Popularitätshascher verachte ich!«
Solche Anschauung verbreitete Kälte um den Herrscher, die, den Abstand der Stellung hinzugerechnet, ihn zunehmender Vereinsamung entgegenführen mußte. Dennoch besaß Ernst der Zweite Herz. Womit keineswegs auf seine Jugend angespielt werden soll, wo er, wie alte Leute erzählten, mit der gleichen Tatkraft, die ihn alles angreifen ließ, auch den Weibern zugetan gewesen. Nein, aber mit seiner Gemahlin hat er eine musterhafte Ehe geführt. Daran ist um so weniger zu zweifeln, als weder antimonarchische Volksteile noch sogar der weit bösartigere Hof-, Staats- und Stadtklatsch von Tillenau das Gegenteil zu behaupten wagten.
Ernst der Zweite vermählte sich erst als Vierziger. Königin Helene, zweite Tochter des griechisch-katholischen Königs von Mingrelien, trat als Braut zum evangelischen Glaubensbekenntnis über. Hierdurch zerfiel sie mit ihren Eltern. Die Königin war von zartem Liebreiz. Das schwarze Haar, die gelbliche Hautfarbe wiesen auf ihren südländischen Ursprung. Sie war von großer (übrigens nie sich vordrängender) Klugheit. Ein Wort des Königs beweist es. Als ein Minister die Geistesgaben der Königin gerühmt, hatte Seine Majestät nur geantwortet: »Glauben Sie denn, mein Lieber, ich hätte ein Schaf geheiratet? Wenn ich das gewollt hätte, brauchte ich nicht erst nach Mingrelien zu gehen!«
Nur eine tiefe Neigung kann den vorsichtigen König veranlaßt haben, bei der Wahl seiner Lebensgefährtin über etwas hinwegzusehen: Königin Helene entstammte einer Bluterfamilie. Allerdings zeigte sie selbst keine lebensgefährdenden Erscheinungen, aber wenn auch bei dieser unglücklichen Veranlagung die Töchter oft scheinbar gesund sind, so kehrt sie doch bei deren Söhnen wieder.
Nach neunjähriger kinderloser Ehe wurde des Königspaares sehnlichster Wunsch endlich erfüllt, doch die Königin starb am Kindbettfieber. Die griechisch-katholische Geistlichkeit erblickte darin den Finger Gottes, weil die Prinzessin Helene von Mingrelien dem Glauben ihrer Väter abtrünnig geworden sei. Ernst der Zweite dagegen, mehr von irdischen Zusammenhängen überzeugt, hatte zwar einen Auftritt mit den behandelnden Ärzten, von dem man sich Fürchterliches erzählte, trug aber den Verlust des einzigen Menschen, dem er nahegestanden, wie ein Held. Er blieb fortan unvermählt.
Das Kind war ein Sohn.
Das Kind war ein Bluter.
Der Kronprinz
Bei dem Kronprinzen Ernst, doppelt zart, weil in Ängstlichkeit und Vorsicht erzogen, mußte man ständig gewärtig sein, daß irgendeine kleine Verletzung, auf die ein Gesunder kaum achtet, sich zu unstillbarer Blutung auswachse. Da erforderte jedes Schnauben Vorsicht, ein Schnitt wurde Ereignis, der Verlust eines Milchzahnes Bedrohung. Ein Schwär brachte einmal nicht allein den Leibarzt Seiner Majestät, Generalarzt Doktor Vagus, in Sorge, nein, es wurde sogar ein Mann von Weltruf hinzugezogen, Geheimrat Professor Doktor Fibrill, der berühmte Chirurg der Universität Tillenau, den sein erster Assistent Doktor Herpes begleitete.
Es ist zu begreifen, daß solcher Zustand den König bedrückte. Wenn er auch mit zärtlicher Liebe an dem Sohne hing, so kränkte es doch sein starkes Osterburger Gefühl, daß einmal ein Siecher als Ernst der Dritte den Thron besteigen sollte. Da er nun, selbst nie auch nur einen Tag krank, kein Verständnis für Schonungsbedürftige besaß, so wuchs daraus, wie der Knabe heranreifte, der Verdacht, sein Sohn stelle sich nur an. Und der Jüngling durfte doch nicht vergessen, er war kein gewöhnlicher Mensch, er war ein Osterburger, ja der Thronerbe!
So wurden denn von Anbeginn die Kräfte des Kronprinzen überspannt. Das Gymnasium schien selbstverständlich, aber darüber hinaus plagte man den Jüngling noch mit technischen Dingen, zu denen ihm jede Anlage fehlte. Außerdem sollte er täglich mit der einundsechzigjährigen Mistreß Cant flirten, dem jungen Monsieur Gaulois den Racine erklären und den Professore Bell'ingegno durch Dantes Purgatorio begleiten.
Alles das leitete Herr lic. theol. Dr. plil. U. N. R. Bittlich. Zur Laufbahn eines Lehrers an höherer Schule schon zu alt, zum Geistlichen aber zu sehr philosophischer Kampfhahn, bekam er, nach endgültigem Siege über des Kronprinzen Nerven, den Titel Oberstudienrat als Pflaster und die lebenslängliche Ordnung der Privatbücherei des Königs als Versorgung. Kein Ruheamt, denn Ernst der Zweite verlangte täglich Quellennachweise zu allem, was ihn beschäftigte.
Übrigens hatte der Herr Oberstudienrat den Sieg um so leichter errungen, als eine körperliche Ausbildung kaum Zeit nahm. Fechten und Turnen waren verpönt. Nur ein wenig reiten durfte der Kronprinz aus Berufsrücksichten.
Bald wurde aus dem einzigen Kinde, das der einsame König besaß, ein kaum mittelgroßer, zarter Mensch mit auffallend gefüllten Hautvenen, der neben der eindrucksvollen Erscheinung Ernst des Zweiten aussah, als gehöre er gar nicht zu ihm. Zusammengewachsene Brauen bildeten zwischen den Augen ein dunkles Kissen, Augenbläue und rotblondes Haar der Osterburger war Mingrelischer Nacht gewichen. Ja, dem Kronprinzen fehlte sogar eine Eigenart aller Manner der Familie, nämlich die tiefe Baßlage der Stimme. Der König konnte in diesem gebrechlichen Südländer unmöglich sein Ebenbild erblicken. Es war kein Mann für eine, wer mochte es wissen, vielleicht einmal bewegte Zeit, es war ein Müder mit der Erscheinung des Todgezeichneten.
Prinzessinnen und der schöne Theodor
Der Lehnvettern des Hauses Osterburg gab es nur wenige. Dem Blute nach stand dem Könige Prinzessin Aurora am nächsten. Gleichaltrig mit ihm, war sie die Tochter seines Vorgängers und Oheims, des Königs Sigismund des Neunten, der 1861 hochbetagt an Nierenbeckenentzündung gestorben war. Die alte Dame machte in der gütigen Bescheidenheit ihrer Natur so wenig aus sich, daß es Tillen genug gab, die nichts von ihr wußten. Dazu trug der König bei, indem er sich kaum um sie kümmerte. Der Hofklatsch behauptete, der Lieblingsplan Königs Sigismund des Neunten, seine einzige Tochter mit seinem Neffen und Nachfolger zu vermählen, sei am Widerstand der Prinzessin gescheitert wegen der Beziehungen des damaligen Prinzen Ernst zur Primaballerina der Hofoper, Fräulein Amaranda Sprung (eigentlich Sprüngli aus Winterthur). Darüber konnten wahrhaft Unterrichtete freilich nur lächeln, denn beim sogenannten Volke stand es fest: die arme Aurora unterhielt Beziehungen zum Leibdragoner Rittmeister von der Brunfft. Der wurde ja auch richtig dann Oberjägermeister.
In Wirklichkeit war Ernst dem Zweiten die arme alte Base zu ledern. In Gegenwart des spöttisch überlegenen Basileus, wie man am Hofe den König nannte, wagte sie nämlich nicht, den Mund aufzutun. Seit langen Jahren verbrachte sie ihr Altjungferndasein in der Abgeschiedenheit des dritten Stockwerkes im Hirschgartenflügel des Residenzschlosses. Dort malte sie leidlich abscheuliche Blumenstücke, die sie den Damen ihres kleinen Kreises schenkte; dort spielte sie Klavier, doch wenn jemand sie dabei überraschte, klappte sie errötend den Flügel zu. Ihre größte Seligkeit war die Oper, in der sie mit ihrer alten Hofdame Fräulein Mirabella von Wunderlich in der »dunklen Loge« an der Bühne ungesehen zu sitzen pflegte. Davon konnte sie aber unmöglich mit dem kunstfremden Könige sprechen, der das Theater, das ihn viel Geld kostete, selbst fast niemals besuchte. Auch ihre Wohltätigkeit, wobei die »Apanage« und ein großer Teil der Zinsen ihres bescheidenen Vermögens daraufgingen, mußte sie im stillen üben, denn einmal hatte sie, um Notleidenden beizuspringen, die Grenze ihres Einkommens überschritten und den Basileus um Hilfe bitten müssen. Zwar zahlte der König, doch bei jeder Begegnung bekam sie es seitdem zu hören: »Nun, liebe Base, wer hat dich denn schon wieder mal reinjelegt?«
Seitdem war die alte Prinzessin so verschüchtert, daß sie dem Basileus, der die Königsgabe des Vergessenkönnens nicht besaß, aus dem Wege ging. Dazu nahm bei Ernst dem Zweiten jene Alterserscheinung, Geiz geheißen, überhand, fehlte doch den Osterburgern ein Hausvermögen. Wenn Unterrichtete den Behauptungen umstürzlerischer Kreise, der König habe Riesengelder gehäuft, entgegentraten, so hatten sie durchaus recht, denn das Königshaus war im Grunde arm.
Dieses traf freilich nicht zu bei dem Prinzen Theodor, entfernter mit dem regierenden Herrn verwandt, indem die Großväter Brüder gewesen waren. Im Gegenteil, der »schöne Theodor« – so hieß er von jüngeren Zeiten her – war so reich, wie man es im Lande wohl kaum ahnte. Von den guten Tillen sprach er immer nur mit einem seltsamen Schmunzeln, das dem alten, weißköpfigen Herrn mit dem Fuchsgesicht und dem gefärbten Schnurrbart nicht übel stand. Und doch hatte er als junger Prinz nichts als seine kleine »Apanage« besessen, ja er war sogar mal »um die Ecke gewesen«, wie man zu wissen glaubte. Als er dann wieder auftauchte, schwamm er in Gold. Gab es nur nicht aus. Wenigstens nicht in Tillen. Er hatte auch einen ganz eigenen Verkehr: Fremde, Forschungsreisende, Händler, Bankleute, Industriekapitäne. Mit Hof- und Staatswürdenträgern, mit Offizieren und Beamten ging er nicht gerne um. Er behauptete nämlich erstaunlicherweise, er wisse nicht, was er mit ihnen reden solle.
Der schöne Theodor lebte in kinderloser Ehe mit Prinzessin Ingeborg. Sie kam aus einem nordischen Reich und war ein Engel, sogar ein bemittelter (was noch seltener ist), denn der schöne Theodor gab ihr für ihre Suppenanstalten, Krippen, Armen- und Waisenhäuser soviel sie nur wollte. Aber die Tillen mochten sie nicht. Engel auf Erden pflegen unbeliebt zu sein. Und dann sprach sie das G nicht als J. Das prinzliche Paar wohnte eine Stunde von Tillenau den Windbergen zu, im sogenannten »Nordischen Palais«. Freilich waren sie meist abwesend. Man erfuhr es nur schwer, denn in dem Einschreibebuche, das im Schlosse auflag, fand sich der Vermerk, ein für allemal: »Ihre Königlichen Hoheiten der Prinz und die Frau Prinzessin Theodor lassen für Meldungen bestens danken.«
Ernst der Zweite küßte der Prinzessin Ingeborg, die auch aus königlichem Hause und von ruhiger, frauenhafter Würde war, immer ritterlich die Hand, obwohl sie das G nicht als J sprach. Der schöne Theodor gab dem Könige, was des Könige ist. Sie störten einander nicht.
Ausländer, wie der Earl of Churl oder Mister Woodrow M. Cunning, die auf Veranlassung des schönen Theodor zur königlichen Tafel gezogen worden, meinten übrigens, der König sei von größerem Wissen, der schöne Theodor dagegen der bei weitem »smartere«. In zwei Dingen schien er Ernst dem Zweiten gewiß über, nämlich in fremden Wechselkursen und in Altertümern aller Art.
Dieses war das eigentliche Haus Osterburg.
Prinz Peters unrühmliches Ende
Es gab jedoch noch eine Nebenlinie. Nichtapanagiert. Bis zum siebzehnten Jahrhundert hatte nämlich das heutige Einsprengel Hilligenstadt ein Sonderdasein geführt unter der fürstlichen Linie Osterburg-Hilligenstadt, während die Tillener Osterburger längst Kurfürsten geworden waren. Sigismund der Fünfte zwang dann auf keineswegs einwandfreie Weise den Hilligenstädter Vetter, Peter den Einfältigen, zur Abdankung, »um die Tochter Hilligenstadt nicht länger ihrer Mutter Tillen vorzuenthalten«.
Mit diesen Worten war der glatte Länderraub bemäntelt worden.
Als Ernst der Zweite zur Regierung kam, lebte nur noch ein Sproß jener durch die lieben Verwandten entthronten Linie, der Prinz Peter. Er war schon mit jungen Jahren in österreichische Dienste getreten. Ein hübscher, schlanker k. u. k. Leutnant mit schwarzem Haar und schwarzen Augen voll geradezu abenteuerlichen Leichtsinns. Da er nichts im Kopf hatte als den Gaul, den er gerade ritt, das Mädel, das ihn just beschäftigte, den Schampus, den er eben trank, war es kein Wunder, daß das Sopherl, eine ebenso hübsche, schlanke, nur blonde und mit blauen Augen bedachte Vertreterin des böhmischen Hochadels sich in ihn verliebte.
Ale siebente unter neun Töchtern des Prinzen Wenzeslaus Slivovitz besaß sie ebensowenig wie Prinz Peter. Sie legten es zusammen, heirateten und führten eine erstaunliche Ehe, ständig von Schulden bedroht, bisweilen getrennt, denn die junge Frau war ihm davongelaufen, weil er eheliche Untreue »aus natürlicher Veranlagung« für unabweislich hielt. Da er nun das Sopherl nicht »reklamierte«, sie jedoch als Katholikin nicht wieder hätte heiraten können, dabei aber, trotz verliebtem Blute, zu eigener Untreue zu fromm war, so blieb ihr nichts anderes übrig, als zurückzukehren.
Schon drohte dem Prinzen Peter Osterburg der Abschied wegen irgend etwas »Grauslichem«, als der Krieg von 1866 ausbrach, und es ihm gelang, mit einem Fleischschuß am Oberschenkel und sieben Säbelhieben, sowie dem Maria-Theresien-Orden zurückzukehren. Diesen höchsten Kriegsorden Österreichs hatte er bei der Kavalleriedivision Taxis erhalten, weil er mit seiner Schwadron, zwar völlig gegen jede militärische Einsicht, auch ohne Befehl, jedoch erfolgreich angegriffen. Den Ritter des Maria-Theresien-Ordens abzuhalftern, ging wohl nicht an. In der Verzweiflung eines kleinen ungarischen Nestes wurde ein Sohn gezeugt und, der Eheabmachung entsprechend, evangelisch getauft auf die Namen Arbogast Ernst Peter Franz. Ernst der Zweite hatte nämlich als Äußerstes zugestanden, daß etwaige Töchter katholisch würden, während Söhne evangelisch sein mußten, widrigenfalls er dem Prinzen die Apanage entzogen hätte.
So war Prinz Peter zwar evangelisch geblieben, aber er hätte der alleinseligmachenden Kirche einmal doch wohl anheimfallen müssen, wäre nicht das Sopherl plötzlich zu ihren Heiligen abberufen worden durch eine Herzlähmung nach Genuß von Satanspilzen.
Angesichts einer wirtschaftlich trostlosen Lage und bei der Gefahr, Prinz Arbogast mit dem unevangelischen, auch gänzlich untilligen Namen möchte unter Leitung seines Vaters noch betrübend endigen, überwand König Ernst der Zweite seine Abneigung gegen die fürstliche Linie im allgemeinen, wie Sopherl Osterburg-Slivovitz im besonderen und rief Prinz Peter in die Tillener Heimat zurück. Ein Abschied von der k. u. k. Armee, der dem alternden Rittmeister wie seinem Regimentskommandanten Tränen entlockte, nämlich dem Jüngeren der Trauer, seinem Vorgesetzten der Erleichterung.
Prinz Peter wurde nun in Tillenau im Sigismundflügel des Schlosses sozusagen »interniert«, denn wenn er auch nicht gerade unter Aufsicht stand, so mußte ihm doch immer abends bei verspäteter Heimkehr der Wachthabende von der Schloßwache das Tor aufschließen.
Der k. u. k. Rittmeister im Ruhestand fiel in Tillenau völlig aus dem Rahmen mit seinem in die Schläfen gebürsteten Haar, dem kleinen Backenbart, der immer etwas zu engen Kleidung und dem Strohhalm der Virginia hinterm Ohr. Doch er genoß einer Art Volkstümlichkeit: armer Peter, dessen Frau der König »verjiftet« hat. Jawohl, denn wie »das Volk« genau wußte, hatte ja Ernst der Zweite das Sopherl aus dem Wege räumen lassen (oder war sie etwa nicht an »Jift« gestorben?), damit nicht etwa noch katholische Töchter geboren würden. Daß übrigens ein Sohn da war, ahnte man nicht, weil er nie gesehen ward. Der König ließ nämlich Prinz Arbogast auswärts erziehen.
Auch Prinz Peter zeigte sich nirgends. In der Öde seiner kleinen galizischen und ungarischen Garnisonen hatte er irgendwelche geistige Regsamkeit, falls etwa Ansätze dazu vorhanden gewesen sein sollten, schnell eingebüßt. Auf Urlaub in Wien genügte ihm die »Operett'«. Am liebsten ging er freilich in den Wurstlprater, denn er fuhr leidenschaftlich gern Karussell (man denke sich, daß Ernst der Zweite ihn auf einem Holzpferdchen gesehen hätte!), sang mit den Volkssängern die Gigeratschen-Gageratschen, pfiff das Fiakerlied und drehte beim Heurigen den Hut. Sonst las er im Kaffeehaus den »Kikeriki«.
Wie er nun nach Tillenau in die Verbannung kam, erblickte er ein neues Feld der Tätigkeit in der Abrichtung der Pferde des Königlichen Marstalles. Doch dieser Plan zerschlug sich an dem Widerstände des Oberstallmeisters Exzellenz von Zaum, der unbegreiflicherweise der Ansicht schien, er und seine Hofbereiter könnten das besser. Da nun der Prinz vom Schatullverwalter Seiner Majestät, Exzellenz von Böswetter, knapp gehalten wurde, blieb nichts übrig als das Kaffeehaus. Nun konnte man das Haupt der Hilligenstädter Seitenlinie alltäglich bei J. Schwanzer an der Stechbahn in Hemdsärmeln Billard spielen sehen mit Hofspediteur Packer oder Ratsarchivar im Ruhestand Staub, am liebsten aber mit Herrn Sauber, einem geborenen Wiener, ehemals Wachtmeister bei Windischgrätz-Dragonern. Leider stand Herr Sauber in keinem guten Rufe, weil er eine Dame geehlicht hatte, die unter dem Namen der »Madame« bei der Lebewelt Tillenaus als Inhaberin eines zweifelhaften Hauses bekannt war.
Da nun die Herren vom Königlichen Hofe den Vertreter der Fürstlichen Linie ziemlich von oben herab behandelten, so schnitt Prinz Peter sie seinerseits, indem er, genau wie der schöne Theodor, behauptete, er wüßte nicht, was er mit ihnen reden solle. In der Tat, sie kannten weder den »Niki Esterhazy« noch die »Pepi Gallmeyer«. Keiner von ihnen hatte je in Pardubitz oder in Kecskemét geritten. Wenn er vom Prater erzählte, so fingen sie vom Hirschgarten an, dem Tillenauer Park, der ja ganz nett war, aber doch eben kaum mehr als das. Hatten sie beim Sperl mit der Poldi Flitscherl oder der Mizzi Koller gedraht? Und was war das Tillenauer Schloß gegen die Hofburg oder Schönbrunn? Wer beim Sacher gespeist, konnte doch unmöglich in der »Goldenen Gabel« Tillenaus essen. Freilich durfte der Prinz da im Grunde nicht mitreden, denn seine Mittel erlaubten ihm nicht einmal das. Aber wenn auch die Hofschranzen wegwerfend von seinen Kaffeehausfreunden redeten, so verstanden ihn doch die Gaste bei J. Schwanzer, denn der Herr Ratsarchivar Staub, großer Antisemit (obwohl seine Frau heimlich beim Juden kaufte), lachte sich schief, wenn der Prinz sagte, in seiner galizischen Garnison habe es »bei dreihundert Einwohnern dreihundertundsechs Juden g'habt«. Übrigens führte der Hofspediteur Packer ja auch einen Hoftitel, genau wie die Hofschranzen.
Dabei kam des Prinzen Osterburger Hochmut an den Tag, schien ihm doch sein Abstand von einem Hoflieferanten nicht größer als von einer Oberhofcharge, denn beide waren ja keine Osterburger. So tat er mit den Spießern freundlich, mit den Schranzen von oben herab. Freilich fand er kaum Gelegenheit dazu, höchstens bei den Hofbällen. Dann erschien Prinz Peter mit dem Maria-Theresien-Orden und dem Großkreuz des Osterburger Hausordens auf seiner österreichischen Ulanenuniform und hatte seinen großen Tag, wenn er hinter dem Könige eintrat und die »hochmütige Bande« sich vor ihm mit verneigen mußte. Die Czapka im Arm prüfte er die Damen. Zwar nicht Wienerinnen, gewachsen wie die Pfeifenröhrl, sondern als Tillen etwas gedrungen, aber es machte doch Spaß, hübschen Mädeln in den Ausschnitt zu gucken.
Mit den Herren hatte er sich nichts zu sagen. Die Gesandten freilich mußte er anreden, das verlangte der König. Der Lausitzer, Exzellenz von Gaffe, kam von selbst, seine tiefen Diener zu machen, und dem braven Schwaben Freiherrn von Hutzel, wie dem gemütlichen Bajuvaren Doktor Max Ritter von Vollbier hing er seine österreichischen Geschichten auf, aber dem Borussen Exzellenz von Klops gegenüber blieb er fremd und steif. Er haßte die Borussen. Meist tratschte er daher mit dem österreichischen Gesandten, Seiner k. u. k. Apostolischen Majestät Geheimen Rat Scheberl, Edler von Fisol, ursprünglich Berufskonsul, der aber, seitdem er, reicher Fabrikantensohn aus Brünn, die arme Gräfin Gabrielle Schau geheiratet, zur Diplomatie übergegangen war. Mit dem österreichischen Attaché, dessen lange schwarze und pinselartige Wimpern alle Tillener Damen schwer beunruhigten, sagte er sich Du, war jener doch ein Slivovitz, wenn auch nur von der gräflichen Linie.
So hätte der gute Prinz Peter allmählich in ein ehrenwertes Alter hinübergleiten können, wäre nicht etwas durchaus Unwürdiges geschehen. An einem späten Abend nämlich erschien beim Hauptmann der Schloßwache Herr Sauber, der einstige Wachtmeister von Windischgrätz-Dragonern, und seine Worte bewirkten, daß der Hauptmann den Flügeladjutanten vom Dienst weckte. Dieser wiederum rüttelte den alten Kammerdiener Treu, der im Vorraum vor dem Arbeitszimmer des Königs eingenickt war. Der Alte lauschte an der Tür. Man hörte Räuspern, ein Buch weglegen: Ernst der Zweite war bei der Arbeit. Was dann geschehen ist, hat kein Mensch erfahren. Nur die Posten draußen am Ausgang zur »langen Galerie« haben später erzählt, daß sie eine tiefe Stimme vernommen hätten, wie ein Löwengebrüll. Kurz darauf verließ Herr Sauber in Begleitung von zwei Herren das Schloß, und eine Stunde später fuhr durch das Seitentor des Sigismundflügels eine Droschke. Etwas wurde ausgeladen. Der Leibarzt Generalarzt Doktor Vagus schritt nebenher.
Am nächsten Tage erfuhr man, daß Seine Durchlaucht Prinz Peter von Osterburg-Hilligenstadt plötzlich an Herzruptur verschieden war. Trotz allen Vorsichtsmaßregeln sickerte aber durch, es sei geschehen bei seinem Freunde Herrn Sauber, oder vielmehr im Hause von dessen Gattin, der »Madame«.
Seitdem war die fürstliche Linie nur noch auf zwei Augen gestellt.
Prinz Arbogast Ernst Peter Franz von Osterburg-Hilligenstadt
Prinz Arbogast zählte erst vierzehn Jahre, als sein Vater starb. Der König, auf dessen Gnade der junge Sproß der Seitenlinie jetzt allein angewiesen blieb, übertrug die Sorge um ihn dem Schatullverwalter Wirklichen Geheimen Rat von Böswetter. Dieser nun, aus engen Verhältnissen emporgekommen und erst seit einigen Jahren geadelt, kannte nur eines: Sparsamkeit. Er verwaltete des alten Herrschers Privatvermögen, nicht durch glänzende Anlage es mehrend, sondern mit einer Knauserigkeit, die ihm seines Herrn Schätzung, Ernst dem Zweiten aber den Ruf eines Knickers eingetragen hatte.
Die Erziehung des Prinzen Arbogast sollte also möglichst wenig kosten. Da er nun auf dem Gymnasium in Stangenberg sitzengeblieben war, fürchtete Exzellenz von Böswetter, er möchte bei einer Wiederholung solch betrüblichen Vorfalles dem Könige zu kostspielig werden, und steckte ihn kurzerhand in die Erziehungsanstalt Außensee. Bei verzweifelten Eltern hatte sie einen Ruf etwa wie das Rauhe Haus in Hamburg, das in jener fernen Zeit allen nicht gut tuenden Schülern als Schwarzer Mann vorgehalten wurde, ohne daß im Grunde einer Näheres davon wußte. Nun war der Prinz aber weit begabter als seine Lehrer, die einst die Berufewahl nur als Brotfrage angesehen. Auch drängten sich nicht eben die ersten Schulmänner nach Außensee, einem kleinen, landschaftlich freilich herrlich gelegenen Örtchen am Westufer des Tillensees, denn dort gab es im Winter keine Unterhaltung. Der Lehrkörper ersetzte also durch Schärfe, was ihm an Bedeutung abging.
Freilich fehlte es in dieser Anstalt nicht an schwierigen Schülern, die mit stillem Widerstand, ja sogar mit Umsturzmitteln arbeiteten. Die Lehrer waren vor chinesischen Stinktöpfen wie jähen Entladungen nie ganz sicher. Solch merkwürdiges Arbeitsfeld pflegte immerhin nur eine Minderheit von Gewaltmenschen, die in diesem strengen Hause auch gewöhnlich nur kurze Zeit tätig sein durften. Die meisten Schüler, ursprünglich gute Jungen, aufsässig erst geworden in Händen von Erziehern, die sich selbst nicht beherrschten, besaßen gerade an jener Stelle, wo im Hirn der Rechensinn vermeintlich sitzt, leider keine Windungen.
Zu diesen zählte Prinz Arbogast. Während er in Sprachen, Länderkunde und Geschichte spielend vorwärts kam, schien ihm alles versagt, was unter oder über einem Bruchstriche stand. Dieses konnte der Rechenlehrer, Herr Doktor Siegfried Matheser, nicht fassen. Die kleine gewöhnliche Kaulquappe mit rachitischen Säbelbeinen, dicker, vorgeneigter Stirn, winzigen Äuglein, kiemenartigen Ohren, die Arme meist angezogen, sah einer Menschenfrucht nicht ganz unähnlich. Da er nun noch dazu in jedem bescheidenen Ansatz den »Embryo« erblickte zu kommender »Weltgleichung«, so konnte es nicht fehlen, daß ihn die Schüler, die immer am schnellsten die Albernheiten ihrer Lehrer aufgreifen, den Embryo nannten.
Besagter Doktor Isidor Matheser nun, rieb sich vor allem an Arbogasts Abstammung. Nie rief er ihn anders auf als: »He, der dumme Prinz da!« So kam es, daß in dem bescheidenen, oft verträumten Prinzen Arbogast ein hilfloser Haß erwuchs gegen seinen Peiniger, der ihn beschimpfte, ohne daß er hätte antworten dürfen. Da er nun auf eine Beschwerde beim Rektor Grobheiten erntete, so faßte sich der kleine Prinz ein Herz und schrieb an den König. Die Folgen solchen Briefes waren, daß Exzellenz von Böswetter beritten antwortete, der Prinz habe damit die vorgesetzte Stelle, nämlich ihn, umgangen, der König aber Allerhöchsteigenhändig: a) Prinzen sind da, um das Doppelte zu lernen als andere Leute; b) Lehrer sind die von Gott den Schülern übergeordnete Gewalt; c) Arbogast kostet so viel Geld, daß er alles tun muß, um vorwärts zu kommen.
Dadurch geriet der Prinz in derart verzweifelte Stimmung, daß er heimlich ein Boot losmachte und auf den Tillensee hinausfuhr, um zu fliehen. Zwar wußte er nicht wohin, besaß auch kein Geld, doch in der Anstalt wollte er keinesfalls bleiben. Als er nun längs der Dampfschifflandungsbrücke auf den gewaltigen See hinausruderte, der in seiner himmelgespiegelten Bläue gleich einem Meere vor ihm lag, schwebte dem überspannten Knaben etwas vor wie ein Blutzeugentod, mit dessen Ärgernis er sich an allen Lehrern rächen könnte. Und er beschloß, sich das Leben zu nehmen. Da hörte er plötzlich Klatschen, Glucksen und sah Kreise im Wasser ziehen. In die klare Tiefe blickend, entdeckte er auf dem lehmigen Seeboden eine weibliche Gestalt mit luftgeblähtem Rock.
Prinz Arbogast, ein guter Schwimmer (schon deshalb schien ein Tod durch Ertränken zweifelhaft), besann sich keinen Augenblick, sondern sprang über Bord, tauchte, und es gelang ihm, die scheinbar Leblose ans Ufer zu bringen. Inzwischen kamen Schüler; auch der Physiklehrer Professor Doktor Fall, der eben mit seiner Gattin lustwandelte. Er brachte die Dame ins Leben zurück, übrigens war sie weder jung noch schön, sondern die überreife Lehrerin Fräulein Undine Wasserscheu, die wegen verschmähter Liebe das Königreich Tillen ein für allemal hatte verlassen wollen.
Während nun Prinz Arbogast von Professor Fall belobt ward, lief die Gerettete, ehe jemand an ein Zurückhalten denken konnte, den Landungssteg hinaus und stürzte sich von neuem in die blaue Flut. Prinz Arbogast aber sprang ihr ein zweites Mal nach und brachte die überfällige Jungfrau, die Zähne in ihren Kragen eingeschlagen, wie ein treuer Pudel sein Stück Holz, an Land. Dann aber lief er in die Anstalt, um sich umzuziehen, denn das Wasser hatte nur neun Grad Celsius Wärme.
Damit war der »dumme Prinz« mit einem Male der Held des Tages. Im »Illzenauer Anzeiger« stand der Vorfall. Da jedoch einige Unrichtigkeiten untergelaufen, wie die Angabe der Wasserwärme mit elf Grad Celsius, so mußte die Sache richtiggestellt werden. Dieses unternahm denn auch der Zeichenlehrer der Anstalt, Herr Raffael Kreis, der, um seinen kärglichen Bezügen aufzuhelfen, heimlich am »Tillenauer Boten« Berichterstatter war für Tillensee und Hohe Munde. Kunstmaler mit brauner Sammetjacke, jedoch in Absonderlichkeiten verloren, hatte er nie etwas verkauft, dagegen ein Berufsmodell geheiratet und sechs Kinder in die Welt gesetzt. Sie durchzubringen war er Zeichenlehrer in Außensee geworden, zugleich an der Höheren Töchterschule des Nachbarortes Bankert. Ein Name, der übrigens vorsichtige Eltern schon öfters abgeschreckt, ihre Töchter dieser sonst ausgezeichneten Anstalt zu überantworten.
Besagter Herr Raffael Kreis verfaßte also einen langen (Zeilengeld) und farbigen (Maler) Aufsatz, worin er das Ultramarin des Sees mit Liebe mischte, und daraus die »Märchengestalt eines jungen Sprossen unseres geliebten Königshauses« steigen ließ in Verbindung mit neun Wärmegraden Celsius, Lehrerin und Bankert. Aber solche Mischung von Prinz, Lehrerin und Bankert konnte zu Hintergedanken Veranlassung geben. Der ›Prolet‹, das Stangenberger rote Blatt, ließ denn auch hämisch durchblicken, mit der Lebensrettung von seiten Seiner Durchlaucht des Prinzen Arbogast aus dem erlauchten Osterburger Hause schiene es seine eigene Bewandtnis zu haben. Es wurde daher im ›Staatsanzeiger‹ das Alter der Lebensmüden mit siebenundvierzig und das des Prinzen mit vierzehn genannt, zugleich erhielt Prinz Arbogast für zweimalige Rettung eines Menschen vom Tode des Ertrinkens die goldene Lebensrettungsmedaille. Kultusminister Exzellenz Doktor Bloede überbrachte sie sogar selbst. Hierzu fand feierlicher Festaktus statt, und der Minister wohnte auch dem Unterrichte bei. Offenbar wollte er auf Befehl des Königs Herrn Doktor Siegfried Matheser kennenlernen. Der Embryo geriet darob in solche Aufregung, daß er sich an der Tafel einspann in allerlei Rechenwurzelzeug, ein Freimaurergeheimnis zwischen ihm und einigen wenigen Mathematikbegabten, und so gar nicht merkte, wie inzwischen Seine Exzellenz den Hörsaal verlassen. Wohl aber der Rektor, mit dem der Minister draußen eine lange Unterredung hatte über mangelnden Beruf zum Jugendbildner.
Fortan nannte der Embryo den Prinzen Durchlaucht, und wie Prinz Peter einst, abschiedsreif, in den sechsundsechziger Krieg gezogen, aber mit dem Maria-Theresien-Orden zurückgekehrt, so endete seines Sohnes Arbogast Auszug zum Blutzeugentod mit der goldenen Lebensrettungsmedaille, darauf die Inschrift: Vita donorum suprema.
Des Prinzen Arbogast schwere Jugend
Zweierlei drückte der Landschaft bei Außensee den Stempel auf: einmal die meergleiche Erscheinung des Tillensees, dann die den Himmel durchschneidende Kette der Hohen Munde. Ursprünglich hatten die Anwohner des Sees allein vom Fischfang gelebt. Die berühmte Tille aus der Familie der Lachse ( Salmo salvelinus Tillensis L.), blaugrau mit orangeleuchtendem Bauch, bis zu fünfzehn Kilo Lebendgewicht, wurde, dem Rheinlachs gleich gewertet, weit versandt. In den Gründerjahren aber war am Westufer des Tillensees eine Sommerfrische an der anderen entstanden. So das anspruchsvolle » Grand Hotel Seeblick« in dem schon genannten Bankert, dann das ebenso scherzhafte Küßchen, den glücklichen Inseln gegenüber.
Es waren ihrer drei. Zwei unbewohnt, doch viel besucht, mit üppigem Wiesengrün unter weitschattenden alten Linden, im Volksmunde das Große und das Kleine Glück geheißen. Auf der dritten aber, der Liebesinsel, träumte in halbverwilderten Parkanlagen ein zerfallenes Schlößchen: Verzückung allen verstiegenen Seelen. Die Sage hatte sich nämlich seiner einstigen Bewohner bemächtigt, etwa wie des Fräulein Hero und des Herrn Leander. Die Geschichte dagegen sagte nüchtern: Hier hatte Kurfürst Sigismund der Erbauer seinen berühmten Hofarchitekten Pius Glockenstrang, den großen Meister deutscher Spätrenaissance (Hauptwerke: Ballhaus – später Hofoper, Wunderkammern – heute Museum, sämtlich in Tillenau) bei der Frau Kurfürstin Immaculata im Bett erwischt und kurzerhand in den See geworfen. Um so länger war dann die Kurfürstin in dem Schlößchen auf der Liebesinsel eingesperrt gewesen, nämlich noch dreiundvierzig Jahre, bis zu ihrem natürlichen Verfall. Der Volksmund redete wieder einmal von »Jift« und machte aus ihr ein unschuldig junges Blut, das nur in sinnbetörter Leidenschaft gefehlt, während die gute Immaculata in Wirklichkeit kein Lämmchen gewesen war, sondern eine stark verliebte Dame, die zur Zeit jenes grausigen Ereignisses bereits fünfundvierzig Lenze zählte.
Von der »Tillener Riviera«, wie die Wirte gern sagten, allem Ausländischen hold, erblickte man, dem Ostufer nahe, die bei weitem größte Insel des Sees, die Schloßinsel (7,4 Quadratkilometer), königlicher Privatbesitz. Sie trug ein wohlerhaltenes Barockschloß, wo Ernst der Zweite den Sommer zu verbringen pflegte.
Im Winter war es um so einsamer, als der See keine Schlittschuhläufer anzog, denn er war seit Menschengedenken nicht zugefroren. Man erklärte es durch den hohen Salzgehalt des Wassers, das unterirdisch mit den Bergwerken der Salzmunde in Verbindung stünde. Auch von warmen Quellen wurde geredet; jedenfalls stiegen bisweilen zwischen Liebesinsel und Kleinem Glück seltsame Blasen auf. Die einen meinten von den Tränen der Kurfürstin Immaculata, die anderen aber vom Gasleib des Herrn Hofarchitekten Pius Glockenstrang, der dort auf dem Seegrunde liegen sollte. Erblickt hat ihn keiner, obwohl eine bekannte Wetterregel der Gegend lautete: »Siehst du den Tillengrund, stürmt's in 'ner halben Stund'.«
Auch die Hohe Munde war für die Anwohner des Tillensees von Bedeutung. Ihr Besuch nahm ständig zu. Schon blühte ein Munde-Verein mit vier Sektionen, die bereits neun alpine Unglücksfälle zu verzeichnen hatten. In Außensee entstand eine Rettungsstation, und es ist klar, daß Prinz Arbogast dazu gehörte.
Neben dem gewaltigen Tillensee gab es noch den langgestreckten stillen Gattersee. Hier hatte sich eine Anzahl geistiger Arbeiter bescheidene Holzhäuslein gebaut und führte dort über Sonntag oder in den Ferien ein einfaches Leben ohne Klassenkampf, friedevoll wie die Guten im alten Reich. Am schönsten aber war der kleine Ostersee. Ein blaues Auge im Tal der Oster zwischen Hoher und Niederer Munde. Weiße Wolken, graue Kalkzinnen, grüner Hochwald spiegelten sich darin.
Dort hat Prinz Arbogast, der eltern- und liebelose, die wenigen glücklichen Stunden einer harten Jugend verlebt. Nicht im Arm der Liebe, diesem reinen Jüngling fern, sondern mit einem Freunde, mittellos und einsam wie er. Inhaber der einzigen Freistelle Außensees, deren Genuß ihm vorgeworfen wurde, genau wie dem Prinzen sein Dasein auf dieser Welt, nur weil es Geld kostete, war er der Sohn des verstorbenen Landpfarrers von Gattersee. Untersetzt neben dem schlanken Arbogast, mit breitem Tillengesicht im Vergleich zu dem langen, schmalen Osterburger Kopf. Hanns Medicus, der arme Pfarrersohn, war dem armen Prinzen treu ergeben.
Sie träumten mitsammen. Sie ruderten zur Liebesinsel, sie sahen die Blasen steigen. Über den gewaltigen See fuhren sie und umkreisten scheu die Schloßinsel. Wenn sie dann glaubten, einen Schatten am Fenster zu sehen, wendete der Prinz das Gesicht, daß man ihn nicht erkenne, und sprach, als rede er von einer strengen Gottheit: »Der König!«
Oft aber schwammen sie vom Großen Glück zum Kleinen Glück, lagen auf dem Rasen und glitten, wenn ein Boot kam, schnell ins Wasser wie Krokodile, die sich gesonnt.
In der Hohen Munde wanderten die beiden während der Ferien und verbrachten, das Nachtlager zu sparen, und weil es herrlich-schauerlich war, manche Sommernacht in den Felsen. Alle Anstiege wurden ihnen vertraut, die schwersten der Kalktürme haben sie erklettert. Bei den Bergbauern nährten sie sich um ein paar Groschen von »Pamms«, jenem dicken Bauernessen aus Milch, Brot, Majoran und Wurst. Ja, der Osterbauer hat den beiden armen Burschen oftmals die Zeche geschenkt. Vom Oftersee blickten sie auf zur Ruine der Ofterburg. Der Prinz spann den Traum, daß mit seinen Ahnen einst auch einer der Väter seines Freundes dort oben gehaust hätte. »Als Pförtner«, meinte jener. Doch der Prinz sagte lächelnd: »Leibarzt vielleicht«.
So gingen die Jahre hin. Es gelang Prinz Arbogast, sich ohne schwerere Unfälle durch die Schule zu schlängeln. Ja, er würde eine glänzende Abgangsprüfung gemacht haben, hätte ihn nicht die Mathematik in der Gesamtleistung herabgedrückt. Der König sagte dem Jüngling, als er sich bei ihm meldete: »Ich hatte erwartet, du würdest das beste Examen machen. Du hast mich enttäuscht. Du wirst nun die Universität beziehen. Hier. Cave, adsum. Danke.«
Prinz Arbogast aber nahm ins Leben mit: ein gutes Gedenken einem armen Narren, dem Zeichenlehrer Raffael Kreis, der ihm, neben der Liebe zu den bildenden Künsten, eine erhebliche Fertigkeit beigebracht, seinen Gedanken durch ein paar schnelle Striche höchste Anschaulichkeit zu verleihen; ein hochgemutes Vergessen den gesamten anderen Sündern an seiner Jugend; Milde des Urteils über alle irrenden Seelen, zu denen der größte Teil seiner Mitschüler gezählt; Dankbarkeit gegen den Freund; die Liebe zu jener weiten Landschaft des Tillensees, wo er in trüben Stunden auf die bläuliche Kette der Hohen Munde geblickt und in dem er einst den Tod gesucht, um durch Fräulein Undine Wasserscheu das Leben wiederzufinden.
Hermundurenzeit
Es ist nun einigermaßen betrüblich, melden zu müssen, daß auf der Alma mater weder des Königs noch auch des Prinzen Arbogast Erwartungen sich erfüllten. Jene Erziehung rächte sich, die den Knaben wirtschaftlich aufs alleräußerste beschränkt und ihn, weltabgeschlossen, den Wert des Geldes nicht hatte erkennen lassen. Im Besitz eines bescheidenen, wenn auch gegen die Außenseer Ärmlichkeit fürstlichen Wechsels wähnte der Prinz seine Einkünfte unerschöpflich. Auch überfiel ihn förmlich ein Rausch junger Freiheit, eine so derbe Lebenslust, daß er nicht immer den Lockungen widerstand, die von Großstadt wie leichtsinnigen Brüdern ausgingen.
Prinz Arbogast kam fast augenblicklich in die Kreise der »Hermunduren«. Sie nahmen ihre Leute in jene strenge Zucht der C.C.-Konstitutionen, wie sie in den Korps des alten Reiches herrschte. Ein Segen für richtungslose Flapse, trieb diese Korpserziehung mit offiziellem Bummel, Vorschriften über Verkehr und Anschauung, selbständige Geister zu Auflehnung gegen Satzungen, die ihnen unerträgliche Fesseln dünkten, während sie Heerdenmenschen und Zeitgenossen dagegen nur heilsam sein konnten. Auch wurde im Korps jeder, der von Natur ein zaghaftes Herz besaß, zur Männlichkeit erzogen.
Prinz Arbogast, für das Kommentmäßige nicht eben eingenommen, geriet bald in einigen Zwiespalt. Dazu kam, daß er eines Morgens aufwachte und sich einer für seine Verhältnisse geradezu erstaunlichen Schuldenlast gegenübersah. Es gab eine schlimme Auseinandersetzung mit Exzellenz von Böswetter, der, statt des Prinzen Eröffnungen vertraulich zu behandeln, sie dem Könige vortrug. Ernst der Zweite befahl den Prinzen zu sich, und das Ende war ein Verweis, den der Rektor den Hermunduren erteilte. Diese aber konnten nur in Prinz Arbogast den Angeber erblicken und ›dimittierten‹ ihn, wegen eigenbrötlerischen Wesens überhaupt keineswegs beliebt, dem Antrage des ersten Chargierten stud. jur. et rer. pol. von Abfuhr gemäß, auf die Zeit von vier Wochen. Die Antwort des Gemaßregelten war sofortiger Austritt aus dem Korps.
Hieran knüpft sich nun eine unliebsame Geschichte, um so weniger je geklärt, als weder die Hermunduren darüber sprachen, noch der Prinz. Aber jedesmal, wenn ihn später etwas daran erinnerte, ward er rot, daß eine scharfe Terz auf seiner rechten Gesichtshälfte glühte. Es war einer jener törichten Vorfälle, wie ihn das unnatürlich gesteigerte Ehrgefühl junger Leute, die ungenügend beschäftigt sind, zu erzeugen pflegt. Hart arbeitenden Menschen hätte zu derartigen Spitzfindigkeiten einfach die Zeit gefehlt. Immerhin schien solches das Ventil, den Überdruck an jugendlicher Talkraft zu entlassen. In der Hohen Munde wäre unter dem Jungvolk eine Wirtshausschlägerei daraus geworden; in der Salzmunde hätten sie einander aufgelauert beim Heimweg; in der Erzmunde würde es einen Kampf dreihundert Meter unter der Erde gegeben haben; in Tillenaus Vorstadt Weyher wie im Stangenberger Industriegebiet wäre mit Messern gestochen worden.
Eines steht fest: Prinz Arbogast ging in das Café Glockenstrang an der Stechbahn, wo die Hermunduren nach dem Essen Bestimmungsmensuren entgegennahmen, grüßte förmlich die einstigen Korpsbrüder, die, den Stürmer auf dem Kopf, an den kleinen Marmortischen saßen, schritt geradenwegs auf den ersten Chargierten, den stud. jur. et rer. pol. von Abfuhr zu und wischte ihm seine Handschuhe um die Ohren. Wie sich das zugetragen wird so verschieden geschildert, daß es am richtigsten scheint, einige Urteile wiederzugeben, so sehr sie auch voneinander abweichen mögen.
Der Oberkellner des Cafés Glockenstrang, Herr Joseph Pils aus Wien, VII. Bezirk:
»I hab' grad' den Kaffee serviert, als unser ehemaliger Prinz Arbogast, dem Herrn von Abfuhr a Watschen langt. Der Herr von Abfuhr hat sich wollen auf Seine Durchlaucht stürzen, doch i hab' gesagt: »Meine Herren, vergessen's net, wo's sein!« Hat's da a Hetz geben! Jessas! G'schriegn haben's, und kaner hat ka Wort net verstanden. Und wenn die Frau Abbort von die Garderob' es wissen will, soll's die Pappen halten, nachdem sie sich im Kaffeezimmer net auskennen tut, denn i laß kanen net eini, von z'wegen die Konterhagen von die Kavalier. Also die Abbort mag nur auf ihre Nummern schaun, daß keiner an falschen Huat derwischen tut, und net tratschen.«
Frau Abbort von der Kleiderablage im Cafe Glockenstrang:
»Ich habe jrade dem Herrn Geheimrat von Schacht aus Rafft den Überzieher jebracht, wo nämlich unsern Herrn Schacht chunior besucht hat, was sei Sohn ist, da sehe ich unsere Durchlaucht, die nich mehr kommt, man munkelt so was, springt auf den Herrn von Abfuhr los, und der Joseph, was der Ober is, der läßt sei' Platoo fallen, und raus is er, denn der Joseph is nich fürs Raufen, wie er spricht; da bin ich auch fortjemacht, man muß nich bei allem dabei sein!«
Geheimer Rat Doktor Schacht, Bergwerksbesitzer aus Rafft, Reichs- und Landtagsabgeordneter:
»Ich bin alter Herr des Korps Hermunduria und besuchte meinen Sohn, gleichfalls Hermundure. Eben wollte ich mich verabschieden, als ein junger Herr, den ich von früher her als Prinz Arbogast von Osterburg-Hilligenstadt kannte, eintrat und Herrn von Abfuhr bedrohte. Es wäre vielleicht zu bedauerlichen Auftritten gekommen, wenn nicht ein paar Besonnene die Streitenden getrennt hätten. Übrigens hat der damalige Prinz sich dann gut herausgepaukt. Wie die Einzelheiten gewesen find, kann ich freilich nicht mehr sagen.«
In der Tat wurde nun auf Beschluß des S.C.-Ehrengerichts aus einem Pistolenduell, auf dem der Prinz Arbogast zuerst bestanden, eine Mensur auf krumme Säbel. Hierbei schlug im dritten Gange der Prinz seinem Gegner eine Quart über den Schädel, wie der Paukarzt solche noch nie gesehen. (Spaltung der Schwarte von Stirnbein bis Hinterhauptsbein. Knochensplitter. Vehemente Blutung der Hinterhauptspulsader. Sensorium getrübt. Tiefe Ohnmacht. Pulslosigkeit. 36 Nadeln.) Auch der Prinz erhielt eine gleichzeitig geführte und heruntergefallene schwere Terz. (Durchschlagung des rechten Kaumuskels.) Wenn Prinz Arbogasts Blut auch den Boden rötete, so ging er doch aufrecht davon, um sich draußen verbinden zu lassen.
Fortan grüßten zwar die Hermunduren den Prinzen wieder sehr artig, doch dessen Hochschulbesuch nahm ein jähes Ende. Der Vorfall blieb nämlich dem Könige um so weniger verborgen, als Prinz Arbogast zum ersten Hofball, zu dem er eingeladen worden, mit dem Verbande unmöglich erscheinen konnte. Natürlich ward er der Presse kund. Äußerst kriegerisch zog der ,Held', das Tillener Pazifistenblatt, damals noch als Witzblatt eingeschätzt, dagegen los. Auch der ,Prolet' beschäftigte sich damit. Zwar brachte er zufällig in der gleichen Nummer zwei Messerstechereien, die eine in Geisenberg (Industriegebiet) um eine Tippelschickse, die andere in Rademund (gleichfalls Kreis Stangenberg), weil ein Metalldreher von einem Rohrleger nicht so tief gegrüßt worden, wie er gemeint, daß es ihm zukäme. Doch unter der Spitzmarke »Prinzliche Gesetzesübertretung« wetterte er gegen das »Vorrecht privilegierter Klassen, sich den Hals abzuschneiden«. Damit nicht genug, erörterte im Zentrumsblatte ›Der heilige Sebastian‹ die nichtschlagende Verbindung »Tillia« abfällig die Angelegenheit, weil sie überhaupt gegen den Zweikampf war. Der ›Landwirt‹, landwirtschaftliche Zeitung aus dem Illzkreise, war geteilter Meinung. Der alte Oberst a. D. Graf Druff begeisterte sich daran, daß auch ein Prinz sich nicht außerhalb der Gepflogenheiten anderer Ehrenmänner stelle, wogegen der Ungenannte »vom Hofe« (Deckname für den Oberzeremonienmeister a. D. von Oehlich) es für unrichtig hielt, daß ein Mitglied des Herrscherhauses (wenn auch von der nicht regierenden Seitenlinie) einen Zweikampf ausfechte.
Kurzum, der bislang in weitesten Kreisen unbekannte Prinz Arbogast stand nun zum zweiten Male mitten im Tagesgespräch des Königreichs Tillen. Damit war jedoch Seine Majestät keineswegs einverstanden. Der Prinz sollte aus der Hauptstadt verschwinden. Da es nun aber in Tillen keine andere Hochschule gab, auch Exzellenz von Böswetter die hohen Kosten des Studierens ins Feld führte, so bestimmte Ernst der Zweite die militärische Laufbahn für den Prinzen. Ihm dieses mitzuteilen, befahl er ihn zu sich.
Prinz Arbogast erzählte später, Seine Majestät habe ihm die Hand gereicht (was er selten tat), sich den Schmiß angesehen und etwas verlauten lassen von »Tatmensch, sympathisch«. Dann aber habe er, der in seiner Jugend selbst den Speer geführt, in der leider bei ihm üblichen scharfen Weise gesagt: »Du scheinst keine Terz parieren zu können!« und nicht verfehlt, dem jungen Verwandten seine Mißbilligung auszudrücken, daß er die Öffentlichkeit beschäftigt habe. Zu der abweisenden Bemerkung von einst: »Popularitätshascher
Der arme Rittmeister
Illzenau, Hauptort des Illzkreises, hatte 32690 Einwohner. Ein baukünstlerisch wenig bedeutendes, einst Osterburgisches Schloß war Sitz der Kreisdirektion. Die beachtenswerte frühgotische Hauptkirche besaß ein Altarblatt von Hans Baldung Grien. (Einfluß Dürers. Stark übermalt. Von Professor Doktor Vesser-Weiß von der Königlichen Gemäldesammlung in Tillenau aber angezweifelt.) Weit bedeutender dagegen darf ein Erzbild der Kurfürstin Immaculata genannt werden, in der Stiftskirche am Obstmarkt, von Kurfürst Sigismund dem Illzer seiner Großmutter errichtet. Sie erscheint hier als junge schöne Frau, die kniend die Hände ringt. Eines der wenigen sicheren Werke von Peter Backenstreich, mit kaum dreißig Jahren im Tillensee ertrunken. Großer Markt und Stiftskirche, Rathaus und Schloß, sowie manche alten Straßenzüge lagen malerisch auf einer Insel der breit ziehenden, stellenweise versumpften Illz, während die neueren Stadtteile jenen protzig überladenen Baustil aufwiesen mit Stuck und falschem Prunk, wie er leider jener Zeit des alten Reiches eignet. Hier blickte am Ende einer langen Reihe von Roßkastanien die Kaserne des 2. Tillener Dragonerregiments Nr. 36 von einem Hügel auf das Städtchen.
Prinz Arbogast wurde im Regiment freundlich aufgenommen. Die Zweiten Dragoner empfanden Genugtuung, einmal einen Prinzen zu erhalten, pflegten diese doch sonst bei den ersten (Leib-) Dragonern in Tillenau einzutreten. Immerhin hatten die Offiziere unabhängigen Sinn genug, Prinz Arbogast erst auf Herz und Nieren zu prüfen, ob er auch zu ihnen passe. Und der Kommandeur Major Graf Druff, dessen Vater jenen Aufsatz im ›Landwirt‹ verfaßt, schenkte ihm ebensowenig etwas wie sein Schwadronschef Rittmeister von Hengst. Prinz Arbogast besaß vom Vater eine natürliche Eignung zum Reiten. So wurde er bald ein brauchbarer, ja in nicht ferner Zeit ein tüchtiger Soldat. Die Studentenjahre waren längst abgetan. Dies um so leichter, als die Offiziere sich mehr dünkten als jene jungen Herren auf den Schulbänken der Hörsäle, indem Studenten, weil noch nicht selbständig, nicht Reserveoffiziere werden konnten. Dieses aber erachteten die Herren erst als Vollgültigkeit eines Menschen ihrer Kreise. Wenn einer Anschauungen huldigte, die ihrer Auffassung von Ehrenpunkt und Pflicht zuwiderliefen, so war es gewiß nur ihr Recht, solchen nicht zuzulassen. Wer bei den Roten andere Ansichten äußerte als die Parteileitung, wußte ja auch, daß er flog.
Es entsprach aber leider dem Kastenwesen der Tillen jener Zeit, jeden nicht für voll anzusehen, der einen anderen Weg ging. Gegenseitige Überhebung weitete Klassenabstände, ja trieb zum Klassenhaß. Von solchem war freilich in Illzenau noch nichts zu bemerken, fehlte doch der Industriearbeiter in diesem landwirtschaftlichen Mittelpunkt des Illzkreises. Zwischen den Bürgern und dem Regiment herrschte ein angestammtes gutes Einvernehmen, nur selten getrübt durch ein Aufflammen jugendlichen Übermutes. So hatte eines Sonntagabends der Gefreite Forsch von der dritten Schwadron im Tanzlokal von Stemmort am Obstmarkt das Fräulein Riekchen Schämig belästigt. Als die würdige Mutter auf dem Regimentsbüro erschien, um sich zu beschweren, gab Oberleutnant Prinz Arbogast (der eben Regimentsadjutant geworden war) die Versicherung ab, solchen Übergriffen würde gesteuert werden. Obwohl es nun der Kommandeur war, der sofort eingriff, so rechneten doch die Bürger den Erfolg dem Prinzen an, und bald genoß er das allgemeine Vertrauen. Als Adjutant hatte er es mit allen Bevölkerungsschichten zu tun. Dem reichen Pfeffersack sah er genau so in den überfüllten, wie der armen Witwe in den leeren Magen. Als Untersuchungführender gewann er Einblick in Vorstrafen bösartig-glatter Burschen wie armer Tölpel, die aus Dummheit oder Not gefehlt. Bei allem leitete ihn das hohe Gerechtigkeitsgefühl, das eine schwere Jugend in ihm entwickelt.
Bald kannte den »Arbo« – die Abkürzung hatten sie seinen Kameraden abgelauscht – jedes Kind. Er blieb aber auch auf der Straße stehen mit dem alten Bäcker Dietrich Hefe, der am Tillensee Sonntags zu angeln pflegte. Er fragte die dicke Frau Siebenwurff nach ihren vielen Kindern, von denen immer eines gestorben war, nur nahmen sie wunderlicherweise niemals ab. Der Herr Rentner Heinel durfte ihm über seine flatterhafte junge Frau klagen. Ja, Arbo redete sogar mit dem Inhaber des Zehnpfennigbasars, Herrn Moritz Schofel, der ihn gar nicht wieder losließ. Bald war es auch allgemein bekannt, daß er sich im Dienste nicht »Durchlaucht« nennen ließ, sondern bei der Charge. So fühlten Große wie Kleine nie bei ihm jenen Abstand, der sonst Menschen voneinander lähmend trennt.
Wenn nun Prinz Arbogast sonst seines Vaters Art wenig glich, hier regte sich doch sein Blut. Und wie jenem ging es auch ihm mit dem Gelde. Der Zuschuß, den er vom Könige bekam, war so gering, daß er von allen Kameraden des Regiments wirtschaftlich am schlechtesten stand. Er blieb daher ihren Vergnügungen fern; damit freilich auch mancher Oberflächlichkeit. Über Sonntag fuhren die Herren meist nach Tillenau zu Theater, Brettl, Ball, Einladung. In der »Goldenen Gabel« oder im » Grand Hôtel Bristol« am Tillkai pflegten sie zu speisen.
Des Prinzen karger Zuschuß hätte solches verboten. Nur den Hofbällen konnte er, des Königs halber, nicht ausweichen. Sonst beschränkte er sich auf die bescheidenen Vergnügungen von Illzenau: ein Tanzfest mit dünner Bowle, die keinen umwarf, beim Kreisdirektor Geheimrat Quasselbarth; dann etwa eine »Venezianische Nacht« in der »Verträglichkeit«, wie die Illzenauer Gesellschaft besserer Leute hieß – übrigens durchaus ungerechtfertigt, denn ein echt Tillener Geist des Besserdünkens machte sich dort breit. Die Herren von der Verwaltung meinten, auf die vom Gericht herabsehen zu sollen. Beide aber waren gemeinsam neidisch auf das Offizierkorps, wenn sie auch, humanistischer Bildung voll, zwischen sich und den »Notgewächsen aus Presse und Kadettenkorps« einen geistigen Abstand wähnten, etwa wie zwischen dem alten Blücher und Immanuel Kant. Die Reserveoffiziere unter ihnen schienen freilich wiederum geneigt, auf jene ihrer Amtsbrüder, die es nur bis zum Vizefeldwebel d. R. gebracht, herabzusehen, durften sie doch jedes Jahr zu Kaisers oder Königs Geburtstag ihre Uniform zeigen. Trotzdem wurden sie wieder von den Aktiven, im heimlichen Herzen wenigstens, als Sommerleutnants gewertet.
Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß Überhebung und Empfindlichkeit bei den Damen im Quadrat, ja durch Hinzutreten von Kleider- und Schönheitsfragen im Kubus wuchs. Da war zum Beispiel die Frau Doktor Kolon der Frau Apotheker Pillendreher überlegen, weil der Gatte Verordnungen schrieb, die der andere nur ausführte; beide aber bildeten die Einheitslinie der gelehrten Berufe gegen die Kaufmannsgattinnen. Daß hierbei Frau Losung (Geflügel- und Wildbrethandlung) den kürzeren zog gegen Frau Babette Barchent geborene Plundl aus München, schien selbstverständlich, weil Herr Barchent (Tuch- und Weißwaren) nur im Kontor saß und nicht selbst im offenen Laden verkaufte, wie Herr Losung.
Auch das Offizierkorps war nicht immer völlig geschlossen. Nie hätten die Zweiten Dragoner in ihren Reihen eine dumme Überhebung geduldet, weil sie mehr Geld zu vertun hatten. Dennoch gab es im 5. Tillener Infanterie-Regiment Nr. 578 eine Anzahl Offiziere, die bei den Dragonern Kavalleriedünkel voraussetzten. So leider gerade der Kommandeur Oberst Knote, der bei jeder Kritik etwas anmaßend betonte, die Infanterie sei die Hauptwaffe.
Das vergalt die II. Abteilung des 3. Tillener (Feld-) Artillerie-Regiments Nr. 246, indem sie sich die »intelligente Waffe« nannte, obwohl alle Berechnungen in Schußtafeln festgelegt waren, und sie zum Generalstab nicht mehr stellten als 578er oder Dragoner. Auch Prinz Arbogast wollte die Prüfung zur Kriegsakademie ablegen. Da nun aber verlautete, Seine Majestät würde einen Besuch dieser borussischen Vorbereitungsanstalt zum Generalstabe bei Mitgliedern seines Hauses nicht gerne sehen, hatte doch Tillen 187l auf eine eigene Generalstabsschule verzichten müssen, so befragte der Prinz Exzellenz von Böswetter. Der – als echter Tille überhaupt gegen alles Borussische eingenommen – lehnte jedoch zugunsten der Schatulle die kleine Mehrausgabe ab.
Dadurch sah Prinz Arbogast jeden Aufstieg nun zum zweiten Male sich abgeschnitten. Als er nämlich vor Jahren Ordonnanzoffizier bei den Kavallerie-Divisionsübungen hätte werden können, mußte sein Kommandeur davon absehen, weil der Prinz zu schlecht beritten war. Auf des Königs Befehl bekam er nämlich seine Pferde zwar aus dem Marstall, doch Oberstallmeister von Zaum gab der kleinen Durchlaucht von der einflußlosen Nebenlinie immer nur solche Tiere, die er aus dem Königlichen Reitstalle los sein wollte.
Schon damals hatte den Prinzen die getäuschte Hoffnung, einmal einem höheren Stabe anzugehören, schwer getroffen. Jetzt aber, wo ihm jede militärische Zukunft genommen schien, überfiel ihn eine Verzweiflung wie einst in Außensee. Wenn sie sich auch nicht bis zum Martertod verdichtete, so zeigte er doch plötzlich für seinen Beruf keine Teilnahme mehr. Eine Schwäche dieses hochgemuten und begabten jungen Mannes, die gebucht werden muß, um ein richtiges Bild von ihm zu runden.
Nun, nach neun Jahren Dienstzeit, begann er seine Pflicht zu vernachlässigen, so daß er mit dem neuen Kommandeur, seinem ersten Schwadronschef, jetzt Oberst von Hengst, aneinandergeriet. Der Prinz, der aus Sparsamkeit, außer beim Regimentsdiner, niemals Wein getrunken, lud plötzlich Gäste ein und ließ dafür seine Rechnung beim Schneidermeister Bock anstehen. Ja, er fing eine Liebschaft an mit Fräulein Käthe Brüstlein, der sentimentalen Liebhaberin des Stadttheaters, und war nahe daran, dieser menschlich durchaus wertlosen Dame die Ehe zu versprechen. Er träumte davon, alles hinter sich zu werfen, um wie sein entfernter Vetter Erzherzog Johann Salvator als Johann Orth, so er als Arbo Hilligenstadt ein neues Leben zu beginnen, etwa als Reitbahnstallmeister in Chicago oder Bergbauer in der Hohen Munde.
Da fügte es der Zufall, daß sein einstiger Schulfreund in Außensee, Hanns Medicus, bisher Unterarzt am Garnisonlazarett Tillenau, als Assistenzarzt zu den zweiten Dragonern nach Illzenau versetzt wurde. Diesem gelang es, dem Prinzen sein »Idol«, wie der Verliebte Fräulein Käthe Brüstlein nannte, auf einem Blitzlichtbilde zu zeigen, das der Schauspieler Herr Ferdinand Locker, weinbetört, am Stammtisch hatte umgehen lassen. Die beiden spielten darauf das erste Menschenpaar derart natürlich, daß es keines Apfels bedurft hätte, den Vorgang zu erklären.
Tief erschreckt, von Weltschmerz geschüttelt, kehrte Prinz Arbogast in die Reihen seiner Kameraden zurück. Zugleich wurde er, nachdem er ohne Vorpatentierung wie jeder andere seine Zeit gedient, endlich zum Rittmeister befördert.
Meldung bei Seiner Majestät
Im Empfangssaale, dessen schwere Renaissancedecke auf Marmorsäulen ruhte, von einem blassen Rot, etwa wie das Fleisch der gekochten köstlichen Tille, pflegte Ernst der Zweite die Meldungen Beförderter und Ausgezeichneter entgegenzunehmen. Gehoben durch Aufstieg und Gnade, gingen der Wartenden Lippen über, daß bald ein Summen entstand, etwa wie der Sprachgebrauch die Judenschule sich vorstellen mag. Den größten Lärm aber verursachte gerade jener, der auf Ruhe hätte halten sollen: Oberstabelmeister Freiherr von Quatsch. Einige Berufssterne über dem linken Lungenflügel, erklärte er, gleichsam im Alleinbesitz des Hofbrauches, jedem einzelnen, er solle auf Fragen Seiner Majestät des Königs nur ja »bündig, bündig« antworten, womit freilich die eigene greisenhafte Geschwätzigkeit in einigem Widerspruche stand.
Die Reihe herunterrutschend, ohne die Sohlen zu heben, kam er zu Prinz Arbogast. Da der Oberstabelmeister an durch fortschreitenden Entzündungsvorgang im Mittelohr bedingter Schwerhörigkeit litt, wenn er es auch, im Bangen um seine Stellung, nicht wahr haben wollte, so zerrte er den neu ernannten Rittmeister gönnerisch am Knopfloche heran: »Na, Prinzchen, lassen Sie sich ooch mal sehen?« Der Prinz, nicht schlagfertig, fand um so weniger gleich eine Antwort, als eben ein kleiner, ungemein eng in seine Flügeladjutantenuniform gezwängter Major erschien, mit langer Ordensreihe über der vierten Rippe, und sich vor der Exzellenz verbeugte:
»Seine Majestät ...«
Ehe er ausgeredet, war der Oberstabelmeister gleichsam im Rückgrat niedergebrochen und hatte eine Art Spazierstock des 18. Jahrhunderts mit goldenem Knauf dreimal auf den Täfelboden gestoßen, so daß die Judenschule jäh verstummte. Es war aber nichts als ein Mißverständnis, wie Ernst der Zweite einmal das ganze Dasein des Herrn Oberstabelmeisters genannt hatte, denn Major Pupp, wegen seiner zierlichen Gestalt und der runden Porzellanbäckchen vom Hofwitz Puppchen geheißen, ergänzte: »... hat nach Rittmeister Prinz Arbogast gefragt.«
Der Flügeladjutant ging rechts voraus, wortlos, die Nase nichtachtend erhoben, durch den »Waffensaal« mit Pfeifenharnischen an den getäfelten Wänden, durch die »lange Galerie« voll Schulbilder, die einst Kurfürst Sigismund dem Kenner als alte Meister aufgehängt worden, zu einer Tür, an der ein Doppelposten von Leibdragonern stand. Prinz Arbogast trat ein. Puppchen blieb zurück und verneigte sich tief vor dem Holz der wieder geschlossenen Pforte.
Es war ein düsterer Raum, der durch bunte Scheiben kaum mehr als ein gebrochenes Licht einfing, ein strenger Raum, ein Raum der Arbeit. Am mächtigen Schreibtisch voller Schriftstücke und Bücher, darauf nur eine Uhr tickte, ein Bild der in Gott ruhenden Königin stand und ein großer Vormerkkalender sichtbar ward, saß im weißen Bart einer, dessen Gänsekiel beim Schreiben einen dünnen, singenden Ton gab, wie eine scheidende Kindesseele. Der König erhob sich. Nun erst konnte man seiner Größe recht inne werden, da Prinz Arbogast ihm kaum bis an die Schultern reichte, als er die Absätze schloß: »Ich melde mich alleruntertänigst unter dem 28. November zum Rittmeister befördert.«
Ernst der Zweite blickte ihn mit seinen unerbittlichen graublauen Augen an:
»Hättest du das Examen zur Kriegsakademie gemacht, so würde ich dich bei etwaiger Einberufung zum Generalstabe vorpatentiert haben. Aber Leute ohne Ehrgeiz berücksichtigt man nicht.«
Prinz Arbogast:
»Halten zu Gnaden, Euer Majestät, mein Kommandeur meinte, Mitglieder des Königlichen Hauses sollten nicht auf die borussische Kriegsakademie gehen.«
Der König blitzte den Verwandten von der Seitenlinie an:
»Das mag für den Kronprinzen gelten, aber nicht für dich. Das heißt denn doch seine Bedeutung überschätzen. Übrigens habe ich von deinem Kommandeur nichts Nachteiliges gehört. Es mag dabei bleiben. Vergiß nicht, daß du die Ehre, dem Königlichen Hause anzugehören, damit bezahlen mußt, dich keinen Augenblick gehen lassen zu dürfen. Noch eines: Du brauchst als Rittmeister ein zweites eigenes Pferd. Melde dich beim Oberstallmeister. Ich habe ihm befohlen, dir eines aus dem Reitstall zu überweisen. Dort sind ohnehin allerlei unnütze Fresser. Danke.«
Damit war Prinz Arbogast entlassen. Der Kammerdiener Treu, mit faltigem Gesicht und blondweißem Backenbart, so dicht und lang, daß man meinen konnte, ihm hingen zwei Hasenpfoten aus den Ohren, mahnte durch stumme Gegenwart. Der Basileus legte ihm freundlich die Hand auf die Achsel:
»Ich komme, mein Lieber!«