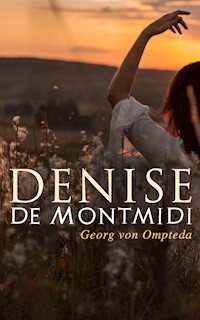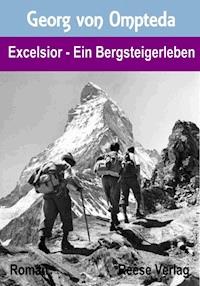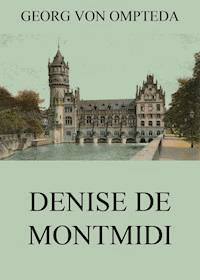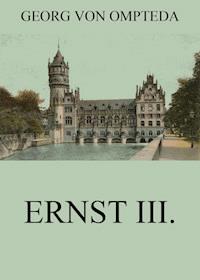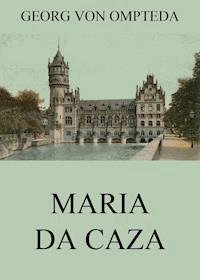Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Georg von Omptedas Buch 'Denise de Montmidi' ist ein fesselnder historischer Roman, der im Deutschland des 19. Jahrhunderts spielt. Der Autor verwendet einen detaillierten und präzisen Schreibstil, um die Leser in die Welt der Protagonistin Denise de Montmidi einzuführen, eine junge Adlige, die sich inmitten politischer Turbulenzen und gesellschaftlicher Normen behaupten muss. Ompteda gelingt es, historische Ereignisse geschickt in die Handlung zu integrieren und eine authentische Atmosphäre zu schaffen, die die Leser in eine vergangene Ära eintauchen lässt. Dieser Roman ist nicht nur eine spannende Lektüre, sondern auch ein Einblick in die komplexen sozialen Strukturen des 19. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Denise de Montmidi (Historischer Roman)
INHALTSVERZEICHNIS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
KAPITEL 1
Inhaltsverzeichnis
Die kleine Denise de Verneuil hatte nur einen einzigen Wunsch: sie wollte einen Mann haben! Dieser Wunsch mochte komisch erscheinen bei einem Mädchen, das, kaum von den frommen Schwestern, wo es erzogen worden, in das Vaterhaus zurückgekehrt war. Aber die kleine schwarze Denise war schon von den ersten Kinderjahren ab ungeheuer entschieden gewesen; Vater wie Mutter hatten sie verwöhnt und ihr jede Bitte erfüllt.
Als Denise beim Frühstück Herrn de Verneuil ihr Begehr aussprach, in dem Ton etwa, als hätte sie um ein Stück Brot gebeten, machte er zuerst ein erstauntes Gesicht. Dann fing er an zu lachen, und als er die traurige Miene seiner Tochter sah, die beleidigt zu sein schien, daß er ihre Bitte nicht ernst nahm, lachte er bis zu Tränen und steckte seine Frau an, daß auch sie schließlich das Taschentuch an die Augen hielt. Die kleine Denise war auch zu komisch mit ihrem Wunsch, daß sie einen Mann haben wollte, so etwa, als begehre sie eine Puppe zum Spielen. Und der Vater fragte sie, indem er abwechselnd seine Frau und seinen Sohn René listig ansah:
»Sag' mal, mein Kind, was willst du denn damit anfangen?«
Aber sie antwortete nur, sie wollte einen Mann haben. Als sie nach dem Frühstück einen Augenblick in ihr Zimmer gegangen war und die andern drei am Kamin saßen, in dem an dem regnerisch kühlen Herbsttage ein Feuer wohlig prasselte, sagte Herr de Verneuil, ein großer hagerer Mann mit schwarzem Schnurrbart und einer Fliege am Kinn:
»Lucy, wir werden uns also wohl für die Kleine nach einem Manne umsehen müssen.«
René schnippte die Asche seiner Zigarette in das Feuer; er starrte in die Glut und schien zu überlegen. Er war erst einige zwanzig Jahre alt, wie sein Vater, groß und schlank, ganz sein Ebenbild, nur daß der Schnurrbart erst im Ansatz sich befand; aber auch die Fliege saß ihm am Kinn.
Frau de Verneuil ließ ihre Modezeitung sinken, das einzige Blatt, das sie las, und rief:
»Ich wüßte einen Mann für die Kleine!«
»Nun?«
»Renés Freund, de la Caille.«
Ihr Sohn rührte sich nicht, er sah immer noch ins Feuer. Herr de Verneuil aber nickte nachdenklich:
»Gute Familie, sehr vermögend, ganz vernünftig, soviel ich weiß!«
René blickte seinen Vater kurz an und starrte dann wieder in die Glut, aber Frau de Verneuil hatte den Blick bemerkt und fragte ihren Sohn:
»René, das stimmt wohl nicht?«
René, der zu Haus immer etwas Gelangweiltes, beinahe etwas Philiströses an sich hatte, aber eine ganz andere Natur zeigte, wenn er mit seinen Freunden auf dem Boulevard bummelte, meinte:
»Gott, nicht vernünftiger, aber auch nicht unvernünftiger als andere!«
Herr de Verneuil erhob sich und sagte, indem er in einer gewissen Manier den Kopf hin und her bewegte: »Ach, papperlapapp, überlegen wir es uns, wir haben ja noch Zeit!«
Damit küßte er seine Frau im Vorübergehen auf die Stirn, winkte René mit einem Blick seiner Augen zu und ging davon, wie immer, um in seinem Cercle Zeitungen zu lesen.
Mutter und Sohn blieben allein, und nun stand Frau de Verneuil auf, setzte sich neben René, strich ihm die Wange und begann:
»Mein Kleiner,« so nannte sie ihn noch heute, »nun sage mir einmal, also was meinst du denn zu deinem Freund?«
Mit der Mutter war der Sohn ganz anders; er liebte abgöttisch diese weiche Frau, die immer etwas Schwermütiges hatte, der er alle seine kleinen Herzensangelegenheiten anvertraute, nur die großen nicht, und die ihm immer fürs erste aushalf, wenn er in Geldverlegenheit war. Beim Vater, der selbst viel Geld verbrauchte, mußte man sorgfältig die Gunst der Stunde nutzen.
René nahm die Hand seiner Mutter, und während er sprach, spielte er mit ihren zarten, dünnen, beringten Fingern und drückte ab und zu einen Kuß darauf:
»Mein liebes Mamachen, Robert de la Caille ist das leichtsinnigste Huhn, das ich kenne.«
»Aber warum hast du denn das Papa nicht gesagt?«
»Wir haben schon ein paarmal über ihn gesprochen, und ich weiß, daß er sehr eingenommen von ihm ist.«
Die Mutter beugte sich nahe zu ihrem Sohn:
»Aber, René, wirst du denn nie Vertrauen zu deinem Vater haben?«
René zuckte die Achseln und blickte zu Boden:
»Ist es denn überhaupt nötig, die arme Denise sofort zu verheiraten? Sie hat doch noch Zeit.«
Frau de Verneuil lächelte: »Du hast aber doch gehört, daß sie einen Mann haben will!«
»Ach, das ist Kinderei! Ich habe meine kleine Schwester gern, und ich kenne die andern jungen Leute. Ich kenne meine Freunde. Ich bin ja vielleicht nicht besser als sie, aber das kann ich dir sagen, ehe Denise einen von denen heiratet, da sollte sie es lieber überhaupt bleiben lassen.«
Frau de Verneuil antwortete nichts und vertiefte sich wieder in ihr Modeblatt.
René stand bald auf. Er küßte seine Mutter auf die Stirn, genau wie es ein paar Minuten vorher der Vater getan hatte, nur vielleicht ein ganz klein wenig herzlicher. Dann ging auch er davon; er wollte sich, wie seine Redensart lautete, einmal ein wenig die Läden ansehen. Auch Frau de Verneuil blieb nicht lange sitzen, sie hatte das Coupé bestellt und fuhr zur Schneiderin.
So blieb die kleine Denise allein zu Haus. Sie saß in ihrem Mädchenzimmer, beschäftigte sich mit einer Stickerei, malte, schrieb an dem winzigen Rokokoschreibtisch, den sie zum Neujahrstage bekommen hatte – sozusagen als Zeichen, daß sie erwachsen war – einen Brief an eine Freundin, die jetzt auf einem Schlosse ihres Vaters in der Normandie ihr Leben »vertrauerte«.
Keines der beiden Mädchen war zufrieden. Margarete de Palustre, die Tochter des Marquis de Palustre, eines Mannes, der nur Interesse für das Landleben hatte, für Jagd, Vieh- und Pferdezucht und niemals nach Paris kam, beneidete die kleine Denise in jedem Briefe, daß sie in der Hauptstadt lebte. Denise wiederum schrieb ihrer Freundin jedesmal, wie gern sie in der Normandie wäre. Die eine klagte von den düstern Mauern des alten normannischen Kastells, von finsterm, freudelosem Dasein, von eisiger Kälte, von Schneefall und kahlen Bäumen, von dem gewaltigen Wind, der Tag und Nacht landeinwärts blies. Und die andere schilderte ihre Eindrücke in diesem Häusermeer, in diesem Gewirr und Hasten der Weltstadt, in dem sie sich verloren und verlassen fühlte. Im Grunde genommen sehnten sich beide nach dem stillen Klosterhof zurück, nach dem wundervollen Garten der frommen Schwestern, und beiden tat, einer jeden nach ihrer Weise, die erste Berührung mit der Welt weh.
Denise war nicht so kindisch, wie Vater und Mutter und auch René glaubten; sie sah nur eine Möglichkeit, als streng gehaltenes französisches Mädchen diesem Zustande zu entfliehen, die Ehe, und darum hatte sie so naiv um einen Mann gebeten. Was dann folgen sollte, wo sie leben würde, ob das besser wäre als jetzt, darüber zerbrach sie sich nicht den Kopf.
Diese Nachmittage waren schrecklich. Die Mutter nahm sie zu ihren Besorgungen nicht mit, sie durfte sie erst später zur täglichen Ausfahrt in das Bois de Boulogne begleiten. So betrachtete sie denn unaufhörlich ihre Habseligkeiten, ihre drei Gebetbücher, die zwei Muttergottesbilder und die kleine Christusfigur, die ihr die gute Schwester Klara beim Abschied geschenkt hatte. Dann ordnete sie peinlich ihre Wäsche, legte die Taschentücher zurecht, verschnürte und verpackte sorgfältig die Briefe ihrer Freundin, indem sie alle paar Tage eine andere Reihenfolge vornahm und sie einmal rechts, einmal links in den Schreibtisch legte. Schließlich ging sie in den Salon hinüber, den für eine Pariser Wohnung fast saalartig großen Raum; wie er, ganz im Empirestil gehalten, war auch der große Flügel, an den sich Denise nun setzte, um zu spielen.
Sie nahm die Noten vor. Es war mehr eine mechanische Arbeit. Sie wußte, wenn ihre Eltern Gäste sahen, mußte sie »ihr Stück« spielen. Und sie übte das peinlich und sorgfältig, ohne Schwung, ohne Talent, nur weil sie eben »ihr Stück« vortragen mußte. Dann kam irgendeiner und sagte ihr, das wäre sehr gut und ein zweiter:
»Wie lange spielen Sie schon?«
Und ein dritter:
»Sie sollten es wiederholen!«
Aber dazu kam es nie, denn auch andere wollten gehört sein, und bei den Verneuils wurde viel musiziert.
Die Herren, die das Mädchen bei ihren Eltern gesehen hatte, gefielen ihr alle nicht. Sie ahnte, daß die jungen Leute eingeladen wurden, um sie zu besehen, und auch, damit ihre Eltern sie kennenlernten. Ab und zu hatte sie, wenn sie auch gar nicht so tat, ein paar Worte aufgeschnappt, denn die Frage der Heirat wurde im Hause immer besprochen. Sie hörte, wie der Vater den einen zu jung fand, den andern zu arm, und im Innern hätte sie sich ausschütten mögen vor Lachen, als er neulich den Vicomte de Cornadon für sehr passend erklärte, einen Herrn mit fast grauem Haar, den sie am liebsten Großpapa genannt hätte.
Denise hielt im Klavierspiel inne, stützte das Kinn auf ihre noch etwas magern, schlanken Mädchenarme, beugte sich weit vor und starrte zwischen dem Notenpult in die Saiten unter dem Deckel des Flügels.
Einen hätte sie schon gewußt, der ihr gefiel, das war Renés Freund, de la Caille. Ja, Robert, wie ihn René immer nannte, und unter diesem Namen kannte sie ihn am besten, den hätte sie gern zum Mann gehabt. Er war immer so nett mit ihr, eben wie ein Freund ihres Bruders. Er sah sie nie prüfend von der Seite an, wie die andern, denn auch das merkte sie ganz wohl. Er sagte ihr nie eine fade Schmeichelei, er sprach mit ihr beinahe wie ihr Bruder, einfach, freundlich. Und sie waren ja so alte Bekannte; sie erinnerte sich noch, wie er mit René in die Schule ging – man sagte einfach »die Schule« – die sie beinahe alle besuchten aus dem Faubourg Saint-Germain, wo man alle Familien kannte, wo die Jungen miteinander verkehrten, wie einst ihre Väter verkehrt hatten, und wo René mit jedem ruhig Freundschaft schließen konnte, ohne die Eltern zu befragen, denn sie alle waren anständiger Leute Kinder. Robert war Sonntags immer gekommen, und damals war er reizend gegen das kleine Mädchen gewesen, für das René eigentlich in jenen Jahren eine gewisse Verachtung gehabt. Robert hatte ihr Kuchen mitgebracht, heimlich, denn die Mutter wollte es nicht, und ab und zu eine Blume, und wenn er sie übergab, war es immer wie eine kleine, zarte Huldigung.
Der Ton war geblieben, obgleich sie sich jahrelang nicht gesehen hatten. Denn von den frommen Schwestern war sie kaum einmal nach Haus gekommen. Man sollte, wie es hieß, den Gang der Erziehung nicht durch andere Eindrücke beeinträchtigen. Und nun hatte sie Robert wiedergesehen, und er war genau so wie früher, nur die kleine kindliche Knabenhuldigung dem um acht Jahre jüngern Mädchen gegenüber hatte einer ruhigen Freundschaft Platz gemacht. Er brachte ihr keinen Kuchen mehr und auch keine Blumen, aber er sprach immer mit ihr; und seine Worte gingen nie auf Stelzen, sie waren herzlich und einfach.
Wie Denise über alles das nachdachte, immer noch auf den Flügel gelehnt, mit einem Finger ab und zu einen Ton anschlagend und lauschend auf das Nachzittern der Saiten, ward sie sich plötzlich klar, daß sie an Robert gedacht, als sie ihren Eltern heute beim Frühstück gesagt hatte, sie wollte gern einen Mann haben.
Sie stand auf, klappte das Instrument zu und kehrte in ihr Zimmer zurück, als schämte sie sich, als wollte sie jetzt nicht gesehen sein. Und sie starrte auf den Hof hinaus, denn ihr Zimmer lag nach hinten. Da sah sie das Coupé stehen; das Pferd war schon ausgespannt. Der Kutscher vertauschte eben den Livreerock mit seiner Ärmelweste. In einer halben Stunde wurden also die beiden Braunen eingespannt, und dann kam die übliche Fahrt ins Bois. Schnell, schnell, sie mußte sich anziehen.
So nahm sie denn alle die Sachen, in denen sie gekramt hatte, warf sie kunterbunt durcheinander in das Fach ihrer kleinen Kommode, trat mit dem Fuß dagegen, daß es zurutschte, und machte sich fertig. Sie wußte nicht, welchen Hut sie aufsetzen sollte und mußte zweimal den Schleier wieder abbinden. Endlich saß das feine Gewebe, für das sie von ihrem Taschengeld immer verhältnismäßig viel ausgab, und nun nahm sie eine Haarnadel und lüftete den Schleier rechts und links, damit das Haar nicht an den Schläfen kleben sollte. Dann öffnete sie den Mund ein paarmal wie zum Gähnen und spannte dadurch den Schleier ein wenig ab. Sie zog die Handschuhe an und huschte hinaus:
»Mama, da bin ich!«
Frau de Verneuil saß im Schlafzimmer an ihrem Louis-XVI.-Schreibtisch. Sie fuhr zusammen:
»Herrgott, habe ich mich erschrocken!«
Sie fügte etwas ärgerlich hinzu:
»Du mußt auch nicht immer so hereinplatzen!«
Aber Denise fiel ihrer Mutter um den Hals, küßte sie, daß sie sich lächelnd ihrer kaum erwehren konnte, und rief:
»Meine liebe gute Mama, du bist ja doch nicht böse!«
Sie war auch nicht böse, sie konnte Denise nicht böse sein, wie keiner im Hause.
Mutter und Tochter stiegen nun in den Wagen, der Diener stopfte ihnen noch die Decke zurecht, schob die große Wärmflasche unter die Füße, dann lehnten sich die beiden Damen in die Seidenpolster des Coupés, und während der Diener schnell auf den Bock kletterte, zogen die Pferde an. Lautlos auf den Gummirädern rollte der Wagen durch den Torweg.
Als sie aus der stillen Straße, in der nur einzelne vornehme Hotels lagen, ein- oder höchstens zweistöckige, in die Champs Elysées hinausbogen, umflutete sie das ganze gewaltige Leben dieser Nachmittagsstunde, wo Hunderte von Equipagen die übliche Fahrt ins Bois antraten, die Denise so aus tiefstem Herzen haßte. Auf der breiten Avenue mit den entlaubten Bäumen rechts und links, aus denen die Häuser mit ihren hohen Schieferdächern und ihren teils in Gärten versteckten Fronten lugten, war ein unausgesetztes Hin und Her. Hohe schwere Omnibusse kamen gefahren, Automobile stießen ihre Klage- und Warnungsrufe aus und huschten an den vornehmen Gefährten vorbei, die in unausgesetzter, doppelter, drei- oder vierfacher Reihe hintereinander oder einander überholend zum Bois hinausstrebten. Der Hauptstrom ging hinauf zum Triumphbogen, nur wenige Gefährte bewegten sich von dort zurück nach der Place de la Concorde.
Nun brach die Sonne, die sich bisher versteckt gehalten hatte, durch ein Wolkenfenster durch und bestrahlte dieses wimmelnde Nachmittagsbild. Damen in kostbaren Pelzen lenkten selbst ihre Automobile oder ihr Gefährt, und in den Coupés sah man sie zurückgelehnt, lässig und müde in größter Eleganz sitzen, während regungslos vor ihnen auf dem Bock die beiden glattrasierten Bedienten Platz genommen hatten. Die Sonne spielte auf dem Lack der Wagen, als ob es lauter polierte Spiegel wären; sie glitzerte in dem silberbeschlagenen Geschirr und zeichnete glänzende Flecken auf den Kruppen der tadellos gehaltenen Pferde, die in hoher Aktion stolz vor ihren Wagen in den Strängen lagen.
Auf den Bürgersteigen erging sich die Menge, die Herren im blanken Zylinder, die Krücke ihres Stockes nach unten gesenkt, in Lackstiefeln und weißen Handschuhen. Sie neigten sich zu den Damen, die sie begleiteten, und sagten irgend etwas. Man erriet, daß es wohl eine Artigkeit sein mußte. Dazwischen gingen Kinderfrauen mit ihren runden Hauben und den lang herabhängenden Bändern, das pflegebefohlene Kind unter dem weiten Mantel verborgen. Und bei dem milden Schein der Sonne, bei dem es plötzlich wärmer geworden war, saßen die Menschen jetzt auch überall auf den Bänken und starrten auf das Fluten des Verkehrs. Kleine Bürger, die Riesenzahl der Rentner, hier und da ein Arbeiter in blauer Bluse, irgendein Paket in der Hand, der auf seinem Gange rastete und dem eleganten Treiben zusah, das für ihn immer und ewig ein unerreichbares Märchen bedeutete. Ab und zu sah man auch ein paar Uniformen, kleine, schwarze Soldaten in roten Hosen und blauen Röcken, mit den Epauletten, die beinahe größer zu sein schienen als die winzigen Kerlchen.
Die beiden Damen im Wagen achteten nicht auf all das, sie waren es gewohnt. Der Mutter schien es zum Leben notwendig, der Tochter langweilig, zu bunt und zu unruhig. Sie sprachen kein Wort, während der Wagen um den Triumphbogen herumfuhr, immer weiter dem Bois de Boulogne zu, und noch immer redeten sie nicht, als sich die weite Avenue auftat und man rechts und links die Wälle der Stadt-Enceinte sah.
Nun beschrieb der Wagen den Weg, den er immer machte, um den See herum, dann die Akazienallee hinunter. Die einzige Unterhaltung bildete jetzt, daß Frau de Verneuil, aus dem Fenster blickend, Bekannte sah, die genau so wie sie den täglichen Rundweg machten, die sie täglich traf, die sie täglich begrüßte. Nur ab und zu kam die Bemerkung:
»Sieh mal den neuen Tricorne der Gräfin Brizennes! Hast du ihn gesehen, Denise? Sehr hübsch!«
Oder: »Die Berteaux könnten nun auch wirklich einmal ein paar andere Pferde anschaffen, so reiche Leute!«
Dann herrschte wieder Schweigen in dem kleinen Coupé, das beim schnellen Trabe der Pferde fast ohne Geräusch und ohne Erschütterung dahinglitt. Frau de Verneuil beugte sich von Zeit zu Zeit vor, sah in den kleinen Spiegel ihr gegenüber und blickte nach der Uhr, die im Vorderteil des Wagens im Seidenkissen eingebettet lag.
Plötzlich schien Denise aufzuwachen, die bisher gleichgültig dagesessen hatte:
»Sieh mal, Mama, Robert!«
Die Mutter blickte hin und sah gerade noch ein Tandem vorüberhuschen, von einem schlanken jungen Manne gefahren, der ein ganz klein wenig René ähnelte, dessen Gesicht nur regelmäßiger war, da ihm die scharfe Nase fehlte. Und Frau de Verneuil dachte an den Ausspruch ihres Mannes und fragte unwillkürlich:
»Ist er noch immer so nett?«
Denise meinte nur kurz, ohne ihre Mutter anzusehen:
»Sehr nett!«
»Nun ja, als Renés Freund und dein alter Spielkamerad!«
Denise antwortete nicht. Ihre Mutter kam auf keinen Gedanken. Sie sagte sich: »Wäre er am Ende doch etwas für meine Kleine?«
Sie überlegte, daß, wenn er auch wirklich nicht als Tugendspiegel gelten konnte, schließlich Herr de Verneuil in früheren Jahren auch keiner gewesen war. Und wieder sagte sie sich: »Ach, Renés Freund ist so nett, und er treibt's doch wohl nicht anders als andere junge Leute. Und wenn mancher so viel Geld hätte, so würde er wohl noch ganz anders sein. Es muß nur die richtige Frau sein, und die kleine Denise würde ihn schon vernünftig machen.« Da kam ihr plötzlich der Gedanke, zu forschen, und sie fragte:
»Sag' mal, mein Kind, du wolltest doch einen Mann haben?«
Denise war jetzt etwas beschämt, seitdem ihr die Augen aufgegangen waren, und sie wich aus:
»Mama, es war ja bloß ein Scherz!«
»Na, na, aber so kleiner Kinder Wünsche erfüllt man doch, wenn man kann!«
Die Tochter bat:
»Bitte, Mama, sprich nicht davon!«
»Davon will ich ja auch gar nicht reden, ich will von ganz anderm sprechen. Du sagtest, Robert wäre nett; ist er noch gegen dich wie früher? Seid ihr noch immer so gute Kameraden?«
»Gewiß!«
Forschend fragte die Mutter:
»Weißt du noch, wie er dir früher Bonbons brachte und Blumen? Das tut er doch nicht mehr?«
Denise seufzte ein wenig:
»Nein, aber das brauche ich auch nicht. Wozu? Er geht mich ja nichts an, er ist ja nichts als Renés Freund.«
Frau de Verneuil grüßte eine Bekannte, dann fragte sie ganz unvermittelt:
»Nun, Denise, was denkst du denn von dem?«
Denises Gesicht überflog ein purpurner Schimmer:
»Wie meinst du das?«
Die Mutter, die seinerzeit auf gegenseitiges Familienübereinkommen mit Herrn de Verneuil verheiratet worden, und die, obwohl sie jetzt wieder den Frieden erlangt hatte, in ihrer Ehe schon recht unglücklich gewesen war, hatte sich geschworen, es ihrer Tochter nicht so widerfahren zu lassen, wie es ihr ergangen war. So fragte sie geradezu:
»Nun, du wolltest doch einen Mann haben! Was meinst du zu Robert?«
Denise fuhr erschrocken zusammen. Sie wollte eigentlich nein sagen, doch die Mutter redete ihr freundschaftlich zu und sie, die sonst Denise gegenüber etwas Strenges hatte, – ein ganz anderes Verhältnis als zu ihrem Sohn – zog ihrer Tochter kleine Hand aus dem Muff, spielte mit ihren Fingern, lehnte sich an ihre Schulter, während sie jetzt dem See zufuhren und die Zahl der Bekannten abnahm. Sie sprach auf Denise ein: sie müßte nun doch mal an die Ehe denken, und sie sollte, damit die Mutter ihre Interessen wahren könnte, einfach sagen, was sie wünschte. Wenn nun Robert in Frage käme, würde sie zufrieden damit sein?
Da antwortete Denise, indem sie denselben naiven, ruhigen Ton wiederfand, in dem sie heute beim Frühstück kindlich gebeten hatte, sie wolle einen Mann haben:
»Robert, ja!«
Ein paar Augenblicke darauf gab Frau de Verneuil durch das Sprachrohr dem Kutscher den Befehl, zur Stadt zurückzukehren, und zeitiger als sonst fuhren sie wieder dem Triumphbogen zu, der, augenblendend von den Sonnenstrahlen umspielt, wie ein gewaltiges Eingangstor zu der Eleganz und Schönheit der Weltstadt dalag.
Als es die Champs Elysses hinunterging und die breite stolze Avenue vor ihnen lag, noch schöner vielleicht als vor einer halben Stunde, da sie hinaufgefahren waren – denn man konnte nun das Heer der ungezählten Wagen bis zur Place de la Concorde hinunter verfolgen –, erschien Denise das Bild, das sie sonst in seiner Beweglichkeit beängstigend gefunden hatte, doch nicht ohne Reiz, als wäre sie durch die Frage der Mutter mit Paris schon etwas versöhnt worden.
Herr de Verneuil hatte René noch einmal ins Gebet genommen und ihn unter vier Augen, nicht wie ein Vater den Sohn, sondern wie ein älterer erfahrener Mann den jungen lebenslustigen Freund gefragt, ob es denn wirklich mit Roberts Leichtsinn so schlimm wäre.
René befand sich in schwieriger Lage. Robert war sein Busenfreund, sie trafen sich täglich, sie gingen ins Theater, in den Zirkus, in die Vergnügungslokale. Sie gehörten beide demselben Cercle an, einem andern als der Vater, und alles, was René etwa Nachteiliges über den Freund gesagt hätte, wäre zum guten Teil auf ihn selbst zurückgefallen. René stellte sich aber gern als soliden jungen Mann dar. So gab er schließlich seinem Vater eine befriedigende Auskunft.
Nun ward ihm der Auftrag, seinem Freunde nahezulegen, sich doch mal Denise etwas näher anzusehen.
Da wurde denn Robert de la Caille eines Tages unvermutet von René zum Frühstück mitgebracht, und sein erster Blick fiel auf Denise. Er beobachtete sie, während sie im Salon warteten, daß der Diener der Frau des Hauses melden sollte, es sei angerichtet.
Er saß bei Tisch neben ihr, und wenn er schon für alle erzählte, wandte er sich doch stets zu seiner Nachbarin, als gelte es ihr besonders. Es wurde in Anbetracht der Anwesenheit des jungen Mädchens ein anderer Ton angeschlagen als wohl sonst, und auch von Dingen gesprochen, die ihr näher lagen. Robert fragte nach den frommen Schwestern, und wie es Denise im Kloster ergangen sei. Das Mädchen antwortete ihm, nachdem die erste Verlegenheit überwunden war, unbefangen auf alle Fragen und lachte mit ihm, als er daran erinnerte, wie er ihr früher Blumen gebracht hatte.
Nach Tisch, als sie wieder in den Salon hinübergegangen waren und er einen Augenblick mit ihr allein am Fenster stand, sagte der hübsche, elegante Mensch so von ungefähr: »Wissen Sie denn auch wohl, daß Sie eigentlich eine alte Liebe von mir sind? Oh, Sie brauchen sich nicht zu ärgern, es war ja eine Kinderei, ich war damals Schüler und Sie waren ein ganz, ganz kleines Mädchen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich habe die Blumen jedesmal an die Lippen gedrückt, ehe ich sie Ihnen schenkte.«
Denise meinte lachend in ihrer entschiedenen sichern Art, die sie auch im Verkehr mit jungen Leuten hatte, wenn nicht gerade die Eltern zuhörten:
»Das wird ja den Blumen nichts geschadet haben!«
Er fragte:
»Haben Sie es denn geahnt?«
Sie blitzte ihn an:
»Nein, sonst hätte ich sie nicht angenommen!«
Er legte bedauernd die Hände zusammen: »Oh, oh, so hart sind Sie?«
»Ich war es!«
»Und heute?«
»Ich weiß nicht!«
»Wir wollen mal sehen! Das nächste Mal bringe ich Ihnen Blumen mit!«
Sie wurden unterbrochen, und Robert, der meinte, sein Besuch hätte lange genug gedauert, empfahl sich mit ein paar artigen Worten.
An einem der nächsten Tage kam er abends zum Diner, dabei brachte er ein paar weiße Rosen mit und unversehens drückte er einen Kuß darauf, ehe er sie Denise überreichte. Dann sagte er:
»Ich habe eine große Bitte, schenken Sie mir eine dieser Rosen!«
Sie löste eine kleine Knospe heraus. Er fragte:
»Duften sie schön?«
Denise verstand, und während sie, um nicht Antwort zu geben, sich auf die Blumen niederbeugte, war es, als berührten auch ihre Lippen die kühlen frischen Blätter.
René hatte bereits mit seinem Freunde gesprochen und auch mit Herrn de Verneuil eine Unterredung gehabt. Man war einig geworden, und Robert konnte jetzt, noch ehe es zu Tisch ging, Denises Vater mitteilen, er glaube, sie wäre einverstanden. Er sagte das mit so strahlender Miene, daß Herr de Verneuil ganz gerührt war, denn er meinte, an dem Glück des jungen Mannes und damit des jungen Paares nicht zweifeln zu können.
Während der Mahlzeit wurde zuerst noch nichts davon laut. Doch beim Nachtisch erhob plötzlich Herr de Verneuil sein Glas, in dem der Champagner schäumte, und sagte zu den wenigen Anwesenden, nur Verwandten:
»Ich bitte Sie, auf das Wohl des jüngsten Brautpaares zu trinken!«
Alle hatten es geahnt, keiner wunderte sich auch nur einen Augenblick. Man hob die Kelche gegeneinander, leerte sie, und die Verlobung war besiegelt.
KAPITEL 2
Inhaltsverzeichnis
Der Brautstand dauerte nicht lange. Schnell wurden die Besorgungen gemacht: Wäsche, Möbel, Spitzen gekauft. Der Bräutigam überreichte der kleinen Denise wundervollen Schmuck: Armbänder, Ringe, ein paar Diamanten in die Ohren, ein Diadem für Festlichkeiten.
Die Geschenke häuften sich. Die Verwandten, die Freunde, die Bekannten, jeder brachte irgendeine Kleinigkeit. In einem Zimmer, das dazu ausersehen war, entstand bald eine förmliche Ausstellung von silbernen Gegenständen, Bronzen, Spitzen, Porzellan, Schmuck, Uhren, Vasen, Nippessachen, auch ein paar künstlerisch ausgeführte Lampen fehlten nicht. Die Freunde Roberts meldeten sich fast alle mit kleinen Kunstgegenständen, wie einem Aquarell von einem Meister, in kostbarem handgeschnitzten Rahmen oder dem Vorzugsdruck einer Radierung. Es war, als hätten sie sich das Wort gegeben, die Wände des neuen Heims ausreichend zu schmücken.
Auch die Wohnungsfrage war entschieden worden. In der Nähe des Hotels der Eltern würden sie eine Etage beziehen, einen schönen ersten Stock, unmittelbar an den Champs Elysées und nicht weit vom Métropolitain, der Untergrundbahn, vor der Denise bisher immer eine solche Angst gehabt hatte, daß sie sich weigerte, damit zu fahren. Nun würde sie es wohl müssen, denn eine Equipage sollte fürs erste nicht gehalten werden. Robert besaß ein kleines Gut in der Provinz im Südwesten; dort auf dem Lande mußte man sowieso Pferde und Wagen haben, also war es hier ein Luxus.
Robert hatte seine Finanzverhältnisse bei der Heiratsbesprechung klarlegen müssen, und es stellte sich heraus, daß er gar nicht so reich war, wie die Verneuils geglaubt hatten. Wohl war es einmal gewesen, aber der Aufenthalt in Paris, Bakkarat und anderes hatten viel Geld verschlungen. Da war es besser, anstatt groß anzufangen und dann einen Pflock zurückstecken zu müssen, lieber von Anfang an haushälterisch zu sein. Seinen Freunden gegenüber meinte Robert, er mache eine Liebesheirat, seine Braut habe nicht genügend Geld, um auf großem Fuße leben zu können. Die Verneuils aber ließen ihrerseits durchblicken, die Vermögensverhältnisse des jungen Mannes reichten nicht hin, um in Paris ein Haus zu machen.
Herr de Verneuil aber sagte zu René, und das war die Schlußfolgerung, die er zog:
»Siehst du, mein Junge, sei vernünftig, sonst wird es dir gerade so gehen!«
Robert schaffte also sein Tandem ab und schloß seine Junggesellenwohnung. Mit Eifer richtete er die neuen Räume selbst ein. Die Braut besuchte ihn in Begleitung ihrer Mutter ein paarmal, wie er dort bei der Arbeit war, in Hemdsärmeln, als wäre er selbst Tapezierer, wie er den Hammer schwang und alles nach seinem guten, etwas kostbaren Geschmack anordnete, der ihm in seinem bisherigen Erdenwallen in jeder Beziehung ziemlich viel Geld gekostet hatte.
Endlich war das kleine Nest fertig. Es war die höchste Zeit, denn morgen schon sollte die Hochzeit sein. Die Einladungen waren längst verschickt, das feierliche Mahl mit der ganzen Verwandtschaft der Verneuil und der de la Caille fand am Abend statt.
Der Marquis de Bloudarnenez, der eine de la Caille zur Frau hatte, erschien mit seinen sieben Söhnen, ein Hugenotte alter Rasse, der sich mit den übrigen de la Cailles jahrelang nicht gesehen hatte, weil seine Frau, von ihm bekehrt, zum Protestantismus übergetreten war. Es waren große Gestalten mit eckigen, scharfgeschnittenen Gesichtern, derb, knochig und mit Bauernschädeln, die nur durch das Ausgearbeitete der Züge das alte Geschlecht verrieten. Es waren Leute von einfachen Sitten und ungebrochener gallischer Kraft. Diese ganze kinderreiche Familie, deren Erscheinen Aufsehen erregte, war wenig modisch gekleidet und bildete einen schreienden Gegensatz zur Übereleganz der übrigen Hochzeitsgäste.
Dann kam die Herzogin von Lamont, »die Wohltäterin der Armen«, wie sie die Boulevardblätter nannten, eine kleine bewegliche runde Frau mit weißem Scheitel. Dann Baron und Baronin Scheffler, als Elsässer doppelt wütende Patrioten; ihr Hotel am Park Monceau war der Sammelpunkt der Klerikalen und Royalisten im Lande. Endlich die Gutsnachbarn der de la Caille, nicht ganz so elegant wie die Pariser. Sie röchen ein wenig nach Provinz, meinte die Herzogin, aber es waren die ältesten Familien des Landes: die de Vallot, de Roncières, de Petrilly und dann der alte General de Saint Genois, der glänzendste Reiterführer Frankreichs, wie man ihn allgemein nannte, gemaßregelt vom letzten Kriegsminister, weil er nicht republikanisch genug sei. Ein Mann, der, seitdem er den Dienst hatte verlassen müssen, mit einemmal zusammengebrochen war und an einem Stock gehend erschien.
Er pflegte sich über die Etikette hinwegzusetzen, das kannte man an ihm. Er schritt denn auch sofort auf die Braut zu, betrachtete sie gerührt, nannte sie ein reizendes Kind, sagte das den Eltern, dem Bräutigam, den Verwandten, jedem, der es nur hören wollte, und dann führte er eine kleine theatralische Szene auf, indem er das Mädchen plötzlich wie ein guter alter Vater auf die Stirn küßte, ehe die Erschrockene sich wehren konnte, wobei er vor lauter Bewegung mit zitternder Stimme sagte:
»Mein Kind, werden Sie glücklich!«
Der kleine Graf Riquois de Grancin, der mit René zusammen Brautführer war, aber – ausschließlich in der zweiten Quadrille der großen Oper beschäftigt – sich eigentlich bei dieser feierlichen Hochzeit sehr komisch vorkam, flüsterte einem andern zu:
»Der alte Kerl ist nicht dumm, das werde ich mir merken, so kann man jedes Mädchen umsonst küssen!«
Und er näherte sich einer Verwandten der Verneuil, einer jungen Frau mit lebhaften, glänzenden Augen und auffallend langen, schwarzen Wimpern, die sie den Männern gegenüber auch auszunützen verstand. Da er wußte, daß sie mit sich scherzen ließ, tat er hinter dem breiten Rücken eines der Hugenotten, als wolle er sich zur Stirn der kleinen Frau neigen, während er im Ton des Generals meinte:
»Mein Kind, werden Sie glücklich!«
Sie lachte und bog sich zurück; das war ihr doch zu viel, und sie meinte abwehrend, wobei ihr die Heiterkeit aus den Augen blitzte:
»Das bin ich schon!«
»Schade!« meinte er. Dann ging es zu Tisch. Aber nun war wieder Feierlichkeit, Ernst und Würde.
Es gab ein prachtvolles Essen. Den Hauptgesprächsstoff bildete das junge Paar, das, nebeneinandergesetzt, die Zeremonie wie etwas Notwendiges, aber Schreckliches an sich vorübergehen ließ. Es wurde sehr schnell serviert, man stand bald auf, und kurz darauf trennte sich die ganze Gesellschaft.
Am nächsten Morgen fuhren an der Kirche Saint Philippe du Roule eine Menge eleganter Equipagen vor. Ein förmlicher Fuhrpark wartete dort. Die Umwohnenden, wenn sie auch die Hochzeiten gewohnt waren, blickten trotzdem neugierig aus dem Fenster oder standen umher, denn eine solche Menge wappengeschmückter Wagen sahen sie immerhin selten.
Man hörte in der Kirche Gesang, und trotz des Lärmes der Straße konnte man eine Stimme vernehmen, die siegreich über der begleitenden Orgel schwebte; der Baritonist Louis Calvin von der Großen Oper trug eine geistliche Ode vor. Endlich summte die Orgel nur noch gedämpft weiter, und da die Menge annahm, daß die Feier nun zu Ende sei, drängte sie sich um das Eingangstor. Da erschien plötzlich der Schweizer, winkte, und die Wagen fuhren vor.
Das Brautpaar trat heraus. Die kleine schwarze Denise in ihrem weißen Brautstaat, einen pelzverbrämten Umhang um die Schultern, den Orangenzweig im dunklen Haar, schlug die Augen zu Boden, der Bräutigam aber blickte sich ruhig um, sah lächelnd auf die Menge, und ein paar Weiber sagten: »Schöner Kerl!« Dann half er seiner jungen Frau in den Wagen, und das Gefährt rollte davon.
Im Hotel Verneuil fand das Frühstück statt. Die Damen hatten schicke, hohe Toiletten an und überboten sich in duftigen Hüten. Die Herren trugen den Gehrock und zeigten in Krawatte, Busennadel, Wäsche und Stiefeln Eleganz. Man beglückwünschte das Brautpaar. Denise nahm die Worte ohne jede Verlegenheit entgegen und schaute allen klar ins Gesicht; nur ab und zu warf sie einen Blick auf ihren Bräutigam, einen Blick, aus dem Liebe und Glück sprach.
Als die Gäste noch beieinander saßen, die Herren den Damen allerlei Unsinn erzählten, Schmeicheleien sagten, Klatsch aus Paris mitteilten, alle der Reihe nach den Gesang von Louis Calvin wundervoll fanden, fragte plötzlich einer:
»Wo ist denn das junge Paar?«
Die Frage pflanzte sich fort, man erkundigte sich nach allen Seiten, und obgleich jeder, wußte, daß die Jungvermählten wahrscheinlich längst im Zuge saßen, taten alle, als wären die beiden geradezu auf rätselhafte Weise verlorengegangen. Allmählich ging man zu anderen Gesprächen über und hatte das Brautpaar vergessen.
Inzwischen saßen Robert und seine junge Frau im Wagen, er in einem dunklen, karrierten Anzug und langem Reiseüberzieher, einen weichen Hut auf dem Kopf; sie in einem braunen Kleide und ihrer Sealskinjacke, die mit der Ausstattung angeschafft worden war.
Sie saßen Hand in Hand, während das Coupé lautlos dahinrollte. Er fragte:
»Meine kleine Denise, hast du mich denn lieb?«
Sie antwortete:
»Wie kannst du das fragen?«
Und er küßte ihre kleinen Hände. Er zog dazu ihre Handschuhe zurück, um ihre Haut zu berühren. Dabei sah er die Ringe blitzen. Er betrachtete sie noch einmal, und sie, die bisher als junges Mädchen noch keine getragen hatte, zog den Handschuh ganz ab, hielt die Hand ein Stück entfernt und sagte:
»Du hättest mir nichts Schöneres schenken können!«
Die Smaragden blitzten, von Brillanten umsäumt. Alles glänzend neu, neu wie das Leben, das sie zu beginnen hatten.
Ein neues Leben! Für das Mädchen, bei dem dieser Tag den größten Wandel in ihrem Dasein bedeutete, ein süßes und doch sie erschreckendes Geheimnis, dem sie mit unbestimmtem Bangen entgegensah. Für ihn der Abbruch aller alten Beziehungen. Mehr noch fast ein neues Dasein als für sie. Er hatte sich fest vorgenommen, er wollte ein guter Wirt werden, er hatte sich das Versprechen gegeben, im Cercle keine Karte mehr anzurühren. Und alle schönen Damen von Paris, denen er bisher zu Füßen gelegen hatte, die aus der Gesellschaft, die vom Theater, alle sollten ihm gleichgültig sein, denn er hatte Ersatz gefunden in dieser kleinen Frau an seiner Seite, die ihm vertrauend ihr Dasein überließ, die er bilden konnte nach seinem Willen, die unberührt bei den frommen Schwestern da draußen nichts geahnt hatte von allem Schönen dieses großen Paris, aber auch nichts von allem Entsetzlichen, das es barg. Er wollte seine Frau glücklich machen. Er hatte Erfolge gehabt, er war groß, hübsch, lebhaft, immer gut angezogen, er hatte das Geld nicht gespart, er war verwöhnt worden. Nun wollte er alles aufgeben und alles dieser kleinen Frau zu Füßen legen, die neben ihm saß.
Bei diesem Gedanken überkam ihn ein unbändiges Glück; er faßte die schmale Hand, an der die Steine blitzten, zog sie an die Lippen, küßte die rosigen Nägelchen, küßte die Finger, schob den Ärmel zurück und küßte das Gelenk. Dann plötzlich legte er den Arm um ihren Nacken, und trotz ihres Sträubens und obgleich sie immer rief:
»Aber Robert, man sieht es!« preßte er sie an sich und küßte durch den Schleier hindurch ihre Wangen, ihre kleinen Ohren, die flockigen Härchen am Hals, ihre Nase sogar und endlich ihren Mund.
Als er sich aufrichtete, schrie sie, aber sie lachte dabei:
»Um Gottes willen, da!«
Sie entdeckten das Gesicht eines Bengels, der die Mütze im Nacken, neben der Equipage herlief und grinsend zum Fenster hineinsah. Eine echte Pariser Range.
Doch Robert lachte nur:
»Ach, der dumme Junge, das schadet nichts!«
Dann schob er seinen Arm unter den seiner Frau, und nun überließen sich beide ihren Gedanken, denn im Überschwang ihres Glückes konnten sie nicht Worte finden. So saßen sie und warteten, bis sie an den Bahnhof kamen.
Sie sagten dem alten Kutscher und dem Diener der Eltern Lebewohl, Robert gab das Gepäck auf und löste die Fahrkarten, denn sie wollten nach dem Süden. Eigentlich hatten sie ein paar Tage auf dem Gut verbringen wollen, aber schließlich waren sie davon abgekommen, denn da standen um diese Zeit die Bäume kahl, kein Grün war zu sehen und auch nichts vorgerichtet. Sie hätten sich unwohl gefühlt, dort, wo der Hauch des Ozeans kalt herüberwehte und Dünste und Nebel um das Haus trieb; wo der Sturm heulte, daß die Schieferplatten auf dem Dach klapperten, und wo es unheimlich war in den verlassenen Räumen. Nein, sie wollten nach dem Süden, nach Schönheit und Sonne.
Ihr erstes Ziel war Nizza, das sie allerdings erst morgen erreichen würden, denn heute abend fuhren sie nur wenige Stationen weit. Sie wollten die ersten Stunden, die sie sich angehörten, nicht auf der Eisenbahn verbringen.
Und als sie in ihrem Abteil erster Klasse saßen, ganz allein beim halben Licht der Lampe oben an der Decke, beim gleichmäßigen Stoßen und Zittern, beim Rattern und Rollen des Zuges, schmiegten sie sich eng aneinander, und wieder begann dasselbe Spiel, daß er ihre Hände küßte und dann ihr Gesicht und ihr erklärte, wie glücklich er sei, daß sie die Seine geworden. Er erzählte, wie er wirklich eine Schülerneigung zu ihr gehabt hatte, als er ihr damals Blumen und Konfekt gebracht; er gestand, daß er sie dann vergessen hatte, und er drückte mit einfachen Worten das Glück aus, das ihm geworden sei, sie jetzt wiederzufinden.
Ein paarmal kam es ihm auf die Lippen von seiner Vergangenheit zu sprechen, ihr zu sagen, daß mehrfach Frauen sein Herz erobert hatten. Es war ihm, als müsse er das von seiner Seele herunterhaben, erst dann würde sie ihm ganz angehören. Er wollte es nicht machen wie andere, daß die Frau denken solle, sie schlösse einen reinen Engel in ihre Arme! Nein, sie sollte alles wissen, daß er vor keinem Zufallswort zu zittern hätte und es nie eine Frage gäbe.
Er wollte ihr sagen, ich habe die und die gekannt, aber du vergibst mir, du mußt mir vergeben, du hast mir schon vergeben! Das werden sie alle so machen, und deswegen habe ich dich nicht hintergangen, denn hier in Paris wirst du einen Mann, der keine gekannt hat, nicht finden. Wenn du wissen willst, wer es war, will ich dir sogar die Namen nennen. Ich kann es ruhig, denn das liegt wirklich hinter mir, keine Bande ketten mich an die Vergangenheit. Es ist alles aus und nie wieder kann es beginnen. Ein neues Leben hat angefangen, das Leben mit dir, mit meiner kleinen Frau, und du sollst mir gehören, bis uns beide einmal der Allmächtige auseinanderreißt, der die Augen zudrückt und die Hände erkalten läßt und das Herz anhält.
Er kämpfte mit sich, sollte er es ihr jetzt sagen? Sollte er nicht lieber warten?
Nein, heute wollte er sein Glück genießen, denn er wußte ja nicht, wie solche Eröffnungen auf die weltfremde junge Frau wirken würden. Davon zu sprechen war noch Zeit. Es mußte ihr allmählich beigebracht werden auf dieser Reise nach dem Süden. Gerade in Nizza, in Cannes, in Monte Carlo würde sie so viel Neues sehen und erleben, daß er sie ganz allmählich einführen und aufklären konnte. Für heute wies er diese Gedanken ab. Es war ihm genug, daß er die feste Absicht hatte, Denise einmal alles zu sagen, weswegen vielleicht seine Freunde, René an der Spitze, ihn sogar ausgelacht hätten.
Darum schloß er wieder seine kleine Frau in die Arme, und das alte Spiel begann, daß er ihre Finger küßte, ihre Wangen, ihre Stirn, ihre Augen, ihren Mund.
KAPITEL 3
Inhaltsverzeichnis
Den Tag darauf kam das junge Paar in Nizza an. Sie hatten es gut getroffen, es war herrliches Wetter; ein blauer Himmel spannte sich über dem blauen Meer, in den Gärten lebte alles von immergrünen Pflanzen, von Blumen und Büschen und Bäumen des Südens, denn hier begann bereits der Frühling einzuziehen.
Es duftete in dem Vorgarten des an der Promenade des Anglais gelegenen Hotels, wie in Paris zu dieser Zeit nur auf den kleinen Karren der Blumenverkäufer, die, ihre Ware anpreisend, durch die Straße zogen.
Denise schlug, als sie am Morgen die Fensterläden öffnete, vor Freude die Hände zusammen:
»Mein Gott, das Meer!«
Das Meer hatte sie noch nie erblickt; und nun konnte sie die Augen nicht davon wenden, sie sah immer die klaren Wellen anlaufen, die langen weißen Linien, Kämme und überhängenden Spitzen sich von der großen blauen Fläche abzeichnen, und sie rief einmal über das andere: »Robert, sieh nur, das läuft ja immer fort! Das hört ja gar nicht auf! Wo kommt denn das her?«
Ihm, der in Trouville, in Biarritz so oft viele Sommerwochen verbummelt hatte, machte die kindliche Freude seiner jungen Frau Spaß, als ob er das alles selbst auch noch nie gesehen hätte.
Bald darauf standen sie auf der Straße, er nahm ihren Arm, preßte ihn, und verliebt sahen sich die beiden an. Nur ab und zu, wenn sie in die Nähe von Menschen kamen, von denen sie das Gefühl hatten, es könnten vielleicht Bekannte sein, ließ er sie los und dann schritten sie ernst und würdig nebeneinander her.
Plötzlich blickte die kleine Frau ihn groß an:
»Denke dir, Robert, nun sind wir schon zwei Tage verheiratet!«
Er rechnete die Stunden zusammen und bestritt, daß es bereits genau zwei Tage wären, aber da sagte sie mit einem schmollenden Mündchen:
»Ach, Robert, du mußt nicht so pedantisch sein!«
Ohne daß er wußte, wie es kam, antwortete er:
»Ich bin nie pedantisch gewesen, ich habe leider nicht alles sehr genau genommen!«
Sie blickte ihn einen Moment erschrocken an, dann aber lachte sie wieder, und der Gedanke huschte vorbei.
Ihm aber kam die Erinnerung an das, was er ihr beichten wollte. Das war ja eben ein erster Ansatz dazu gewesen. Doch er schob es abermals von sich, wenn es ihn auch quälte, denn trotz seines jahrelangen Leichtsinns in Paris war er wirklich ein wenig pedantisch.
Da ihm die Republik ohne Verleugnung seiner Familientradition und seiner Anschauungen keine Möglichkeit zum Arbeiten bot, da er in die Armee nicht hatte eintreten wollen, und an seinem Gut nicht viel zu bewirtschaften war, außerdem sein Haupteinkommen aus den Zinsen seines Vermögens bestand, hatten ihn Tatenlosigkeit und Mangel an Beschäftigung in Paris zum Bummeln getrieben. Die Freunde hatten ihn oft Spaßes halber den Philosophen genannt, denn manchmal, wenn sie im Café de Paris mit irgendeiner Schauspielerin, einer Tänzerin, einer Dame saßen, deren Neigung nur durch die ihr gebotene Möglichkeit, glänzend zu leben, zu erobern war, hatte er seine düstern Stunden gehabt, begann Gespräche über die Nichtigkeit des Daseins, so daß einmal die schöne Alice Colombier von den Bouffes, die solche philosophischen Anwandlungen gar nicht liebte, die immer nur lachen und sich unterhalten wollte, etwas mißvergnügt zu den andern Herren gesagt hatte:
»Ich glaube, Herr de la Caille wird noch einmal in ein Kloster gehen!«
Aber alle diese Gedanken, die nur flüchtig aufgetaucht waren, schwiegen jetzt wieder angesichts seines Glückes, als er auf der sonnebeschienenen Promenade des Anglais am Meere hinschritt.
Beide machten Beobachtungen über die ihnen begegnenden Menschen. Denises entschiedener klarer Verstand begann sich zu regen und kleine Funken zu sprühen in ihren Bemerkungen über die Vorübergehenden: diese Dame sah genau aus wie das Zebra im Jardin d'Acclimatation, jener Engländer hatte etwas von der Seerobbe, die sie dort in ihren spaßigen Wasserspielen bei der Fütterung oft beobachtet hatte. Und waren nicht die beiden kleinen Mädchen mit ihren großen Nasen, die für die Zukunft viel versprachen, die reinen Pfefferfresser? Der kleine Junge mit dem vorgeschobenen Mund, der zurücktretenden Stirn und den dichten schwarzen Locken, das war ja ein Pudel!
Jedesmal, wenn sie so etwas gesagt hatte, lachte Robert, und die Lust wandelte ihn an, seine kleine Frau an sich zu ziehen und ihr einen Kuß zu geben. Er tat es sogar, als sie in einen Hausflur getreten waren, da sich das Band ihres Schuhes gelöst hatte, und sie bot ihm ruhig die Lippen; dann sagte sie mit einer komischen Miene, daß es ihn überlief und er sich förmlich schüttelte vor Glück, vor einem Glück, das er nie in seinem Leben geahnt und nie für sich für möglich gehalten:
»Du, du, daß deine Lippen nur nicht wund werden!«
Dann bummelten sie weiter, blieben bei den Modistinnen stehen und vor allen Dingen bei den Juwelieren. Aber so schöne Sachen sie auch dort sahen, nie sprach sie davon anders, als daß sie – bei einem Ringe zum Beispiel, der in der Auslage auffiel – hinzufügte:
»Aber, Robert, meiner ist viel schöner!«
Dann streifte sie wieder den Handschuh ein Stück von der kleinen Hand, hielt sie gegen das Glas, und sie verglichen wie die Kinder, freuten sich, daß Denises Stein wirklich größer war oder mehr Feuer hatte. Er aber sagte:
»Wir finden alles, was wir haben, besser, denn wir sind glückliche Menschen!«
Denise blickte ihn an:
»Das muß man auch! Und es ist auch so!«
»Glaubst du wirklich?«
»Ja, denn es gibt keinen Mann in Paris, nein, was sage ich, in ganz Frankreich, überhaupt auf der ganzen Welt, der so ist wie mein Robert!«
Seine Augen glänzten:
»Meinst du das wirklich?«
Sie antwortete einfach:
»Sonst würde ich es doch nicht sagen!«
Während sie weitergingen, so ineinander vertieft, daß sie beinahe die Leute anrannten, und man dem Paar erstaunt nachsah, fragte er: »Hast du mich denn lieb, meine kleine Denise?«
Sie ließ ihn nicht mit den Augen los:
»Ich habe dich so furchtbar lieb, so, daß ich's nicht sagen kann! So, daß ich – ach, ich weiß es nicht, ich habe dich eben lieb!«
Sie frühstückten in ihrem Hotel an einem kleinen Tisch einander gegenüber. Zuerst war der Speisesaal leer, sie freuten sich dessen, so konnten sie sich besser unterhalten. Allmählich aber kamen Leute: Vater, Mutter, zwei kleine Mädchen und die Gouvernante; dann mehrere Herren, die sich eifrig unterhielten, einander Papiere herübergaben beim Essen, wobei der eine, wenn er las, jedesmal den Kneifer aufsetzte. Endlich ein junger Priester mit einem alten Ehepaar, ein moderner Priester mit reinlicher, gutgeschnittener Soutane, Seidenschärpe und untadeliger Wäsche.
Nun mußten sich Robert und Denise in acht nehmen mit ihrer Unterhaltung, aber das gab um so größeren Reiz. Sie flüsterten, und unausgesetzt, sobald der Kellner serviert hatte, hauchte Robert ihr allerlei Fragen zu, ob das Essen gut wäre, Bemerkungen über die Nachbarn, dazwischen plötzlich:
»Denise, du hast so schöne Augen!«
Oder:
»Wo hast du denn den kleinen Mund her?«
Sie lachte jedesmal und gab ihm unversehens, während sie tat, als wolle sie das Brot nehmen, einen Klaps auf die Hand.
»Was wollen wir heute nachmittag machen?« fragte er.
Ihr war alles gleich, wohin er sie brachte, sie sah ja doch nichts anderes als ihn. Er fragte:
»Wollen wir einen Wagen nehmen?«
Sie meinte nur:
»Mir ist alles recht!«
Aber sie waren müde, legten sich nachmittags ein wenig hin, und unversehens schliefen sie dabei ein, Hand in Hand. Sie fuhren gleichzeitig verstört auf: Um Gottes willen, es war schon fünf! Nun rieben sie sich die Augen, jetzt war es wohl zu spät, noch etwas zu unternehmen, denn trotz der Frühlingsluft begann gegen Abend doch die Kälte wahrnehmbar zu werden, und eine Wagenfahrt verlohnte sich nicht mehr. Da sagte er:
»Wir müßten mit der Bahn fahren!«
Aber sie hatte von der langen Reise von Paris her genug und wehrte erschrocken ab.
»Wir brauchen ja nicht weit zu fahren! Vielleicht nach Cannes? Oder willst du lieber hier bleiben?«
Da kam ihr plötzlich ein Gedanke: sie hatte soviel von Monte Carlo gehört, wohin sie, wenn sie vielleicht mit den Eltern eine Reise nach dem Süden gemacht hätte, als Mädchen nie hingekommen wäre, wenigstens nicht ins Kasino. Nun wollte sie in dem Vollgefühl, ihrer jungen Würde den Vorteil auskosten, den sie als Frau besaß; darum fragte sie mit leuchtenden Augen:
»Ist Monte Carlo weit?«
Er lachte:
»Nein, da können wir heute noch hinfahren!«
Sie hüpfte im Zimmer herum, klatschte in die Hände, wie ein kleines Mädchen und rief:
»Oh, das ist hübsch! Mein Robert, bist du gut! Wir fahren nach Monte Carlo, nicht wahr?«
Er freute sich, ihr einen Spaß machen zu können und antwortete sofort:
»Gut, ziehe ein schönes Kleid an. Pardon, ich habe ja nicht daran gedacht, daß du nur schöne Kleider hast! Also ziehe dich an, und wir fahren hin, denn so etwas hast du noch nie gesehen!«
Sie sah die Kleider durch, die sie mitgenommen hatte, und fragte ihren Mann, welches das geeignetste wäre. Er wählte schließlich ein helles, elegantes, womit er meinte, daß seine niedliche kleine Frau schon Figur machen würde.
Während sie sich anzog, fragte sie:
»Darf ich denn auch spielen?«
Er dachte an seine Vorsätze und sagte:
»Du, Denise, ja, ich nicht!«
»Du nicht?«
»Nein, denn ich habe schon genug Geld in meinem Leben verloren!«
Sie sah ihn von der Seite an und drohte scherzhaft mit dem Finger:
»Robert, du bist wohl sehr leichtsinnig gewesen?«
Er antwortete nur:
»Ich bin es nicht mehr!«
Nach einer Weile fragte sie:
»Wieviel darf ich denn setzen?«
Er zögerte und sagte dann:
»Ich will dir etwas sagen, Denise, wir sind nur einmal auf der Hochzeitsreise, du bekommst dazu hundert Franken, die kannst du verspielen, denn verlieren tust du sie doch.«
Sie war glücklich:
»O nein, paß nur auf, ich werde schon gewinnen! Du sollst mal staunen, ich habe solches Glück entwickelt, daß ich auch da Glück haben werde!«
Er hielt ihre beiden Hände, näherte sich ihrem Gesicht, blickte ihr in die Augen und fragte zärtlich:
»Wo hast du denn Glück gehabt?«
Sie sagte einfach:
»Daß ich dich gefunden habe!«
Und er küßte sie gerührt.
Eine Stunde darauf saßen sie im Zuge. Sie fuhren immer an der Küste hin, links türmten sich die Kreidefelsen, rechts unter dem Schienenstrange brauste das Meer, und ab und zu tauchten sie, Landzungen durchfahrend, in Tunnels. Während weiße Häuser und Villen, Blumengärten und Palmenhaine, Segelschiffe, Fischerboote und bei Beaulieu ein ganzes Panzergeschwader an ihnen vorüberhuschten, ging es Monte Carlo zu.
Sie stiegen die schöne Treppe hinauf, die zu den Anlagen um das Kasino führt. Eine Menge Ausflügler aus Nizza war mit ihnen gekommen, ein langer Zug, der dem Tempel des Mammons zustrebte.
Nun traten sie in die Palmenhaine mit ihrem exotischen Pflanzenwuchs, und dann sahen sie den Spielsaal vor sich liegen, mit seinen geschlossenen Fenstern, hinter denen die Spieltische standen, hinter denen man all das äußerlich ruhige, innerlich wild bewegte Leben der Spieler ahnte, die Vermögen hin- und herschoben, um sie schließlich doch alle in dem einen großen Schlund verschwinden zu lassen: der Bank.
Kurz ehe sie auf den Platz zwischen dem Café und dem Kasino traten, auf dem Bonnen, Kinder, dienstfreie Croupiers, an Geldbeutel wie Nerven ermüdete Spieler, Lungenkranke, elegante Damen, große wie kleine Halbweltlerinnen saßen, Wagen auf Wagen an der Bank vorfuhren, immer neue Besucher bringend, nahm Robert hundert Franken aus der Brieftasche und steckte sie seiner kleinen Frau zu:
»Denise, mehr bekommst du nicht, das ist für unsere Verhältnisse genug.«
Und er dachte sich im stillen: »Ich bin jahrelang unvernünftig gewesen, jetzt steure ich den neuen Kurs; die Vernunft fängt an.«
Aber erst wollten sie essen, und sie traten in das gegenüberliegende Café de Paris. Als sie einander gegenübersaßen, beide im Gesellschaftsanzug – denn er hatte den Frack unter dem Überzieher zur Fahrt angelegt –, sagte er mit einem zärtlichen Blick zu seiner kleinen Frau: »Denise, nun sollst du mal gut essen!«
Er stellte sorgsam mit Hilfe des Kellners eine Speisenfolge zusammen, und unwillkürlich geschah es, daß in dem eleganten Raum bei dem übereleganten Publikum, dem es auf ein Zwanzigfrankenstück so wenig ankam wie anderen vielleicht auf einen Sou, das Menü etwas teuer ward, aber es ward gut.
Denise hätte er alles vorsetzen können; sie war wenig wählerisch im Essen. Bei den frommen Schwestern war sie nicht verwöhnt worden. Mit einem Teller Suppe und einem Stück Brot hätte sie vorlieb genommen. Sie hatte nicht einmal Zeit zum Essen, immer blickte sie ihrem Robert in die Augen, und der Kellner nahm ihr die Teller fort, fast ehe sie noch etwas angerührt hatte. Nur an ihrem Glase nippte sie ein paarmal.
Inzwischen hatte sich das Restaurant immer mehr gefüllt. Erstaunt blickte sich Denise um. Sie flüsterte ihrem Manne Bemerkungen zu über die Toiletten, die sie sah. Reiche, schicke Amerikanerinnen, schön gewachsene Engländerinnen, etwas sonderbar angezogen, Damen der Halbwelt in dekolletierten Kleidern, mit Schmuck behangen, traten mit Herren ein, die alle im Frack waren.
Das war ein Strahlen von Luxus und Eleganz rings an den Tischen, wie es Denise noch nie gesehen hatte. Es machte ihr Spaß, und mehrmals sagte sie zu ihrem Manne:
»Robert, das ist ja reizend hier!«
Er, der die Feste gefeiert, auch ohne daß sie fielen, ward angeregt durch den eleganten Rahmen, den er so oft in Paris in den großen Restaurants um sich gesehen hatte. So kam er in gehobene Stimmung, und als er zu seinem Kaffee einen Fine Champagne geleert hatte, erschien ihm alles leichter, und seine neuen, strengen Grundsätze waren ein wenig verflogen, so daß er plötzlich zu seiner Frau sagte:
»Denise, weißt du, wir gehören jetzt ganz zusammen, und ich muß alles tun, was du tust. Du darfst hundert Franken verspielen, also ich auch! Wenn wir das verloren haben, fahren wir nach Nizza zurück, dann hat die liebe Seele Ruh!«
Dabei nahm er aus seiner Brieftasche einen zweiten Hundertfrankenschein und steckte ihn in die Westentasche.
Sie bezahlten, dann gingen sie zur Bank hinüber. Sie gaben ihre Namen an, erhielten die Eintrittskarten und durchmaßen nebeneinander das Atrium. Ein paar Herren, die dort standen und eine Zigarette rauchten, starrten der jungen Frau nach, deren kleine Schleppe hinter ihr dreinrauschte, und die mit der Grazie, dem Liebreiz und dem natürlichen Anstand der jungen Französin hinschritt, als hätte sie nie anderes getan.
Als sie in die Spielsäle traten, blieben sie zuerst stehen und sahen sich um. Die Menschen drängten sich um die Tische, auf denen schon die Lampen brannten, an langen vergoldeten Ketten von der Decke niederhängend, mit Schirmen versehen, die ihr Licht nur auf das grüne Tuch warfen. Man hörte das Klimpern des Geldes, das Laufen der Kugel in der Roulette, das eintönige Rufen der Croupiers. Denise gab ihren ersten Eindruck wieder:
»Gott, ist das komisch!«
Robert war in guter Stimmung. Er rieb sich die Hände, zog sich die Manschetten etwas heraus, und in stolzer Haltung ging der große, schlanke, elegante Mann neben seiner kleinen Frau her, strich sich den Schnurrbart und fühlte sich so wohl, als wäre er zu Hause.
Sie blieben an einem Tisch stehen. Die junge Frau ließ sich erklären, wie man setzen müsse, und welche Gewinnmöglichkeiten es gäbe. Aber als Robert sie lachend aufforderte, sie möchte doch spielen, sagte, sie, indem sie ängstlich ihren zusammengefalteten Hundertfrankenschein zwischen den weißbehandschuhten Fingern festhielt:
»Nein, nein, erst muß ich's lernen!« Er lachte:
»Da ist doch nichts zu lernen!«
Aber sie setzte eine wichtige Miene auf:
»Doch, ich weiß ja nicht, wie die Geschichte ist!«
Sie gingen also weiter, blieben wieder an einem Tische stehen, durchmaßen alle Räume und traten endlich in die Trente-et-Quarante-Säle. Für die kleine Frau wieder etwas Neues, und abermals erklärte ihr Robert die Spielweise mit halblauter Stimme, indem er sich zu ihr niederbeugte und ihr ins Ohr flüsterte.