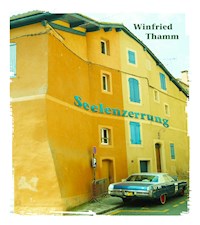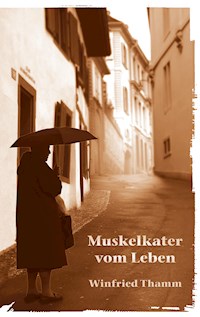Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OCM
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
26 Erzählungen, die eines gemeinsam haben – die Distanz. Die Distanz zwischen Generationen. Die Distanz zwischen früher und heute. Die Distanz zwischen Kulturen. Die Distanz zwischen Erlebtem und den Gefühlen. Die Geschichten erzählen von alltäglichen Erfahrungen, von persönlichen Erinnerungen und von Gedanken zu Themen, die uns bewegen. Immer nah dran, immer ehrlich, immer den Menschen im Blick. All die Entfernungen sind fragil, höchst empfindlich und leicht brennbar. Die Entfernung eben, die aber keine Sicherheit verspricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Auflage November 2023
©2023 OCM GmbH, Dortmund
Gestaltung, Satz und Herstellung: OCM GmbH, Dortmund
Verlag:OCM GmbH, Dortmund, www.ocm-verlag.de
ISBN 978-3-949902-14-7
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über portal.dnb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages.
Aus unsichererEntfernung
Winfried Thamm
Für Wolfgang Salz,einen engen Freund über Jahrzehnte undeinen klugen Berater bei meinen Geschichten,der zu früh gestorben ist.
Inhalt
Kurze Nachricht, ohne Bild
Nur die Hortensien scheinen zu lächeln
Das Monster-Molekül
Feuerwasser und Friedenspfeife
Spaziergang eines Misanthropen
Logorrhö oder von der Inkontinenz der Sprache
Lehrerkonferenz
Bettentunnel
Wenn ich nachts nicht schlafen kann
Anstand steht an
Wie aus einem toten Tümpel ein Meer wird
Nachtgespräch mit einem Klavier
Moderne Zeiten
Die Bürgerwehr
Die Entscheidung
Irgendwie ging’s
Einundzwanzig Gramm
Das Ende der Welt
Der Misanthrop am Strand
Kleines Desaster
Paradies
Vom Tag zum Abend in die Nacht
Der Verlierer
Faszination Marokko
Aus unsicherer Entfernung
Dafür schreibe ich
Der Autor
Der Verlag
Orientierungsmarken
Cover
Impressum
Inhaltsübersicht
Textanfang
Kurze Nachricht, ohne Bild
Bei einem Unfall in den frühen Morgenstunden auf der A 52 auf Höhe der Ausfahrt Essen-Kettwig wurde ein dreijähriger Mercedes Benz, mit Namen Maybach, tödlich verletzt.
Er erlitt schwere Frakturen an Achsen und Holmen und irreparable Hämatome an Motorblock und Antriebswelle. Er starb auf dem Weg in die nahegelegene Vertragswerkstatt am hohen Verlust von Bremsflüssigkeit und Treibstoff. Die trauernde S-Klasse des Stammwerkes bei Stuttgart säumte den Straßenrand zum Werksgelände mit Lichterketten aus Zündkerzen.
Bei diesem Unfall wurde auch ein Mensch schwer beschädigt. Sieben Liter Blut liefen aus und gelangten in die Kanalisation. Umweltbehörden warnen vor Hepatitis- und HIV-Infektionen. Die Versicherung spricht von einem Human-Totalschaden in Höhe von 36 Euro 82.
Nur die Hortensien scheinen zu lächeln
Mit Blick von der großen Terrasse, mit den blühenden Sträuchern in den schweren Terracotta-Kübeln, weiter hinten der rote Zierahorn, japanisch filigran, daneben die dunklen Zypressen, der Rhododendron-Blütenberg, genieße ich die Schönheit meines Gartens. Alles übergossen mit Frühlingssonnenlicht, auch das üppige Tal im Hintergrund. Nicht zu übersehen die dicken Dolden der schweren Hortensienblüten. In violettem Blau stehen sie in praller Pracht und zugleich in morbider Blässe an den Rändern, als hätten sie die Zeichen der Vergänglichkeit in ihren Genen, wie wonneproppige Kinder mit Greisengesichtern. Carpe diem, memento mori. Das barocke Lebensgefühl. So sitze ich in dieser Idylle und lese meine schlaue Wochenzeitung.
In wohlgesetzten Worten, zu Sätzen gekettelt, stilvoll, intellektuell, studiere ich die dringenden Appelle, die flehenden Beschwörungen und herzergreifenden Bitten der renommiertesten Wissenschaftler der Welt an die Politik, an die globale Gesellschaft, an uns:
‚Seht, versteht, handelt! Und zwar schnell und radikal, sonst löschen wir uns selber aus, wir, uns Menschen!‘
Ja, es geht um die Klimakatastrophe, um die Erderwärmung, das Insekten- und überhaupt Artensterben, die schwimmenden Plastikmüllteppiche, die Abschmelzung der Pole, die wachsenden Wüsten und ertrinkenden Inseln, die Tornados, Tsunamis, die Überschwemmungen, Waldbrände gigantischen Ausmaßes und Völkerwanderungen von Millionen und Abermillionen von Klimaflüchtlingen.
Und wenn ich in meiner heimeligen Idylle der von Landschafsgärtnern geschaffenen Blütenblätterwelt, einen perfekten Cappuccino auf dem Teakholz-Gartentisch, so etwas lese, in stilvollen Formulierungen, mit Verweisen auf Historiker und Philosophen, dann … ja, dann fühle ich mich so kosmopolit, so menschheitlich, so mittendrin in der Geschichte unserer Spezies, so berührt davon, so betroffen, ja, aber auch so … erhaben.
Und sofort schäme ich mich dafür. Das geht doch nicht!
Ich lege die schlaue Zeitung weg und greife zu Stift und Kladde.
‚Es gibt ein globales, psychologisches Phänomen‘, schreibe ich. ‚Man geht nicht ins kalte Wasser, wenn man nicht muss. Es sei denn, man wird geschubst. Man geht nicht zum Arzt, wenn nichts weh tut. Man klammert sich an das, was man hat, auch wider jegliche Vernunft. Anzunehmen, der Mensch sei ein vernunftgesteuertes Wesen, ist der älteste Witz seit der Aufklärung. Man entscheidet sich gerne dafür, andere entscheiden zu lassen. Dann hat man wenigstens einen triftigen Grund dagegen zu meckern. Und wenn kein anderer entscheidet, ist auch gut, dann bleibt es eben so, wie es ist. Veränderung ist ja immer gefährlich, oder zumindest unbequem. Für all das gibt es ein Wort: Verdrängung.‘
Ich lege meine Kladde weg. Wozu schreibe ich das auf? Für die Nachwelt? Gelächter! Der Kaffee ist kalt, schmeckt bitter.
Als wir, unsere Generation, unsere Eltern gefragt haben, warum sie nichts getan haben, damals gegen das NS-Terror-Regime, kamen Antworten, wie: „Wir haben nicht geglaubt, dass die wirklich drankämen, uns nicht vorstellen können, wie böse die werden würden.“ Viele Juden wurden ermordet, weil sie dachten, das wird schlimm, aber nicht so schlimm, wie es dann wirklich wurde.
Wolken in Dunkelgrau verschlucken das Sonnenlicht und ziehen die Farben aus der Welt. Den Hortensien scheint das zu gefallen, so farben-kräftig werfen sie sich in die Blütenbrust.
Muss ich mir bald diese Frage von meinem Sohn gefallen lassen? „Seit den frühen neunziger Jahren ist das Phänomen der Klimaerwärmung und ihre Folgen von der Wissenschaft nachgewiesen und durch eine Unmenge von Publikationen veröffentlicht worden. Warum habt ihr nichts getan?“
Dann werde ich sagen: „Wir haben doch Müll getrennt; gelbe, blaue, braune Tonne. Wir haben weniger Plastiktüten benutzt, Elektroschrott und Kühlschränke, Farben, Lacke und Öle auf Sondermülldeponien gebracht und keine Q-Tips aus Plastik mehr gekauft. Wir sind sogar auf Demos gegangen, gegen AKW und sauren Regen. Hatte AKW-nee!- und Baum-ab-nein-danke-Aufkleber auf meinem Gitarrenkoffer.“ Das werde ich sagen, mit schamrotem Gesicht.
Ich schaue mich in meinem so üppigen Garten um: Bald sind wir nicht mehr, aber all das hier wächst weiter, breitet sich aus, holt sich zurück, was wir ihr gestohlen haben, der Natur. Während das Eis schmilzt, die Eisbären ertrinken, die Pinguine an Hitzschlag sterben, die Rinder auf den überfluteten Weiden ersaufen, macht das Kabarett Witze darüber, quält Heidi K. die nächste Riege junger storchenbeiniger Model-Mädels und sucht Bauer weiterhin Frau.
Wir kommen nicht vorbei, an der Frage nach der Schuld. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie: Alle! Ja, wir alle tragen die Schuld daran. Und komme mir jetzt ja keiner mit Ausflüchten: „Wir konnten ja nicht wissen, dass … die U.S.A. haben ja auch nicht … die Chinesen sowieso nicht … und die Schwellenländer, besonders jetzt Brasilien und Indien … der Regenwald … McDonald’s …! Auf der letzten Klimakonferenz hat man beschlossen, dass … wenn wir alle zusammen, also global … dann könnten wir … Aber wir tun es nicht!“
Lasst uns wenigstens diese Erkenntnis gemeinsam betrachten, dieses Geständnis gemeinsam ablegen und diesen letzten Rest von eigener Ehrlichkeit bewahren. Wenn sonst schon nichts mehr zu bewahren da ist, bald: Es ist fünf nach zwölf. Der Zug ist abgefahren. Weg. Es kommt keiner mehr, war der letzte.
Die Sonne ist verschwunden. Wolken türmen sich schwarz auf zur drohenden Himmelsbrandung. Ich packe schnell meine Sieben Sachen zusammen und flüchte ins Haus. Mächtige Sturmböen fegen die filigranen japanischen Ahornbäumchen samt ihrer Terrakottatöpfe von der Terrasse in die Rabatte. Tischtennisgroße Hagelkörner knallen Dellen in das teure Gartenmobiliar und zerfetzen die gesamte Gartenblütenpracht binnen Minuten.
Nur die Hortensien scheinen zu lächeln, auch ohne Blütenblätter.
Das Monster-Molekül
Ich war noch nie gut in Chemie, deswegen ist meine Vorstellung von der Verbindung chemischer Elemente eher naiv:
Wie entsteht ein Molekül? Zwei Atome treffen zufällig aufeinander, wie zwei Menschen in der Kneipe oder wie zwei Autos auf der Kreuzung, und verbinden sich zu einem Molekül. Also: Entweder wird’s ein geselliger Abend oder ein Verkehrsunfall mit Todesfolge.
Was meinen Fall angeht, entspricht das eher dem zweiten Beispiel, also einer Katastrophe.
Das erste meiner beiden Atome – um im Bild zu bleiben – ist eine Nachricht, die ich im Radio auf der Fahrt zur Arbeit gehört habe. Die laienhafte Zusammenfassung dieser Nachricht lautet: Die Wissenschaft hat nachgewiesen, dass sich traumatische Erfahrungen und deren Auswirkungen auf die Psyche im genetischen Material einnisten und sich durch hinterlistige Vererbung über die nächste Generation hermachen; bei Mäusen, bisher. Also: Eine durch Bedrohung, Krieg, Folter oder physische wie psychische Gewalt traumatisierte Maus bekommt Mäusekinder, die ähnliche Verhaltensweisen, also Angstneurosen, Panikattacken, Depressionen oder suizidale Tendenzen zeigen wie ihre Eltern, obwohl sie selbst nie so ein Trauma erlebt haben. Sie sagen: „Ach, das sind ja nur Mäuse. Die haben ja auch Angst vor Katzen. Ich nicht.“ Darauf kann ich nur antworten: „Löwen und Tiger sind auch Katzen.“ Und mal nebenbei: Mäuse sind bekannterweise Säugetiere, die sich in ihrem Erbgut nicht sonderlich von den Menschen unterscheiden. In einem Spiegel-online-Artikel heißt es: Zwischen dem Erbgut von Mensch und Maus besteht, wie eine Analyse des Mäuse-Chromosoms 16 zeigt, offenbar kaum ein Unterschied. Vom Nager trennen uns demnach nicht einmal drei Prozent der Gene. Sehen Sie?!
Nennen wir also mein erstes Horror-Atom, in Abwandlung des Begriffes Erbgut, das „Erbpech-Atom“.
Das zweite Atom überrollte mich nicht so plötzlich und unvorbereitet wie das erste. Es gründet sich auch nicht auf eine punktuelle Information von außen, sondern basiert eher auf einer Reihe von Selbstbeobachtungen über einen längeren Zeitraum, zeigt ähnliche Auffälligkeiten in unregelmäßigen Abständen, die ich an mir selbst wahrgenommen habe und so zusammenfassen kann:
Ich werde, ich handle, ich verhalte mich, ich bin selten, hier und da, manchmal, gelegentlich, vielleicht schon häufiger, immer öfter WIE MEIN VATER!!! Oh Gott!
Und was fällt mir auf, wenn ich denke, ich bin schon bald genauso wie mein Vater? Welche Eigenschaften, Charakterzüge und Haltungen meine ich?
Ja, hier und da gibt es Ansätze von Kleinigkeitskrämerei, Pedanterie oder Rechthaberei. Manchmal wäre ich gerne ein Dorfpolizist mit einem dicken Knöllchenblock. Sporadischer Missmut zeigt sich, misanthropische Ansätze, der Drang zur harschen Kritik mit gleichzeitiger Hochsensibilität der eigenen Person, gelegentliche rationale Furcht, z. B. vor allgemeinen Verrohungstendenzen in der Gesellschaft, und irrationale Ängste, Einsamkeitsgefühle, die Empfindung einer gewissen Abstumpfung und Leere, schließlich der latente Verlust der Lebensfreude. Und für diesen Cocktail aus psychischem Erdrutsch und existentiellem Absturz habe ich vor kurzem in dem Roman ‚Die Korrekturen‘ von J. Franzen noch den passenden Begriff gelesen. Ich habe ihn sofort gegoogelt und es gibt ihn wirklich: ‚Anhedonie‘, der Verlust der Lebensfreude. Ich sollte keine Romane mehr lesen. Sie werden eh kulturell überbewertet. Eine ordentliche Fußballzeitung tut’s auch. Oder für die Kultur einmal im Monat der Playboy.
Das ist also das zweite, wir nennen es ‚Anhedonie-Atom‘.
So! Mein ‚Erbpech-Atom‘ trifft rein zufällig oder gezielt – das Ergebnis ist das gleiche – auf mein ‚Anhedonie-Atom‘ und sie vereinigen sich zu meinem persönlichen ‚Monster-Molekül‘, als hätten sie ihr ganzes Leben aufeinander gewartet. Sie passen zueinander wie Mönch und Nonne, wie Bonnie & Clyde, wie Fred und Ginger, wie Dick und Doof.
Die durch meinen Vater vererbten Traumata-Auswirkungen verbinden sich großartig und völlig logisch mit den oben beschriebenen Beobachtungen meiner Verhaltenstendenzen, die ich eben auch meinem Vater zuschreibe. Der Kreis schließt sich. Die Katze beißt sich in den Schwanz, das Hamsterrad ist angeworfen, der Nachtschlaf verabschiedet sich für immer, der Wahnsinn guckt durchs Küchenfenster. Da haben wir den Salat!
Wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Wo ist der Notausgang? Kann ich jemanden anrufen, der mich abholt? Nein, nicht die Männer mit der weißen Jacke und den langen Ärmeln. Psychiatrie, verlass mich nie?! Was bleibt mir noch?
Geht meine Ehe jetzt baden oder ist sie schon lange passé und ich habe es nur noch nicht gemerkt? Wohin führen mich diese Gedanken, wenn nicht in die Gummizelle? Auf die nächste Brücke? Vor den nächsten Zug? Wo ist der Schalter: NOTAUS?
Ja!
Genau!
Da!
Schalter umlegen!
Durchatmen!
Abstand!
Achtsamkeit!
Positives Denken verzaubert!
Ich habe gestern noch gelacht. Ach!
Vorgestern waren Freunde zum Essen bei uns. Es war ein schöner Abend. Wir hatten viel Spaß, sprachen über unsere Kinder und unsere Arbeit, hörten uns zu. Äußerten unsere Sorgen um die Welt, beschrieben unsere Pläne, lachten über Kurioses, verabschiedeten uns mit der Freude auf das nächste Wiedersehen. Wie geht das, mit ‚Monster-Molekülen‘ im Kopf?
Welche guten Seiten hatte eigentlich mein Vater? Na ja.
Und dann wäre da ja noch meine Mutter. Oh Gott!
Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Hoffe, dass es nicht die Scheinwerfer der heranrasenden Lokomotive sind.
Feuerwasser und Friedenspfeife
Es gibt viel zu tun, nichts Wichtiges. Zerstreut und fahrig laufe ich schon wieder durch die Innenstadt. Vorgestern genauso: Rosenmontag, nachmittags, leere Straßen, hier und da bunte Betrunkene, Mallorcaschlager aus Boxentürmen, schwarz und hochkant wie Vampirsärge. Nichts erledigt, nichts erreicht, nichts gewollt. Nur ziellos durch die Gegend gestreift.
Heute beim Ordnungsamt den Zweitschlüssel abgegeben, von der Wohnung meines Freundes, der ordentlich beerdigt wird vom Ordnungsamt. Ohne Termin, ohne Trauerfeier. So ordentlich, dass ich ihn nicht wiederfinde auf dem anonymen Gräberfeld. Wie ein Soldatenfriedhof.
Wie ein Soldat im Kampf gegen den Krebs gefallen. Er hat seinen Krieg verloren. Die letzte Schlacht ist geschlagen. Der Todfeind hat gesiegt: Krebs, Metastasen von der Lunge ins Gehirn. ‚Aussiedlung‘ hat der Arzt es genannt. Schönes Wort, so harmlos. Ich habe einmal ‚Aussiedler‘ unterrichtet, aus Polen, Deutsch als Fremdsprache, fünfundzwanzig nette kleine Krebsgeschwüre. Werd’ bloß nicht zynisch, denk ich mir. Auch egal.
Weinen macht frei. Ja, am Todestag, als wir an seinem Bett standen, ihn scheu ein letztes Mal berührten. Die wächserne Haut war noch warm, anfangs weinten wir und setzten uns zu ihm, hüllten uns in Geschichten über ihn und uns und damals und es tat gut. Tränen sind gut gegen hölzerne Herzen. Sie machen sie geschmeidig für das Weiterleben.
Es gibt keine Bestattung, der man beiwohnen könnte. Sagte ich schon. Die letzten Mohikaner deines zersprengten Freundesstammes treffen sich privat auf einen Schluck Feuerwasser und eine Friedenspfeife. Deine Ewigen Jagdgründe sind unsere Erinnerungen an dich, mein Freund.
Draußen ist es kalt, immer noch, sehne mich nach Frühlingslüften und Blütendüften. Doch die Sonne scheint mir jetzt durchs Café-Fenster aufs Papier. Schreiben ist Trost. Endlich wieder Sonne, nach dieser lichtlosen Zeit.
Es wird schon wieder, das mit der Lebensfreude. Trauer lässt sich ungern zur Eile antreiben. Es wird schon wieder, solange ich nicht so einsam werde wie du es warst, mein Freund.
Spaziergang eines Misanthropen
Langsam kommt die Sonne durch. Auch das noch. Hab mich zu ’nem Spaziergang aufgerafft, an der Ruhr entlang, von der Ruhrallee bis Steele. Muss auch noch zurück, den ganzen Weg.
Das Grün ist ausgebrochen, aus dem Winterknast und hält die Bäume und Sträucher besetzt. Blüht noch nix. Gottseidank. Immer diese Knallfarben, wenn’s blüht. Kriegste Augenkrebs von. „Das Grün bricht aus den Zweigen …“ Wolf Biermann, alter Jammerlappen, lange her, fand ich mal gut, früher, na ja. „Das Grün facettiert in allen Varianten“. Hab’ ich neulich mal gelesen. Da hat sich einer aber einen hin und weg formuliert. Dichter eben. Klingt so ’n bisschen nach Verbal-Verstopfung. Vielleicht les’ ich besser nix mehr. Mal gucken.
Treffe kaum Menschen. Gut so.
Anders in Steele. Grober Fehler, Kaiser-Otto-Platz voll. Fressbuden, Autoscooter, Stände mit Billigware, vom Laster gefallen. Fünf Meter weiter: zwei Polizisten. Lassen sich nagelneues Werkzeug schenken. Spaten für’n Garten und so. Hör mir doch auf. Erzähl mir doch nix vom Leben. Ach komm, ist doch überall so!
Die fettigen Dünste und neonbunten Klamotten locken sie nach draußen, die Gelangweilten und Abgestumpften, die Neugierigen und Gierigen. Wie die Fliegen auf’m Pferdeappel kleben sie auf dem Platz, eng aneinandergedrängt, verschwitzt, strengsäuerlich müffelnd. Kein Deo der Welt gewinnt gegen zwei Wochen alte Schweißränder.
Gibt’s hier was umsonst? Nee! Kauft den Schrott, verschlingt die matschigen Pommes, beißt in die fetttriefenden Bratwürste, setzt eure schreienden Bälger in die Karussell-Raketen und schießt sie auf den Mond. Ach, wär’ das schön. Kein Kindergeschrei mehr. Und wenn man dann noch diese dickbäuchigen, blassbeinigen und rotgesichtigen Hässlichkeiten von Eltern mit den aufgequollenen Froschaugengesichtern in eine sich auftuende Erdspalte schubsen könnte, wäre ich dabei, Hand anzulegen. (Mann, war das ’n Satz!) Und tschüss. Dann wäre endlich Ruhe im Karton. Ach, was echauffiere ich mich. Auch so’n Wort. Großartig bekloppt. Chauffage central, weiß ich noch aus der Schule, heißt Zentralheizung und ist Französisch. Gut nee?!
Ich höre musikähnliche Geräusche, sehe einen Menschenpulk, meine verdammte Neugier treibt mich hin. Eine andere Art von Masochismus. Sie stehen vor einer Bühne, die Untoten, auf der sich zwei Gestalten bewegen. Zwei Männer in kurzen, knalligen Frauenkleidern staksen in Disco-Fox-Manier auf High-Heels, machen auf Mädels-Tanz im 2/4-Takt, singen schlecht, aber laut, irgendwas Atemloses durch die Nacht oder so von Helene Berg oder Andrea Fischer oder Fischers Fritze, der mit den frischen Fischen. Geil!
Grell, laut, steif. Die Lila-Laune-Lolitas bringen die Massen zum Toben. Sie lächeln sich an, selig, diese Geisterbahngestalten, diese Zombies. Alles klatscht, singt, wippt, tanzt mit. Die hässlichen Fratzen, von dümmlichem Grinsen verzerrt, starren mit ihren bierglasigen Fischaugen voller Bewunderung auf die schrillen Weibsmänner. Bei Männlein wie Weiblein kleben die geweckten Gelüste in ihren Billigunterhosen. Sie haben Spaß beim einfältigen Patschen ihrer unbeholfenen Flossen. Wie Seehunde. 4/4-Takt: Klatschen, ¾-Takt: Schunkeln. Das ist die deutsche Devise. Klappt immer. Ist genetisch verankert.
Ach, was reg ich mich auf.
Die Damen und Herren in ihren ach so modischen Steppjacken sehen aus, als kämen sie gerade von der Jahreshauptversammlung der Michelin-Männchen.
Können auch nix dafür. Sind eben so.
Ja, fair ist das nicht, ich weiß.
Aber wer ist schon fair?
Hör mir auf. Geh mir weg.
Halt’s nicht mehr aus. Ich flüchte. Finde ein kleines Café in einer Nebenstraße. Die Kellnerin ist keine Transe, hübsch statt grell, und freundlich. Der Salat ist ohne Dressing. Sie stellt Essig und Öl daneben. Kann der Koch wenigstens nix falsch machen. Gut so.
Langsam kommt die Sonne durch. Wird warm. Auch das noch. Scheiß Sonne.
Logorrhö oder von der Inkontinenz der Sprache
Es ist noch gar nicht spät am Abend, keine tiefe Nacht. Ich sitze hier auf dem weichen Sofa im weichen Licht der gelben Lampe und lese dieses Buch ‚Parlando‘, was ‚sprechend‘ bedeutet. Der Autor, Bodo Kirchhoff, schüttet einen Redeschwall nach dem anderen über mich aus. Es regnet Sprache wie aus Eimern. Und ich habe keinen Schirm. Selten ein Punkt, viele Kommata, keine Absätze, kein Absetzen der wörtlichen Rede durch Anführungszeichen, nur mitten im Satz diese Großbuchstaben. Eine verschriftete Art von Logorrhö, ‚krankhafter Redefluss‘ laut Lexikon, sondert er ab, die sich in all ihren Abschweifungen schließlich zu einer Geschichte entwickelt.
Diese Brandung, diese Flut von Worten erinnert mich an einen Menschen, der früher oft in meiner Stammkneipe saß. Ein Verrückter, der sich Dichter nannte und ‚Nietzsche‘ genannt wurde, in schwarzer Kleidung, mit schwarzem Hut, den er nie abnahm. Er kümmerte sich um andere noch Verrücktere, lebte mit ihnen in einer Wohnung zusammen und hatte ein Auge darauf, dass sie sich nicht aus den Augen verloren. Doch er war eigentlich der einzige, wirklich Verrückte unter ihnen. Bei den anderen war die Verrücktheit nur ein Symptom, das Symptom für Einsamkeit, die Krankheit mit der eiternden Seele, die zu sehr aus ihren Augen nässte, als dass sie noch einen Blick für die Welt besäßen. Er versorgte sie, die verletzten Seelen. So verband und betupfte er die Wunden, mit seinen Worten und Sätzen. Sie hatten keinen Zusammenhang, obwohl es Sätze waren, wohl formulierte Sätze in ausgesuchter Hochsprache. Ihre Schönheit war Pflaster und Verbandszeug für die klaffenden Seelen der Einsamen. Er formulierte so gesetzt und rhythmisch, so einfallsreich und genial, so tiefsinnig und gleichzeitig unsinnig, so absurd und doch so ehrlich. Er meinte, was er sagte, obwohl ihn niemand verstand. Er verstand, dass ihn niemand verstand und stand darüber. Seine Sprache hatte die Schönheit abstrakter Bilder, die vor formaler Ausgewogenheit und Harmonie, Intensität und Ehrlichkeit strahlen, weil sie sich von jeglichem Inhalt, jeglicher Aussage, jeglicher Botschaft befreit haben. Diese seine Sprache forderte nicht auf zur Befreiung, sie war Befreiung. Sie erreichte mit nichts anderem als mit ihrer Form den Zuhörer, machte ihn glücklich und frei, für Momente, ohne zu sagen, was Freiheit ist. Die geniale Form der absoluten Leere als Sinn des Lebens.
Seine kleine Schar der Verlorenen, seine lebenskranken Schützlinge liebten ihn für diese Inhaltslosigkeit. Sie fühlten sich verstanden, nicht ausgegrenzt durch den Stacheldraht des Mitleids und der Nachsicht. Der Verrückte, der Nietzsche genannt wurde, litt nicht an dieser Logorrhö, es war nur das Symptom seiner Verrücktheit, so wie die Verrücktheit nur ein Symptom der Lebenskranken, der Verlorenen, der Einsamen war.
Ich kannte nur einen Menschen, nur zufällig eine Frau, die ursächlich an dieser Krankheit des Redeflusses litt, und die war leider nicht verrückt. Sie hieß Marta.
Sie redete unaufhörlich, ohne Punkt und Komma, sogar beim Einatmen, und sagte gar nichts Verrücktes, sondern nur Alltägliches, meist völlig Uninteressantes. Sie ließ dem Zuhörer – von Gesprächspartner zu reden, wäre Zynismus – keine Zehntelsekunde einer Beteiligung, einer Chance, aus ihrem Monolog einen Dialog zu entwickeln. Das machte sie sehr einsam, obwohl sie immer unter Leuten lebte, in Kneipen, auf Feten, bei Ausstellungen, auf Konzerten. Ein vereinsamtes Herdentier, unter der Käseglocke der eigenen Geschwätzigkeit. Bei ihr war die Einsamkeit ein Symptom oder besser, eine Nebenwirkung dieser Logorrhö. Ein klassisches Beispiel dafür, dass Nebenwirkungen oft verheerender sind als die eigentliche Krankheit.
Nur bei der Liebe war Marta stumm, sagte mir einmal einer ihrer Liebhaber.
Ich war damals fasziniert von der Schönheit der sprachlichen Form des Verrückten, der sich Nietzsche nannte, der dabei so nah und so unschuldig ehrlich war, wie das erste Wort eines kleinen Kindes. Allein fehlte mir die Verständigung.
Die an Logorrhö erkrankte Marta bedauerte ich nur, sie litt an sprachlicher Schließmuskelschwäche. Sie konnte ihre Wörter nicht an sich halten, sie ließ sie unter sich gehen. Gäbe es doch Inkontinenzwindeln für Sprechblasenkranke.
Die sprachliche Form kann mich als Zuhörer begeistern oder abstoßen, an mir vorbeirauschen oder mich ganz gefangen nehmen durch Schönheit, Witz oder Genialität. Sie ist aber auch immer Ausdruck von Inhalten, es sei denn, wir reden über Dada. Und die Sprache will dosiert sein wie Medizin, denn die Dosis macht das Gift.
Lehrerkonferenz
Alle brabbeln durcheinander. Der Schulleiter schwingt die gediegene Messingglocke, ohne Wirkung, ohne Erfolg. Die lautstarke Bitte um Ruhe aus seiner heiseren Kehle verhallt ungehört. Ein engagierter Sportlehrer stößt kraftvoll in seine signalrote Trillerpfeife. Plötzlich Totenstille. Na also, geht doch. Nur im Innenohr bleibt ein hohes Sirren.
Der Schulleiter dankt dem sportlichen Kollegen durch ein zugewandtes Nicken und ergreift das Wort. Er verliest die Tagesordnung, spricht Formalien an, redet von Schulprogrammen und Leitbildern. Grummeln und Rumoren im Kollegium nehmen wieder zu. Der Schulleiter versucht es zu ignorieren, schaut beleidigt, macht weiter, kaum einer hört zu. Witze werden erzählt, hinter vorgehaltener Hand gegibbelt und gelacht.
Lehrer sind wie Schüler, nur ohne Perspektive.
Der Schulleiter schwingt die Glocke, die Ängstlichen legen verschämt die Hand auf den Mund, die Dreisten lachen nur umso lauter. Der Sportlehrer zeigt mit ausgestrecktem Arm seine alarmrote Trillerpfeife. Das reicht. Wieder kehrt Ruhe ein.
Meine Gedanken schweifen ab. Vor 23 Jahren habe ich hier angefangen. Da war die Schule noch nagelneu. Vor 20 Jahren, mein erster Theaterkurs in der Oberstufe. ‚Kasimir und Karoline‘ haben wir gespielt. Sie waren Feuer und Flamme, die jungen Leute. Haben das Publikum gerührt und mich berührt in ihrem unbeholfenen Bemühen um Glaubhaftigkeit. Sogar zum Walzertanzen habe ich sie gekriegt in ihren großen offenen Turnschuhen. War damals modern. Sie waren so glücklich bei der Verbeugung im tosenden Applaus des Publikums. Schön war’s.
„Welche Kolleginnen oder Kollegen möchten sich in der Arbeitsgruppe ‚Gesundes Mensa-Essen‘ engagieren. Die ewigen Pommes oder Nudeln müssen endlich mal ein Ende haben“, unterbricht der Schulleiter meine Erinnerungen. „Was anderes essen die Blagen doch heutzutage nicht mehr.“ „Hab’ ich da Blagen gehört?“ „Kommst du denen mit Salat, ist die Mensa leer.“ „Also, wer ist dabei?“
Ich mache mich klein, krame in der Tasche nach meinem Butterbrot.
Lehrer sind wie Schüler, nur feiger.