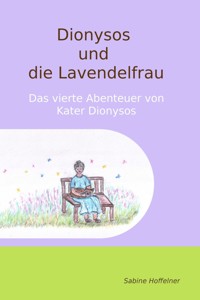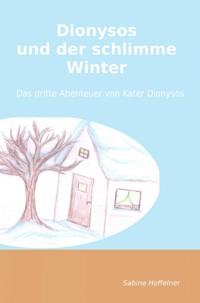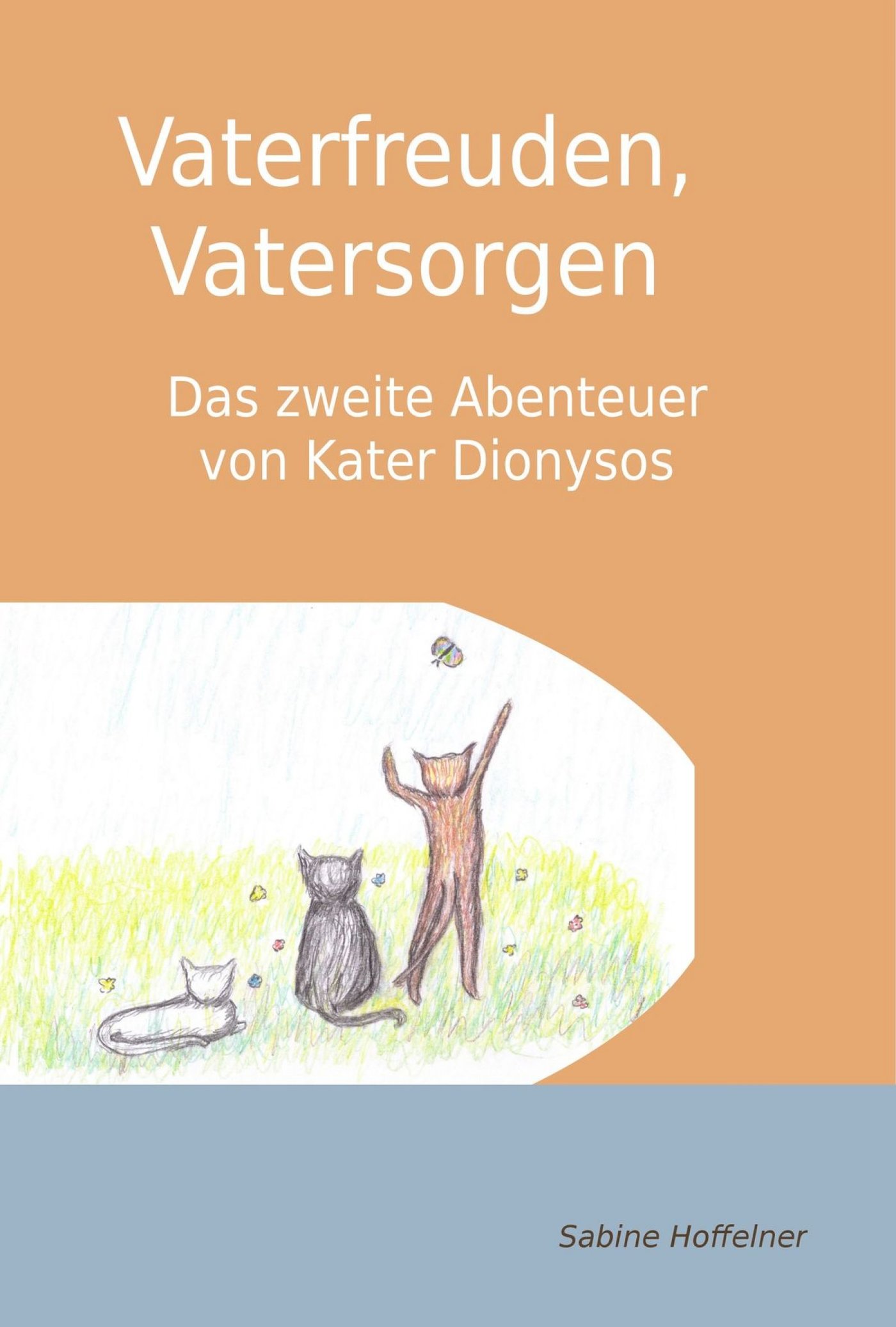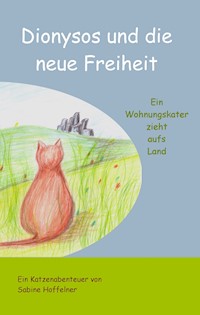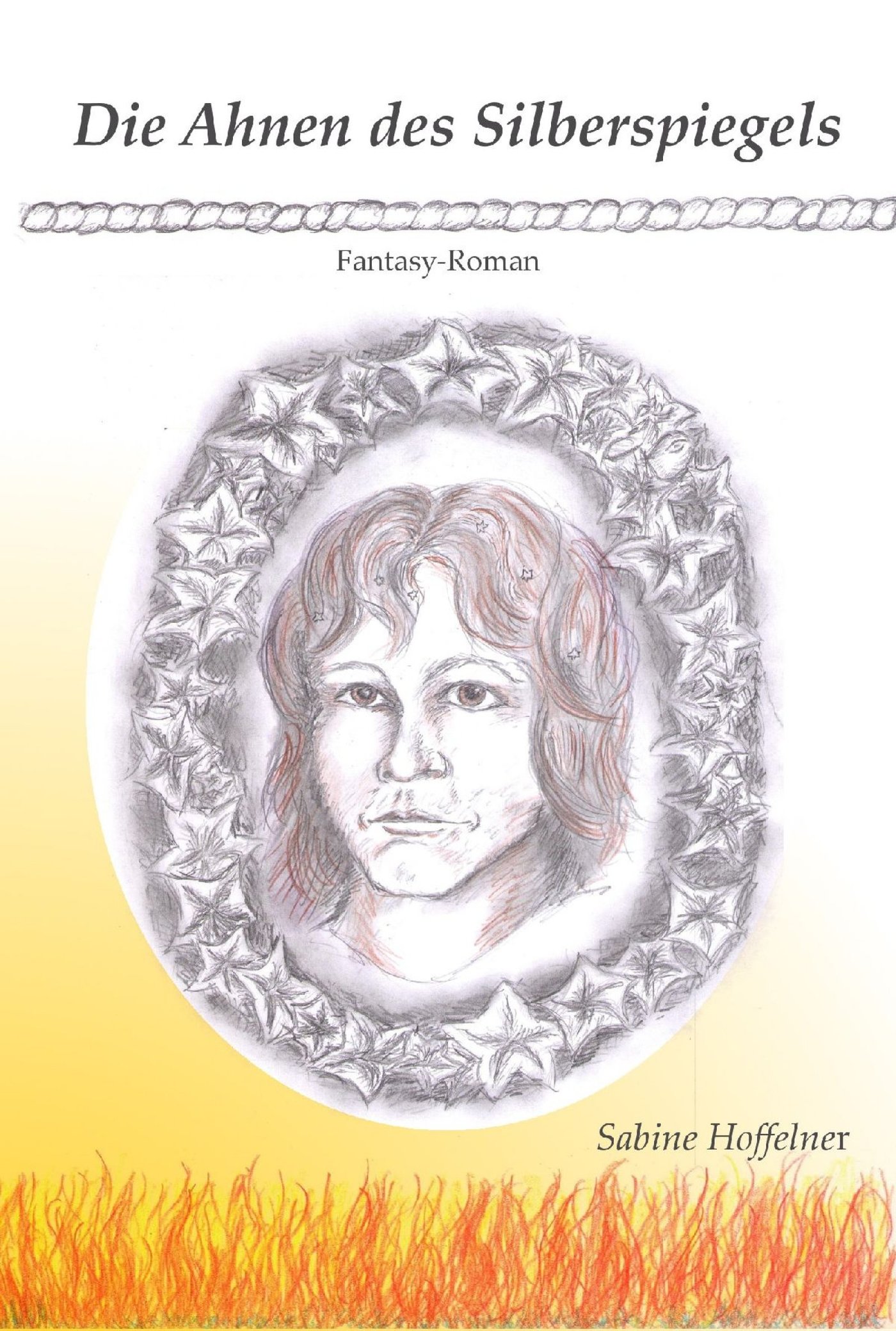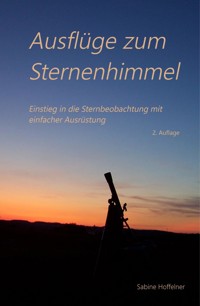
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch richtet sich an Menschen, die der Blick zum Nachthimmel fasziniert und die dort oben gern mehr entdecken möchten als bisher, ohne gleich in teuere Ausrüstung zu investieren. Der Mond, Planeten, Sternschnuppen, einige Doppelsterne, Veränderliche und Sternhaufen lassen sich schon mit einem Fernglas oder kleinen Amateur-Teleskop gut beobachten. Für manche Himmelserscheinungen reicht sogar das bloße Auge. Um den Einstieg in die Hobby-Astronomie zu erleichtern, soll dieses Büchlein einige grundlegende astronomische Zusammenhänge und Fachbegriffe erklären. Es enthält Tabellen von Objekten, die sich auch mit einfacher Ausrüstung gut beobachten lassen. Einige Sternkarten bieten einen Überblick, wo diese Objekte am Nachthimmel zu finden sind. Für die 2. Auflage wurde das Buch komplett überarbeitet und um einige Kapitel erweitert. Neu dazu kamen zum Beispiel Kapitel zur Himmelsmechanik, den Grundlagen zu Ferngläsern und Teleskopen und zum astronomischen Zeichnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ausflüge zum Sternenhimmel
Einstieg in die Sternbeobachtung mit einfacher Ausrüstung
2. Auflage
Von Sabine Hoffelner
2. Auflage 2023
Autorin: Sabine Hoffelner
Grafiken, Zeichnungen, Bilder (soweit nicht anders angegeben) und Covergestaltung: Sabine Hoffelner
Alle Rechte verbleiben bei der Autorin
Copyright © 2023 Sabine Hoffelner
Selbstverlag: Sabine Hoffelner; Schottenau 29 f; 85072 Eichstätt
Kontakt: [email protected]
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Bildnachweis:
„Der Mond in Öl“ im Kapitel „Der Mond“ von Karl-Heinz van Heek
Urheberrechtsnachweis Kapitel „Wissenswertes über Ferngläser“
Autor des Kapitels: Gerhard Schmitt
Urheberin der darin enthaltenen Grafiken: Sabine Hoffelner
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie
___________________________________
Danke
Ohne die geduldige und kompetente Unterstützung einiger sehr erfahrener Astronomen, denen ich Löcher in den Bauch fragen durfte, wäre diese Neuauflage niemals zustande gekommen. Deshalb möchte ich mich ganz herzlich für ihre Hilfe bei der Erstellung dieses Buches bedanken bei:
Gerhard Schmitt (der außerdem das Kapitel „Wissenswertes über Ferngläser“ spendiert hat)
Reinhard Lauterbach
Karl-Heinz van Heek (dessen Bild „Der Mond in Öl“ ich freundlicherweise für das Buch verwenden darf)
René Merting und Christopher Hay (den Autoren des wunderbaren Projekts „Beobachteratlas für Kurzentschlossene“, BAfK).
Dr. Hans Zekl
***
Ein weiteres großes Dankeschön geht an alle anderen Sterngucker, die mich während der letzten Jahre auf meinem Weg zur Astronomie begleitet haben.
___________________________________
Warum ich dieses Buch geschrieben habe
Schon im Altertum faszinierte der Sternenhimmel die Menschen. Gelehrte beobachteten die Gestirne genau und fanden allein dadurch einiges über sie heraus. Auch heutzutage finden Viele den klaren Nachthimmel schön anzuschauen und bekommen Lust, sich näher damit zu befassen. Doch leider lassen sie sich oft allzu schnell davon wieder abbringen. Zu mächtig ist die weit verbreitete Vorstellung, dass in der Hobby-Astronomie nichts geht, ohne sich gleich ein teueres Teleskop samt Zubehör anzuschaffen. Und besitzt man dann die nötige Ausrüstung, wird man damit irgendwohin in die finstere Einsamkeit fahren müssen und am besten auf einen Berggipfel klettern, um der Lichtverschmutzung zu entkommen und überhaupt etwas am Sternenhimmel erkennen zu können.
Mir selbst ging es lange Zeit so. Im Sommer schaute ich nachts gern hinauf zu den Sternen. Von den Sternbildern kannte ich gerade mal den Großen und Kleinen Wagen und das „Himmels-W“. Der Mond war hübsch und hatte ein Gesicht. Dass dort oben auch irgendwo Planeten herumflogen, war mit klar. Die Venus hatte ich schon mal als Abend- oder Morgenstern gesehen. Aber alle anderen Lichter da droben waren eben Sterne.
Doch dann, vor etwa einem Jahr, wollte ich mehr erfahren. Ich wollte die Planeten und den Mond erkunden. Und deshalb legte ich mir ein kleines 60-Millimeter-Refraktor-Teleskop zu. Professionellere Amateur-Astronomen werden dieses Gerät eher als größeres Fernglas bezeichnen, das an die Leistungsfähigkeit eines „richtigen“ Teleskops nicht heranreicht. Aber mir öffnete es eine neue Welt. Es war überwältigend, damit zum ersten Mal mit eigenen Augen Saturn mit seinem Ring sehen zu können. Und der Blick zum Mond offenbarte faszinierende Details wie Krater und Gebirge.
Seitdem habe ich mich Stück für Stück in die Himmelsbeobachtung eingearbeitet. Und es überrascht mich immer mehr, was man schon mit ganz einfachen Mitteln oder bloßem Auge am Nachthimmel entdecken kann. Und nein, dafür ist mitnichten zwingend ein stockdunkler Himmel fernab von jeder Zivilisation nötig. Der Mond, Planeten, Sternhaufen und Doppelsterne lassen sich selbst aus Vorstadtgebieten heraus gut beobachten.
Mit diesem Buch möchte ich allen Sternfreunden Mut machen, den Nachthimmel zu erforschen, auch wenn sie dafür (noch) kein Vermögen in Gerätschaften investieren wollen. Dieses Buch soll den Einstieg in die Hobby-Astronomie erleichtern, und zwar aus dem Blickwinkel einer Einsteigerin. Es gibt Beobachtungsanregungen und erklärt ein paar grundlegende Fachbegriffe und astronomische Zusammenhänge, die für den Einstieg in dieses Hobby wichtig sind.
Gerade am Anfang, wenn man noch von überhaupt nichts eine Ahnung hat und beginnt, sich einzulesen, kann man schnell von all den Ms, NGCs, ICs, magnitudos, Bogenminuten und -sekunden, Bortle-Werten, und so weiter schier erschlagen werden. Selbst im Anfängerbereich von Hobby-Astronomie-Foren fühlt man sich womöglich recht verloren und überfordert. Das alles kann ziemlich abschreckend sein und dazu führen, dass man aufhört, sich weiter mit der Sternenbeobachtung zu beschäftigen.
Deswegen wollte ich das Wissen, das ich mir inzwischen angeeignet habe nicht nur für mich selbst bündeln und übersichtlich zusammenfassen, sondern in Form dieses Buches auch Anderen zugänglich machen. Es soll einen Überblick darüber geben, was man dort oben am Nachthimmel schon mit einfachster Ausrüstung entdecken kann und Lust machen, den Sternenhimmel zu erkunden. Was dieses Büchlein nicht bieten kann, sind Details zur Funktionsweise von Ferngläsern und Teleskopen oder gar eine Kaufberatung .
Ja, ich bin selbst Astronomie-Anfängerin und vielleicht werde ich dieses Stadium auch nie verlassen. Aber es fasziniert mich immer wieder aufs Neue, nachts den Sternenhimmel zu erforschen und seine Schönheit zu genießen. Und vielleicht hilft mein Büchlein ja dem einen oder der anderen, dieses Hobby ebenfalls für sich zu entdecken.
Vorwort zur zweiten Auflage
Warum diese zweite Auflage?
Während der drei Jahre, die seit der ersten Auflage verstrichen sind, machte ich mit der Hilfe einiger sehr erfahrener und hilfsbereiter Sternfreunde in meinem astronomischen Tun Fortschritte. Ich verstehe inzwischen ein wenig mehr von den theoretischen Hintergründen der Himmelsmechanik. Und ebenso bin ich, was das praktische Beobachten betrifft, ein gutes Stück vorangekommen. Zum Beispiel wurde mir klarer, wie wichtig das astronomische Sehen ist und dass man es trainieren kann, um nach und nach immer mehr Details von beobachteten Objekten wahrnehmen zu können. Außerdem entdeckte ich das astronomische Zeichnen für mich.
Das alles führte dazu, dass ich die „Ausflüge zum Sternenhimmel“ gern um einige neue Themengebiete erweitern wollte, weil ich sie für wichtig halte oder sie mir persönlich am Herzen liegen. So überarbeitete ich das Buch komplett, strukturierte es neu und erweiterte es um einige Kapitel.
Jeder findet seinen eigenen Weg in die Astronomie. Auf diesem Weg gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Dinge, die man plötzlich versteht. Und man entdeckt Bereiche, die einen besonders ansprechen und in die man sich gern weiter einarbeiten möchte. Dieses Finden seines persönlichen Weges, das Hineinwachsen in die Astronomie, soll auch mein Büchlein hier widerspiegeln.
So wünsche ich allen, die sich auf diesen Weg einlassen möchten – jeder auf seine ganz persönliche Weise – viel Freude beim Entdecken all der unterschiedlichen Facetten, die das Hobby Astronomie zu bieten hat.
Teil 1 – Theoretische Grundlagen
M 36 (links) und M 38 (rechts); 80/400 Teleskop (seitenrichtig)
Bewegungen des Himmels und der Erde
Unsere Erde bewegt sich auf einer festen Bahn um die Sonne herum. Für eine komplette Runde benötigt sie ein Jahr. Auch die anderen Planeten unseres Sonnensystems umkreisen die Sonne auf etwa derselben Ebene wie unser eigener Planet.
Erdbahn um die Sonne
Tag und Nacht
Innerhalb eines Tages dreht sich die Erde einmal um sich selbst. Auf der Seite der Erdoberfläche, die der Sonne gerade zugewandt ist, ist Tag. Auf der sonnenabgewandten Seite ist Nacht.
Die Neigung der Erdachse und die Jahreszeiten
Die Erdachse ist eine gedachte Linie durch den Nord- und Südpol unseres Planeten. Sie ist um etwa 23,45 Grad gegenüber der Bahn gekippt, auf der sich die Erde um die Sonne bewegt. Verlängert man diese Achse in den Himmel, so zeigt ihr nördliches Ende zum Polarstern, dem Himmelsnordpol. Das bleibt auch während der gesamten Jahreswanderung unseres Planeten um die Sonne herum so.
Das führt dazu, dass während eines Jahreslaufs der Nordpol der Erde mal der Sonne zugeneigt ist und mal von ihr weg zeigt. Im ersten Fall haben wir Bewohner der Nordhalbkugel Sommer, im zweiten Fall ist es Winter.
Ausrichtung der Erdachse während der Jahreszeiten
Aus der Perspektive eines mitteleuropäischen Beobachters steigt die Sonne im Sommer zur Mittagszeit sehr hoch in den Himmel. Ihre Strahlen treffen die Erdoberfläche in einem steilen Winkel. Im Winter erreicht die Sonne mittags dagegen nur eine geringe Höhe und ihre Strahlen treffen in einem flachen Winkel auf. Das hat zur Folge, dass dieselbe Menge Wärme, die im Sommer auf einen Quadratkilometer Erde auftrifft, sich im Winter auf eine viel größere Fläche verteilt. Deshalb ist es bei uns im Winter kälter als im Sommer. Auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten umgekehrt. Am Äquator gibt es keine Jahreszeiten. Dort steht die Sonne mittags immer hoch am Himmel.
Auch, wenn die Sonne für einen mitteleuropäischen Beobachter stets im Osten auf- und im Westen untergeht, tut sie das im Lauf der Jahreszeiten an sehr unterschiedlichen Positionen am Horizont. Genau im Osten geht sie nur an den Tagen des Frühlings- und des Herbstbeginns (21.3. und 23.9.) auf. Nur an diesen Tagen geht sie auch genau im Westen unter.
Im Winter überquert die Sonne die Horizontlinie eher im Südosten. Mittags erreicht sie dann als höchsten Stand (das nennt man Kulmination) nur eine geringe Höhe. Nach einem kurzen Tag versinkt sie im Südwesten. Im Sommer geht sie dagegen eher im Nordosten auf, steht mittags hoch im Süden und geht im Nordwesten wieder unter.
Im Sommer ist der Tag viel länger als im Winter. Die Strecke, während der die Sonne über dem Horizont sichtbar ist, ist viel länger als im Winter. Man nennt den scheinbaren Bogen, den die Sonne bei ihrer Wanderung über den Himmel beschreibt, Tagbogen. Genau genommen ist der Bogen der Sonne, den man am Tag beobachten kann, nur ein halber Tagbogen. Die andere Hälfte dieses Bogens beschreibt die Sonne während der Nacht unterhalb des Horizonts.
(halber) Tagbogen der Sonne während der Jahreszeiten
Die scheinbare Bewegung der Sterne
Genauso, wie am Tag die Sonne etwa im Osten aufgeht, in einem Bogen über das Firmament zieht und danach im Westen wieder untergeht, tun das nachts alle anderen Himmelsobjekte ebenfalls. Der Grund dafür ist die Drehung der Erde um sich selbst, die ein Beobachter als Drehung des Himmelszeltes wahrnimmt.
Bewegung der Sterne für einen Beobachter am Nordpol
Es sieht so aus, als würden sich alle Sterne auf Kreisbahnen über den Himmel bewegen. Das Zentrum dieser Kreisbahnen ist für einen Beobachter auf der Nordhalbkugel der Erde der Himmelsnordpol. Denn zu diesem Pol hin verlängert sich die Erdachse nach Norden in den Himmel hinein. Und um diese Achse herum dreht sich ja die Erde bzw. für einen irdischen Beobachter der Himmel.
Je nachdem, auf welchem Breitengrad sich ein Beobachter auf der Erdkugel befindet, verlaufen diese scheinbaren Bahnen der Sterne am Himmel anders. Für einen Beobachter am Nordpol der Erde drehen sich alle Sterne in Kreisbahnen um den Polarstern herum. Am Südpol geschieht das entsprechend mit den Sternen der südlichen Himmelsregion. Die Sterne gehen weder auf noch unter und sind die ganze Nacht hindurch zu sehen.
Bewegung der Sterne für einen Beobachter am Äquator
Über einen Beobachter am Äquator ziehen die Sterne auf bogenförmigen Bahnen hinweg, die senkrecht zum Horizont ausgerichtet sind. Der Polarstern bzw. der südliche Himmelspol ist nicht zu sehen. Alle Sterne gehen im Lauf der Nacht auf und wieder unter.
Bewegung der Sterne für einen Beobachter in Mitteleuropa
Ein Beobachter in Mitteleuropa hat einen mittleren Blickwinkel zwischen diesen beiden Extrempositionen. Er kann schräg über sich den Polarstern sehen, um den herum sich einige Sternbilder drehen, die während einer Nacht nie auf- oder untergehen. Man nennt sie zirkumpolare Sternbilder.
Je nördlicher sich ein Beobachter auf der Nordhalbkugel der Erde befindet, desto mehr Sterne sind für ihn zirkumpolar. Die anderen Sterne ziehen von Osten nach Westen über den Himmel. Sie gehen auf und auch wieder unter.
Wenn es Nacht wird...
Der Übergang vom Tag zur Nacht und umgekehrt kann uns bei gutem Wetter ein prächtiges Farbenspiel bieten. Wie lange Morgen- und Abenddämmerung dauern, hängt von der Jahreszeit und vom Breitengrad ab, auf dem sich ein Beobachter gerade befindet.
Am Äquator vollzieht sich dieser Übergang schnell, weil die Sonne dort in einem steilen Bogen über den Himmel wandert. In Polnähe bewegt sich die Sonne in einem flachen Bogen über den Horizont, deshalb dämmert es dort viel länger. Am Polarkreis geht sie je nach Jahreszeit eine Weile lang gar nicht unter bzw. auf. Dann herrscht dort Polartag bzw. Polarnacht.
Im Sommer gibt es auch in Deutschland Nächte, in denen es gar nicht wirklich dunkel wird und die Abenddämmerung sofort wieder in die Morgendämmerung übergeht. Man unterscheidet drei Dämmerungsphasen: die bürgerliche, die nautische und die astronomische Dämmerung.
Bürgerliche Dämmerung
Die Zeit kurz nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang nennt man bürgerliche Dämmerung. Hier reicht das verbleibende Tageslicht noch aus, um zum Beispiel Zeitung zu lesen oder ohne künstliches Licht Arbeiten nachzugehen. Diese Phase endet abends, wenn die Mitte der Sonne 6 Grad unter den Horizont gesunken ist. Morgens beginnt die bürgerliche Dämmerung, wenn sich die Sonnenmitte noch 6 Grad unter dem Horizont befindet.
Nautische Dämmerung
Abends folgt auf die bürgerliche Dämmerung die nautische. Jetzt ist der Horizont noch gut erkennbar, während man bereits die ersten Sterne sehen kann. Morgens geht die nautische Dämmerung der bürgerlichen voraus. In früheren Zeiten war diese Dämmerungsphase für die Navigation von Schiffen sehr wichtig. Denn mit Hilfe der Sterne und der Horizontlinie konnten Seefahrer ihre Position bestimmen.
Von der nautischen Dämmerung spricht man, wenn abends oder morgens das Zentrum der Sonne zwischen 6 und 12 Grad unter dem Horizont steht. Im Sommer gibt es auf Breitengraden nördlicher als ca. 54,5 Grad Nächte, in denen die nautische Abenddämmerung in die nautische Morgendämmerung übergeht. Das betrifft in Deutschland die ganz nördlichen Gebiete, zum Beispiel Teile von Schleswig Holstein.
Astronomische Dämmerung
Nach Sonnenuntergang schließt abends die astronomische Dämmerung an die nautische an. Die letzten Reste des Tageslichts verschwinden und der Himmel wird (sofern keine Lichtverschmutzung stört) tiefschwarz. Alle Sterne, die man mit bloßem Auge erkennen kann, erscheinen nach und nach.
Morgens ist die astronomische Dämmerung die erste Phase, mit der sich die Nacht in Richtung Tag verabschiedet. Während dieser Dämmerungsphase steht die Mitte der Sonne ca. 12 bis 18 Grad unterhalb der Horizontlinie.
Dämmerungsphasen