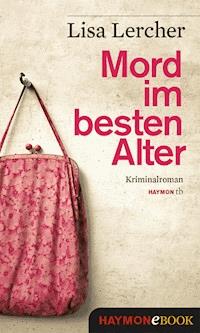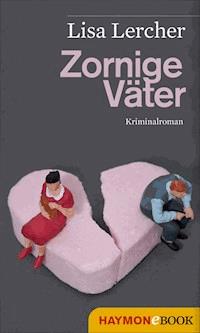Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lisa Lercher Krimis
- Sprache: Deutsch
Mord im Magistrat Die engagierte Beamtin Anna wird in eine andere Stabsstelle versetzt: Sie soll einen freigewordenen Posten nachbesetzen - ihre Vorgängerin hat sich erst kurz zuvor das Leben genommen. Mit gemischten Gefühlen tritt sie ihren Dienst an und schon bald ist klar: Das Arbeitsklima in ihrer neuen Abteilung ist unerträglich. Sticheleien und Kränkungen prägen den Alltag, die machthaberische Chefin quält ihre Mitarbeiter. Anna bemüht sich, Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Bis ihre Kollegin ermordet wird... Mit Charme, Humor und einem einzigartigen Gespür für Alltagsbeschreibungen schickt Lisa Lercher die Magistratsbeamtin Anna in ein fein gesponnenes Netzwerk aus Intrigen. Ausgestattet mit detektivischem Spürsinn und einer gehörigen Prise lakonischen Humors versucht Anna an ihrem neuen Arbeitsplatz nicht zwischen die Fronten zu geraten doch nach und nach gerät auch sie in den Strudel der Ereignisse. ***Feiner Humor, ausgeklügelte Komposition und erfrischend ungekünstelte Beschreibung von Alltagsszenen und Milieus.*** Weitere Krimis von Lisa Lercher: - Der letzte Akt. Kriminalroman - Der Tote im Stall. Kriminalroman - Die Mutprobe. Kriminalroman - Zornige Väter. Kriminalroman - Mord im besten Alter. Kriminalroman
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lisa Lercher
Ausgedient
Kriminalroman
© 2014HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Überarbeitete E-Book-AusgabeOriginalausgabe: Milena Verlag, Wien 2004
ISBN 978-3-7099-3563-7
Coverbild: www.photocase.com/zettberlin
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Inhalt
Inhalt
„Ich glaub‘s einfach nicht.“ Eine dunkelhaarige Frau schaut mich neugierig an. Habe ich etwa laut gedacht? Kein Wunder, nach einem solchen Schock. Und das am frühen Morgen.
Ich tue, als würde ich den Blick der Frau nicht bemerken. Sie wendet sich ab, zupft einen Faden von ihrer kurzärmeligen Jacke.
Noch vier Minuten. Warum dauert das heute gar so lange?
Eine Gruppe von Neuankömmlingen ergießt sich über den Bahnsteig. Sie kommen über die Rolltreppe und aus dem Lift. Wahrscheinlich von einer der anderen Linien, die sich hier kreuzen.
Ich gehe ein paar Schritte weiter, um dem Gedränge zu entkommen. Ein Mann mittleren Alters im grauen Businessanzug streift mit seiner Aktentasche meinen Oberschenkel. Er entschuldigt sich knapp. Zerstreut nicke ich ihm zu. Mit meinen Gedanken bin ich ganz wo anders.
Ein lautes „Peter, jetzt gib endlich eine Ruhe“, läßt mich zusammenzucken. Eine hagere Brünette in Jeans und einer karierten Bluse kämpft um ihre Autorität. Die Volksschulkinder sind kaum zu bändigen. Sieht ganz nach einem Wandertag aus, so wie die Kleinen angezogen sind. kurze Hosen und Turnschuhe. Einige haben Regenjacken auf ihren Rucksäcken festgeschnallt. Die Kinder schnattern aufgeregt und drängeln nach vorne. Vorbei an den Menschen, die so wie ich auf dem Weg zur Arbeit sind. Die Ermahnungen der Brünetten und ihrer zwei jungen Kolleginnen haben wenig Erfolg.
Noch immer vier Minuten. Da muß etwas passiert sein. Warum sagen die nichts durch? Das ist ein Tag. Ungeduldig trommle ich mit den Fingern auf meinen Hüften. Ich hätte doch zu ihr fahren sollen.
Von einer Reklametafel lacht mir ein junger Mann mit einem glatzköpfigen Säugling im Arm entgegen. Kinder wohin man schaut. Nun schiebt sich auch noch ein Buggy in mein Blickfeld. Schön langsam fühle ich mich verfolgt. Das Kleinkind nuckelt an einer Semmel, oder dem, was noch davon übrig ist.
Sie hat wie ferngesteuert geklungen. Anscheinend kann sie es selber nicht so recht glauben.
Das Kleine grinst mich an und schwenkt fröhlich sein Frühstück. Die Frau beugt sich über den Kinderwagen und nimmt dem Kind sein Essen aus der Faust. Das Kleine verzieht sofort den Mund, wird aber gleich darauf mit einem Stück frischer Semmel beruhigt. Süß sind sie ja. Aber Mona und ein Kind? Ich kann es immer noch nicht fassen. Meine beste Freundin ist schwanger. Sie hat es mir heute morgen gesagt. Das Läuten des Telefons hat mich aus dem Bett geholt. Es war noch nicht einmal sieben, als sie angerufen hat, um mir das Ergebnis des Schwangerschaftstests mitzuteilen.
Ist doch nur ein Test. Heißt es nicht immer, daß mindestens ein Drittel von denen nicht stimmt?, habe ich sie aufzumuntern versucht. Mona hat mir widersprochen. Sie hätte es eh geahnt. Ihre Regel sei schon seit drei Monaten überfällig, hat sie mir mit ganz ruhiger Stimme erzählt.
Warum sie nicht eher was unternommen hat? Auf meine Frage hat sie einige Momente lang geschwiegen. Ich wisse doch, wie das mit ihren Tagen sei, dem unregelmäßigen Zyklus und so.
Daß ich an ihrer Stelle schon viel früher einen Test gemacht hätte, habe ich für mich behalten. Es ist mir nicht als der richtige Augenblick erschienen, ihr auch noch mit Vorhaltungen zu kommen. Auf jeden Fall solle sie zu ihrer Frauenärztin gehen und noch einen Test machen lassen, weil das wahrscheinlich zuverlässiger ist, habe ich sie gedrängt. Noch heute solle sie sich einen Termin geben lassen.
Die Menschenmenge am Bahnsteig wird immer größer. Trotzdem kommen vom Stiegenaufgang her, dort wo die Rolltreppe ist, immer noch welche nach. Die haben sicher nicht alle in der nächsten U-Bahn Platz. Ich quetsche mich an zwei Burschen vorbei in die erste Reihe. Ich habe keine Lust, länger als unbedingt nötig zu warten. Den beiden scheint es nichts auszumachen, daß ich mich vordränge. Ich an ihrer Stelle hätte auch nichts dagegen. Verspätete U-Bahnen waren schon immer ein guter Entschuldigungsgrund für‘s Zuspätkommen.
Der Silberpfeil quält sich über die langgezogene Steigung. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Eine aufgedonnerte Blondine schiebt mir ihren Ellenbogen in die Seite. „Was ist?“ fauche ich sie an. Sie kneift die auffällig geschminkten Augen zusammen und rückt ein Stück zur Seite. Gewonnen, denke ich befriedigt. Der kleine Sieg macht mich nicht wirklich froh.
Und dann?, hat sie gefragt. Ich habe geschwiegen. Was hätte ich auch auf eine so gewichtige Frage antworten sollen? Sie hat geseufzt. Am liebsten hätte ich sie in den Arm genommen und getröstet.
Ein lauter Knall läßt mich herumfahren. Die Augen der Blondine sind schreckensgeweitet. Sie starrt mit offenem Mund auf den Bahnsteig. Die Leute hinter ihr wirken wie eingefroren. Es ist totenstill. Dann höre ich eine Frau schreien. Es klingt hysterisch. Ein Kind beginnt zu weinen. Langsam wende ich den Kopf und beuge mich ein wenig nach vor, um deutlicher zu sehen.
Die U-Bahn ist zu etwa einem Drittel in die Station eingefahren. Warum hat sie angehalten? Auf den Geleisen entdecke ich schließlich etwas Buntes. Was ist das? Ein Stück Stoff?
„Da ist einer gesprungen“, sagt einer der Jugendlichen hinter mir.
„Gesprungen?“ frage ich und schüttle dabei den Kopf, als ob das etwas an den Tatsachen ändern könnte. So unwirklich ist mir die Realität schon lange nicht mehr vorgekommen. Der Bub zeigt in Richtung U-Bahn.
„Da vorne. Da liegt noch was.“ Er zieht seinen Freund am Ärmel näher zu sich heran. „Da, schau! Ein Fuß?“
Ich merke, wie mir schlecht wird. Die Frau neben mir erbricht. Ich würge und drehe mich schnell weg, bevor auch ich mich übergeben muß.
Die Buben recken noch immer die Hälse. „Na sicher. Schau, das ...“ Der Rest des Satzes wird von der kreischenden Stimme der Brünetten verschluckt, die versucht, ihre aufgeregten Schulkinder in Zaum zu halten.
Bewegung kommt in die Menge. Ein paar besonders Neugierige schieben mich zur Seite, wohl in der Hoffnung auf eine bessere Aussicht. Diesmal gebe ich nach. Das Risiko, auf die Geleise zu fallen, ist mir bei dem Gedränge zu groß.
Ein kleiner Mann mit einem mächtigen Bierbauch flucht dicht neben meinem Ohr. „Schweinerei, so eine Drecksau.“ Ich folge seinem empörten Blick. Er ist mit den Sandalen in die halbverdauten Frühstücksreste der Blondine gestiegen. Das hat er von seiner Sensationsgier. Angewidert versucht er, die beschmutzte Schuhsohle auf den Betonplatten des Bahnsteigs abzuputzen. Kein leichtes Unterfangen bei den vielen Schaulustigen, die einen Blick auf das Unglück erhaschen wollen.
„Bitte räumen Sie den Bahnsteig. Benutzen Sie den hinteren Ausgang, damit die Rettungskräfte durch können.“ Die Stimme aus dem Lautsprecher ist ruhig und sachlich, fast unbeteiligt und übertönt das Stimmengewirr. Genau das Richtige, um einen drohenden Tumult im Keim zu ersticken. Oder täusche ich mich etwa?
Eingekeilt in eine Gruppe von Geschäftsleuten in grauen und beigen Sommeranzügen werde ich in Richtung U-Bahn geschoben. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Aber es hat keinen Zweck, Widerstand zu leisten. Ich konzentriere mich auf meinen Vordermann. Das hilft gegen die Platzangst. Den Schweißausbruch kann ich trotzdem nicht verhindern. Nur nicht hinfallen. Ich erinnere mich über den Bericht über die Massenpanik in dem brennenden Theater, den ich vor kurzem gesehen habe. Nur die Ruhe, eine Massenpanik ist das noch lange nicht. Ich kontrolliere meine Atmung, ganz so, wie ich es im Yoga-Kurs gelernt habe.
Ein Uniformierter der Wiener Verkehrsbetriebe taucht neben mir auf. „Weitergehen. Bitte gehen Sie weiter. Sie behindern die Feuerwehr. Machen Sie doch bitte den Bahnsteig frei.“ Er ist sichtlich genervt, bemüht sich aber um einen einigermaßen höflichen Tonfall.
Der kleine Dicke von vorhin versucht einen Blick auf die Geleise zu werfen. Der Uniformierte legt ihm eine Hand auf die Schulter. „Sie behindern die Einsatzkräfte. Gehen Sie bitte weiter vor zum Ausgang.“ Der Bierbäuchige grinst verlegen, reckt aber weiterhin den Hals.
„Grauslich. Hast du den Blutfleck gesehen?“ höre ich einen der Jugendlichen aufgeregt hinter mir. Die brauchen wahrscheinlich psychologische Betreuung, oder ist das für sie wie in einem dieser Actionfilme?
„Wahnsinn. Voll arg.“ Der Bub ist komplett aufgelöst.
„Weitergehen. Da gibt’s nichts zum Gaffen.“ Der barsche Befehl ist wohl an die Jugendlichen gerichtet.
Die Türen der vorderen Waggons sind noch verriegelt. Fahrgäste stehen an den Fenstern und starren nach draußen. Einige haben sich in Grüppchen zusammengeschart und kommentieren offenbar die Lage.
Endlich sind wir beim Abgang angelangt. Bei den Stufen passe ich besonders auf, obwohl ich bei dem Gedränge sicher nicht weit fallen würde.
Weiteres Stationspersonal hat inzwischen Posten bezogen und leitet die Fahrgäste in die Eingangshalle und auf den Vorplatz weiter.
Eine ältere Dame wird von einem der Uniformierten beruhigt. „Ja, es gibt einen Schienenersatzverkehr. Es wird durchgesagt. Sie müssen draußen warten, bis die Busse da sind.“
Es kommt mir wie eine kleine Ewigkeit vor, bis ich endlich auf dem Vorplatz angelangt bin. Hier ist weniger Gedränge. Die Menschen stehen in Gruppen beisammen und bereden den Vorfall. Ein Anblick mit Seltenheitswert, wo doch sonst die Leute in der U-Bahn schon nervös werden, wenn man sie freundlich anlächelt.
„Ich war direkt daneben. Die Frau ist viel zu weit vorne gestanden“, macht sich eine füllige Dame im großgeblümten Sommerkleid wichtig.
Eine Frau also. Warum sie wohl gesprungen ist?
„Der Autofahrer hat gar nichts dafür können. Außerdem hat es geregnet“, setzt die Geblümte ihre Geschichte fort.
Ach so, die reden über einen ganz anderen Unfall.
Mich fröstelt ein wenig. Ich gehe weiter zu den Heckenrosen, die den Eingang zum benachbarten Park flankieren. Die hellrosaroten Blütenblätter recken sich der Junisonne entgegen. Ein paar Bienen sind emsig bei der Arbeit.
Wie verzweifelt muß man sein, um diesen Schritt zu machen? Sich vor eine U-Bahn zu werfen. Nie wieder sehen zu können, wie aus den verblühenden Heckenrosen Hagebutten werden, nie wieder ihren Duft zu riechen. Ich stecke meine Nase in eine der rosaroten Blüten. Sie riechen ja gar nicht, stelle ich ernüchtert fest.
„Dieser Trottel. Was muß der Depp gerade zur Stoßzeit auf die Schienen hupfen? Den ganzen Betrieb aufhalten? Und was das kostet, der Feuerwehreinsatz, die Verspätung, alles unser Geld“, ereifert sich ein junger Mann, der meinem Versicherungsvertreter ein wenig ähnlich sieht. Er hat seinen schwarzen Aktenkoffer neben sich gestellt und tippt eine Nummer in sein Handy.
Ich spüre Wut in mir aufsteigen. Wie kann man in einer solchen Situation so gefühllos sein? Sicher ein Geschäftsmann. Die haben immer nur ihren Profit im Kopf.
„So kannst du das aber nicht sagen. Wenn du einmal so weit bist, dann ist dir das wirklich nicht wichtig“, widerspricht der Mann neben ihm. Er trägt ebenfalls einen Sommeranzug und eine dunkle Aktentasche. Ich bin dankbar für diesen Einwand. Doch noch nicht Hopfen und Malz verloren bei diesen Typen.
„Was heißt, nicht wichtig? Sicher macht der das zur Stoßzeit. Würde ich auch tun. Wenn mir schon vorher keiner hilft, dann sollen sie wenigstens jetzt etwas davon haben“, mischt sich ein dritter ins Gespräch. Aha, auch psychologisch geschult. Hat aber nicht unrecht, der Mann.
„Also mir ist das herzlich Blunzn“, antwortet der mit dem schwarzen Aktenkoffer. „Nur weil der Probleme hat. Wo kämen wir denn da hin? Glaubst du, meinen Kunden kümmert das, daß sich da ein Wahnsinniger vor die U-Bahn schmeißt, wenn ich zu spät zur Präsentation komme? Schert es den Irren, wenn ich Probleme habe?“
„Jetzt sicher nicht mehr“, sagt sein Kollege und grinst dabei zynisch.
Die Männerrunde lacht.
„Frau Tropper? Ja. Bei mir wird es noch ein wenig dauern. Ja, genau.“ Der Typ mit dem Handy dreht sich um und gibt in knappem Befehlston ein paar Anweisungen durch.
Unruhe kommt in die Wartenden.
„Der erste Bus ist schon da“, ruft eine Frau mit leichtem ungarischem Akzent und einer auffallend großen Handtasche.
„Wo?“ fragt die ältere Dame mit weißem Handschuhen neben ihr.
„Da drüben.“ Die Frau deutet zum Parkplatz. „Kommen Sie. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir sicher noch einen Platz im ersten Bus.“ Die Frau mit dem Akzent klemmt ihre Handtasche unter den Arm und geht zügig voraus.
Ich mache mich ebenfalls auf den Weg. Beim Anblick eines quengelnden Kleinkindes fällt mir meine Freundin Mona wieder ein.
Yasemin nickt mir mißmutig zu, als ich das Büro betrete.
„Tut mir leid, die Verspätung“, keuche ich. Ich bin das letzte Stück gelaufen, weil ich weiß, wie streßig der Telefondienst für eine allein sein kann.
Yasemin schaut anklagend auf ihre Uhr. „Das ist diese Woche schon das zweite Mal. Du hättest mir sagen können, daß du später kommst“, sagt sie vorwurfsvoll.
„Ist keine böse Absicht. Diesmal kann ich wirklich nichts dafür“, verteidige ich mich. „Da hat sich jemand vor die U-Bahn geworfen und ...“
„Wirklich?“ unterbricht mich meine Kollegin und schlägt sich die Hand vor den Mund. „Du bist daneben gestanden? Furchtbar.“ Sie schaut mich mitleidig aus ihren großen schwarzen Augen an.
Yasemin ist erst seit kurzem bei uns. Sie ist der Ersatz für Thomas, meinen langjährigen Kollegen. Er hat vor knapp drei Monaten endlich eine unbefristete Stelle bekommen, mußte dafür aber in eine andere Magistratsabteilung wechseln.
„Soll ich dir einen Kaffee machen?“ Yasemin steht langsam von ihrem Bürosessel auf. Das Läuten des Telefons unterbricht die Bewegung. Yasemin greift nach dem Hörer. „Bürgersoforthilfe“, meldet sie sich geübt.
So heißt unser Telefonberatungsdienst seit einigen Wochen. Die Stadtregierung hat der Opposition gleich nach den Wahlen zeigen wollen, daß nunmehr Nägel mit Köpfen gemacht werden. Mit einem neuen Namen und geänderten Beratungszeiten hat die Stadträtin unsere bewährte Einrichtung als neue Maßnahme und ersten Erfolg verkaufen können. Ich habe mich immer schon gefragt, warum die Leute auf so etwas hereinfallen.
Yasemin wechselt ins Türkische. Sie ist mit ihren Eltern als Kind nach Wien gekommen und hier aufgewachsen. Ihre Zweisprachigkeit war einer der Gründe, warum sie den Job beim Magistrat bekommen hat.
Ich habe meine Weste über die Sessellehne gehängt und greife nach dem Wasserkocher, der auf dem Aktenschrank gleich neben der Tür steht. Er ist halb voll und das Wasser ist noch einigermaßen warm. Aus der Schreibtischlade hole ich mir meinen Nescafé. Eineinhalb Löffel auf einen Viertelliter Wasser. Der Zucker steht schon neben dem Kocher, ich schaufle zwei Löffel davon in mein grünes Häferl. Das gehört dringend wieder einmal abgewaschen. Früher hat sich Thomas um solche Kleinigkeiten gekümmert.
Yasemin ist in das Gespräch vertieft und spielt abwesend mit einem Blatt des Ficus. Noch so eine Erinnerung an Thomas, dieser Blumenstock, der zwischen unseren Schreibtischen steht. Damit ich recht oft an ihn denke, hat er gesagt, als er mir das gute Stück überlassen hat. Meine Sorge, ich könnte seinen Ficus vertrocknen lassen oder gar ertränken, hat er mit einem Grinsen weggewischt. Ich werde eben von Zeit zu Zeit vorbeikommen müssen, um nach dem Rechten zu sehen, hat er angekündigt.
Ich setze mich mit meinem lauwarmen Kaffee zurück an meinen Schreibtisch und logge mich in den Computer ein. Mein Telefon läutet. Ich erkenne Thomas‘ Nebenstelle auf dem Display.
„Hallo Anna, was gibt‘s Neues?“ fragt er, ohne seinen Namen zu nennen.
„Das ist aber eine Überraschung“, antworte ich.
„Überraschung, wieso?“
„Na weil du immer so beschäftigt bist, wundere ich mich halt, daß du dich auch wieder einmal bei mir rührst.“
„Jetzt übertreibst du aber“, erwidert er mit einem leicht beleidigten Unterton. „Ich hab dich doch erst ...“, er verstummt.
„Siehst du, du kannst dich nicht einmal mehr erinnern, wann du das letzte Mal mit mir telefoniert hast“, setze ich nach. Es macht mir Spaß, ihn ein wenig zu sekkieren.
„Dann muß ich das schleunigst wieder gutmachen. Hast du heute mittag Zeit?“
So wie er fragt, kann ich schlecht nein sagen. Außerdem möchte ich ihn gerne treffen. „Wieso? Willst du mich zum Essen einladen?“ schäkere ich deshalb.
„Warum nicht? Obwohl, bist nicht du mit dem Zahlen dran?“ Nun hat er mich auf der Schaufel.
„Ich denke, du willst etwas wieder gutmachen“, plänkle ich weiter.
„Überredet,“ gibt er nach. „Und was gibt es sonst Neues?“
Anscheinend ist er heute zum Plaudern aufgelegt, was bei ihm reichlich selten vorkommt.
„Ich bin heute in der Früh Zeugin eines Unfalls geworden“, beginne ich zu erzählen.
„Ist dir etwas passiert?“ fragt er besorgt.
„Nein, mir nicht.“ Er wartet geduldig, bis ich fortfahre. „Ich bin ein bißchen durcheinander, weil jemand vor die U-Bahn gesprungen ist, während ich in der Station gewartet habe.“
„Echt?“ Thomas klingt erschrocken und setzt nach einer kleinen Pause „Du Arme!“ nach. Sein Mitgefühl tut mir gut.
„Bist du direkt daneben gestanden?“
„Nein. Von dem Sprung habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Ich weiß nicht einmal, ob es ein Mann oder eine Frau war. Aber was mich so richtig schockiert hat, das waren die Reaktionen der Leute.“
„Entschuldige kurz Anna.“ Dem undeutlichen Gemurmel im Hintergrund nach zu urteilen, hat Thomas eine Hand über die Muschel gelegt. Gleich darauf teilt er mir mit: „Der Chef braucht mich dringend. Macht es dir ...“
„Kein Problem“, unterbreche ich ihn. „Job ist Job. Melde dich halt, wenn du Zeit für ein Mittagessen hast.“
„Das habe ich auf jeden Fall. Ich ruf dich an, sobald ich wieder an meinem Platz bin.“
Er legt auf, ohne sich zu verabschieden.
Yasemin hat in der Zwischenzeit ihr Beratungsgespräch beendet. „Eine Obsorgegeschichte“, klärt sie mich auf. „Die Frau macht sich große Sorgen, daß der Ehemann die Kinder nach der Scheidung in die Türkei zu den Großeltern schickt.“
Ich nicke.
„Dann hätte die Regierung ein Ausländerproblem weniger“, ergänzt sie trocken und zwinkert mir dabei zu.
Ihr Zynismus ist mir sympathisch und auch selber nicht ganz fremd. „Du hast Nerven. Der Frau hast du hoffentlich bessere Tips gegeben.“
Yasemin lacht. Eine kleine Lücke zwischen den Schneidezähnen unterbricht die ansonsten perfekte Zahnreihe. Ihre langen schwarzen Haare hat sie zu einer Aufsteckfrisur hochgetürmt. „Sicher. Ich habe sie an die Frauenberatungsstelle verwiesen. Eine Kollegin dort spricht auch türkisch und kann der Frau sicher besser weiterhelfen als wir hier.“
„Auf jeden Fall. Bei der Erfahrung die die mit solchen Fällen haben“, bestärke ich sie.
„Wie war das in der U-Bahn? Was genau ist da passiert?“ wechselt Yasemin das Thema.
„Gesehen habe ich eigentlich nichts Genaues. Irgend etwas ist vor, oder besser gesagt mehr unter der U-Bahn gelegen. Aus der Ferne hat es wie ein Stück Stoff ausgeschaut. Es könnte aber genau so gut ein Fetzen Papier gewesen sein.“
„Und aus der Nähe?“
„Keine Ahnung. Ich war weiter weg, so ungefähr im letzten Drittel von der Station. Da war ein ziemliches Gedränge, und ich habe eigentlich gar nicht im Detail wissen wollen, was von jemandem nach einem Zusammenstoß mit der U-Bahn übrig bleibt. Ehrlich gesagt, selbst wenn ich auf die Geleise gesehen hätte, hätte ich mich weggedreht.“
„Verstehe.“ Yasemin kratzt sich mit dem Ende ihres Kugelschreibers am Kopf. So muß das in der Barockzeit ausgesehen haben, wenn die Damen und Herren unter ihren Perücken die Flöhe aufgescheucht haben.
„Den Anblick einer Leiche vergißt frau nicht so schnell wieder“, erkläre ich ihr und ich weiß, wovon ich rede.
„Natürlich, keine Frage. Mir wird schon bei rohem Faschierten schlecht.“
Wie das aussieht, mag ich mir im Moment lieber nicht vorstellen. Ob die Buben wirklich einen abgetrennten Fuß erkannt haben? Ich verdränge auch diesen Gedanken.
„Wer weiß, ob die Person wirklich tot war. Ich habe einmal von einer jungen Frau gehört, die sich vor die U-Bahn geworfen hat und es sich dann im letzten Moment doch noch einmal anders überlegt hat.“
„Sie ist wieder aus dem Schacht herausgeklettert?“ frage ich nach.
„Sie wollte“, Yasemin runzelt die Stirn. „Sie hat es auch fast geschafft. Leider aber nur fast. Ihr sind beide Beine abgetrennt worden.“
„Grausig.“ Ich schüttle mich.
„Schlimm, ja. Aber heute sitzt sie im Rollstuhl und engagiert sich für selbstmordgefährdete Jugendliche.“
„Wo? In einer von den Beratungsstellen, mit denen wir zusammenarbeiten?“
„Nein, im Internet.“
„Online-Beratung? Wo?“ Meine Frage kommt wie aus der Pistole geschossen. Online-Beratung gehört zu den Themen, mit denen ich mich gerne ausführlicher beschäftigen möchte, aber der Senatsrat kann sich nicht entschließen, mich endlich auf eine Schulung zu schicken.
„Nicht direkt, es ist ein wenig komplizierter. Es gibt eigene Foren im Internet, wo sich suizidgefährdete Jugendliche treffen und sich gegenseitig Tips geben, wie man sich am besten, schnellsten und sichersten umbringen kann“, klärt sie mich auf.
„Ehrlich?“ staune ich. Ich habe schon viele kranke Geschichten gehört, aber die hier ist mir neu.
„Das weißt du gar nicht?“ Yasemin hebt ihre rechte Augenbraue.
„Höre ich heute zum ersten Mal“, bestätige ich.
„Es ist ziemlich schwierig, an die Leute, die solche Seiten konsumieren, heranzukommen. Die Mailkontakte zu Gleichgesinnten sind gewissermaßen ihr letztes funktionierendes soziales Netz.“
„Kann man dieses Netz nicht nutzen, um sie von ihren Selbstmordabsichten abzubringen?“
„Nicht direkt, weil diese Gleichgesinnten nämlich das genaue Gegenteil erreichen wollen“, setzt meine Kollegin fort. „Und wenn sich einer oder eine von den Selbstmordgefährdeten zum Weiterleben entschließt, wird er oder sie von den anderen als Feigling beschimpft und fertig gemacht.“
Ich nicke. „Verstehe. Wenn es im letzten Kontakt zur Außenwelt nur noch um den Selbstmord geht, verengen sich die Perspektiven zusätzlich.“
„Genau.“
Wir schweigen nachdenklich.
„Was kann man dagegen tun?“ frage ich schließlich.
„Aufklären, informieren, die Seiten verbieten, das Übliche halt“, antwortet Yasemin, ein wenig resigniert, wie mir vorkommt. Ich verstehe sie gut, unsere Sozialarbeit ist manchmal wirklich der reinste Sisyphusjob.
„Und die Frau, von der du erzählt hast? Ist sie auch in Sachen Aufklärung unterwegs?“ frage ich nach.
„Ja, vor allem in Schulen und in Jugendzentren. Außerdem versucht sie über diese Internetlinks an besonders gefährdete Jugendliche heranzukommen. Ich habe gehört, daß sie schon ein paar Mal erfolgreich war.“
Unsere Telefone läuten fast gleichzeitig. Wir bemühen uns, nicht allzu laut zu sprechen, damit wir uns nicht gegenseitig bei den Beratungen behindern. Wie oft haben wir schon argumentiert, daß wir, schon allein aus akustischen Gründen, ein größeres Büro brauchen.
Der Senatsrat hat immer nur mit den Schultern gezuckt. „Meine liebe Frau Kollegin“, hat er gesagt, „ich verstehe Sie vollkommen. Aber Sie müssen auch meine Position sehen. In diesen Zeiten, wo überall eingespart wird ...“ Den Rest hat er offengelassen. „Aber selbstverständlich werde ich mich bemühen ...“ Um was, hat er auch nie gesagt. Er ist eben ein Meister der unvollendeten Sätze.
Glücklicherweise haben Yasemin und ich eher leise Stimmen, ansonsten wäre es während der Telefondienstzeiten nicht auszuhalten.
Mein Klient braucht ein paar Antragsformulare für eine Beihilfe. Ich lasse mir seine Adresse geben und verspreche ihm, die Formulare gleich mit der Post wegzuschicken.
Yasemins Gespräch dauert länger. Als sie auflegt, komme ich noch einmal auf unser Thema von vorhin zurück.
„Am meisten schockiert haben mich die Leute. Das hättest du erleben sollen. Da haben sich glatt welche aufgeregt, daß sie nicht rechtzeitig in die Arbeit kommen.“
„Du natürlich nicht“, spielt Yasemin auf mein Zuspätkommen an.
„Wenn sich jemand vor meinen Augen umbringt ...“, wende ich fast empört ein.
„Eh klar. Ich versteh schon, wie du es gemeint hast.“ Yasemin steht von ihrem Sessel auf und streckt sich. Der enge schwarze Rock paßt gut zur grünen Seidenbluse. Im Gegensatz zu mir ist meine Kollegin immer tipp topp angezogen. „Mich wundert es nicht. Ich hab nicht so eine hohe Meinung von den Menschen wie du“, setzt sie fort.
„Kein Mitleid“, sinniere ich. „Jedenfalls habe ich nichts in diese Richtung gehört. Da war auch kaum Betroffenheit in den Gesichtern der Leute.“
„Wieso auch. Die haben das Opfer nicht gekannt. Am ehesten hat man noch Mitgefühl für den Fahrer. Für den Betroffenen soll das ein Riesenschock sein. Manche müssen sogar den Arbeitsplatz wechseln, weil sie mit ihren Schuldgefühlen nicht zurecht kommen.“
Bevor ich etwas dazu sagen kann, läutet mein Telefon erneut. „Krisentelefon“, melde ich mich. Die neue Bezeichnung unserer Einrichtung will mir noch immer nicht über die Lippen.
Kurz nach zwölf klopft es.
„Ja bitte“, ruft Yasemin.
„Das wird Thomas sein“, informiere ich sie. Und richtig steht er gleich darauf in der Tür. Er sieht müde aus. Unter seinen waldhonigbraunen Augen sind Ringe. Er trägt eine helle Leinenhose und ein T-Shirt. Seine alte abgewetzte Ledertasche hat er unter den Arm geklemmt.
„Hallo die Damen. Wie geht‘s immer?“ Die Frage ist mehr an Yasemin als an mich gerichtet.
„Danke gut“, antwortet sie auch sogleich. „Schön langsam wachse ich in meine Aufgabe hinein. Ihre alten Klienten fragen auch nur noch selten nach Ihnen.“
„Beruhigend zu wissen, daß die sich bei Ihnen gut aufgehoben fühlen“, antwortet Thomas. „Du Anna, ich hab nur eine halbe Stunde Zeit, sollen wir trotzdem?“
Ich nicke. Das Bedürfnis, den morgendlichen Vorfall noch ausführlicher mit Thomas zu erörtern, ist trotz des Gesprächs mit Yasemin nicht geringer geworden.
Wir beschließen, in die kleine Pizzeria gleich neben dem Rathaus zu gehen. Für eine Minestrone oder ein Tramezzino wird die Zeit schon reichen.
Am liebsten würde ich gleich lossprudeln. Die Geschichte ist mir anscheinend doch tiefer unter die Haut gegangen, als ich zunächst geglaubt hatte. Aber die Kolleginnen und Kollegen, die wir auf dem Weg durch das Stiegenhaus, über den Hof und die Straße treffen, hindern mich daran. Was wäre das auch für ein Erzählen, wenn ich mich nach jedem zweiten Wort mit einem freundlichen „Mahlzeit“ unterbrechen müßte.
Kaum haben wir uns gesetzt, beginnt Thomas: „Du, ich hab gerade vorhin ganz was Arges gehört. Die Susanne Pachler hat sich heute in der Früh umgebracht.“ Er greift nach meinem Arm.
Verständnislos starre ich ihn an. „Susanne Pachler?“ Der Name sagt mir gar nichts.
„Ja, die Susanne. Erinnerst du dich nicht mehr an die Kollegin, die uns damals um die Scheidungsbroschüre gebeten hat?“
Ich erinnere mich dunkel. Da ist irgend etwas mit einer Kollegin gewesen, deren Mann sich eine wesentlich jüngere Geliebte genommen hat. Ein Drama, wie es oft genug vorkommt. Routine in meinem Berufsalltag.
„Nicht mehr so genau.“ Ich ziehe meinen Arm ein Stück zur Seite. Das Kribbeln, das ich spüre, wenn Thomas mich berührt, macht mich nervös. Nach den Erfahrungen mit Heinz im steirischen Thermenland bin ich bei Männern lieber vorsichtig. Auch wenn sich Thomas mehrfach als Freund und Berater bewährt hat, bin ich mir nicht sicher, ob es zu mehr reicht. Auf jeden Fall drängt er mich nicht, und das schätze ich an ihm. Genaugenommen bin ich auch ein wenig verärgert, weil er mir mit seiner Neuigkeit die Show stiehlt. Eigentlich wollte ich ja von dem Vorfall in der U-Bahn erzählen.
„Ist auch nicht so wichtig.“
Der Kellner steht abwartend neben unserem Tisch. Wir bestellen beide eine geeiste Gurkensuppe. Die kommt der biologischen Kost, mit der sich Thomas überwiegend ernährt, noch am nächsten.
„Der Punkt ist, daß sich die Pachler vor die U-Bahn geworfen hat.“ Er schaut mich abwartend an.
„Heute? Glaubst du, daß es der Unfall ...“ ich zögere bei der Wahl dieses Wortes, „war, der heute bei meiner Haltestelle passiert ist?“
„Da bin ich mir ziemlich sicher. So viele Leute bringen sich nicht am selben Tag auf die gleiche Art und Weise um“, sagt er pragmatisch.
„Furchtbar“, murmle ich. Wir schweigen beide ein paar Augenblicke und hängen unseren Gedanken nach.
„Hat ihr Selbstmord etwas mit der Scheidung zu tun?“
Thomas’ gebräunte Hände spielen mit der Speisekarte. „Keine Ahnung. Ich weiß nicht einmal, ob sie sich überhaupt scheiden hat lassen.“ Thomas scheint noch etwas durch den Kopf zu gehen. Ich warte.
„Du weißt ja, daß ich im allgemeinen nicht so viel auf den Tratsch im Amt gebe“, beginnt er schließlich.
Ich nicke zustimmend. Unsere Dienststelle ist für ihre Gerüchteküche berühmt, und auch ich bemühe mich um Zurückhaltung. Oft genug habe ich erlebt, wie leicht man sich mit der Weiterverbreitung von angeblichen Tatsachen in die Nesseln setzen kann.
„Vor ein paar Wochen ist in der Kantine erzählt worden, daß ihr Mann sie unten in der Tiefgarage geohrfeigt hat. Irgendwer wollte sogar die Polizei holen, aber dazu ist es nicht gekommen.“ Thomas rückt ein Stück zur Seite, um dem Kellner Platz für die Suppentasse zu machen. Wir warten, bis er auch das Brotkörberl abgestellt hat.
„Das auch noch, die arme Frau.“ Die Tote hat mein volles Mitgefühl, obwohl sie das jetzt sicher nicht mehr braucht. „Wahrscheinlich hätte die statt des Scheidungsratgebers gleich die Adresse vom Frauenhaus gebraucht.“
„Machst du dir etwa Vorwürfe?“
Ich höre ein wenig Besorgnis aus Thomas‘ Stimme. „Nein.“ Ich nehme mir einen der Löffel und rühre die Suppe um.
„Hast du ihr damals ein Beratungsgespräch angeboten?“ frage ich.
„Nein. Sie wollte nur den Ratgeber. Was sie genau für Schwierigkeiten gehabt hat, hat sie mir nicht erzählt. Sie hat auf mich eher verschlossen gewirkt, vielleicht ein wenig mißtrauisch.“
„Das ist bei mißhandelten Frauen gar nicht so selten“, doziere ich. „Außerdem wollte sie sicher nicht, daß im Amt noch mehr über sie getratscht wird.“ Ich koste von der Suppe. Sie schmeckt ein wenig versalzen.
„Geh, wir haben doch Schweigepflicht“, entrüstet sich Thomas.
„Eh“, beschwichtige ich ihn.
„Und wenn, warum hat sie sich nicht gleich an eine Beratungsstelle oder ans Bezirksgericht gewandt? Da hätten wir dann mit Sicherheit nichts erfahren.“
Ich lege nachdenklich die Stirn in Falten. Da hat er auch wieder recht.
Thomas streicht sich eine seiner Locken hinter das Ohr. Das ist längst nicht mehr so wirkungsvoll wie damals, bevor er sich die lange Mähne hat schneiden lassen. Aber ich will nicht unfair sein. Er sieht auch mit kürzeren Haaren immer noch umwerfend aus.
„Wie alt war diese Pachler eigentlich?“
So Mitte, Ende vierzig hätte ich geschätzt.“ Thomas wischt sich den Mund mit der Serviette ab. Er fächelt sich mit der Hand Luft zu. „Mir wird es hier langsam zu heiß“, stöhnt er.
Mir ist auch warm, aber noch halte ich es für erträglich.
Ich lege meinen Löffel weg. „Deprimierend. In dem Alter fangen viele noch einmal ein neues Leben an.“
„Die Perspektive hat sie vermutlich nicht gesehen.“ Thomas‘ Kommentar ist ernüchternd. „Du, ich muß leider wieder“, ergänzt er nach einem kurzen Blick auf seine Armbanduhr.
„Dringende Termine?“
„Ach was. Diese Umorganisation. Die scheuchen uns von einer Besprechung in die nächste, und wenn wir glauben, daß endlich eine Entscheidung getroffen wird, ist innerhalb kürzester Zeit alles wieder ganz anders.“ Er wirkt ein wenig verärgert.
„Die neue Regierung will halt alles besser machen“, sage ich provokant.
„Sowieso“, grinst Thomas zynisch. Wir werfen uns einen verschwörerischen Blick zu. Natürlich sind wir einer Meinung. Daß die Korrekturen in der GOM, wie die Geschäftsordnung des Magistrats unter Insidern heißt, mehr parteipolitischer Natur sind, ist längst bekannt. Deshalb ist es umso ärgerlicher, daß Bedienstete unter dem Deckmantel der demokratischen Mitbestimmung in Arbeitsgruppen delegiert werden und fundierte inhaltliche Begründungen für die Umorganisation entwickeln sollen. Thomas ist von seinem Chef nominiert worden und hat mir erst vor kurzem wieder bestätigt, wie absurd das Ganze eigentlich ist.
„Bleibst du noch sitzen oder kommst du auch schon mit?“ fragt er dann.
„Ich werde noch einen Kaffee trinken und die Pause ein wenig genießen.“
„Paß auf, daß du keinen Sonnenstich kriegst“, sagt er und legt mir seine Hand kurz auf den Arm. „Ich zahle drinnen. Das geht schneller.“
Ich protestiere, denn eigentlich wäre ich heute mit dem Zahlen dran gewesen.
Er winkt ab und schiebt seinen Sessel zurück. Dann dreht er such um und läßt mich mit meinen Gedanken alleine.
Mona umarmt mich herzlicher als sonst. Bei unserem morgendlichen Telefonat habe ich ihr versprochen, sie nach der Arbeit zu besuchen.
„Schön, daß du gekommen bist“, nuschelt sie in meine Haare.
„Wozu sind Freundinnen da?“ frage ich lakonisch.
„Komm rein. Hast du Lust, dich auf den Balkon zu setzen?“
„Nein, danke. Für heute habe ich schon genug geschwitzt. Dieser Juni hat es heuer wirklich in sich. Ich möchte lieber in deiner kühlen Küche sitzen, statt auf dem Balkon zu verdampfen.“
„Na, da übertreibst du jetzt aber.“ Mona kickt die Haustür mit dem Fuß ins Schloß.
Ich ziehe meine Sandalen aus und stelle sie unter den Garderobenständer.
„Klar können wir in die Küche gehen. Obwohl es auf dem Balkon nicht so schlimm ist, weil die Sonne ohnehin bald hinter dem Nachbarhaus verschwunden sein wird. Aber du hast recht, die Mauern strahlen auch ab.“
Mona wohnt in der Innenstadt und leidet im Sommer wesentlich mehr unter der Hitze als ich, die ich am Stadtrand im Grünen lebe. Dafür hat sie eine Altbauwohnung mit fast vier Meter hohen Räumen. Da ist es zumindest im Sommer erträglicher als in diesen Betonneubauten.
Das Fenster zum Innenhof steht offen. Gegenüber sind die Jalousien heruntergelassen. Vermutlich nicht nur wegen der Hitze, sondern auch als Schutz vor neugierigen Blicken. Mona ist da toleranter. Sie hat nicht einmal im Schlafzimmer Vorhänge. „Ich hab nichts zu verbergen“, betont sie hin und wieder. Und so hält sie es wohl auch heute, obwohl sie nur ein knappes T-Shirt trägt. Ihre zur Abwechslung blond gefärbte Mähne hat sie zu einem Knoten hochgesteckt.
„Ich hätte nicht gedacht, daß es am Nachmittag noch so drückend wird“, sage ich und falte meinen Wickelrock auseinander, so daß auch meine Beine etwas von der angenehmen Kühle haben.
„Es soll eh noch ein Gewitter kommen“, antwortet meine beste Freundin aus Schultagen, während sie zwei große Gläser aus dem Küchenschrank holt.
Das Geplänkel über das Wetter soll uns noch eine kleine Galgenfrist gönnen, bevor wir uns dem eigentlichen Grund meines Besuchs zuwenden.
Ich warte, bis sich Mona zu mir an den Küchentisch gesetzt hat. Ideal eingerichtet, dieser Raum. Eine Küchenzeile mit Kühl- und Gefrierschrank und ein kleiner Eßplatz für zwei Leute. Da Mona überwiegend als Single wohnt, reicht das vollkommen für ihre Bedürfnisse.
Sie schenkt mir aus dem Glaskrug ein.
„Was ist das?“
„Holundersaft von meiner Mutter. Selbstgemacht.“
Wir prosten uns zu. „Schmeckt super. Aber jetzt sag, wie es dir geht.“
Mona fährt sich übers Gesicht und stützt dann den Kopf in ihre Hand. Sie schaut aus dem offenen Fenster. „Frag mich etwas Leichteres. Ich habe keine Ahnung.“
Ich warte auf eine Fortsetzung. Als nichts kommt, ergreife ich neuerlich die Initiative. „Seit wann weißt du davon?“
„Genaugenommen seit heute in der Früh. Ich habe den Test gemacht, mit Morgenurin, so wie sie das empfehlen und das war‘s dann auch schon.“
„Geahnt hast du auch nichts?“
„Geahnt“, sie seufzt. „Jetzt im nachhinein betrachtet, waren da schon ein paar Dinge, die mir komisch vorgekommen sind. So eine penetrante Übelkeit am Morgen und ein leichtes Ziehen in der Brust. Ich hab das aber auf den Streß geschoben. Du weißt ja, die Diss und der Zeitdruck im Job.“
Mona hat die letzten Monate über wirklich sehr viel um die Ohren gehabt. Sie jobbt für diverse Magazine und neuerdings auch für einen kleinen Privatradiosender. Daneben versucht sie, endlich ihre Dissertation fertig zu kriegen. Ich vermute, daß sie den Abschluß nur haben will, um ihrem Vater etwas zu beweisen.
Ich greife nach ihrer Hand und drücke sie. „Warst du schon bei deiner Frauenärztin?“
Plötzlich rinnen Tränen über Monas Gesicht. Sie schnieft. „Entschuldige.“
„Schon gut“, tröste ich sie und nehme sie in meine Arme. Sie legt ihren Kopf an meine Schulter. Ich streichle über ihren Rücken.
„Ja, ich war noch am Vormittag dort. Der Test bleibt positiv“, murmelt sie nach einer Weile resigniert. Sie löst sich aus meiner Umarmung, und ich setze mich zurück auf meinen Platz.
„In der wievielten Woche bist du?“
„Wahrscheinlich schon in der zehnten.“
„Das heißt, dir bleibt nicht viel Zeit für die Entscheidung.“
Mona steht auf und öffnet eine der Laden neben dem Herd. Sie nimmt eine frische Packung Taschentücher heraus und schneuzt sich herzhaft. Dann wischt sie sich auch noch über die Augen.
„Weißt du, das ist es, was mich am meisten quält. Irgendwie habe ich es überhaupt noch nicht begriffen. Da wächst so ein Wesen in mir, und wenn mir nicht jeden Tag in der Früh so schlecht wäre, daß ich am liebsten mein ganzes Innenleben ins Klo kotzen möchte, würde ich gar nichts davon merken. Es ist so unbegreiflich, unwirklich. Verstehst du, was ich meine?“ Sie legt ihre Handflächen auf den Bauch, als könnte ihr diese Geste helfen, die Realität besser zu erfassen. Ich glaube nicht, daß sie wirklich einen Kommentar von mir erwartet, weil sie mich gar nicht zu Wort kommen läßt. „Theoretisch war ich immer überzeugt, daß eine Abtreibung die beste Lösung für Frauen in meiner Situation ist. Ich meine, ohne Partner, der sich mit mir die Verantwortung teilt und ohne regelmäßiges Einkommen und so. Aber jetzt, wo es konkret ist, bin ich mir total unsicher.“ Sie schluchzt noch einmal.
„Ich weiß, die biologische Uhr tickt“, klinke ich mich ein, denn diese Diskussion ist nicht neu. Sie gehört mehr oder weniger zu unseren Standardthemen.
„Ich werde bald vierzig, und einen idealen Zeitpunkt für ein Kind wird es in meinem Leben nie geben.“
Ich spüre ihren Schmerz und möchte ihr gern einen Teil davon abnehmen. „Also, bis zu deinem Vierziger sind es noch ein paar Jahre“, versuche ich zu argumentieren, um wenigstens etwas Ermutigendes zu sagen. „Aber ich verstehe, was du meinst. So eine Entscheidung zu treffen ist der Hammer. Immer läuft man Gefahr, sich später einmal Vorwürfe zu machen, weil man doch das Falsche getan hat.“
Mona legt das zusammengeknüllte Taschentuch auf den Tisch und hält sich statt dessen am Glas fest. „Eine junge Mutter bin ich auch nicht mehr. Eine Erstgeburt in meinem Alter ist ein Risiko. Erbkrankheiten und was weiß ich, was noch alles. Aber wem erzähl ich das?“
„Ja, aber wir kennen doch genug Frauen, bei denen es gut gegangen ist. Irene war sogar schon 45, als sie ihr erstes Kind gekriegt hat“, versuche ich sie aufzumuntern. Sie schaut mich zweifelnd an.
„Ich würde mich von der Altersfrage nicht fertig machen lassen. Garantien gibt es ohnehin nie.“
Sie seufzt. „Hast recht. Es ist halt alles nur so schwierig.“ Sie nimmt einen großen Schluck von ihrem Holundersaft.
„Weiß er eigentlich schon davon?“
Es dauert einen Moment, bis sie kapiert, wen ich meine. „Nein. So lange ich mir nicht im klaren bin, ob ich das Kind will, werde ich ihn auf gar keinen Fall anrufen“, antwortet sie schließlich sehr bestimmt.
„Habt ihr eigentlich schon einmal über das Thema geredet?
Überrascht hebt sie den Kopf. „Ich meine, theoretisch“, füge ich hinzu. „Hast du eine Ahnung, wie er sich verhalten wird, wenn er davon erfährt?“
Mona schüttelt den Kopf. „Alles hypothetisch. Er hat immer wieder betont, daß er mit mir zusammenbleiben will. Daß ich genau die Frau bin, von der er immer geträumt hat.“ Sie rümpft die Nase. „Aber wer weiß, was ihm einfällt, wenn es jetzt ernst wird?“
Die Frage kann ich ihr auch nicht beantworten. „Und du? Kannst du ihn dir überhaupt als Vater vorstellen?“
Mona klopft mit dem Fingernagel gegen ihr Glas. „Es gibt sicher schlechtere.“ Sie schneuzt sich noch einmal in das Taschentuch und wirft es dann in Richtung Mistkübel. Es fällt daneben. Sie ignoriert es und starrt an mir vorbei auf die Jalousien gegenüber. Ich folge ihrem Blick. Es ist irgendwie düster geworden. Die Lamellen klappern leise im Luftzug. Womöglich ein Vorbote des angekündigten Gewitters? Ein greller Blitz spiegelt sich für Sekundenbruchteile im Fensterglas und bestätigt meine Vermutung.
„Ich hab noch Wäsche am Balkon“, sagt Mona in die Stille. Als ob das jetzt wichtig wäre. Wir schauen uns an und müssen beide lachen. Dann rappeln wir uns auf, um den vollen Wäscheständer ins Schlafzimmer zu schleppen.