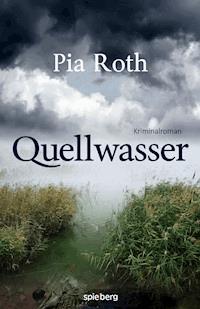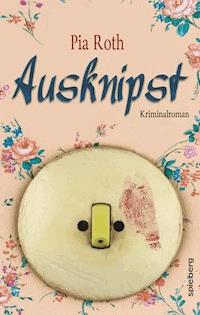
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Spielberg Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Fall für Weinzierl und Oberhauser. Ein toter Asylbewerber. Nicht ganz einfach in einer Zeit, in der man sofort differenziert: Gut oder böse, links oder rechts, Gutmensch oder Nazi. Wie zu erwarten: Eine Gratwanderung. Doch die Kommissare haben auch ein Privatleben, oder zumindest was davon bleibt. Weniger wäre mehr, wenn überraschend die Mutter auf der Matte steht. Und das nicht allein. Sie hat ihren Putzfimmel mitgebracht. Über Jahre gehegt und gepflegt. Richtig aufgeblüht ist er; geradezu perfektioniert. Es beginnt eine Leidenszeit für Weinzierl und seinen Hund. Da hilft auch eine Frau Dr. Sandra Fröhlich nicht wirklich. Magda Oberhauser spielt Theater. Eine kleine Rolle. Der Senfsamen in Shakespeares Sommernachtstraum. Oberhauser leidet unter ihrer Abwesenheit. Sie ist nicht da für ihn, wenn er sie braucht. Und das tut er. Gewohnheitsmäßig. Sie werden auch diesen Fall zu Ende bringen, die beiden Kommissare aus Regensburg. Allerdings mit Kratzern auf der Seele.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vollständige eBook Ausgabe 2017
© 2017 SPIELBERG VERLAG, Neumarkt/Regensburg
Umschlaggestaltung: Ronja Windmeißer
Umschlagbild: © Gina Sanders - fotolia.com
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
(eBook) ISBN: 978-3-95452-083-1
www.spielberg-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Pia Roth (Ps.) wurde in München geboren. Nach einer Lehre zur Bankkauffrau, arbeitete sie viele Jahre als Verwaltungsangestellte.
Nach ihrem ersten Kriminalroman ›Quellwasser‹, folgte 2014 der Krimi ›Schwammerl-Risotto‹. In ihrem neuen Buch ›Ausknipst‹ lässt sie das Ermittler-Duo - Weinzierl und Oberhauser - einen ganz speziellen Fall lösen. Roth lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Regensburg.
»Was glauben Sie, was in diesem Land los wäre, wenn mehr Menschen begreifen würden, was in diesem Land los ist.«
Volker Pispers
Kapitel 1
»Biermoser, gud Moang!« Man traf sich auf dem Gang zu den Büros im ersten Stock der Kriminalpolizei in Regensburg.
»Servus Weinzierl! Na, wie geht’s so alloa ohne Kollegn? Hast ja im Moment ned so vui z’doa, wie ich ghört hab, gell?« Angriffslust lag in Biermosers Stimme. »De Drecksarbat ham ja mir, der Huber und ich.« Er räusperte sich.
Weinzierl überhörte den Vorwurf. »Und? Kummts weiter mit eurer Bahnleich?«
»Ach, koa Drodenga! Es war ja sowieso a Glück – ach, was hoaßt in dem Foi scho Glück! Für uns wars koans«, bellte er, »dass oana von da Feiawehr gmerkt hod, dass der Mo scho tot war, bevor eam da Zug dawischt hod. Du woaßt scho, oana von dene Männa, die de Streckn gramt ham. Und der gute Doktor Anton Späth hat des nach da Leichenschau bestätigt.« Er machte eine abwertende Bewegung mit dem Kopf hin zu Weinzierl, als hätte dieser bei der Obduktion assistiert und wäre persönlich für die Diagnose verantwortlich, ehe er fortfuhr: »Glaubst, uns war liaba gwesn, der Feiawehrler hätt des ned gmerkt. Er hat gmoant, dieser Mann hätte nicht geblutet! So ein Gschaftl! Aber des nur unter uns. Und mir stenga jetzt da, wia da Ox vorm Berg. Der Mo war a ordentlicher Familienvadda, zwoa Kinder, verheirat mit a schena Türkin«, wobei er mit der Zunge schnalzte, »mit am guadn Job, politisch engagiert, ehrenamtlich in mehreren Vereinen und allgemein beliebt. Da find amoi wos, wost osetzn konnst.« Ärgerlich, wie er nun war, schüttelte er den Kopf und wechselte zu etwas Ergiebigerem: »Wo hast denn heid dein Hund?« Herausfordernd schaute er nach rechts und links.
»Der ist bei der Nachbarin, da wo er immer ist, wenn ich ihn ned dabei hab.« Weinzierl wandte sich bereits zum Gehen. Das heikle Thema Hund mit Biermoser zu erörtern, brachte beide ziemlich sicher an den Rand eines Konflikts.
Aber der Kollege war noch nicht fertig: »So, aha! Bei dir mächad i Nachbar sei, des derfst ma glam!« Sein Blick sagte weit mehr als seine Worte. Dann, selbst Biermoser mochte die Woche nicht in Unfrieden beschließen, etwas versöhnlicher: »Wann kummt denn da Hausl wieda?«
»Am Montag ist er wieder da, so Gott will, und er sich ned an Virus eighandelt hat in seim Urlaub. Oder ein kleines Bazillchen. Du kennst ihn doch! Er ist prädestiniert im Dawischen von Krankheiten, welcher Art auch immer.« Weinzierl steckte den Schlüssel ins Schloss seiner Bürotüre.
»Kleines Bazillchen! Hä, hä, hä, des is guad!«, krächzte Biermoser. Beide lachten. Darin war man sich einig. Hier wollte und konnte selbst der Kollege nicht widersprechen.
»Also, servus Sepp. Einen erfolgreichen Freitag wünsch ich euch, dir und dem Huber. Und koane Bahnleichen mehr! Und a schens Wochenend, falls ma uns nimmer seng. Servus.«
»Habe die Ehre Kurt! Du hast ja bestimmt einen geruhsamen Tag. Du scho! Oiso, dir a a schens Wochenend.« Biermoser tippte sich an die Stirn und verschwand in seinem Büro.
Weinzierl sperrte die Türe auf und trat ein. »Wie’s da herin wieder müffelt«, brummelte er vor sich hin, dachte flüchtig an das Stück Käse, das er gestern auf die schnelle in der Schreibtischschublade deponiert hatte, öffnete das Fenster und starrte gedankenverloren auf die Straße. Erst hatte er sich auf die Zeit gefreut, die er allein hier im Büro verbringen sollte; konzentriert arbeiten wollte er. Aber jetzt, nach zwei Wochen war er es leid, so ohne Ansprache, ohne Kontroversen und ohne Lachen hier herumzusitzen. Es war wie jedes Jahr, wenn der Kollege im Urlaub war. Noch dazu war im Moment bei ihnen wirklich nicht viel zu tun, wie Biermoser es grantig, leicht neidisch, doch richtig bemerkt hatte. Er wandte sich vom Fenster, füllte die Kaffeemaschine und setzte sich an seinen Schreibtisch. Gelangweilt machte er sich über Arbeiten her, die bereits seit einiger Zeit unberührt herumlagen und die er in der kollegenfreien Zeit wegarbeiten wollte. Das trug nicht dazu bei, seine Laune zu verbessern. Wird Zeit, dass der Hausl wieder kommt, dachte er und erledigte einen Teil der Ablage via Papierkorb. Selbst der Kaffee schmeckte so allein beinah wie lauwarmer Tee. Bei Tee dachte er an den Kollegen und lächelte. Apropos Tee: Hatte er Frau Künzer informiert, dass ein Paket für ihn auf dem Weg war, und sie es für ihn in Empfang nehmen sollte? Er hatte sich endlich, nach langem Überlegen, dazu entschlossen, einen Kaffeevollautomaten anzuschaffen und einen solchen im Internet bestellt. Er kannte sich inzwischen aus mit der modernen Kommunikation. Selbst der Hausl hatte das bereits bemerkt. Dieser sparte sich mittlerweile Bemerkungen über unbedarfte Kollegen, die der Fortschritt – er meinte damit das Internet – nicht beleckt hatte. Hatte er doch seit einiger Zeit einen heimischen Internetzugang und damit das aktuelle Wissen. Kurts Gedanken kehrten zurück zu seiner Bestellung. Über eintausend Euro kostete dieses Brühwunder aus der Schweiz. Würde Frau Künzer die Sendung nicht in Empfang nehmen, musste er am Samstag, also morgen, nach Wörth fahren und das Paket selbst bei der Post abholen. Dazu hatte er wenig Lust. Was ihn dort erwartete war bekannt. Er würde dann wieder ewig in dem engen Laden stehn, ganz hinten in der Schlange, und er würde vor sich hin schimpfen, mehr oder weniger laut, über die langsame, trödelige Abfertigung. Er würde murren über die Extrawünsche der Kunden und mit dem neben ihm Harrenden, der ebenfalls grantig motzte, wissende Blicke tauschen. Der Andrang war gerade an Samstagen besonders groß. Er ärgerte sich dann darüber, dass einige unter den Wartenden genauso gut an einem Wochentag den Weg zur Post machen könnten und nicht am Samstag den Schalter blockieren mussten. Aber wie es so ist, wenn er dann endlich dran war, gab es sicher auch bei ihm wieder Schwierigkeiten bei der Herausgabe der Sendung. Die gab es immer. Irgendwas war selten so, wie es den postalischen Vorschriften entsprechend sein musste. Entweder hatte er seinen Pass vergessen oder derselbe war abgelaufen, was auch schon einmal vorgekommen war. Oder er hatte die Mitteilung vom Paketdienst zu Hause liegen lassen oder sie war nicht ordnungsgemäß ausgefüllt; oder die Abholfrist war bereits abgelaufen und das Erwartete wieder auf dem Weg zum Absender, auch das war ihm schon passiert. Er hatte auch des Öfteren erlebt, dass die Sendung zum genannten Abholtermin noch nicht im Postamt eingetroffen war. Sie war anscheinend noch unterwegs oder lagerte irgendwo, wäre aber sicher an einem der nächsten Tage abholbereit, würde die trostreiche Auskunft lauten. Sie fanden immer ein Argument, um das Erwartete nicht aushändigen zu müssen, so kam es ihm wenigstens vor. Und die Schlange der Wartenden wuchs, während er am Schalter resigniert dem Kommenden entgegensah. Oft war dann aus der Reihe hinter ihm Geraune oder sogar Schimpfen zu hören, was er als unmöglich, überflüssig, ja geradezu empörend empfand. Man kannte das Prozedere doch! Musste man das denn dauernd kommentieren? Peinlich. Mitmenschen gab es! Er konnte sich nicht erinnern, dass irgendwann so eine Paketabholung problemlos über die Bühne gegangen wäre. Apropos Bühne. Da fiel ihm ein, dass die Magda nun zur Gilde der Schauspieler gehören würde. Zu den Laienschauspielern, um der Wahrheit Ehre zu geben. Der Hausl hatte ihm so was erzählt am letzten Tag vor seinem Urlaub. Er stand auf, holte sich Kaffee. Seit sie die neue Kollegin hatte in der Kanzlei, in der sie arbeitete, würde sie sich für die Schauspielerei interessieren, seine Magda, hatte er gesagt. Die Magda wäre prädestiniert für die Bühne, soll die neue Kollegin gemeint haben. Und anscheinend hatte sie Magda davon überzeugt. Hausl war eher skeptisch, kam es Kurt vor. Sie würden ein Stück von Shakespeare aufführen im Saal vom Stümpflinger. Kurt hatte gelacht, als Hausl ihm das berichtet hatte. Das passte wie die Faust aufs Auge. Der Sommernachtstraum auf der Bühne beim Stümpflinger! Ausgerechnet beim Stümpflinger! Kurt grinste in sich hinein, knüllte ein Blatt Papier, das für die Ablage bestimmt war und warf es in den Papierkorb. Magda im Sommernachtstraum! Wen würde sie wohl darstellen? Erbsenblüte, Spinnweb, Motte, Senfsamen? Also eine der Elfen? Nein. Dazu war sie nicht mehr jung genug. Obwohl, warum mussten Elfen eigentlich jung sein? Sicher gab es auch ältere, alte Elfen, sofern es überhaupt Elfen gab. Er spitzte einen Bleistift und stellte sich Magda als Senfsamen vor, klein, rund und kugelig. Das ging nicht. Auf keinen Fall! Kurt hätte das Argument Alter oder Figur niemals vor den Ohren seines Kollegen vorgebracht. Aber so bei sich….Magda als Senfsamen! Fast gemein. Nein. Magda als Spinnweb! Hi, hi. Magda als Spinnweb! So ein Fädelchen war sie nun auch wieder nicht. Er griff zum nächsten Stift und merkte nach der ersten Umdrehung, dass er einen Kugelschreiber erwischt hatte. Er legte ihn weg und gestand sich seine gedachte Gemeinheit ein. Spinnweb! Nein, das ging überhaupt nicht. Er wischte den Gedanken beiseite. Sie wäre eher geeignet für Hippolyta, die Königin der Amazonen. Er sah sie auf einem weißen Pferde sitzend mit entblößter Brust – wie es sich für Amazonen gehört – erhobenen Hauptes, Armbrust und Pfeil in den Händen. Und das auf der Bühne beim Stümpflinger. Unmöglich! Aber Hippolyta würde schon in ihre Richtung gehen. Nur die entblößte Brust… Nein. Kurt stand auf, entleerte den Spitzer und setzte sich wieder. Magda war Titania! Nur die Rolle der Titania kam für sie in Frage. Die Königin der Elfen. Das war die Magda! Seine Fantasie schlug Blasen. Und der Hausl war Oberon. Hausl als Oberon! Das war wie Stoiber als Kanzler! Kurt lachte laut und schlug sich auf den Schenkel. Oberon und Titania Oberhauser! Und der Herr Schröder war der Puck! Aber Hausl spielte ja gar nicht mit und der Hund wahrscheinlich auch nicht. Gott sei Dank. Bisher, jedenfalls, hatte Hausl diesbezüglich nichts angedeutet. Es reichte schon die Magda. Kurt saß da und träumte vor sich hin. Das kommt davon, wenn man so allein ist, dachte er nach geraumer Zeit. Man wird merkwürdig. An was man so alles denkt! An Magda mit entblößter Brust. Pfui über ihn! Aber irgendwie hatte die Vorstellung was. Sicher hatte sie einen schönen Busen. Alles an ihr war nach seinem Geschmack. Und nach dem Geschmack vom Kollegen. Also fort mit diesen Gedanken. Er mochte diese Frau, daran bestand kein Zweifel. Und er mochte den Hausl. Schon darum kam sie als Hippolyta nicht in Frage. Auf keinen Fall spielte Magda die entblößte Hippolyta! Nicht einmal mehr in seinen Gedanken. Und schon gar nicht beim Stümpflinger. Das Telefon tat ein Übriges.
»Ah, servus Anton. Was gibt’s? Sag bitte nicht, du hast a Leich für mich. Nicht mehr in der Woch, ned heid am Freitag! Nächste Woch kannst uns eine aufs Aug drücken, wenns schon sein muss, da ist dann der Hausl wieder da. Wennst heut eine hast, gib sie dem Biermoser, der gfreit sich; hat er mir vorhin gsagt.« Pause. Kurt hörte zu. »Ach, so! Sag des doch gleich. Nein. Leider, kann ich heut nicht. Gern wär ich wieder einmal zum Stammtisch gekommen, aber heut muss ich mich um meinen Hund kümmern, der kennt mich ja schon gar nimmer. Die ganzen letzten Tag war er jetzt bei der Nachbarin. Des ist schon fast eine Zumutung, weißt. Mitbringen? Meinen Hund? Ich glaub, besser nicht. Wer weiß, was er wieder anstellt. Außerdem stinkt er bestimmt wieder und dann müsste ich ihn erst baden. Mei, Anton, mit dem Kerl hab ich mir was aufbrummt.« Pause. »Ja, ja, du hast mich gewarnt! Ich habs nicht vergessen. Aber mei, so ists halt. Na, heut geht’s wirklich nicht. Mach ma was aus für nächste Woch am Freitag, da ist dann a der Hausl wieder da. Du, ich gfrei mich. Wirklich. Hab schon an richtigen Stammtischentzug. Also dann, bis nächste Woch, da telefoniern wir dann aber vorher noch einmal. Servus Anton, und a schöns Wochenend.« Er legte auf. Gern wäre er heute wieder einmal zum Stümpflinger gegangen. Seit vierzehn Tagen hatte er keine richtige Ansprache mehr, seit der Hausl in Urlaub war. Freilich, mit den anderen Kollegen hatte er schon hi und da einen Ratsch gehalten. Aber so eine richtige, tiefgehende Unterhaltung, nein, die hatte er nicht gehabt. Mit dem Helmut oder der Hannelore so über den Gartenzaun ein paar Worte übers Wetter oder Pawels neue Streiche, ja, das schon; mit Frau Künzer über Mephistos Unmöglichkeiten oder Floris schulische Leistungen, die oftmals nicht ihren Erwartungen entsprachen. Aber sonst? Der Hausl fehlte ihm schon sehr. Er hätte das gar nicht gedacht. Jedes Jahr traf er diese Feststellung aufs Neue.
Wieder läutete das Telefon. »Weinzierl. Ja, Frau Künzer, griaß eahna! Was…?« Weiter kam er nicht. Frau Künzers Stimme überschlug sich bereits: »Herr Weinzierl, es ist was Furchtbares passiert! Der Mephisto ist angefahren worden. Oh mei, oh mei! Und es schaut nicht gut aus.« Es folgte ein erbärmliches Schluchzen. »Mein Gott, er hat nicht gefolgt. Ich war beim Einkaufen, da hab ich ihn dabeigehabt.« Wieder war nur ihr Weinen zu hören und Gestammel. »Einfach losgerissen hat er sich, wegen der Katz.« Schluchzen. »Und dann ist es passiert. Er ist hinter dem Vieh her über die Straß. Er war so schnell, hat sich losgerissen, einfach so. Mein Gott, Herr Weinzierl, ich hab ihm noch gschrien! Herr Weinzierl, bitte kommen Sie! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist so schlimm und ich bin schuld!« Er hörte, wie ihre Stimme langsam wieder in Höhen stieg, die einem Weinkrampf vorausgingen. »Frau Künzer, ich komm sofort, bleibens ruhig. Ich bin schon unterwegs. Wo sinds denn?« Darauf verließ er das Büro im Laufschritt.
Auf der Heimfahrt plagte ihn sein Gewissen. Er hatte seinen Hund vernachlässigt. Aufs Gröbste hatte er ihn vernachlässigt. Er hatte sich nicht um ihn gekümmert. Was war er doch für ein schlechter Mensch, ein mieses Herrli. Wenn er so nachdachte, konnte er sich nicht erinnern, in letzter Zeit für seinen Hund auch nur ein paar freundliche Worte gehabt zu haben. Immer hatte er nur mit ihm geschimpft. Sein ewiger Gestank ging ihm auf die Nerven. Sogar vorhin beim Anton hatte er ihn noch angeschwärzt. Und nun das. Er verachtete sich. Es war seine Schuld, dass der Hund nicht folgte. Keine fünf Minuten hatte er sich Zeit genommen, den Kerl ordentlich zu erziehen. Im Gegenteil, oft hatte es ihn belustigt, wenn sich der Hund daneben benahm. Als er die Wurst vom Biermoser gefressen hat, war er fast stolz auf ihn. Und jetzt das. Grad recht geschieht es mir. Und der unschuldige Mephisto musste es ausbaden. Das zweite Mal ist er jetzt schon angefahren worden. Hoffentlich überlebt er es. Wenn er diesmal noch durchkam, wollte er in Zukunft alles besser machen. Eine Hundeschule würde er mit ihm besuchen. Er wollte sich künftig um ihn kümmern. Er gelobte es. Er fing an, das Vaterunser zu beten, hörte aber bald wieder auf, er hatte den Text vergessen. Auch das noch. Ein ganz schlechtes Omen. Die letzte Zeit war der Kerl doch nur bei den Künzers deponiert. Aber es war doch sein Hund! Armer Mephisto. Das schlechte Gewissen hatte ihn voll im Griff. Er fühlte, wie auf seiner Stirn Hörner wuchsen.
Am Nachmittag berichtete er Flori, was die Tierärztin an Verletzungen festgestellt hatte. »Ach, weißt, Flori, die Fraktur am Hinterlauf wär noch das kleinere Übel. Die Milzruptur ist das Schlimme. Und dazu kommt, dass unser Tierarzt nicht da war. Auch das noch. Jetzt hab ich ihn nach Oberachdorf zu der Neuen bringen müssen. Woher soll ich wissen, ob die was taugt. Aber auf die Schnelle ist mir nichts anderes übrig geblieben. Sie hat ihn operiert und zur Beobachtung dabehalten. Jetzt weiß ich nicht, wie es ihm geht, ich erreiche sie nicht. Nur der Anrufbeantworter ist dran. Glaubst Flori, richtig fertig bin ich.« Er stöhnte leise und wischte sich mit zittriger Hand über die Stirn, auf der Angstschweiß stand.
»Ach Herr Weinzierl, ich glaub, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, wenn es ihm schlecht ginge, würde die Frau Sie schon anrufen. Ich mein, es wird schon wieder.« Der Optimismus der Jugend, dachte Weinzierl, erwiderte aber mit einem Nicken. Floris Worte trafen nicht ganz den Nerv, der bei ihm blank lag. Kurt kannte die Tierärztin ja nicht. Er kannte auch keinen, der sie kannte, bei dem er sich informieren könnte über ihre Fähigkeiten, ihr Fachwissen, ihr Können. Sie hatte die Praxis erst kürzlich eröffnet. Ihm war sie nicht so recht vertrauenswürdig vorgekommen. Gut, sie hatte eine Diagnose gestellt. Fragt sich nur, ob die auch richtig war. Sie hatte seinen Mephisto operiert. Da hatte er aber nicht dabei sein dürfen. Wahrscheinlich, damit er nicht mitbekam, wenn sie Fehler gemacht oder stümperhaft gearbeitetet hatte mit ihren lackierten Fingernägeln. Er traute dieser Frau nicht zu, seinen Hund richtig verarztet zu haben. Er würde es überhaupt keiner Frau zutrauen, wenn er ehrlich war. Ein Tierarzt war ein Mann! Er stellte sich vor, er hätte ein Pferd gebracht. Wie sollte diese Frau mit so einem großen Tier fertig werden? Würde sie nicht. Dazu fehlten ihr schon rein körperlich alle Voraussetzungen. Daraufhin überlegte er, seinen Hund abzuholen und in die Tierklinik zu bringen. »Was meinst du?«, wandte er sich an Flori, der ihm gegenübersaß und Weinzierls Selbstgespräche an sich vorbeiziehen ließ, »soll ich ihn in die Tierklinik bringen? Die kennen sich halt aus.«
»Und wenn ihm der Transport schadet, so kurz nach der Operation? Wenn ihm dann was passiert, ist es Ihre Schuld. Ich würde ihn dortlassen.« Flori hatte nicht ganz unrecht. »Ich glaub, ich muss jetzt wieder zu meiner Oma rauf. Die ist auch ganz fertig, weil ihr das heute passiert ist. Aber ich kenn den Mephisto. Oma trifft ganz bestimmt keine Schuld. Er kann ein furchtbarer Hund sein. Und hören tut er rein gar nicht. Man müsste mit ihm in eine Hundeschule. Da lernt er, dass er folgen muss. Und ganz ehrlich, das wäre nicht schlecht. Der Kerl macht nur, was er will. Ich habe auch oft meine Schwierigkeiten mit ihm. Aber ich bin halt schneller als meine Oma. Sie hatte keine Chance bei ihm. Noch dazu, wenn er eine Katz gesehen hat. Bei Katzen dreht er jedesmal völlig durch. Er muss unbedingt das Folgen lernen.«
»Genau das hab ich auch gedacht, heute Vormittag beim Heimfahren. Er muss lernen, dass er zu gehorchen hat. So geht das mit dem Kerl nicht weiter. Ich werde mit ihm in die Hundeschule gehen. Sofern er wieder gesund wird..«, stöhnte er, stand auf, griff zum Telefon und wählte erneut die Nummer der Tierärztin. Wieder erreichte er nur den Anrufbeantworter. »Herr Weinzierl, ich geh jetzt. Wenn Sie was hören, sagen Sie uns bitte Bescheid. Schon wegen der Oma.«
»Mach ich Flori, ist doch klar. Und sag ihr, sie braucht sich keine Gedanken machen, sie trifft keine Schuld, ich kenn meinen Hund.«
Das Brühwunder stand bei Frau Künzer. Weinzierl hatte es vergessen. Auch Frau Künzer hatte anderes im Kopf.
»Diese Herwarterei halte ich nicht aus. Das ist ja zum aus der Haut fahren«, stöhne Weinzierl als er die Tür hinter Flori schloss.
Da fiel ihm der Anton ein. Genau, den Anton musste er fragen. Der kannte sich aus; der wusste bestimmt, was bei einer Milzruptur zu tun war, wie sie behandelt werden musste. Und er kannte seinen Mephisto, hatte er ihm doch schon einmal das Leben gerettet. Das war die Lösung überhaupt! Und er musste den Abend nicht allein verbringen. Er würde zum Stammtisch fahren. Zu Hause, so auf sich reduziert, würde er doch keine ruhige Minute haben. Gesagt, getan.
Beim Stümpflinger war Hochbetrieb. Freitagabend. Der Stammtisch war schon fast bis auf den letzten Platz besetzt. Und auch sonst war einiges los. Es hatte sich offensichtlich weiträumig herumgesprochen, dass man hier besonders gut und reichlich aß. Hausl schwörte auf die Küche vom Wirt. Kurt bahnte sich den Weg zum Stammtisch, an dem bereits in trauter Runde der Anton saß und ganz offensichtlich die Anwesenden politisch auf Vordermann brachte. Die Männer am Tisch, der Apotheker Ernst Knaus, der Professor Doktor Ludwig Leuther, Philologe emeritus, Doktor Paul Langer, ehemaliger Chirurg – die Herren waren Mitglieder des Stadtrates – hörten mehr oder weniger interessiert zu. Sie kannten den Anton und wussten ihn zu nehmen. Späth gestikulierte mit dem Weißbierglas in der Hand und übertönte die Gespräche an den Nachbartischen. Vom Tisch, an dem die Mitglieder des Sportvereins saßen, wurden Stimmen laut, die den Pathologen um phonetische Mäßigung baten. Mehr oder weniger freundlich und natürlich vergeblich. Am anderen Nachbartisch, den der Kirchenchor belegt hatte, wurden Antons laute Kommentare mit gottergebenem Kopfschütteln bedacht. Man wusste Bescheid. So war er immer. Politik war sein Leben und kam gleich nach oder sogar vor seinen Leichen. Kurt überlegte kurz, wieder nach Hause zu fahren, als er Anton so in seinem Element sah. Es war ihm fast etwas peinlich, sich dazu zu setzen. Das aufkommende Schamgefühl unterdrückte er. Er würde den Anton mit seinen Fragen nach den Genesungsaussichten seines Mephistos auf andere Gedanken bringen und von seinem politischen Vortrag ablenken. Dieser setzte in dem Augenblick, als Kurt Platz nahm, sein Bierglas hart auf den Tisch, es schwappte über. »Bist jetzt doch kuma?« Er wischte die Bierlache mit einer kurzen Handbewegung vom Tisch. Es interessierte ihn nicht, dass der Schwall auf der Hose seines Nachbarn landete. Mit solchen Nichtigkeiten vertat er die kostbare Zeit am Stammtisch nicht. Da gab es beileibe Wichtigeres. Er erwartete von Kurt keine Antwort, sondern setzte seine Rede, die durch dessen Eintreffen kurz unterbrochen worden war, fort: »Ich lass mir das doch nicht verbieten! Ich sag Neger! Grad und mit Absicht. Neger hab ich schon als Kind gesagt, genau wie meine Mutter. Und Zigeuner sag ich auch! Ja Himmelherrgottsakrament, wo kummatn mir denn da hi, wenn so dahergelaufene, selbsternannte Gutmenschen von einer grünen oder roten Partei nimmer wissen, was sie uns noch alles vorschreibn solln? Ha? Einen verordneten fleischfreien Dog in da Woch! Veggieday! Fandad i generell ned schlecht. Aber ich lass mir doch das nicht vorschreiben! Am Dienstag koa Fleisch! Vielleicht hab ich aber grad am Dienstag einen Heißhunger auf eine Blutwurst. Und am Mittwoch Lust auf Dampfnudeln. Und dann? Diesen Paternalismus lass ich mir ned gfalln. Alles wird einem vorgschrieben. Fehlt nur noch, dass sie uns song, wann wir zum Scheißen gehen dürfen. Alle, die arbeiten müssen, morgens von 5 Uhr 50 bis sieben Uhr. Dann die Schüler von sieben bis halb acht. Die Alten und Hausfrauen von acht bis zehn Uhr. Das würde die Wasserwerke entlasten. Es geht doch wirklich nicht an, dass alle gleichzeitig aufs Klo rennen. Der Karl Valentin war schon für eine solche Regelung. Am Montag nur Radfahrer, am Mittwoch nur Droschken, am Samstag nur Bierfuhrwerke. Und die Feierwehr nur am Feiertag. Bei dem war es Parodie. Aber diese Weltverbesserer meinen es ernst! Und dann die Demonstrationen gegen Rechts! Dabei san die Linken koa bissl besser mit eanare Methoden. Im Gegenteil!« Er schnaubte und fuhr dann ungebremst fort: »Neger deafat ma nimma song! Das Wort bedeutet nix anders als schwarz. Da beißt sich doch d´ Katz in Schwanz! Sog i Neger, moan i schwarz; sag i schwarz, konn i genausogut Neger song. Als ob des was schlimmes wär! Neger! Da hört sich doch ois auf! Negerküss ham mir gessen als Kinder. Guad warns. Oder Mohrenköpf. Genau des gleiche. Und, hamas überlebt? Aus den Kinderbüchern werds rausgstrichen, das Unwort Neger! Habts ihr sowas scho ghört! Als nächstes ist dann die Bücherverbrennung dran! Ham mir alles scho einmal ghabt. Gell!« Er nahm einen tüchtigen Zug, schaute angriffslustig in die Runde und fuhr fort, ehe ein anderer zu Wort kam: »Ich lass mir das nicht gfalln! Wo kämen wir denn da hin? Was bilden die sich denn überhaupt ein, uns vorschreiben zu wollen, was wir sagen dürfen und was nicht? Bei Zigeuner machen sie das selbe Gschieß. Dabei kann ich mich erinnern, dass meine Mutter damals schon gsagt hat, Kinder helfts mir die Wäsch runtertun, Zigeiner kumma!« Herausfordernd streifte sein Blick die Anwesenden. Keiner sagte was. Keiner wollte sich mit dem Anton anlegen. Es wäre überdies zwecklos. »Wennst ned redst, wie die Grünen und die siebengscheidn weltverbesserischen Gutmenschen sich des vorstelln, warst a schon ein Nazi. Des geht heut schnell. Und bsonders wichtig machen sich da diese türkischen Verbände. Habts des mitkriegt, wie die Hinterbliebenen der NSU-Opfer entschädigt worden sind? Wann, bitte, sagts es mir, wennz es wissts, wann ist den deutschen Angehörigen nach einem Mord durch Ausländer so viel Geld in den Arsch blasen worden? Ha? Hat der türkische Staat je deutsche Opfer entschädigt? Aber da sagt koana was!« Herausfordernd blickte er in die Runde. »Aber bei dene scheißt man sich in Frack. Da wird buckelt vorn und hinten! Von dene kriegt auch keiner eine gscheite Straf, wenn er wieder mal einen halb totgeprügelt oder -getreten hat. Die Nationalität der Täter wird in den Zeitungsberichten nicht einmal mehr erwähnt. Man traut sich nicht mehr Ross und Reiter zu nennen. Wennst wissen willst, woher so ein Täter kummt, muasst in der Bildzeitung nachlesen. Sunst traut sich keine Zeitung, die Nationalität preiszugeben. Diese Leit können sich aufführen, wie sie wollen. Und da soll mas dann nicht dick kriegen, die Bagage. Da Kohl wollte sie noch loswerden, die Sippschaft, weil die nicht in unsere Gesellschaft passt, hat er gmeint. Hätt ich dem alten Knaben gar nicht zugetraut, soviel Weitblick und Verstand. Aber wir heute: Nur des Geringste wennst dagegen sagst, bist ein Rechter. Ich sag euch, so gesehen bin ich es gern, das ist heut schon fast eine Auszeichnung, eine Ehre. So weit is kumma bei uns! Geh, leckts mich doch am Arsch! Schwoamas owe!" Zustimmung vorausgesetzt überblickte er die Runde, während er einen tiefen Schluck vom Bier nahm. Dann hielt er das leere Glas in die Höhe: »Mare, bring ma noch oans! Des Reden macht an Durscht!«
Weinzierl nutzte die Gelegenheit, Anton die Fragen zur Genesungsaussicht seines Mephistos zu stellen. Nach kurzer Überlegung, in der er aus den Sphären der Politik ins Jetzt und Hier zurückkehrte, meinte Anton: »Dea werd scho wieder!« Und dabei blieb es. Nichts konnte ihm seine Wutrede versaun: »Geh, Mare, was soll des! Doch koa Helles, a Weißbier, wia immer.« Er hielt ihr sein Glas hin, böse aufblickend. »Also: I bin dagegen, dass mir dafür san: I moan: Ihr vom Stadtrat seids für des Asylantenheim. Habts eich des a guad überlegt?« Dabei streifte sein Blick den Apotheker Ernst Knaus. Der wollte etwas sagen, kam aber nicht dazu. Anton schnitt ihm mit einer kurzen Handbewegung das Wort ab und grantelte weiter: »Es is nur furchtbar, dass die nächsten Wahlen erst in a paar Jahr san.«
Er machte eine Pause und kam zum nächsten wunden Punkt, wissend, dass die betreffende Gegend am Stammtisch vertreten war: »Und wos moants, wie Dortmund moang spuit? Wahrscheinlich verlierns wieder. Wie allerweil in da letzten Zeit.« Am Tisch war man dennoch froh, dass Anton das Thema gewechselt hatte. Alle redeten gleichzeitig und gaben ihre Prognosen ab. Man befand sich vorerst Gott sei Dank wieder auf mehr oder weniger sicherem Terrain.
Kurts Handy fibrierte in seiner Hosentasche. »Ja, bin schon unterwegs.« Er nickte grüßend in die Runde und verließ das Wirtshaus. Nicht ungern.
Kapitel 2
Auf der Fahrt nach Wörth überlegte Kurt, was ihn dort wohl erwarten würde.
Ein Toter im Haus »Am Scharfen Eck«. In diesem Haus, das wusste er, waren hauptsächlich Asylbewerber untergebracht. Er hatte bisher dieses Gebäude noch nicht betreten; er kannte die Verhältnisse dort nicht. Ein eigenartiges Gefühl beschlich ihn. Er hatte noch Antons Worte im Ohr, die man beim besten Willen nicht als ausländerfreundlich bezeichnen konnte. Wie war eigentlich seine eigene Einstellung zu dem Thema? Natürlich sprach man im Bekanntenkreis darüber, erörterte mehr oder weniger emotional das Für und Wider. Das blieb nicht aus. Aber wenn er jetzt unmittelbar mit diesen Menschen zu tun hatte, wie stand er ihnen selbst gegenüber? Ganz tief in seinem Innersten? Er konnte sich nicht festlegen. Er war weder dafür, aber auch nicht dagegen. Das jeweilige Schicksal war für ihn entscheidend; der einzelne Mensch. Und wenn er ehrlich war, gab es da auch bei ihm, wie bei einigen andern, mit denen er über das Problem der gefühlten Überfremdung gesprochen hatte, eine Unterscheidung nach Religionszugehörigkeit. Menschen, die den christlichen Kirchen angehörten, sah er eher als dazugehörig. Er würde nie einen Italiener oder Spanier als fremd empfinden. Nicht einmal einen Holländer. Muslimen stand er dagegen ablehnend gegenüber. Das gab er auch offen zu. Diese Religion machte ihm Angst. Sie war blutrünstig und böse, zu einem nicht geringen Teil wenigstens. Anders konnte er sie nicht bezeichnen. Wenn man die Machenschaften der Taliban oder der Boko haram sah, wenn man den Nachrichten aus Afrika Glauben schenkte. Diese Menschen töteten im Namen Gottes Frauen, Kinder, Alte. Sie kannten keine Skrupel, hatten offensichtlich Freude am Morden. Wenn Gott für Liebe steht, für was bitte steht dann eine solche Religion? Politisch differenziert man beim Thema Islam. Da gab es den guten und den bösen. Er konnte das nicht so sehen. Für ihn hatte diese Form der Gottesanbetung etwas Teuflisches. Er empfand es so. Er war schließlich Christ. Aber war er darum ausländerfeindlich? Nein, mit Ausländerfeindlichkeit hatte diese ablehnende Haltung einer Religion gegenüber seiner Meinung nach nichts zu tun. Es ging schließlich nicht gegen die Menschen an sich, es ging gegen diese rabiate Art der Glaubensauslegung. Er war wie so oft bei diesem Thema gleichwohl fasziniert wie entsetzt, zu was Menschen im Namen Gottes fähig waren. Wie man Menschen mit Gott manipulieren konnte. Seine Mutter war nach dem Tod seines Bruders zu den Zeugen Jehovas konvertiert. Das mochte für die Mutter damals sinnvoll gewesen sein, für ihn nicht. Er dachte nicht gerne an diese Zeit; und aus diesem Grund auch nicht gern an die Mutter. Religion war für ihn ein heikles Thema, das er, wenn es möglich war, vermied. Heute stand er ihm womöglich gegenüber. Er ahnte es. Seine Gedanken wechselten. Wie es wohl seinem Mephisto ging? Aber im Augenblick musste er die Sorge um den Hund hinten anstellen. Wenn wenigstens der Hausl da wär, dachte er und fuhr auf das Anwesen, das als Unterkunft für Asylsuchende in Wörth bereitstand. An der Hauswand stand »Hotel«. Er wollte früher, ehe er in diese Gegend zog und noch in München wohnte, einmal dort essen. Der Eingang war verschlossen gewesen; einladend wirkte das Anwesen nicht. Er war dann weitergefahren, wurde aber den unangenehmen Eindruck, den das Haus auf ihn gemacht hatte, nicht mehr los. Er würde hier nie freiwillig hineingehen, das stand nach diesem ersten Erleben damals für ihn fest. Heute war er wieder hier. Mit einem unguten Gefühl fuhr er auf das Grundstück. Der Hof war voll mit Polizeifahrzeugen, ein Leichenwagen stand dort. Scheinwerfer beleuchteten das Szenario. Er sah die Kollegen, die eifrig hin und her eilten und war froh, den Winkler Hans in dem Gewusel zu erkennen. Er ging auf ihn zu.
»Servus Hans! Gott sei Dank hast du heit Dienst.« Er sah sich um. »Da ist ja einiges geboten.«
»Ja, des konnst laut song. An Neger, Schmarrn, an Schwarzn homs umbracht. Enthauptet! Einfach den Kopf abgschlang. Einfach so.« Er machte eine Pause, sah auf den Boden. Dann: »Kein schöner Anblick, des derfst ma glam.«
Er schritt mit Weinzierl, der ihm folgte, auf das Haus zu, drehte sich um und sagte: »Da moan ich, könnts euch auf was gfasst machen. Des wird bestimmt koa leichte Arbeit. Schon alloa die Sprachen. Turmbau zu Babel sag ich da nur. Da beneid ich euch nicht. Wo ist denn der Hausl?«
»Der hat heut noch Urlaub, sein letzten Tag. Am Montag ist er Gott sei Dank wieder da. Ich glaub, du hast mit deiner Prognose nicht Unrecht. Woaß ma schon, wer der Tote is? «
»Na, bis jetzt ned.« Winkler schüttelte den Kopf. »Vom Ausländeramt hama noch koan dawischt.«
Sie betraten einen langen, düsteren Flur, die Luft stand lauwarm, feucht und drückend. Kurt roch fremdartige Essensgerüche und vermied tieferes Atmen. Lautes Stimmengewirr schlug ihm entgegen. Die fehlende Helligkeit erschwerte es, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen. Er zupfte Winkler am Ärmel: »Könnts des ned a bissl ausleuchten? Da dad ma sich schon a weng leichter.«
Die Frage nach Frischluft schenkte er sich. »Mir san scho dabei, aber die Stromleitungen da herin geben nicht so viel Saft; da hats gleich die Sicherungen nausghaut und jetzt miass ma erst a Leitung von draußen legen. San aber scho dabei. Werd boid heller wern.«
Diese Zuversicht lag aber nicht in seinem Blick. Offensichtlich war man mit dem Problem jetzt schon länger beschäftigt. Weinzierls Augen gewöhnten sich langsam an die Dunkelheit. Eine Reihe von Türen sah er in dem langen Gang; Männer standen da, und wenn er sich in dieser Düsternis nicht täuschte, sah er Kinder hinter ihnen hervorlugen. Er blickte auf seine Uhr. Eine gute Stunde vor Mitternacht. Beinahe schon Samstag. Warum waren diese Kinder nicht in ihren Betten, wo sie um die Zeit hingehörten? Er machte Hans auf seine Beobachtung aufmerksam.
»Das ist bei dene so. Mädchen wirst keine sehen. Nur Buben. Und die sind was Besonderes. Die werden gehätschelt wie Prinzen und dürfen nahezu alles. Also auch aufbleiben, wenn sie es wollen. Zudem muss man sie ja frühzeitig zu Männern erziehen, wennst verstehst.«
Kurt sah bei dessen Worten zum Kollegen; er hörte den Unterton, sagte aber nichts. Er bemerkte jetzt das Fehlen von Frauen. Vielleicht gab es hier keine. Eventuell lebten hier nur Männer. Aber es waren doch Kinder hier. Er schob diesen Gedanken fürs erste beiseite. Sie gingen weiter durch den belebten, düsteren Gang bis zu einer der hinteren Türen. Sie betraten den engen Raum. Stickige Luft auch hier. Gedränge. Beamte vom hiesigen Revier sowie die Leute von der Spurensicherung waren bereits an der Arbeit. Kurt grüßte die Kollegen. Einige schüttelten den Kopf, andere sahen ihn nur schweigend, ungläubig an. Einer sagte: »Sowas hama a no ned ghabt.« Kurt sah sich um. Vier Betten, ein Tisch, ein paar Stühle, Spinde an den Wänden. Und Hilde Wichmann im hinteren Teil des Raumes, nahe am Fenster. Er ging auf sie zu und vermied es vorläufig, auf den Menschen zu sehen, der auf dem Boden lag, aber durch einige Kollegen sowie den vor ihm knieenden Arzt zum größten Teil verdeckt war. »Servus Hilde. Konnst scho was song?« Er wusste, dass diese Frage verfrüht, also überflüssig war. Aber sie verschaffte ihm noch etwas Zeit.
»Servus Kurt. Noch nix, was euch weiterhelfen könnt. Aber mir ham ja auch erst ogfangt. Mit der richtigen Arbeit fang ma dann o, wenn der«, sie deutete mit dem Kopf nach der Leiche »weg ist und mir uns auf das Wesentliche konzentrien kenna. Du kennst ja des Procedere.« Kurt nickte. Ja, er kannte es. Er wandte sich ab und trat endlich zu dem Mann, der da vor ihm ausgestreckt lag. Er war auf Schlimmes gefasst gewesen, aber seine Vorstellungskraft hatte nicht ausgereicht. In diesem Moment war sogar sein Hund vergessen. Der Mann lag auf dem Rücken, von der Brust aufwärts war die Kleidung blutdurchtränkt und es fehlte der Kopf. Er trat einen Schritt zurück. Er wollte nicht in die Blutlache treten, die sich über den Boden ausgebreitete hatte. Er sah zu dem Arzt, der vor der Leiche kniete und dessen Hose sich bereits vollgesogen hatte. Übelkeit überkam ihn. Er kannte das. Eigentlich war er für diesen Beruf absolut ungeeignet. Immer wieder kam er zu der Erkenntnis, namentlich in solchen Situationen. Reiß dich jetzt bloß zamm, dachte er und speib nicht da her. Des gabat a Soß! Er riss sich von der gedachten Unappetitlichkeit los und sprach den Arzt an. Ein Kollege vom Anton hatte Dienst. »Servus Hermann. Mit was für einem Gerät schafft man so eine Sauerei?«
»Griaß di Kurt. Mit einem Säbel oder ähnlichem und einer guten Technik geht des mit einem einzigen gezielten Schlag.« Dabei griff er nach dem Tuch, das den Kopf des Mannes bedeckt hatte, und zog es zur Seite. Weinzierls Übelkeit kehrte mit Wucht zurück. Ein Mohrenkopf! Kurt erschrak über seinen ersten Gedanken, der ihm dieses Wort aufgedrängt hatte. Wie kam er nur auf diesen Ausdruck? Das musste die Auswirkung von Antons Rede sein, dachte er und korrigierte sich sofort. Der Kopf eines schwarzen Mannes lag vor ihm. Leicht zur Seite geneigt und trotz der dunklen Hautfarbe blutleer. So kam es ihm wenigsten vor und war ja auch naheliegend. Offene Augen, offener Mund. Das Haar verklebt, wahrscheinlich vom Blut. Er konnte sich aber auch täuschen. Er sah weg. Er versuchte sich auf die Kleidung des Mannes zu konzentrieren. Jeans. Kariertes Hemd, soweit das trotz des Blutes noch erkennbar war. Er sah auf die Hände, ausgestreckt lagen sie am Boden. Dunkle Hände, die Handflächen etwas heller. Schmale Hände, lange Finger. Vielleicht hatte dieser Mann keine schwere körperliche Arbeit verrichtet. Auch der Körper machte nicht diesen Eindruck. Der Mann war groß und schlank, eher schmal, und er schätzte sein Alter auf Anfang bis Mitte vierzig. Er machte trotz des gewaltsamen Todes und des Blutes einen ordentlichen, ja beinahe reinlichen Eindruck auf ihn. Vielleicht durch die saubere Hose und die geputzten Schuhe. Wo kam dieser Mensch her, und was hatte ihn hierher verschlagen? Wer war der Mann? In diesem Moment schwor er sich, er würde herausfinden, was hinter diesem schrecklichen Schicksal stand. Warum war er in unser Land gekommen, nach Wörth an der Donau? Was hatte ihn hierher gebracht? Ausgerechnet in dieses kleine, eigentlich unscheinbare und verschlafene Städtchen? Und warum musste er hier sterben? Auf diese fremde und grausame Art? Der Tod war ja nichts Neues für Kurt. Aber ein abgeschlagener Kopf? Ein Schuss oder ein paar Messerstiche, eventuell Gift, ja, so wurde hierzulande umgebracht. Auch Morden hatte schließlich Tradition. Doch eine solche Hinrichtung? Und das muss es gewesen sein. Eine Hinrichtung. In Wörth. Er würde es herausfinden, er musste wissen, aus welchem Grund diese bestialische Tat geschehen war. Dschihad? Dieses Wort fiel ihm ein, obwohl er dafür eigentlich keine reale Verbindung fand. Doch er schloss einen religiösen Hintergrund nicht aus. Dergleichen Vermutungen passten zu Menschen mit dieser Religion. Aber er wusste bisher nicht, welcher Religion der Tote angehört hatte. Und auch nichts über die des Mörders. Zudem waren voreilige Schlüsse nicht angebracht, wie er den Hausl gerne und oft belehrend mahnte. Er drehte sich um und ging hinaus in den Hof. Die frische Nachtluft tat gut. Er atmete ein paar Mal tief durch. Er traf wieder auf Winkler, der sich offensichtlich auch aus diesem Grund hier aufhielt. »De Luft tut gut, gell?«, kam es wie abgesprochen von Winkler.
»Des konnst laut song. Sag Hans, redet da drin eigentlich jemand deutsch?«
»Du konnst dir die Befragerei heut Nacht schenga. Da dafragst du nix. Ein einziges Sprachengewirr. Hier redet angeblich keiner deutsch oder versteht auch nur das Geringste. Und an Dolmetscher ham mir bisher ned auftreiben kenna. Außer du konnst gut englisch. Da könnst a paar finden unter den Jüngeren, eventuell. Aber sagen tun die a nix. Das garantier ich dir. Von dene woaß koaner was.«
»Da brauch ich ja gar ned erst ofanga. Seit weiß Gott wann hab ich koa Englisch mehr braucht. Sagts dene Leid da drin, sie müssen im Haus bleiben oder deits es eana. Bis morgen Früh werd sich dann schon jemand gfunden ham, der die Sprachen versteht und dann fang ma mit der Vernehmung an. Da gfrei i mi heit scho drauf. Ich veranlasse einen Durchsuchungsbeschluss. Heute Nacht noch soll das Anwesen nach der Waffe und anderen Beweismitteln durchsucht werden. Ich glaube zwar nicht an einen Erfolg, aber es soll hintnach nicht heißen, wir hätten nicht alles versucht. Die Spurensicherung ist eh auch da, vielleicht finden sie was. Zwei, drei von euch solln den Rest der Nacht vor Ort bleiben. Das dürfte vorerst reichen. Oder? Die Bewohner dieses ehrenwerten Hauses haben ja sowieso die Pflicht, sich hier aufzuhalten. Residenzpflicht, so heißt das doch im Amtsdeutsch. Dann verzieh ich mich jetzt, ihr dawischts mich dahoam oder am Handy. Des war heid a Tagerl. Sowas brauchat ich öfter.« Er machte ein Pause, suchte in der Hosentasche nach seinem Autoschlüssel, dann: »Und da Hausl ist natürlich auch nicht da.« Ein einziger Vorwurf. Er tippte sich an die Stirn und ging zu seinem Auto.
Was für ein Tag! Erst die Nachricht, sein Hund sei überfahren worden. Das allein wäre für heute genug gewesen. Und dann noch diese Leiche. Dabei hatte der Tag ganz gut begonnen. Was hatte Biermoser am Morgen doch gleich gesagt: Ihr habts ja im Moment ned so vui z´doa. Ha, ha! Biermoser wäre jetzt sicher zufrieden. Kurt konnte sich nicht erinnern, während der vielen Jahre im Polizeidienst jemals von einem derartigen Mord gehört zu haben. Wenigstens nicht in dieser Gegend. Der Anton wenn davon erfährt, fühlt er sich wieder bestätigt, dachte er bei sich. Aber bei dem Täter muss es sich nicht zwingend um einen Islamisten handeln. Genausogut könnte es jemand getan haben, der eben diesen Verdacht erwecken wollte. Doch für eine solche Tat bedurfte es schon eines gehörigen Maßes an Grausamkeit. Und wahrscheinlich auch einer gewissen Übung. Er schauderte. Diesen Gedanken wollte er jetzt nicht weiter vertiefen. Er war doch zu schrecklich. Morgen würde er sich damit beschäftigen müssen. Jetzt wollte er lieber an seinen Hund denken. Auch wenn das im Moment nicht wesentlich besser war. Der arme Kerl lag jetzt wahrscheinlich mutterselenallein in einem Käfig. Krank. Vielleicht hatte er Schmerzen. Wenn er nicht schon tot war. Er wendete sein Auto und fuhr zurück nach Oberachdorf. Natürlich konnte er heute nichts mehr ausrichten. Aber er wollte seinem Hund, sofern dieser noch lebte, wenigstens nah sein. Vielleicht spürte Mephisto seine Nähe. Tiere hatten ja hierfür den Sechsten Sinn, wurde gesagt. Nach solchen Erlebnissen macht man sich leicht zum emotionalen Deppen, dachte er. Jetzt glaubte er schon an Telepathie. Das war sonst nicht unbedingt seine Art. Doch änderte diese Einsicht nichts an seinem Vorhaben. Er parkte vor der Praxis und blieb im Auto sitzen. Er versuchte sich zu konzentrieren. Ganz fest dachte er jetzt an seinen Hund. Doch das mit der Konzentration wollte nicht so recht gelingen, lautes Katzengeschrei war zu hören. Ein Fauchen und Miauen, Knurren. Hässliche, wilde Töne. Er sah aus dem Fenster. Richtig, da waren die Störenfriede. Zwei Katzen, nahe an der Hauswand in einer Nische. Kurt schaute dem Treiben zu. Anscheinend handelte es sich um einen verliebten Kater und eine abweisende, weniger verliebte Kätzin; er wollte, sie wollte offensichtlich nicht. Der Kater in seinem Liebeswahn näherte sich ihr unvorsichtig; blitzschnell hatte er ihre Krallen im Fell und weg war sie. Das konnte sein Vorhaben aber nicht bremsen, er rannte hinter ihr her. Was sein muss, muss sein. Weg waren die beiden, für ihn nicht mehr sichtbar. Kurt starrte in die Nacht. Ob der Kerl es heute noch schafft, dachte er? Ja, ja, die Liebe. Er konnte sich gut in den Kater hineinversetzen. Auch er hätte ab und zu noch Lust auf ein paar Streicheleinheiten, ein paar romantische Stunden. Leise stöhnte er bei dem Gedanken. Wenn es sein müsste, könnte er sogar auf die Romantik verzichten. Er dachte an das wesentliche. So ab und zu ein kleines Schäferstündchen... Was bin ich doch für ein armer Kerl, dachte er und verfiel wieder in seine Melancholie, jetzt gepaart mit Selbstmitleid. Allein war er. Wenn er heimkam, wartete niemand auf ihn. Nicht einmal mehr sein Hund. Was bin ich doch für eine arme Sau. Aber wenigstens war am Montag der Hausl wieder im Dienst. Und darüber war er richtig froh. Er startete den Motor und fuhr nach Hause.