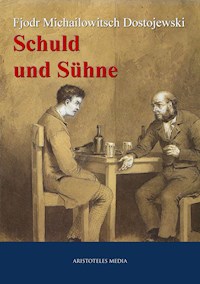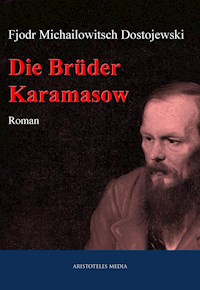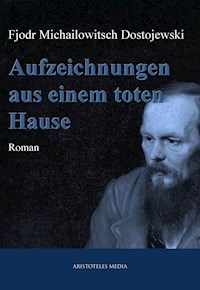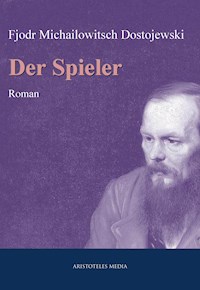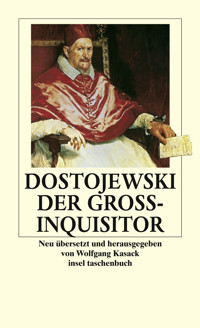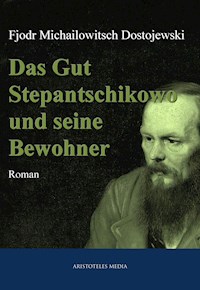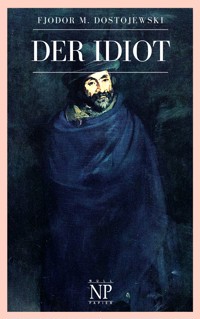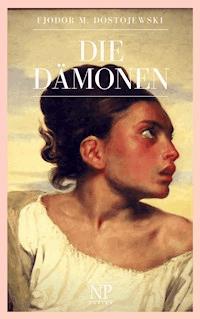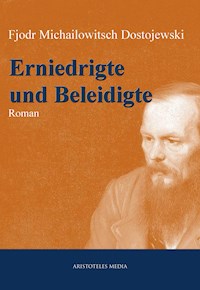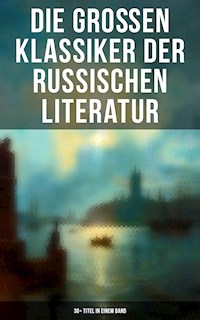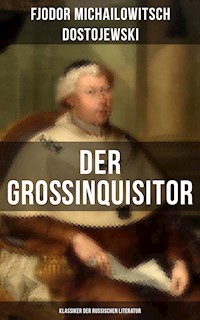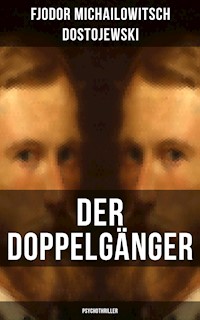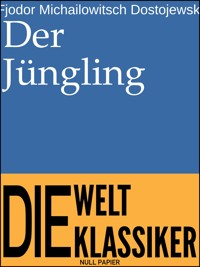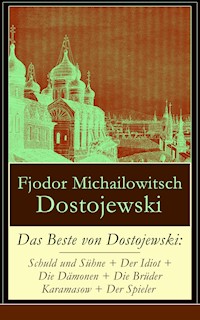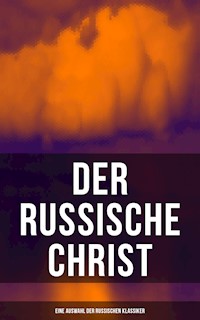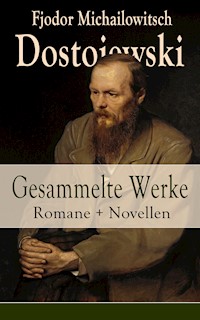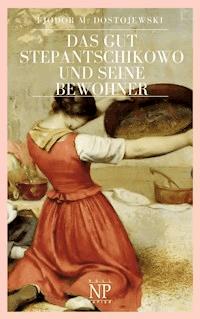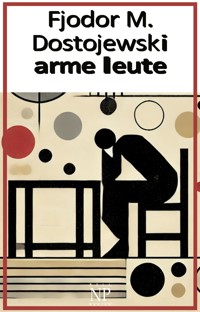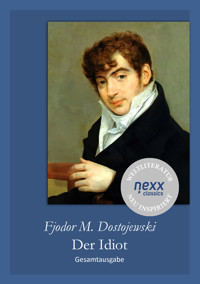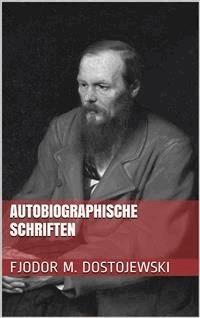
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Paperless
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fjodor Michailowitsch Dostojewski (wiss. Transliteration Fëdor Mihajlovič Dostoevskij; * 11. November 1821 in Moskau; † 9. Februar 1881 in Sankt Petersburg) gilt als einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller. Seine schriftstellerische Laufbahn begann 1844; die Hauptwerke, darunter "Schuld und Sühne", "Der Idiot", "Die Dämonen" und "Die Brüder Karamasow", entstanden jedoch erst in den 1860er und 1870er Jahren. Dostojewski schrieb neun Romane, zahlreiche Novellen und Erzählungen und ein umfangreiches Korpus an nichtfiktionalen Texten. Das literarische Werk beschreibt die politischen, sozialen und spirituellen Verhältnisse zur Zeit des Russischen Kaiserreiches, die sich im 19. Jahrhundert fundamental im Umbruch befanden. Dostojewski war ein Theoretiker der Konflikte, in die der Mensch mit dem Anbruch der Moderne geriet. Zentraler Gegenstand seiner Werke war die menschliche Seele, deren Regungen, Zwängen und Befreiungen er mit den Mitteln der Literatur nachgespürt hat; Dostojewski gilt als einer der herausragenden Psychologen der Weltliteratur. Fast sein gesamtes Romanwerk erschien in Form von Feuilletonromanen und weist darum die für dieses Genre typischen kurzen Spannungsbögen auf, wodurch es trotz seiner Vielschichtigkeit und Komplexität selbst für unerfahrene Leser leicht zugänglich ist. Seine Bücher wurden in mehr als 170 Sprachen übersetzt.In der zweiten Hälfte der 1840er Jahre stand Dostojewski dem Frühsozialismus nahe und nahm an Treffen des revolutionären Petraschewski-Zirkel teil. Dies führte 1849 zu seiner Festnahme, Verurteilung zunächst zum Tode und dann - nach Umwandlung der Strafe - zu Haft und anschließendem Militärdienst in Sibirien. Nach der Entlassung 1859 siedelte er sich in Tver an und begann zunächst mit kleineren Arbeiten und dann mit den Aufzeichnungen aus einem Totenhaus seine Reputation als Schriftsteller wiederherzustellen. Mit seinem Bruder Michail gründete er zwei Zeitschriften ("Wremja" und "Epocha"). Die erste wurde verboten, der Ruin der zweiten zwang ihn zur Flucht vor den Gläubigern ins Ausland, wo er drei Jahre lang bleiben sollte. Dostojewski litt an Epilepsie und war einige Jahre der Spielsucht verfallen. Während seine Zeitgenossen Lew Tolstoi, Iwan Turgenew und Iwan Gontscharow unter Bedingungen materieller Sorglosigkeit schreiben konnten, waren die äußeren Umstände von Dostojewskis Schreibtätigkeit fast zeitlebens von finanzieller Not geprägt. In den letzten zehn Jahren seines Lebens lebte er in finanziell geordneten Verhältnissen und genoss Anerkennung im ganzen Land.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Dostojewski als Publizist
Vorbemerkungen
Zur Lebensgeschichte Dostojewskis
Kindheit und Jugend
Der Anfang seiner literarischen Tätigkeit
Die Katastrophe
Verbannung und Befreiung
Petersburg.
Winteraufzeichnungen über Sommereindrücke
Erstes Kapitel: Statt eines Vorworts
Zweites Kapitel: Im Waggon.
Das dritte und vollkommen überflüssige Kapitel.
Das vierte und für Reisende nicht überflüssige Kapitel. (Die endgültige Entscheidung der Frage, ob der Franzose wirklich »keine Überlegung hat«.)
Fünftes Kapitel: Baal.
Sechstes Kapitel: Ein Versuch über den Bourgeois
Siebentes Kapitel: Fortsetzung des Vorhergehenden.
Achtes Kapitel: Bribri und Mabisch
»Tagebuch eines Schriftstellers.« Aus der Zeitschrift »Der Bürger« vom Jahre 1873.
Einführung.
Menschen von damals
Eine der zeitgemäßen Fälschungen.
George Sands Tod.
Ein paar Worte über George Sand.
Alte Erinnerungen.
Fußnoten
Fjodr Michailowitsch Dostojewski
Autobiographische Schriften
Ich muß gestehen, daß ich diese Aufsätze nicht nur für meine Leser schreibe, sondern auch für mich selbst.
Aus dem »Tagebuch eines Schriftstellers«.
Dostojewski als Publizist
Die früheste publizistische Tätigkeit Dostojewskis fällt in die Zeit nach seiner Rückkehr aus Sibirien im Herbst 1859. Im Jahre 1860 begann er mit den Vorarbeiten für eine politisch-literarische Monatsschrift »Die Zeit« (»Wremjä«), die er dann seit dem Januar 1861 in Gemeinschaft mit seinem älteren Bruder Michail herausgab, bis die Zeitschrift im Mai 1863 infolge eines Irrtums der Zensoren verboten wurde. Ihre Fortsetzung »Die Epoche« (»Epocha« erschien vom März 1864 bis zum Frühjahr 1865) war finanziell, im Gegensatz zur »Zeit«, ein vollkommener Mißerfolg und hinterließ Dostojewski nach ihrem Eingehn noch eine erhebliche Schuldenlast.
Die rein publizistischen Artikel, die von Dostojewski aus diesen Jahren vorliegen – fünf kritische Artikel aus dem Jahre 1861 und der Reisebericht »Winteraufzeichnungen über Sommereindrücke«, den er nach seiner ersten Auslandsreife im Sommer 1862 schrieb und in der »Zeit« veröffentlichte – bezeugen deutlich die Aufnahme und Verarbeitung der Ideen seiner Mitarbeiter an der »Zeit« Apollon Grigorjeff und R. R. Strachoff: der Idee des Slawophilentums und der Hegelischen Idee vom Staat, sowie der ideellen Auffassung Alexander Herzens von Westeuropa.
Diese erste publizistische Tätigkeit, die Dostojewski durch den täglichen Verkehr mit dem Naturwissenschaftler und Philosophen Strachoff und den literarischen Kreisen Petersburgs zwar einerseits die wichtigsten Anregungen eintrug – ganz abgesehen von denjenigen, die er auf seinen zwei ersten Sommerreisen nach Europa empfing, die ihn 1862 nach Deutschland, Paris, London, Genf, Florenz, 1863 u. a. auch nach Rom führten –, nahm andererseits seine Zeit doch so in Anspruch, daß er in diesen Jahren bis zum Frühjahr 1865 an künstlerischen Arbeiten nur die Anekdote »Eine dumme Geschichte«, die Novelle »Aus dem Dunkel der Großstadt« und die kleine Satire »Das Krokodil« geschrieben hat. Nun folgte, nach einer dritten Reise nach Deutschland und Kopenhagen im Herbst 1865, eine Zeit der äußeren Einsamkeit bei größter künstlerischer Produktivität. Zunächst begann er (1865) seinen ersten großen Roman: »Rodion Raskolnikoff«, der 1866 erschien und dem schon zu Ende des Jahres der kleinere Roman »Der Spieler« folgte. Nach seiner zweiten Verheiratung – er vermählte sich am 15. Februar 1867 mit Anna Grigorjewna Gsnitkina – reiste er am 14. April zum vierten Male ins Ausland. Diese vierte Reise dehnte sich infolge der erwähnten Schuldenlast, die abzutragen umso schwerer war, als er außer für seinen Stiefsohn aus erster Ehe auch noch die Familie seines im Juni 1864 verstorbenen Bruders Michail zu unterstützen hatte, zu einem mehr als vierjährigen Aufenthalte in der Fremde aus. Dostojewski und seine Frau reisten über Baden-Baden, wo der Dichter des »Spielers« wiederum spielte und diesmal empfindlich verlor, nach Genf, von dort später nach Mailand und Florenz, von wo sie im August 1869 über Venedig, Wien und Prag nach Dresden übersiedelten. Im Juli 1871 kehrte Dostojewski trotz der noch unabgetragenen Schulden nach Petersburg zurück, da der Russe in ihm das Leben im Auslande nicht mehr ertrug. In diesen Jahren aber, die er mit seiner Frau in der Fremde ganz einsam, ohne Beziehung zu den russischen Emigranten, meist in größten Geldsorgen verbrachte, entstanden: 1867–68 der zweite große Roman »Der Idiot«, 1869 der kleinere Roman »Der ewige Gatte« und 1870–72 »Die Dämonen«. Mithin hat Strachoff nicht so Unrecht, wenn er den Bankrott der »Epoche«, der Dostojewskis publizistischer Tätigkeit 1865 vorläufig ein Ende machte, ein Glück für den Künstler Dostojewski nennt.
Das Jahr 1873 sieht dann Dostojewski zum zweitenmal als Publizisten, jetzt als offiziell bestätigten Schriftleiter des »Bürger« (»Grashdanin«, f. S. 302 Anm.), den er bis zum Frühjahr 1874 leitete und in dem er in der ersten Hälfte des Jahres unter dem Gesamttitel »Tagebuch eines Schriftstellers« – als handelte es sich um Blätter aus einem Tagebuch, das er, wie er einmal bemerkt, nicht nur für seine Leser, sondern auch für sich selbst schrieb – fünfzehn Beiträge und im Dezember noch einen sechzehnten Beitrag über verschiedene Themata unter entsprechenden Sondertiteln, u. a. auch zwei dichterische Skizzen, veröffentlichte. In der zweiten Hälfte des Jahres 1873 schrieb er sodann für den »Bürger« »Überblicke über die auswärtigen Ereignisse« – im ganzen zwölf Artikel–, die er jedoch nicht mit seinem Namen zeichnete. Im März 1874 wurde er wegen einer Verletzung der Zensurvorschriften vorübergehend verhaftet, worauf er die Schriftleitung niederlegte und sich später auf sein Landhaus in Staraja Russa (am Ilmen-See, südlich von Petersburg) zurückzog. Dort verblieb er auch den ganzen folgenden Winter und schrieb in dieser Stille seinen vierten großen Roman: »Der Jüngling«, der 1875 erschien.
Erst hierauf beginnt dann seine wichtigste publizistische Tätigkeit: in den Jahren 1876 und 77.
Dostojewski war nun in der Lage, im Selbstverlage eine Monatsschrift herauszugeben, die er ganz allein schrieb und für die er den 1873 für seine Beiträge im »Bürger« gewählten Gesamttitel »Tagebuch eines Schriftstellers« als Titel beibehielt, da dieser dem Inhalt den weitesten Spielraum ließ und den Artikeln über alles, was ihn gerade beschäftigte, den Charakter einer persönlichen Aussprache gab. Und da er nun einmal für seine Schriften dieser Art die Möglichkeit einer Veröffentlichung im Selbstverlage besaß, veröffentlichte er 1876 und 77 auch die künstlerischen Skizzen, Novellen und Erzählungen, die er in diesen Jahren zwischendurch schrieb, in diesen monatlich erscheinenden Heften.
Im Jahre 1878 zog sich Dostojewski aus diesem zweijährigen unmittelbaren Kampfe der Tagesmeinungen, den er als Publizist namentlich in dem aufregenden Kriegsjahre 1877 für die Balkanslawen mit Leidenschaft geführt hatte, abermals zurück und schrieb nun, wiederum fern aller Publizistik, sein größtes und letztes Werk: »Die Brüder Karamasoff«, in dem er zum Teil zur Ausführung brachte, was er schon 1868 für einen Roman »Der Atheismus« geplant hatte. »Die Brüder Karamasoff« waren das letzte Wort des Dichters. Als Publizist aber hat er dann noch im letzten halben Jahr seines Lebens zwei weitere Hefte des »Tagebuch eines Schriftstellers« herausgegeben: im August 1880 und im Januar 1881.
Von diesen letzten gelegentlich herausgegebenen Einzelheften enthält das erstere vom Jahre 1880 die berühmte Puschkinrede, die Dostojewski am 8. Juni zur Puschkinfeier in Moskau gehalten hatte und die er mit dem alsbald darauf erfolgten Angriff eines Westlers sowie seiner eigenen Abwehr, die nun seinerseits zu einem scharfen Angriff wurde, im August als Einzelheft herausgab (in »Literarische Schriften«, Band 12 der deutschen Ausgabe). Und das letzte, rein politische Heft, das am Tage seiner Beerdigung, am 31. Januar 1881, erschien, und zwar ohne Zensurlücken, trotz der von Dostojewski mehrfach ausgesprochenen Befürchtung, daß ihm wohl manches gestrichen werden würde, enthielt vier Artikel, in denen er erstens nicht für die Einberufung eines Parlaments (einer »Schwatzbude mit Schwätzern«), sondern eines Bauernrates (der »grauen Kittel«, wie er sich vorsichtigerweise umschreibend ausdrückt) eintrat; zweitens der von Peter ausgebauten Bürokratie die Zweckmäßigkeit nicht absprach; und in zwei letzten Kapiteln sich von der früher von ihm verfochtenen Großmachtpolitik Rußlands in Europa abwandte und Rußland »nach Asien« rief (in »Politische Schriften«, Band 13 der deutschen Ausgabe, die Artikel: »Russische Finanzen«, »Die Meinung eines geistreichen Bureaukraten über unsere Liberalen und Westler«, »Was ist Asien für uns?« und »Fragen und Antworten«).
Aus diesem ganzen überaus umfangreichen Material, das von Dostojewski in publizistischer Form vorliegt (also aus seinen Beiträgen in der Monatsschrift »Die Zeit«, wie aus den Beiträgen im »Bürger« und den Monatsheften »Tagebuch eines Schriftstellers«) wurden für die deutsche Ausgabe zunächst die erwähnten ausgesprochen dichterischen Arbeiten ausgeschieden und die Erzählungen den entsprechenden Novellenbänden, Band 20 und 22, zugewiesen. Ferner wurden die »Kleinen Bilder«, Skizzen und Beobachtungen aus dem russischen Volksleben und europäischen Völkerleben zu einem 24. Bande vereint. Schließlich wurde für die kriminalpsychologischen Studien, die Dostojewski in den Jahren seiner publizistischen Tätigkeit verfaßt hat, Band 23 der deutschen Ausgabe vorgesehen: »Russische Prozesse«. Der ganze große verbleibende Rest des nunmehr nur publizistischen Materials wurde sodann nach inhaltlichen Gesichtspunkten geordnet. Auf diese Weise wurden die »Autobiographische Schriften«, Band 11, »Literarische Schriften«, Band 12 und »Politische Schriften«, Band 13 der deutschen Ausgabe gewonnen, während ein letzter, der 25. Band der deutschen Ausgabe denjenigen Aufsätzen vorbehalten blieb, die im wesentlichen als Studien oder Vorläufer späterer Artikel zu betrachten sind.
E. K. R.
Vorbemerkungen
Für die »Autobiographischen Schriften« wurden diejenigen Aufsätze Dostojewskis aus den Jahren 1863, 1873,1876 und 1877 herausgezogen, die lebensgeschichtliche Erinnerungen des Dichters enthalten. Die Anordnung dieses Materials geschah jedoch nicht in der Reihenfolge, in der sich diese Erinnerungen zeitlich aneinanderknüpfen, sondern in derjenigen, in der die Aufsätze entstanden sind. Auf diese Weise ließ sich die entwicklungsmäßige, nicht unwesentliche Veränderung der Stellungnahme Dostojewskis zu Menschen und Ideen am besten veranschaulichen.
Dem Bande vorangestellt wurden die »Materialien zur Lebensbeschreibung Dostojewskis«, die der Literaturhistoriker Orest Miller 1882, nach dem Tode des Dichters, zusammengestellt hat. Miller, dem von der Geheimpolizei zum erstenmal ein allerdings bedingter Einblick in die Akten des Petraschewski-Prozesses gewährt wurde, hat alle ihm erreichbaren Briefe Dostojewskis, sowie Aussagen und Aufzeichnungen über Dostojewski zu einem umfangreichen Bericht zusammengetragen, der einen Überblick über das Leben des Dichters von seiner frühesten Jugend bis in den Anfang der sechziger Jahre gibt. Dieser Bericht findet seine Fortsetzung in dem Überblick über die zweite Hälfte von Dostojewskis Leben, von 1861-81, den damals, 1882, N. N. Strachoff gab, der dieses Leben zunächst als mehrjähriger publizistischer Mitarbeiter Dostojewskis geteilt, später als Freund miterlebt hatte. Dieser zweite Teil der Lebensgeschichte Dostojewskis wurde den »Literarischen Schriften«, Band 12 der deutschen Ausgabe, beigegeben.
Von Dostojewskis Briefen – die intimeren sind noch unveröffentlicht im Besitze seiner Witwe –, aus denen Miller manche Stellen anführt, ist eine Auswahl in dem Sonderbande »F. M. Dostojewski. Briefe. Mit Bildnissen und Berichten der Zeitgenossen« erschienen. Zu diesen Berichten der Zeitgenossen gehören unter anderen auch die von Miller erwähnten und benutzten Erinnerungen an Dostojewski, die D. W. Grigorowitsch, A. P. Miljukoff und Baron Alexander Wrangel aufgezeichnet haben.
E. K. R.
Zur Lebensgeschichte Dostojewskis
Kindheit und Jugend
Fjodor Michailowitschs Geburtstag war der 30. Oktober, doch sein Geburtsjahr war nicht, wie er selbst irrtümlicherweise glaubte und angab, das Jahr 1822, sondern, wie wir aus dem Kirchenbuch ersehen, das Jahr 1821. Am 4. November wurde er getauft und erhielt den Namen seines Großvaters mütterlicherseits, des Moskauer Kaufmanns Fjodor Timofejewitsch Netschajeff.
Eine der ersten Kindheitserinnerungen Fjodor Michailowitschs war: wie eines Abends die Kinderfrau ihn als ungefähr Dreijährigen ins Besuchszimmer zu den Gästen geführt, vor den Heiligenbildern hatte hinknien und sein Abendgebet hatte hersagen lassen: »Alle Zuversicht, Herr, lege ich auf dich. Mutter Gottes, behalte mich unter deinem Schutz.« Den Gästen gefiel das sehr, und sie sagten, indem sie ihn streichelten: »Was für ein kluger Junge!« Dieses Erlebnis hatte sich für immer seinem Gedächtnis eingeprägt und jenes Gebet hat er später seine eigenen Kinder als Abendgebet sprechen gelehrt. Auch behielt er immer in der Erinnerung, wie streng er und seine Geschwister von klein auf erzogen worden waren und wie früh schon das Lernen begonnen hatte. Bereits als Vierjährigen setzte man ihn vor ein Buch und dann hieß es: »Lerne!« – während es draußen so schön war, so warm, und der große schattige Garten des Hospitals so lockte! Doch wenn der Vater seine Kranken in der Stadt besuchte, dann pflegte es wohl zu geschehen, daß die Mutter die Kinder befreite und wieder spielen ließ.
Die anschaulichste Vorstellung von der Kindheit Fjodor Michailowitschs geben uns die Aufzeichnungen seines jüngeren Bruders Andrei Michailowitsch, die deshalb im Wortlaut hier eingeschaltet seien.
»Mein Bruder Fjodor Michailowitsch war drei Jahre und viereinhalb Monate älter als ich, da er aber – zusammen mit meinem ältesten Bruder – erst im Mai 1837 von meinem Vater nach Petersburg gebracht wurde, so habe ich seine Kindheit ungefähr von meinem 5. bis 12. oder von seinem 8. bis 15. Lebensjahr miterlebt und kann mich ihrer noch sehr gut erinnern.
»Unser Vater, der Stabsarzt Michail Andrejewitsch Dostojewski, war nach Absolvierung der damals in Moskau bestehenden Medizinischen Akademie im Jahre 1812 als Arzt in den Militärdienst getreten und hatte nach dem Kriege eine Anstellung am Moskauer Militär-Hospital erhalten.
»Im Jahre 1819 heiratete er die Tochter des Moskauer Kaufmanns Fjodor Timofejewitsch Netschajeff, Marja Fjodorowna. Im Jahre 1820 wurde unser ältester Bruder Michail geboren. Ende desselben Jahres trat unser Vater aus dem Militärdienst in den Zivildienst über und kam als Arzt, mit dem Titel eines Stabsarztes, an das Moskauer Marienhospital. Dort ist dann unser Bruder Fjodor und sind nach ihm alle übrigen Geschwister, mit Ausnahme der jüngsten Schwester, zur Welt gekommen.
»Die Wohnung, die unser Vater daselbst erhielt, lag im Erdgeschosse. Wenn man die heutigen Dienstwohnungen beamteter Personen von gleichem Range mit den damals gewährten Räumlichkeiten vergleicht, so fällt es einem unwillkürlich auf, wieviel sparsamer man in der Beziehung früher war. Unsere Wohnung bestand eigentlich nur aus zwei Zimmern, außer dem Vorzimmer und der Küche. Das dem Eingange zunächst liegende, wie gewöhnlich einfenstrige Vorzimmer wurde durch eine vom Tischler hergestellte Scheidewand in zwei Räume geteilt; in dem auf diese Weise gewonnenen zweiten halbdunklen Zimmerchen schliefen die beiden ältesten Brüder, Michail und Fjodor. Aus dem Vorzimmer trat man in den sogenannten Saal: ein ziemlich großes Zimmer mit zwei Fenstern zur Straße und drei Fenstern auf den Vorhof. Das folgende zweite Zimmer hatte zwei Fenster zur Straße und war gleichfalls durch eine Scheidewand in zwei Hälften geteilt, von denen die halbdunkle den Eltern als Schlafraum diente. Späterhin, als unsere Familie größer wurde, erhielten wir noch ein Zimmer. Die Einrichtung der Wohnung war sehr bescheiden. Das Vorzimmer mit dem abgeteilten Schlafraum der Brüder war mit dunkelgrauer, der Saal mit hellgelber und das elterliche Schlafzimmer mit blauer Leimfarbe angestrichen. An Möbeln standen im Saal zwei Lhombre-Tische (obgleich in unserer Familie nie Karten gespielt wurde), an denen die älteren Brüder lernten, ein Eßtisch und ein Dutzend Stühle aus Birkenholz mit weichem Sitz (aber natürlich ohne Sprungfedern), der mit grünem Saffian bezogen war. Dieser Saal war unser Wohnzimmer,
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!