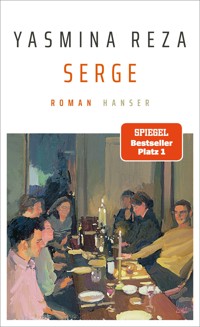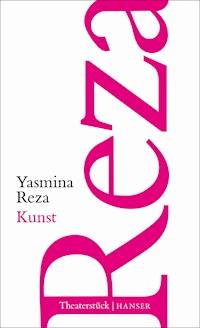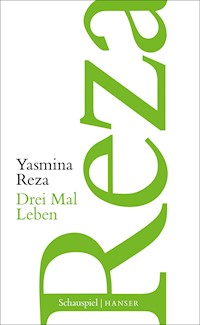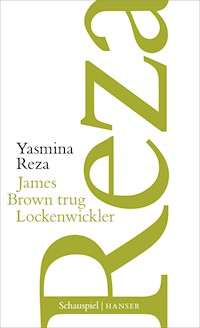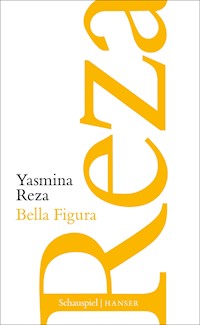Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KGHörbuch-Herausgeber: Hörbuch Hamburg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Elisabeth gibt eine Frühlingsparty. Sie ist keine erfahrene Gastgeberin und sehr nervös. Viel zu viele Gläser und Stühle. Dennoch scheint alles gut zu gehen, bis sich Jean-Lino und Lydie, die Nachbarn von oben, wegen eines Bio-Hühnchens in die Haare kriegen. Als Elisabeth und ihr Mann schon im Bett liegen, klingelt es. Es ist Jean-Lino, der erzählt, dass er Lydie gerade erwürgt hat. Elisabeth wird er bitten, die Leiche mit ihm zusammen aus dem Haus zu schaffen. – Yasmina Reza hat einen unglaublich komischen und dabei tiefernsten Roman geschrieben, der den Leser von einer grotesken Abendgesellschaft in die Abgründe der Paarbeziehung führt und von einer ganz besonderen Freundschaft erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Als Elisabeth eine Frühlingsparty gibt, stimmt das Datum, 21. März, aber draußen schneit es. Elisabeth ist keine erfahrene Gastgeberin und sehr nervös. Viel zu viele Stühle, viel zu viele Gläser. Dennoch scheint alles gut zu gehen, bis sich Jean-Lino und Lydie, die Nachbarn von oben, wegen eines Bio-Hühnchens in die Haare kriegen. Als die Gäste gegangen sind und Elisabeth und ihr Mann schon im Bett liegen, klingelt es an der Tür. Es ist Jean-Lino, der erzählt, dass er Lydie gerade erwürgt hat. Später wird er Elisabeth bitten, die Leiche mit ihm zusammen aus dem Haus zu schaffen.
Yasmina Reza hat einen tragikomischen Roman geschrieben, der den Leser von einer grotesken Abendgesellschaft in die Abgründe einer Paarbeziehung führt und von einer ganz besonderen Freundschaft erzählt. Für Babylon wurde Yasmina Reza mit dem Prix Renaudot 2016 ausgezeichnet.
Hanser E-Book
Yasmina Reza
Babylon
Roman
Aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel
Carl Hanser Verlag
Für Didier Martiny
Die Welt ist nicht schön aufgeräumt, sie ist ein Saustall.
Ich versuche nicht, in ihr Ordnung zu schaffen.
Garry Winogrand
Er steht auf der Straße, an einer Wand. In Anzug und Krawatte. Abstehende Ohren, misstrauischer Blick, kurze weiße Haare. Er ist mager, schmalschultrig. Gut sichtbar hält er eine Zeitschrift vor sich, man kann den Titel lesen, Awake. Die Bildunterschrift lautet: Jehova’s Witness – Los Angeles. Das Foto stammt von Neunzehnhundertfünfundfünfzig. Er sah aus wie ein kleiner Junge. Er ist seit langem tot. Er zog sich anständig an, wenn er seine frommen Traktate anbot. Er war allein, erfüllt von trauriger, verbissener Hartnäckigkeit. Zu seinen Füßen ahnt man eine Aktentasche (der Griff ist zu sehen), darin die Dutzende Traktate, die niemand oder so gut wie niemand ihm abnehmen wird. Auch diese in sinnlos hoher Auflage gedruckten Schriften gemahnen an den Tod. Diese Anfälle von Optimismus – zu viele Gläser, zu viele Stühle … –, wir besitzen viel zu viele Dinge und berauben sie gerade dadurch ihres Sinnes. Die Dinge und unsere Mühen. Die Wand, vor der er steht, ist riesenhaft. Das errät man an ihrer schweren Undurchdringlichkeit, der Größe der behauenen Steine. Sie steht sicher immer noch dort in Los Angeles. Der Rest hat sich irgendwo aufgelöst: der kleine Mann mit den spitzen Ohren im schlotternden Anzug, der sich vor die Wand gestellt hatte, um eine fromme Zeitschrift zu verteilen, sein weißes Hemd, die dunkle Krawatte, die an den Knien durchgescheuerten Hosenbeine, seine Aktentasche, all die Hefte. Was zählt es schon, wer man ist, was man denkt, was aus einem wird? Man steht irgendwo in der Landschaft, bis zu dem Tage, an dem man nicht mehr da ist. Gestern hat es geregnet. Ich schlug mal wieder The Americans von Robert Frank auf. Es war irgendwo im Bücherschrank in ein Regal geklemmt. Ich schlug das Buch auf, zum ersten Mal seit vierzig Jahren wieder. Ich erinnerte mich an den Typen, der auf der Straße seine Zeitschriften darbietet. Das Foto ist körniger, blasser als in der Erinnerung. Ich wollte mir The Americans noch einmal ansehen, das traurigste Buch der Welt. Tote, Tankstellen, einsame Gestalten mit Cowboyhut. Beim Blättern wandern Jukeboxes vorbei, Fernseher, die Gegenstände des jungen Wohlstands. Sie stehen ebenso einsam da wie der Mann, überdimensionierte Neuankömmlinge, zu schwer, zu licht, in unvorbereitete Räume hineingestellt. Eines schönen Morgens werden sie entfernt. Noch eine kleine Runde werden sie drehen auf dem holprigen Weg zum Schrottplatz. Man steht irgendwo in der Landschaft, bis zu dem Tage, an dem man nicht mehr da ist. Mir fiel der Scopitone ein, die Film-Jukebox im Hafen von Dieppe. Um drei Uhr früh fuhren wir mit dem 2CV los, um das Meer zu sehen. Ich war sicher erst siebzehn und in Joseph Denner verliebt. Wir saßen zu siebt in den Wagen geklemmt, dessen Hinterteil über den Boden schrammte. Ich das einzige Mädchen. Denner am Steuer. Wir rasten nach Dieppe und tranken Billigbier, Valstar Rouge. Um sechs trafen wir im Hafen ein, gingen in die erstbeste Spelunke und bestellten Picon-Bière. Im Lokal stand ein Scopitone. Unter Lachanfällen sahen wir den Sängern zu. Einmal hatte Denner Le Boucher von Fernand Reynaud gewählt, der Sketch und der Picon sorgten dafür, dass wir Tränen lachten. Dann fuhren wir wieder nach Hause. Wir waren jung. Wir wussten nicht, dass das unwiederbringlich war. Heute bin ich zweiundsechzig. Ich könnte nicht sagen, dass ich es verstanden hätte, ein glückliches Leben zu führen, ich könnte mir in der Stunde meines Todes keine siebzig von hundert Punkten geben wie der eine Kollege von Pierre, der gesagt hat, ach komm, sagen wir mal siebzig von hundert, ich würde eher sagen sechzig, das wirkt weniger undankbar oder anmaßend, ich würde sagen, sechzig von hundert, auch wenn das ein bisschen geschummelt wäre. Wenn ich mal unter der Erde bin, was macht das dann noch? Ob ich es verstanden habe, glücklich zu sein, ist dann allen scheißegal, und mir erst recht.
Zu meinem sechzigsten Geburtstag lud Jean-Lino Manoscrivi mich zum Pferderennen nach Auteuil ein. Wir begegneten uns immer im Treppenhaus, wir beide gingen zu Fuß hoch, ich, um eine halbwegs genießbare Figur zu behalten, er aus Platzangst. Er war schlank, nicht groß, hatte ein schmales Gesicht, eine breite, fliehende Stirn, darübergekämmt die berüchtigten Strähnen, die Glatzköpfe kaschieren sollen. Er trug Brille, ein klobiges Gestell, das ihn älter machte. Er wohnte im Fünften, ich im Vierten. Diese Begegnungen im Treppenhaus, das ansonsten kein Mensch benutzte, schufen zwischen uns ein gewisses Einverständnis. In manchen Neubauten liegt das unansehnliche Treppenhaus abseits und dient nur den Möbelpackern. Dann reden die Mieter von der Seitentreppe. Eine Zeit lang kannten wir uns noch nicht richtig, ich wusste nur, dass er mit elektrischen Haushaltsgeräten zu tun hatte. Er wusste, dass ich im Institut Pasteur arbeite. Meine genaue Berufsbezeichnung, Patentingenieurin, sagt keinem Menschen etwas, und ich versuche nicht mehr, es so zu erklären, dass es attraktiv klingt. Einmal haben Pierre und ich ein Glas bei ihnen oben getrunken, beide Paare zusammen. Seine Frau war eine Art New-Age-Therapeutin, früher Filialleiterin in einem Schuhgeschäft. Sie waren noch nicht lange verheiratet, also, im Vergleich zu uns. Als ich Jean-Lino am Vortage meines Geburtstags auf unserer Treppe begegnete, sagte ich, morgen werde ich sechzig. Ich schleppte mich die Treppe hoch, es rutschte mir so heraus. – Sie sind noch keine sechzig, oder, Jean-Lino? Er antwortete, bald. Ich sah, dass er gern etwas Freundliches gesagt hätte, sich aber nicht traute. Als ich den Treppenabsatz vor meiner Wohnung erreichte, sagte ich, für mich war’s das, jetzt sind die Jungen dran. Da fragte er, ob ich schon mal beim Pferderennen gewesen sei. Ich verneinte. Stotternd lud er mich ein, falls ich Zeit hätte, könnte ich ihn ja morgen zur Mittagszeit in Auteuil treffen. Als ich an der Rennbahn eintraf, saß er im Restaurant, hing an den Fensterscheiben über dem Paddock. Auf dem Tisch ein Eiskühler mit einer Champagnerflasche, daneben ausgebreitet Rennzeitungen voller Notizen, verstreute Erdnussschalen, alte Wettscheine. Ganz der Mann, der entspannt in seinem Klub Besuch empfängt, so wartete er auf mich, der absolute Kontrast zu dem Jean-Lino, den ich bisher kannte. Wir aßen dann irgendwas Fettes, von ihm ausgesucht. Bei jedem Rennen geriet er schier außer sich, stand halb auf, brüllend, an der gereckten Gabel bebten triefende Lauchstückchen. Alle fünf Minuten ging er hinaus, eine halbe Zigarette rauchen, und kam mit einer neuen Wettmethode zurück. Ich hatte ihn noch nie so überschäumend energisch, ja freudig erlebt. Wir setzten unbedeutende Summen auf Pferde mit verkanntem Potential. Er spürte sie, er hatte seine höchstpersönlichen Überzeugungen. Er gewann ein klein wenig, vielleicht den Gegenwert des Champagners (wir tranken die ganze Flasche leer, er das meiste). Ich kassierte drei Euro. Ich dachte, drei Euro an deinem Sechzigsten, na schön. Mir wurde klar, dass Jean-Lino Manoscrivi einsam war. Eine Art Robert Frank von heute. Mit seinem Kugelschreiber und seiner Zeitung, vor allem mit seinem Hut. Er hatte sich ein Ritual geschaffen, einen eigenen Raum geschaffen, der ihn trug, aus der Zeit herausgelöst. Beim Pferderennen trat er breitschultriger auf, sogar seine Stimme änderte sich.
Mir fiel der Sechzigste meines Vaters ein. Damals aßen wir an der Place de la République eine elsässische Choucroute garnie. Sechzig war das Alter von Eltern. Ein gewaltiges, abstraktes Alter. Jetzt bist du selbst so weit. Wie kann das sein? Eine junge Frau schlägt über die Stränge, wie sie nur kann, zieht aufgebrezelt und in Kriegsbemalung durchs Leben, und auf einmal ist sie sechzig. Joseph Denner und ich gingen fotografieren. Er liebte die Fotografie, und ich liebte alles, was er liebte. Ich schwänzte die Bio-Stunde. Damals hatten wir keine Angst vor der Zukunft. Eine Tante hatte mir eine gebrauchte Konika geschenkt, das wirkte professionell, umso mehr, als ich dazu einen Nikon-Tragegurt abgestaubt hatte. Seine Olympus war keine Spiegelreflex, zum Scharfstellen benutzten wir einen eingebauten Entfernungsmesser. Das Spiel bestand darin, dasselbe Motiv aufzunehmen, im selben Moment, vom selben Standpunkt aus, jeder sein Bild. Wir machten Schnappschüsse auf der Straße wie die von uns bewunderten Großen der Zunft, knipsten Spaziergänger oder die Tiere im Jardin des Plantes neben der Uni, vor allem aber Denners geliebte Pinten am Pont Cardinet, von innen: die Gestrandeten, die Stammsäufer, die langsam irgendwo hinten in einer Ecke versteinerten. Die Kontaktabzüge machten wir bei einem Freund. Dann verglichen wir und entschieden, welche Aufnahme das Vergrößern wert war. Und welche war das? Die mit der besten Einstellung? Diejenige, die eine winzige, unergründliche Szene eingefangen hatte? Wer weiß die Antwort? Ich denke regelmäßig an Joseph Denner. Manchmal frage ich mich, was aus ihm geworden wäre. Aber was hätte schon werden sollen aus einem Typen, der mit sechsunddreißig an einer Leberzirrhose stirbt? Seit das alles passierte, ist er in meinem Kopf sozusagen neu entstanden. Diese kleine Geschichte hätte ihn herzlich zum Lachen gebracht. Der Band The Americans hat Bilder aus der Jugend in mir wachgerufen. Wir träumten in den Tag hinein und taten nichts. Sahen den Leuten nach, beschrieben ihr Leben und an welchen Gegenstand sie uns erinnerten, an einen Holzhammer, an ein Pflaster … Wir lachten. Unter dem Lachen spürten wir einen leicht bitteren Verdruss. Ich würde sie gern mal wiedersehen, diese Fotos vom Pont Cardinet. Wir haben sie wohl irgendwann mit alten Papieren weggeworfen. Nach dem Geburtstag in Auteuil schloss ich Jean-Lino Manoscrivi ein wenig ins Herz. Dann und wann gingen wir gemeinsam spazieren oder tranken bei Gelegenheit einen Kaffee an der Ecke. Draußen durfte er rauchen, zu Hause nicht. Für mich war er der sanftmütigste Mann der Welt, und ich sehe ihn auch jetzt noch so. Vertraulichkeiten gab es nie zwischen uns, wir blieben immer beim Sie. Aber wir redeten miteinander, manchmal über Dinge, die wir mit niemandem sonst besprachen. Er vor allem. Ich aber auch, bisweilen. Wir hatten herausgefunden, dass wir beide dieselbe Abneigung gegen unsere Kindheit hegten und sie am liebsten mit einem schwarzen Strich ausgelöscht hätten. Eines Tages sagte er über seinen Weg auf Erden, das Schlimmste ist auf jeden Fall geschafft. Ich sah das auch so. Väterlicherseits war Jean-Lino der Enkel jüdischer Einwanderer aus Italien. Sein Vater hatte als Handlanger in einem Posamentierwarenladen begonnen, sich dann auf Zierbänder spezialisiert und in den Sechzigern ein eigenes Kurzwarengeschäft aufgemacht, einen schmalen Schlauch in der Avenue Parmentier. Die Mutter saß an der Kasse. Sie wohnten einen Steinwurf vom Laden entfernt in einem Hinterhof. Die Eltern arbeiteten schwer und waren nicht gerade zartfühlend. Jean-Lino verstand sich nicht auf die Materie. Er hatte einen viel älteren Bruder mit einer guten Stellung in der Konfektionsbranche. Er selbst bekam keinen Fuß auf den Boden. Irgendwann hatte ihn die Mutter vor die Tür gesetzt. Dann begann er nach einer Konditorenausbildung als Koch, und im optimistischsten Augenblick seines Lebens kam er auf die Idee, ein Restaurant zu eröffnen. Das war hart. Kein Urlaub, nicht genug Umsatz. Am Ende hatte ihm das Arbeitsamt eine Umschulung zum Großhandelskaufmann finanziert, und eine Arbeitsvermittlungsagentur platzierte ihn im Kundendienst bei einem Filialisten für elektrische Haushaltsgeräte. Kinder hatte er keine. Sonst wollte er den Mächten, die sein Leben gelenkt hatten, nichts vorwerfen. Seine erste Frau verließ ihn, nachdem er mit dem Restaurant Pleite gemacht hatte. Als er Lydie kennenlernte, war sie dank einer Tochter aus früherer Ehe schon Großmutter. Seit zwei Jahren kam der Kleine jetzt regelmäßig zu ihnen. Seine Eltern hatten sich unter übelsten Umständen getrennt, das Jugendamt hatte sich einschalten müssen, und beim geringsten Anlass wurde das Kind bei Oma Lydie abgeladen. Jean-Lino hatte sein Zärtlichkeitsbedürfnis nie ausleben können (höchstens mit seinem Kater), und so empfing er Rémi mit offenen Armen und bemühte sich darum, von ihm geliebt zu werden. Ist es vernünftig, sich um das Geliebtwerden zu bemühen? Ist das nicht eine jener Mühen, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind?
Anfangs war es das reine Chaos gewesen. Als das Kind bei ihnen ankam – es war fünf Jahre alt und hatte vorher in Südfrankreich gewohnt –, belegte es Jean-Lino mit geflissentlicher Nichtachtung und heulte los, sobald Lydie verschwand. Ein nichtssagender, etwas pummeliger kleiner Junge, wenigstens hatte er beim Lächeln niedliche Grübchen. Die Eingewöhnung wurde zusätzlich durch Eduardo, Jean-Linos Kater, erschwert, ein unsympathisches Tier, das er in Vicenza irgendwo auf der Straße aufgegabelt hatte und das man ausschließlich auf Italienisch ansprechen durfte. Lydie hatte es verstanden, Kontakt zu Eduardo zu finden. Sie hielt ihm ihr Pendel vor die Nase, und gebannt verfolgte der Kater das Hin und Her des Rosenquarzes (der Stein hatte sich ihr irgendwo in Brasilien offenbart). Zum Ausgleich hatte Eduardo gegen Rémi eine sofortige Abneigung gefasst. Wenn der Kleine auftauchte, bauschte er sich zu doppelter Körpergröße auf und fauchte furchterregend. Jean-Lino versuchte, den Kater zur Raison zu bringen, auch wenn niemand sonst ihn dabei unterstützte. Schließlich regelte Lydie die Sache, indem sie Eduardo ins Badezimmer verbannte. Rémi piesackte ihn, indem er durch die Tür sein Miauen nachmachte. Jean-Lino wollte das unterbinden, hatte aber nicht die geringste Autorität. Wenn die Luft rein war, versuchte er, das Tier unauffällig zu trösten, indem er ihm durch den Türspalt ein paar Brocken Italienisch zuflötete. Rémi weigerte sich, Jean-Lino Opa Jean-Lino zu nennen. Das heißt, man kann nicht sagen, er weigerte sich, er nannte ihn schlicht und einfach niemals Opa Jean-Lino, trotz Jean-Linos unaufhörlichem Opa Jean-Lino liest dir eine Geschichte vor oder Wenn du schön deinen Fisch aufisst, dann kauft Opa Jean-Lino dir dies oder das. Rémi scherte sich keinen Deut darum, er fand das offenbar unter seiner Würde. Wenn er ihn ansprechen musste, nannte er ihn eben Jean-Lino, und der fühlte sich törichterweise gekränkt durch diesen jeder familiären Tönung baren Vornamen. Später wechselte er die Strategie und setzte sich in den Kopf, die Gunst des Kindes mit Humor zu erobern. Er brachte ihm Blödsinn bei, von Apokoko über Upikiki bis hin zu Opakaka. Das liebte Rémi. Nicht lange, und er ließ die beiden ersten Versionen aus und wiederholte Opa-Kacka in Endlosschleife, gern mit albern verstellter Stimme oder singend, oder er schleuderte Jean-Lino das Wort direkt ins Gesicht, vorzugsweise draußen und möglichst laut. Ich durfte selbst im Eingang unseres Hauses als Zeugin dieses Spektakels herhalten. Jean-Lino sagte gespielt amüsiert, weißt du, wenn man ein Wortspiel zu oft wiederholt, ist es nicht mehr witzig. Er wusste nicht mehr, wie er den Mechanismus abstellen sollte. Je mehr er das Kind zur Vernunft bringen wollte, desto wilder wurde Rémi. Statt zu sagen, etwas sei gut oder nicht gut, sagte er voll geil oder voll ungeil (von Jean-Lino gelernt?), und manchmal antwortete er das ist voll ungeil, Opa-Kacka. Lydie war keine Hilfe, sie beschränkte sich auf die Mitteilung, wie man in den Wald hineinrufe, so schalle es eben heraus. Wenn sie bei Jean-Lino Anflüge von Verzweiflung bemerkte, sagte sie nur, lass den Jungen doch einfach in Ruhe – mit einer nachsichtig-ungeduldigen Betonung im Sinne von, man wird doch ein Opfer großelterlicher Inkonsequenz nicht tadeln wollen. Aus der Rückschau denke ich, sie spürte die Gefahren dieser einseitigen Anhänglichkeit. Ich sollte noch ein Wort zu unserem Hauseingang sagen. Ein länglicher Raum, durch die halb verglaste Eingangsfront fällt das Tageslicht. Der Fahrstuhl liegt der Tür mittig gegenüber. Zur Treppe gelangt man links durch eine etwas zurückgesetzte Tür. Der kurze Flur hinten rechts führt zum Mülltonnenraum. Waren sie zu dritt, so nahm Lydie mit ihrem Enkel den Fahrstuhl, Jean-Lino ging zu Fuß hoch. Wenn Jean-Lino mit dem Kleinen allein war, wollte der unbedingt Fahrstuhl fahren. Wenn man ihn ins Treppenhaus bringen wollte, ließ er sich nur schreiend hineinschleifen. Jean-Lino konnte einfach nicht den Fahrstuhl nehmen. Im Lauf seines Lebens hatte er nach und nach auf Flugzeuge, Fahrstühle, die Metro und die neuen Züge verzichten müssen, in denen man die Fenster nicht mehr aufmachen kann. Eines Tages klammerte der Kleine sich wie ein Äffchen an die Tür zum Treppenhaus, um ja nicht hineingehen zu müssen, irgendwann ließ Jean-Lino sich resigniert auf den untersten Stufen nieder, Tränen in den Augen. Rémi setzte sich neben ihn und fragte, warum willst du nicht mit dem Fahrstuhl fahren?
– Weil ich Angst habe, sagte Jean-Lino.
– Ich hab keine Angst, ich kann fahren.
– Du bist zu klein.
Nach einer Weile stand Rémi auf und ging die Treppe hinauf, wobei er sich am Geländer hochzog. Jean-Lino hinterher.
Wenn ich unter all den Bildern, die mir von Jean-Lino in Erinnerung geblieben sind, ein einzelnes auswählen sollte, dann das, wo er fast im Dunkeln auf dem marokkanischen Lederstuhl sitzt, die Arme auf die Armlehnen gepresst, inmitten einer überflüssig gewordenen Ansammlung von Stühlen. Jean-Lino Manoscrivi versteinert auf dem unbequemen Stuhl, im Wohnzimmer, auf der Truhe stehen noch all die Gläser, die ich panikartig für den Anlass angeschafft hatte, die Schalen mit Sellerie und fettarmen Chips, all die Überreste der in einem Anflug von Optimismus veranstalteten Sause. Wer kann schon sagen, wann genau etwas angefangen hat? Wer weiß, welche obskure, vielleicht lang vergangene Verknüpfung von Dingen den Vorfall steuerte? Jean-Lino hatte Lydie Gumbiner in einer Bar kennengelernt, wo sie als Sängerin auftrat. Wenn man das so hört, stellt man sich eine üppige Frau vor, die mit warmer Stimme ins Mikro haucht. In Wirklichkeit war sie eine kleine Alge ohne viel Busen, als Zigeunerin gekleidet, voller glitzernder Anhänger, die meiste Mühe hatte sie sichtlich auf ihre Frisur verwendet, ein orangefarbenes Gekräusel, füllig, von dekorativen Spangen gebändigt (dazu noch ein Fußkettchen, ebenfalls mit Anhängern …). Sie nahm bei einer Gesangslehrerin Jazzunterricht und produzierte sich dann und wann in Bars (wir haben uns das einmal angesehen). Seinerzeit hatte sie Syracuse von Henri Salvador gesungen und dabei Jean-Lino angestarrt, der per Zufall an jenem Abend ganz vorn vor dem Podium saß und am Ende mitmurmelte, Bevor meine Jugend verweht und mein Frühling welkt … Jean-Lino war ein Salvador-Fan. Sie gefielen einander. Er mochte ihre Stimme. Er mochte ihre langen, duftigen Röcke, ihren Hang zum Grellbunten. Er fand es attraktiv, dass eine Frau ihres Alters sich nicht um städtische Konventionen scherte. Eine übrigens in mancherlei Hinsicht nicht so einfach einzuordnende Frau, die in der Meinung lebte, sie besitze übernatürliche Fähigkeiten. Warum hatten diese beiden Wesen sich zusammengetan? In Straßburg hatte ich am Institut für Gewerblichen Rechtsschutz eine Freundin, eine eher zurückhaltende junge Frau. Eines Tages heiratete sie einen etwas verunglückten, maulfaulen Typen. Sie sagte, na ja, ich bin allein, er ist allein. Dreißig Jahre später traf ich sie im Thalys, sie baute Heißluftballons für Vergnügungsparks, sie war immer noch mit ihm zusammen und hatte drei Kinder. Beim Paar Gumbiner-Manoscrivi fällt das Finale nicht so heiter aus, aber ist das Grundmotiv nicht immer dasselbe, wenn auch unendlich oft variiert? Bei unserem kleinen Fest (Frühlingsfest nannte ich es) machte ich ein paar Fotos. Auf einem davon steht Jean-Lino über Lydie gebeugt, die in einem ihrer knalligen Outfits auf dem Sofa sitzt, beide lachen, die Gesichter nach links gewandt. Es scheint ihnen gutzugehen. Jean-Lino wirkt zufrieden und etwas erhitzt. Er stützt sich auf die Rückenlehne des Sofas, den Körper über ihre roten Locken geneigt. Ich weiß noch genau, was sie zum Lachen gebracht hatte. Das Foto wurde in die Ermittlungsakte aufgenommen. Es hält das Gleiche fest wie jedes andere Foto, einen erstarrten Moment, der sich nie wiederholen wird und so vielleicht nicht einmal stattgefunden hat. Doch da es nie wieder ein Bild von Lydie Gumbiner geben wird, scheint ihm ein verborgener Sinn innezuwohnen, es trägt einen Heiligenschein, eine morbide Aura. Kürzlich sah ich in einer Wochenzeitschrift ein Foto von Josef Mengele in den siebziger Jahren in Argentinien. Er sitzt im Unterhemd irgendwo draußen, vor den Resten eines Picknicks, inmitten einer Gruppe junger Leute beiderlei Geschlechts. Eine junge Frau hat sich bei ihm eingehakt. Sie lacht. Der Nazi-Arzt lacht. Sie sind alle fröhlich und entspannt, erfüllt von Sonnenschein und der Leichtigkeit des Lebens. Ohne das Datum und den Namen der Hauptfigur wäre das Foto ganz und gar uninteressant. Erst die Bildunterschrift lässt die Wahrnehmung umschlagen. Gilt das vielleicht für jedes Foto?
Ich weiß nicht, wie die Idee zu diesem Frühlingsfest in meinem Kopf entstanden ist. Wir hatten bis dahin noch nie etwas Derartiges bei uns zu Hause gemacht, weder Umtrunk noch Fest, noch gar ein Frühlingsfest. Wenn wir Freunde einladen, werden das nie mehr als sechs Leute um einen Tisch. Ursprünglich hatte ich Lust, was mit meinen Freundinnen aus dem Pasteur zu machen, wir wollten ein paar von Pierres Kollegen dazunehmen, und dann fielen mir noch mehr Namen ein, ich fing an, mir mehr oder weniger verheißungsvolle Konstellationen auszumalen, sehr bald stellte sich die Stuhlfrage. Pierre sagte, leih doch bei den Manoscrivis ein paar Stühle aus.
– Ohne sie einzuladen?
– Wir laden sie ein. Sie könnte ja sogar was singen!
Die Manoscrivis interessierten Pierre nicht weiter, aber wenn schon, fand er Lydie amüsanter als Jean-Lino. Ich schickte rund vierzig Einladungen raus. Und bereute es sofort. In der Nacht danach bekam ich kein Auge zu. Wo sollten die alle sitzen? Wir hatten sieben Stühle, den marokkanischen mitgezählt. Die Manoscrivis verfügten vermutlich noch einmal über dieselbe Anzahl. Der marokkanische Stuhl war ziemlich sperrig, aber den konnte man ja wohl nicht aus dem Spiel lassen. Abgesehen von den Stühlen boten Sitzsack und Sofa, bei idealer Synergie, Sitzgelegenheiten für weitere sieben Gäste. Drei mal sieben macht einundzwanzig. Wozu man noch einen Hocker aus dem Keller rechnen musste, also zweiundzwanzig (ich hatte auch an die Truhe gedacht, aber die musste schon als Tisch dienen, in Ergänzung zum Sofatisch). Wir brauchten noch zehn Stühle mehr, aber Klappstühle. Klappstühle, damit man sie erst im Bedarfsfall aufklappen konnte und nicht vorher aufbauen musste, als erwartete man eine Anzahl Zuschauer, aber woher Klappstühle nehmen? Allein schon wegen des mangelnden Flächenangebotes waren dreißig aufgeklappte Klappstühle in der Wohnung undenkbar, abgesehen von der kalten Eintönigkeit solcher Reservestühle, und wozu eigentlich all diese Stühle? Wenn man so ein informelles Fest mit Abendessen veranstaltet – jawohl, informell! –, dann sitzen ja nicht immer alle, sie unterhalten sich im Stehen, wandern herum, man darf mit einer Art Hin und Her rechnen, mit freier Platzwahl, die Leute setzen sich auf die Armlehnen oder hocken am Boden, ganz locker, an die Wand gelehnt, genau! … Aber die Gläser … Mitten in der Nacht stand ich auf, um unsere Gläser zu zählen. Fünfunddreißig, mehr oder weniger zueinander passend. Plus sechs Champagnergläser in einem anderen Schrank. Beim Aufwachen sagte ich zu Pierre, wir haben keine Gläser. Wir müssen zirka zwanzig Wein- und Champagnergläser kaufen. Pierre sagte, es gibt doch Champagnergläser aus Plastik. Ich sagte, oh nein, bloß das nicht, ich bin schon über die Pappteller nicht glücklich, die Gläser müssen echt sein. Pierre sagte, es ist doch idiotisch, extra welche zu kaufen und sie danach nie wieder zu benutzen. Aber wir werden doch nicht den Champagner aus Plastik trinken wie bei einer Abschiedsfeier! Pierre sagte, es gebe superstabile Champagnerflöten aus absolut akzeptablem Pseudoglas. Ich schaute im Netz nach und bestellte drei Packungen à zehn Élégance-Champagnerflöten und drei Schachteln mit je fünfzig Wegwerfmessern, -gabeln und -löffeln aus metallisiertem Plastik in Edelstahl-Optik. Das beruhigte mich, bis ich am Samstag des Festes am Nachmittag eine erneute Gläserkrise hatte. Champagnerflöten hatten wir, aber keine Weingläser. Nach einer Irrfahrt durch Deuil-l’Alouette kam ich mit dreißig Ballongläsern aus Echtglas und einem Karton mit sechs Champagnergläsern zurück, ebenfalls Echtglas. Ich holte eine nie benutzte Tischdecke raus, breitete sie über die Truhe und baute darauf sämtliche Gläser, Kelche, Ballongläser und Pseudogläser auf, dazu dann noch vier Wodkagläser, falls jemand Wodka wollte. Wenn man die aus der Küche dazutat, waren das mehr als einhundert Stück. Gegen sechs klingelte Lydie. Schon ein bisschen angeschickert, an jedem Arm einen Stuhl. Wir gingen zu ihr hoch, die anderen holen. In ihrem Schlafzimmer stand ein gelber Samtsessel. Ich hatte das Schlafzimmer der beiden noch nie gesehen. Das gleiche Zimmer wie bei uns, aber zehnmal bunter, zehnmal unordentlicher, an der Wand Ikonen und ein Poster mit der halbnackten Nina Simone in einem Kleid aus lauter weißen Strippen, und das Bett stand woanders. Mitten zwischen den Kissen ruhte Eduardo, misstrauisch und schläfrig. Was treibst du denn da!, schrie Lydie. Sie klatschte in die Hände, und der Kater trollte sich. Sie sagte, ich erlaube ihm nicht, ins Schlafzimmer zu kommen. Wenn mich nicht alles täuscht, sah ich auch einen Nachttopf mit hölzernem Deckel. Auf den ersten Blick erkannte ich, dass Jean-Lino nie und nimmer etwas zur Ausstattung des Zimmers beigetragen hatte, nicht, dass anderswo seine persönliche Note erkennbar gewesen wäre, aber die übrige Wohnung hatte eher etwas vom zufallsbedingten Kompromiss zweier Leben. Das Fenster stand halb offen, von sanft wehenden seidigen Vorhängen im Design einer englischen Bonbondose gerahmt, in der Ferne erblickte man über den Dächern ein Stückchen Eiffelturm, das wir von uns aus nicht sehen konnten. Ihr Schlafzimmer kam mir fröhlicher, jünger vor als unseres. Beim Anheben des viel zu schweren Sessels wurde ich neidisch. Im Laufe meines Lebens bin ich schon öfter von Zimmern entmutigt worden. Von meinem Kinderzimmer. Diversen Krankenhauszimmern oder Hotelzimmern mit unattraktiver Aussicht. Das Fenster prägt das Zimmer. Welchen Ausschnitt es zeigt, wie viel Licht es einlässt. Und auch die Vorhänge. Die Gardinen! Ich war in meinem Leben dreimal im Krankenhaus, die Entbindung mitgerechnet. Jedes Mal hat mich das Krankenhauszimmer entmutigt mit seinen großen, irgendwie matten Scheiben, durch die der symmetrische Ausschnitt eines Gebäudes zu sehen war, Geäst oder ein überdimensionaler Himmel. Das Krankenhauszimmer hat mir jedes Mal alle Hoffnung genommen. Sogar mit dem Baby in seinem gläsernen Bettchen neben mir.
Eines der bekanntesten Fotos von Robert Frank zeigt den Blick auf Butte, einen Bergwerksort in Montana, von einem Hotelfenster aus aufgenommen. Dächer, Lagerschuppen. In der Ferne Rauch. Zu beiden Seiten ist die halbe Landschaft mit Tüllgardinen verhangen. Das Kinderzimmer von meiner Schwester Jeanne und mir ging teilweise auf die Mauer einer Turnhalle hinaus. Der Putz löste sich in großen Placken. Wenn ich mich nach links hinausbeugte, sah ich eine Straße ohne Passanten und eine Bushaltestelle. Wir wohnten in einem Backsteinhaus in Puteaux. Mittlerweile abgerissen (ich bin mal dort langgegangen, die Gegend war nicht wiederzuerkennen). Wir hatten haargenau die gleichen Vorhänge, die gleichen Maschen, die gleiche senkrechte, etwas knittrige Krause. Das gab ein ebenso tristes Bild von der Welt ab. Auch die Fensterbank war die gleiche. Aus schmutzigen Steinen gemauert, zu schmal, man konnte nichts daraufstellen. Unter dem Hotelzimmerfenster in Butte liegen düstere Baracken und eine leere Straße. Das in Puteaux ging auf eine Rückwand ohne jede Öffnung. Vor etwas Wunderschönes hätte kein Mensch so einen Vorhang getan. Ich sagte zu Lydie, ich fürchte, der Sessel ist ein bisschen wuchtig.
– Ja, ja, dann holen wir ihn eben notfalls später.
Sie zog mich ins Wohnzimmer. Auf dem Balkon, dieser für Neubauten typischen Balkonschachtel, die man eher selten betritt, hatte sie einen kleinen Dschungel geschaffen. Eine große Mimose reckte ihre Äste, man sah sie von der Straße aus. Blühende Büsche in Töpfen. Manchmal tropfte ihr Gießwasser zu uns herunter. Ich sagte, Ihr Balkon ist ja ein Traum. Sie zeigte mir ihre keimenden Tulpen und die Spitzen der Krokusse, die am selben Morgen hervorgekommen waren.
– Brauchen Sie sonst noch was? Teller, Gläser?
– Ich glaube, ich habe genug von allem.
– Wo Sie gerade hier sind, würden Sie noch eine Petition gegen die Kükenschredderung unterschreiben?
– Die Küken werden geschreddert?
– Die männlichen. Sie legen keine Eier, also werden sie bei lebendigem Leibe in den Schredder geworfen.
– Das ist ja grauenhaft! Ich setzte meinen Namen auf die Liste und unterschrieb.
– Und Servietten? Ich habe welche aus Knitterleinen, bügelfrei.
– Ich habe alles, was ich brauche.
– Jean-Lino ist runtergegangen, Champagner kaufen. Und seine Chesterfield rauchen.
– Das wäre aber nicht nötig gewesen.
– Oh doch!
Sie war viel aufgeregter als ich. Ich war von meinen Angstanfällen erschöpft und sah dem Abend entgegen wie einer Strafe. Ihre Freude beschämte mich. Ich fand sie rührend und sympathisch. Es war für sie eine unerwartete Einladung zu Nachbarn, die sie für herablassend gehalten hatte. Wir gingen mit drei weiteren Stühlen nach unten. Dort angekommen, sagte ich, wunderbar, vielen Dank, Lydie, jetzt machen wir uns beide schön! Sie drückte mir das Handgelenk als Zeichen des Einverständnisses.
– Irgendwann demnächst werde ich Sie mal resetten.
– Was ist das?
– Ich evaluiere Sie mit meinem Pendel. Hole alle Schlacken raus, reinige die Organe. Bringe wieder Fluss rein.
– Das dürfte bei mir Jahre dauern!
Sie lachte und sprang mit hüpfenden Locken die Treppe hinauf.