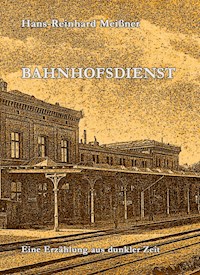
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erzählt wird die Geschichte vom "kleinen Mann" Gustav Brennicke. Diese Zuschreibung betrifft nicht nur dessen Gestalt, seine Körperlichkeit; sie ist vielmehr auch ein Sinnbild für die Rolle des Individuums in bewegter, stürmischer Zeit. Keine politische Strömung gelangt jemals zur Herrschaft, wenn es ihr nicht gelingt, Menschen auf ihre Seite zu ziehen. Anfang der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts gerät Gustav Brennicke in den Sog der nationalsozialistischen Bewegung. Als Parteigänger des Systems, als untergeordneter NSDAP-Funktionär in einer Kleinstadt am Rande des Harzes, profitiert er von diesem. Wie -zig Millionen Deutsche auch, lässt Brennicke willig die Verknüpfung seines persönlichen Schicksals mit den Plänen einer mehr und mehr zum Hasard neigenden NS-Führung zu. Bewusst wird ihm das erst durch persönliche Betroffenheit. Der kleine Mann zahlt einen hohen Preis für sein distanzloses, gläubiges Vertrauen. Von den Anfangsjahren des Dritten Reiches bis hin zu dessen unrühmlichem Untergang kann der Leser den Weg des Protagonisten und seiner Familie, ausgemalt durch zeittypische Episoden, mitverfolgen. Er erlebt Hochstimmung, wohlfeilen Opportunismus, aufkeimende Zweifel dramatische Endpunkte. Durch einen Akt der Menschlichkeit bewirkt Gustav Brennicke im Zusammenbruch noch Gutes. Dass für ihn dennoch alles in der Katastrophe endet, wird keiner besonderen Erwähnung bedürfen. So bleibt Gustav Brennicke stets handelnde natürliche Person und ein Symbol der Zeit zugleich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans-Reinhard Meißner
Bahnhofsdienst
Eine Erzählung aus dunkler Zeit
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Inhalt
V O R S P R U C H
E R S T E S K A P I T E L
Z W E I T E S K A P I T E L
D R I T T E S K A P I T E L
V I E R T E S K A P I T E L
F Ü N F T E S K A P I T E L
S E C H S T E S K A P I T E L
S I E B E N T E S K A P I T E L
A C H T E S K A P I T E L
N E U N T E S K A P I T E L
Z E H N T E S K A P I T E L
E L F T E S K A P I T E L
Z W Ö L F T E S K A P I T E L
E P I L O G
A N M E R K U N G
Impressum neobooks
Inhalt
Hans-Reinhard Meißner
BAHNHOFSDIENST
Eine Erzählung aus dunkler Zeit
V O R S P R U C H
Herbei, herbei, ihr Leute, die ihr Abseits steht! Ein Menschenleben wird besichtigt.
Gegeben wird die Geschichte vom kleinen Mann.
Jener ist von Gestalt ein ziemlicher Winzling, auch kann seiner irdischen Existenz im heftigen Geschiebe und Getriebe der Zeit und der Zeitenwenden kaum herausgehobene Bedeutung zugebilligt werden.
Er hat in Person keine Kriege vom Zaun gebrochen und auch keine Revolutionen ausgelöst.
Aber halt: Warum ist er denn dann überhaupt da? Wozu ist der kleine Mann nütze?
Diese Frage, wertes Publikum, ist nun immerhin ganz leicht zu beantworten.
Er ist, ohne dies bis zu seinem Ende je begriffen zu haben, ein kleines Rädchen in einer monströsen Maschine.
Ein Tropfen, jawohl, nicht viel mehr als ein Regentropfen, der perlend auf ein Blatt trifft oder vom tauenden Eiszapfen herabfällt, das ist er. Aber aus vielen Tropfen wird irgendwann einmal der reißende Strom, schließlich ein Meer.
Die Tatsache, dass die gewöhnliche Umgebung des kleinen Mannes ihn stets und ständig um ein oder zwei Köpfe überragt, erlangt insoweit einiges Gewicht, weil sie ihn unwillkürlich antreibt, vielleicht immer etwas mehr zu tun als andere, ein wenig gefälliger, ein bisschen dienstbeflissener als der Rest des Universums zu sein.
Der kleine Mann wird in eine Kulisse gestellt.
Und das ist zuvorderst die kleine Stadt, die vorm Gebirge liegt.
Weil er nicht allein auf der Welt ist, gehören zur kleinen Stadt vorm Gebirge, dessen Silhouette sich ganz nach Wetter zuweilen glasklar oder auch diesig verschwommen am Horizont zeigt, vor allem die Menschen, die dem kleinen Mann nahe sind oder seine Wege kreuzen.
Die Vorstellung auf dem Theater wird aber zwangsläufig unvollständig geraten, wenn man nicht eines bedeutsamen, ja eigentlich des wichtigsten seelenlosen Akteurs gedenkt.
Ihn durchziehen Adern. Aber in ihnen fließt kein Blut.
Er hat ein Gehirn. Und er hat Nerven. Das Erste ist eingemauert. Sein starrer Inhalt sind Telefone, Schaltkästen, Hebel, Lichttafeln, Dienstpläne.
Die Nerven sind reine Drahtseile, stahlhart, hundertfach gerötelt, fettig auf Gängigkeit geschmiert. Sie verbinden das Hauptstellwerk mit dem dienenden Zubehör.
Es wird also auch die Rede sein von einem Bahnhof, von dampfenden Stahlrössern und den Adern; das sind kalte Schienenstränge, denen es völlig gleichgültig ist, was über sie eingeht oder ausgeht und dass sie zufällig am Rande eines Gebirges liegen. Es ist ihnen schlicht egal, dass es die kleine Stadt überhaupt gibt und sie wie Schlangenlinien gewunden von irgendwo im fernen Dunst herkommen und nach irgendwo wieder an dem Punkt, an denen Äcker sich am Himmelsblau stoßen, verschwinden.
Teilnahmslos lassen sie es geschehen, dass von früh bis spät stählerne Radkränze, wahre Kolosse, über sie hinweg donnern, schmerzhaftes, stechendes Quietschen erzeugen, Funken schlagen.
Neben Bahnsteigen, Signalen, verschiedenen Stellwerken, Lokschuppen, einem Wasserturm und Verladerampen gibt es eine weitere Sache von eminenter Wichtigkeit.
Da liegen in den Boden gesenkt noch jene Gabelungen mit deren Hilfe der Zug von einem Gleis auf das andere wechselt.
Eine Weiche, wenn sie denn nicht nur beiläufig als ein kühles mechanisches Ding aus diamanthartem Metall betrachtet wird, ist auch ein Symbol. Sie ist ein Gleichnis dafür, dass das Leben, unberechenbar, wie es sich nun gerade anstellt, irgendwann einmal den schweren massig-klobigen Weichenhebel herumwerfen kann. Der Pfeil der Weichenlaterne zeigt dann schicksalhaft in eine Richtung und der Weg ist vorgezeichnet. Der Zug ist abgefahren. Was dahinter liegt, ist dahin, aus und vorbei, Vergangenheit, so sehr man sich auch dagegenstemmen mag.
E R S T E S K A P I T E L
Auf die Welt kam der kleine Mann in einem ärmlichen Dorf, das sich noch näher ans Gebirge drückte als die kleine Stadt. Wenn er später über sein Geburtsjahr nachdachte, fiel ihm nur ein, dass in eben jenem Jahr der junge Kaiser Wilhelm dem Fürsten Bismarck den Abschied erteilt hatte. Viel später sah er eine Zeichnung, die ihn faszinierte: Der Lotse geht von Bord.
Der Reichskanzler Bismarck schreitet erhobenen Hauptes das Fallreep hinab. Hoch oben an der Reling der junge Kaiser, der meinte, selbst alles besser machen zu können.
„Ha“, hat da der kleine Mann nach dem ersten großen Krieg gedacht, „von wegen, wohin das geführt hat, haben wir ja gesehen!“
Er erhielt den Namen seiner Mutter. Brennicke hat sie geheißen. Von seinem Erzeuger konnte er nichts erhoffen, nicht einmal einen Namen. Der Wirt des „Schwarzen Adler“, der mephistophelisch anzuschauende Petersen, dem ein solch kalter, stechender Blick eigen war, dass dem Überraschten das Blut in den Adern gefror, verleugnete die Vaterschaft, drohte der Magd und warf sie schließlich hinaus.
Hätte sich nicht ein Bauer aus der Nachbarschaft erbarmt, der die beiden aufnahm, sie hätten im Elend umkommen müssen. Die junge Mutter ließ den Knaben im amtlichen Personenstandsregister und im Kirchenbuch auf den Namen Gustav eintragen, eine Wahl, die sie wegen eines in der Gaststube hängenden vergilbten Stahlstichs „Gustav Adolf, König von Schweden, Retter des Glaubens“ getroffen hatte.
Angaben über die fernere Herkunft ihres Sohnes verweigerte sie allezeit standhaft, zumal ihr der Petersen, nachdem er ihrer Verschwiegenheit sicher war, alle Monate zehn oder zwanzig Mark zusteckte.
Gustav konnte sich an seine Kindheit später kaum mehr erinnern. Wenige Bilder waren haften geblieben, außer dem Gedenken an nimmer enden wollende Schinderei auf stocktrockenen Feldern mit eisenharter Krume, Schläge und daran, dass immer im Herbst das ganze Dorf nach Baldrian duftete. Bei diesem Gedanken bebten stets die Nasenflügel und er schnüffelte gierig. Der Geruch nach Kampfer war ihm dann, wenngleich als solcher keineswegs lieblich, so gegenwärtig, dass er die Augen schloss und sich lebhaft in die Vorzeit zurückversetzt fühlte.
Er wuchs auf in einem Gehöft ganz weit abseits vom Dorf. Hinter seiner Bleibe wogte ein Meer, eine Impression, die die hügelige Landschaft dem Schauenden förmlich aufdrängte, wenn der Wind die Getreidefelder wie Wellen sturmzerzaust hin und her bewegte. Der Fortschritt der Jahreszeiten verwandelte das weiße Winterkleid in saftiges Grün. Dem folgten prall vergoldete Ähren, ehe sich dann die Waldsäume in der verschwenderischen Farbigkeit des Herbstes kleideten.
Das schüchterne kleine Kind sog aus der Natur so unbewusst in sich auf, was ein Philosoph auch mühelos viel komplizierter hätte ausdrücken können: alles fließt. Jedes Ding unter der Sonne ist stetem Wechsel unterworfen.
Der Weg zum Obdach des Gustav Brennicke, der entweder so staubig war, dass es einem an heißen Tagen den Atem verschlug oder aber der Wanderer bei Regenwetter knöcheltief im Schlamm versank, führte am oberen Ende, am Abzweig von der zerfurchten Landstraße, am Anwesen des Bauern Hahne vorbei. Das war ein poltriger, grober Patron gewesen, dessen Knasterpfeife nie ausging. Der kleine Brennicke ängstigte sich lange Zeit, dem verwitterten großschädeligen Graukopf zu begegnen.
Aber wie es so ist: da alles fließt, waren jähe Wendungen nicht ausgeschlossen.
Eines Tages winkte der Bauer den schlotternden Knaben heran und drückte ihm einen Korb mit Birnen, Äpfeln und verschiedenem Gemüse in die Hand.
„Das ist für dich und deine Mutter!“, sprach er mit einem Schmelz in der Stimme, die man bei dem rauen Gesellen, der er zu sein schien, nicht vermutet hätte.
Und siehe da: etwas hatte sich verändert.
Von dort, also vom alten Hahne ab, musste der Schüler noch einen quälend langen Fußmarsch absolvieren, bis er endlich nach Hause kam.
Der quartiergebende Bauer, im Dorf wegen seines kreisrunden feisten Gesichts genannt der „Mond“, hatte ein keifendes Weib, das Mutter und Kind vom frühen Morgen bis in die späte Nacht mit bösen Redensarten malträtierte und unablässig zur Arbeit anhielt. Zwar konnte man in einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft nichts anderes erwarten, der Grund lag indes tiefer. Die Bäuerin hatte ihrem Mann die Aufnahme der „Exulanten“ nie verziehen. Da die Welt aber noch in Ordnung und oben oben und unten unten war, ging es nicht an, gegen den Willen des Bauern zu opponieren. Und irgendwie hatte die Bäuerin mit ihrem Misstrauen auch recht. Während sie im groben Leinenzeug des Bettes von der Arbeit des Tages erschöpft hinweg dämmerte, stieg der „Mond“ Gustavs Mutter nach und – er hatte oft genug Erfolg.
Je mehr sie sich der Neigung des „Mondes“ versicherte, umso weniger kümmerte sich die Mutter um das Kind. Er wuchs ohne die Bindungen auf, die man dem Heranwachsenden wohl von Herzen vergönnt hätte. Liebe hat die Mutter heimlich vom „Mond“ erfahren, das Kind Gustav nie von irgendjemanden.
Zwischen dem Anwesen des Ökonomen Hahne, dieser zunehmend einem verschämten, bisher unentdeckten Ribbeck gleichend, und dem Gehöft des „Mondes“ lagen zweitausend Schritt, die im Dorf, als der „Hahnekackerweg“ verschrien waren. Daraus spricht schon ungeheuerlicher, den tatsächlichen Verhältnissen Hohn sprechender, durch nichts begründeter Dünkel. Wessen Anwesen näher am Kirchhof und am Gutshaus belegen war, der hielt sich selbstgefällig zugute, in der dörflichen Hierarchie etwas Besseres darzustellen, als jene, die an den Ortsrändern siedelten.
Gustav wohnte da draußen, getrennt von den anderen. Der Flurname ging als ein Schimpf auf die Anwohner über. Hahnekacker! Hahnekacker!
In wilder Hatz mit dem Feldgeschrei, der Hahnekacker möchte ja machen, dass er sich in seine Hundetürkei verziehe, haben die gnadenlosen Wänste derer, die sich in dem Gemeinwesen vermöge der Stellung ihrer Eltern herausgehoben wähnten, den kleinen Gustav durchs Dorf getrieben.
Er hat es verdrängt, aber nie eigentlich vergessen. Die kindliche Seele hatte, wenngleich nur einen kleinen Kratzer, so doch eine bleibende Verletzung erlitten. Eine Verwundung im Übrigen, für die es noch keine Abzeichen gab. Nur Stoff zum Grübeln. Er vermochte sich keine Antwort darauf zu geben, was er wohl falsch gemacht hätte, auf dass die anderen ihn so verachteten.
Das Leben fing an kompliziert zu werden.
Hinzu trat noch ein anderes: Der junge Gustav Brennicke blieb körperlich klein, während andere lang aufschossen. Vielleicht forderte ja allein schon jener geringe Wuchs die Umwelt zum Übermut geradezu heraus.
Die Schule des Lebens lehrte Gustav, dass er immer ein wenig härter als andere kämpfen musste, um durchzukommen. Er hat die Lektion gelernt.
Wie dem auch sei. Der Weggang vom Dorf ließ ihn jedenfalls nichts vermissen.
Mit fünfzehn entfloh er deshalb leichten Herzens dem kargen und auszehrenden Landleben. Voller Zuversicht, nun das Gebirge, ohne sich zu wenden, im Rücken und hinter sich lassend, wanderte er in die kleine Stadt. Seine Hoffnung war, dort Arbeit und Brot zu finden.
Das gelang ihm ohne Mühe, denn wohl so dreißig oder vierzig Schornsteine rauchten innerhalb und außerhalb der wohlerhaltenen Befestigungsmauern der uralten Ackerbürgerstadt. Diese hatte ihr Gesicht in den letzten Jahrzehnten markant verändert.
Prosperierende Industrie verhieß gesichertes Auskommen für viele. Aber um welchen Preis?
Zuerst zog er die Hebel an einer schwerratternden Couvertiermaschine im Unternehmen der Geheimen Kommerzienräte Gebrüder Bestehorn, den geheimen Königen allen Tands aus Papier und Pappe, des Packpapiers und der Briefumschläge.
Ob der in glühender Liebe entbrannte Torero im fernen Spanien oder ein wegen seines Compagnons verbitterter Kaufmann im Rheingau oder sonst jemand im weiten Europa ein beschriebenes Blatt in ein Couvert zwängte, es war nicht auszuschließen, dass dieses aus dem mechanischen Apparat, den Gustav Brennicke bediente, ausgespuckt worden war.
Später sägte, feilte, hämmerte und vernietete er Eisenwaren bei Billeter & Klunz, einem der ersten Unternehmen am Platz. Nur unterbrochen vom Militärdienst, den er in einer Handwerkerkompanie bei der Fußartillerie ableistete, gingen die Jahre dahin.
Kein Mensch stieß sich mehr daran, dass er kein Hüne von Gestalt war. Ja, besser noch:
In der Maschinenfabrik merkte die Direktion sich bald seinen Namen. Er war zuverlässig, gewissenhaft und hielt sich von den umstürzlerischen Sozialdemokraten fern. Das alles schätzen seine Vorgesetzen sehr an ihm, der Meister, der Herr Ingenieur und nicht zuletzt die Herren Inhaber.
Gustav blieb zwar ein rechter Zwerg, war aber dennoch nicht unansehnlich, konnte kraftvoll zupacken und gewann das notwendige Vertrauen zu sich selbst.
Die Natur hatte ihn auch mit Vorteilhaftem begabt.
Sein hübsches Gesicht mit den braunen Augen darin zog die Blicke der Mädchen auf sich.
Die körperliche Arbeit hatte ihn schon nach wenigen Jahren gezeichnet, wenngleich er noch fern jener Erschöpfungszustände war, die die Proleten mit vierzig wie zerlederte und ausgelaugte Methusalems aussehen ließ.
Er trug einen kessen schwarzen Schnurrbart, hatte sich verheiratet und war mit sich und der Welt eigentlich zufrieden.
Dann plötzlich: dunkle Gewitterwolken. Ein toter Erzherzog. Der Bündnisfall. Die Armee marschiert. Nach vier Jahren kehrt sie geschlagen heim.
Keine Karriere: Als entlassener Unteroffizier, nur wie Millionen andere auch mit dem EK II dekoriert und zum Erbrechen randvoll mit dumpfem Hass auf die „Spartakisten“, die, wie er es sieht, mit einem Dolchstoß in den Rücken der Front das Reich verraten und ihm den Siegeslorbeer entwunden haben; so sitzt er wieder daheim. Wofür das alles?
Zwei kleine Jungen krabbelten zu seinen Füßen und er lebte. Das versöhnte ihn ein wenig mit seinem Schicksal. Bald bedurfte die Maschinenfabrik wieder seiner Dienste.
Er haderte jetzt nicht mehr mit den Zuständen, schwor sich heilige Eide, nur noch der Firma und seiner Familie zu leben und sich über die politischen Wirren nicht mehr aufzuregen.
Das ging viele Jahre gut. Genauso solange, wie es der Republik gut ging. Mitten in der großen Wirtschaftskrise teilte ihm die Betriebsleitung Knall und Fall mit, dass man sich die Anstellung des Herrn Vorarbeiters Brennicke nicht mehr leisten könne. Man bedauere wirklich außerordentlich.
Sicher hätte man ihn gern verschont, aber die Zeiten, die Zeiten, ließ sich der weißhaarige technische Vorstand Schönemann, schwer nach Luft ringend und Entschuldigungen suchend, vernehmen.
„Lassen Sie man, Herr Ingenieur,“ half der kleine Mann dem Verlegenen mit einer Art Großkotzigkeit, die ihn sonst nicht auszeichnete, aus der Patsche, „ich habe nie richtig an die Kirche oder Jesus Christus oder so was geglaubt – von den Jahren im Schützengraben vielleicht abgesehen-, aber heute sage ich Ihnen, der da oben lässt unser liebes Vaterland nicht verderben. Es kann nur noch besser werden.“
Der alte Schönemann, dem die Last, die Kündigung gerade einem so bewährten Mitarbeiter überbringen zu müssen, fast die Kehle abgeschnürt hatte, atmete befreit auf, überglücklich, dass es der Betroffene so sportlich nahm.
Gustav war über sich selbst erschrocken, wie leicht er diesen Schlag weggesteckt hatte.
Der kernige Satz, mit dem er den Techniker beschämt hatte, war im Übrigen nicht auf seinem Mist gewachsen. Er hatte ihn sinngemäß in irgendeinem Historienschinken gelesen oder im Kriegerverein aufgeschnappt. „Zieten aus dem Busch“ vermutlich.
Aber die Dinge gingen nicht besser. Und das gerade jetzt, wo Ernst und Hermann, die beiden Söhne, heranwuchsen.
Der unbändige Appetit der Kinder entwickelte sich umgekehrt proportional zur Menge des zur Verfügung stehenden Geldes. Dieses wurde knapper und knapper. Die Familie legte Hungertage ein, um über die Woche zu kommen.
Der kleine Mann reihte sich in die schier endlosen Schlangen vor der städtischen Stempelstelle ein.
Eher interesselos nahm Gustav dort einmal wahr, wie unter den Wartenden heftige Worte fielen und ein handfester Streit ausbrach. Er hatte nur etwas von Revolution, Thälmann, Ausbeuter und Versailles aufgeschnappt. Dann fiel der Name „Hitler“, den Gustav bislang nur aus Zeitungen kannte und ein Kiefer knackte. Der durch den Fausthieb niedergestreckte Arbeiter schrie noch:
“Verdammte Faschistenschweine, mit euch werden wir auch noch kurzen Prozess machen!“
Dann führten ihn zwei Kameraden fort.
Mit den Monaten verlor Gustav, der kleine Mann, zunehmend Haltung, Gleichmut und Geduld. Häufiger als zuvor trug er die letzten Groschen in die Kneipe, vornehmlich ins Ledererbräu. Nur einen Steinwurf vom Markt entfernt.
Immer öfter wankte er ziemlich volltrunken nach Hause, begann mehr als einmal zu randalieren und Skandal zu machen.
Im Sommer 1931 berichtete ihm am Biertisch sein früherer Kollege Fritz Kuntze Wundersames.
Der Kuntze war dem Gustav immer als eine Art Ratte erschienen. Das lag zuerst an seinem unbeschreiblich bleckenden und hässlichen Gebiss, einer gelbbräunlichen Trümmerlandschaft, die niemandem verborgen bleiben konnte, dann aber auch an dessen aufdringlichem Gebaren. Jener sprach nun, dass es da einen Befreier aus dem Elend gäbe, einen, der einen Ausweg aus der schrecklichen Misere wüsste. Nicht nur so schlechthin, wie man wieder zu Arbeit käme, sondern so mehr mit Stolz und nationaler Größe.
Das sei der Volksredner Hitler.
Es sei wirklich ein Genuss ihn zu hören. Wahrer Balsam für die Seele wäre das, es schüttele einen dabei richtig im Innern.
Er, der Gustav, solle doch in zwei Wochen mit nach Magdeburg kommen. Die Fahrtkosten könne man sich bis zur nächsten „Stütze“ borgen. Aber dieser Herr sei, worauf er, Kuntze, gern einen Schwur ablegen wolle, das Geld wert.
Gesagt, getan.
Am 15. Juli 1931 traf der kleine Mann mit dem Mittagszug bei nur einmaligem Umsteigen in der großen Stadt an der Elbe ein.
An den Hallen am Herrenkrugpark herrschte Volksfeststimmung, wenngleich den kleinen Mann die Farbe der Uniform, die wohl bald jeder zweite der Besucher auf dem Leib trug, etwas befremdete.
„SA“, raunte Kuntze kurz und knapp, „ganz famose Leute. Die meisten wie wir, einfache Arbeiter, wollen nur, dass es in Deutschland wieder besser wird.“
Marschmusik. Schmetternde Fanfarenklänge. Bewegung im Meer der Feldzeichen und Fahnen. Kuntze wurde hektisch, meinte, jetzt müsse man sich gute Plätze sichern. Das könne nur heißen:
E r kommt!
An allen Ecken und Enden tummelte sich Volk an den Ständen der Wirte, die Fässer angezapft hatten. Der Ausschank lief offenbar wie geschmiert. Gustav hätte zwar lieber zuerst ein Bier aus einem langen schmalen Literglas gezischt, aber der Kuntze zerrte ihn unbarmherzig mit sich.
Da war sie plötzlich: Ohne sich dessen gewahr zu werden, stand Gustav Brennicke vor einer Weiche, die ihm Ziel und Richtung für den Rest des Lebens vorgab.
Ein guter Platz in den vorderen Reihen war bald erobert. Heilrufe einzelner, den rechten Arm dabei in der Art der altrömischen Diktatoren vorgestreckt, wurden vom Publikum dankbar aufgenommen. Der Lärm schwoll an. Immer mehr Besucher fielen in ein planloses, aber lautstarkes Gerufe ein. Schließlich ordnete sich alles und leidlich synchronisierter, aber noch gebändigter Beifall brandete auf: “Heil, Heil, Heil...“
Dann, wie auf Kommando eisiges Schweigen. Was war geschehen?
Ein Mann in Stiefelhosen und Bluse, gerade in jener Uniform, die Gustav schon vor der Festhalle aufgefallen war, betrat die Bühne und verharrte vor dem Rednerpult. Er war größer als Gustav, deutlich größer.
Kräftiges, volles schwarzes Haar, in einem kühnen Scheitel nach links gekämmt. Und ein Schnurrbart. Der stach sofort ins Auge. Nicht etwa so ein diskretes Menjoubärtchen, wie der Gustav es trug, um gutbürgerliche Gelassenheit vorzutäuschen, sondern an den Enden merkwürdig radikal gestutzt, so dass nur noch ein buschiges Quadrat unter der Nase übrigblieb.
Der Redner machte vor dem Publikum eine leichte Verbeugung, schlug sich mit der linken Hand auf das Koppelschloss, straffte sich im Bruchteil einer Sekunde, als ob an einer Marionette ein Faden gezogen würde, riss den rechten Arm in die Höhe und brüllte ebenfalls den allbekannten Gruß.
Die Massen überschlugen sich förmlich vor Begeisterung.
Kuntze rief mit ausgestrecktem Arm: “Heil, Heil...“, wobei es ihm wurscht war, dass er zwischen Hälsen und Genicken der vor ihm Stehenden wild herum ruderte.
Aber keiner beschwerte sich. Die Ekstase schien allgemein. Gustav blickte verunsichert in die Runde. Irgendwie vermochte ihn die hingebungsvolle Emphase der anderen nicht zu ergreifen. Es nagte noch große Skepsis an ihm.
Auch wenn ihm sein Bekannter nun derb, schon sichtlich verärgert, auf den Rücken schlug und aufforderte, er solle jetzt endlich den Gruß rufen, mittun, etwas im Inneren klemmte derweil in Gustav. Er konnte nicht. Der Kuntze schimpfte wie ein Rohrspatz auf den kleinen Mann. Man mache sich ja unmöglich mit ihm und so weiter und so fort.
Plötzlich mit einem Schlage trat wieder Stille ein. In elastischen Schritten stürmte der Parteiführer zum Rednerpult, schwieg eine wahre Ewigkeit, blickte dann, sich kurz besinnend, nach unten und hob an:
„Freunde, Volksgenossen, Parteigenossen.“
Gustav irritierte sofort die ungeläufig klingende Aussprache. Die Stimme des Redners überraschte ferner durch eine kratzige Heiserkeit. Dann durch ihr Rollen und befremdliches Tremolieren. Worte flogen zu ihm herüber, die er zwar nicht verstand, aber doch einem bajuwarischen oder mehr österreichischem Dialekt zuzuordnen vermochte.
Das Rednerpult umwallte ein gewaltiges rotes Tuch mit einem weißen Kreis. Mittendrin jenes merkwürdige Symbol, dass Gustav aus den Zeitungen kannte. Im düsteren Hintergrund des scheunenhaft großen Saales wachten Fahnen -und Standartenträger der SA. Statisten.
Der Redner strich sich über das volle schwarze Haar, schaute abwechselnd auf sein für die Zuhörer unsichtbares Manuskript, dann wieder in die Reihen vor ihm. Er atmete tief durch, so, gerade als ob jetzt eine explosionsartige Tirade wie befreiender Donnerschlag folgen müsse. Aber weit gefehlt.
Mit fast verschüchterten, leisen Worten, die die Mikrofone verschluckten, begann der, wegen dem der kleine Mann extra aus der finstersten Provinz in die große Stadt gereist war, zu reden.
Als sich Gustav ein wenig hineingehört hatte, ging es besser. Der Parteigründer am Pult murmelte wie ein gleichmäßig dahin plätschernder Bach. Eher langweilig und verhalten. Gustav schnappte etwas von schwerer Jugend auf. Na und, die hatte er schließlich auch gehabt, bockte er innerlich und dachte noch dagegen. Gehemmt, auch mit einem gehetzten Blick wie gestelltes Wild, sprach der Redner die nächsten Minuten. Nervös flogen seine Augen von einem Ende des Saales zum andern.
In merkwürdigen Stimmvibrationen hauchte er zitternd und ergreifend seine Fronterlebnisse hinaus.
Das Wort Weltkrieg faszinierte den kleinen Mann. Sein dösendes Dämmern wurde durch diese Vokabel brachial unterbrochen. Ja, war er nicht auch im Kriege, in Frankreich und in Flandern gewesen? Hatte er nicht von der Marne über Verdun bis zur Loretto-Höhe alles mitgemacht? Sprach der da vorn nicht von Dingen, die er auch erlebt und durchlitten hatte? Er hörte genauer hin.
Da vorn redete ein Kamerad!
Immer noch ganz ruhig im Ton, verbindlich, jetzt auch sicherer, die Hände auf das Pult gelegt, ab und zu nach unten schauend, referierte er seine Gefühle, die ihn nach der Niederlage, von der er im Lazarett zu Pasewalk überrascht worden sei, durchströmt hätten.
Trauer, Scham, Wut und Hass, Hass und nochmals Hass!
Warum wohl wäre der Krieg verloren gegangen? Das sei ein Unding, weil der deutsche Soldat anerkannt der tapferste der Welt gewesen sei. – Diese Frage richtete er direkt und mit gefrierendem, stechendem Blick an sein Publikum.
Etwas wühlte im kleinen Mann. Gustav wunderte sich jetzt allen Ernstes, warum er sich eine so klare, auf der Hand liegende Frage nicht eher gestellt hatte. Nahm er bisher an, die zahlenmäßige Überlegenheit an Soldaten, Maschinengewehren, Kanonen oder Flugzeugen, sei die Ursache gewesen, so wies ihn jener unbekannte Soldat des Völkerringens darauf hin, dass hinter diesen scheinbar verständlichen Gründen andere, gewichtigere standen.





























