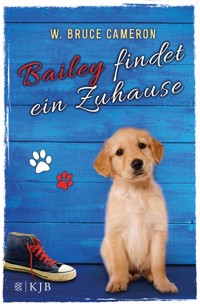
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die zu Herzen gehende Freundschaft zwischen einem Jungen und seinem Hund – aus Hundeperspektive erzählt. Worin besteht der Sinn eines Hundelebens? Für den kleinen Golden-Retriever-Welpen Bailey gibt es keinen Zweifel: mit dem achtjährigen Ethan zu spielen, zusammen mit ihm den Wald zu erkunden und sein Geschirr »abzuspülen«, indem er den Teller sauberleckt (aber nur, wenn Ethans Mutter nicht hinsieht). Doch Bailey lernt auch, dass das Leben nicht immer so einfach ist, dass manche Menschen Böses im Schilde führen und schlimme Dinge passieren – und dass es keine größere Aufgabe für ihn gibt, als Ethan zu beschützen. Wie Bailey in Ethan seinen besten und treuesten Freund findet, wie sie gemeinsam Abenteuer erleben und wie er dem Jungen am Ende das Leben rettet, beschreibt Bruce Cameron in »Bailey findet ein Zuhause« wunderbar liebevoll und mit ganz viel Herz. Warmherzig, beglückend und fundiert – die Geschichte über den Hund Bailey aus »Ich gehöre zu dir« für Kinder neu erzählt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 181
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
W. Bruce Cameron
Bailey findet ein Zuhause
Über dieses Buch
Worin besteht der Sinn eines Hundelebens?
Für den kleinen Golden-Retriever-Welpen Bailey gibt es keinen Zweifel: mit dem achtjährigen Ethan zu spielen, zusammen mit ihm den Wald zu erkunden und sein Geschirr »abzuspülen«, indem er den Teller sauberleckt (aber nur, wenn Ethans Mutter nicht hinsieht). Doch Bailey lernt auch, dass das Leben nicht immer so einfach ist, dass manche Menschen Böses im Schilde führen und schlimme Dinge passieren – und dass es keine größere Aufgabe für ihn gibt, als Ethan zu beschützen.
Wie Bailey in Ethan seinen besten und treuesten Freund findet, wie sie gemeinsam Abenteuer erleben und wie er dem Jungen am Ende das Leben rettet, beschreibt Bruce Cameron in ›Bailey findet ein Zuhause‹ wunderbar liebevoll und mit ganz viel Herz.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
W. Bruce Cameron, geboren 1960, ist der New-York-Times-Bestseller-Autor von ›Ich gehöre zu dir‹, ›Ich bleibe bei dir‹ und ›Weihnachten auf vier Pfoten‹. 2011 wurde er von der »National Society of Newspaper Columnists« als Kolumnist des Jahres ausgezeichnet. Als er ungefähr acht Jahre alt war, brachte sein Vater ihm eines Tages einen Labrador-Welpen mit. Diesen Augenblick der uneingeschränkten Freude und grenzenlosen Zuneigung erzählt er in ›Bailey findet ein Zuhause‹. W. Bruce Cameron lebt mit seiner Frau und seinem Hund in Kalifornien, USA.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden sich auf www.blubberfisch.de und www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016
unter dem Titel ›Bailey's Story: A dog's Purpose Novel‹
bei A Starscape Book, published by Tom Doherty Associates, LLC
Copyright © 2016 by W. Bruce Cameron
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Birgit Gitschier Grafikdesign & Illustration
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-5022-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Golden Retriever
Jeder Hund ist einzigartig, [...]
Rasse
Für Garrett und Ewan:Willkommen auf der Welt!
1
Eines Tages ging mir auf, dass die warmen, quietschigen, miefigen Dinger, die ständig um mich herumwuselten, meine Geschwister waren. Ich war schwer enttäuscht.
Schon seit einer Weile drängelte und schubste ich diese zappeligen Leiber beiseite, um an die kuschelige Wärme und die köstliche Milch meiner Mutter zu gelangen. Und nun stellte sich heraus, dass diese Dinger, die zwischen mir und meiner Nahrung standen, Welpen waren wie ich!
Ich blinzelte zu meiner Mutter hoch und bat sie im Stillen, die anderen loszuwerden. Sie sollte ganz mir gehören. Aber sie ging nicht darauf ein. Anscheinend würden mir meine Brüder und Schwestern erhalten bleiben.
Also beschloss ich, der Chef zu werden. Meine Wurfgeschwister aber begriffen das nicht recht. Kaum packte ich einen am Nackenfell, sprangen mir zwei oder drei andere auf den Rücken. Bis ich die abgeschüttelt hatte, raufte der Welpe, dem ich eine Lektion erteilen wollte, mit jemand anderem. Wenn ich ein drohendes Knurren zum Besten gab, knurrten meine Geschwister nur freudig zurück.
Wirklich lästig.
Wenn ich nicht gerade versuchte, meinen Geschwistern die Welt zu erklären, erforschte ich meine Umgebung.
Von Anfang an hatte ich viel Bellen gehört, und in der Nähe roch ich fremde Hunde. Als ich mich unter einem Haufen, bestehend aus meinen Wurfgeschwistern, hervorkämpfte, spürte ich unter meinen Pfoten rauen, harten Untergrund. Und nach ein paar Schritten stieß ich mit der Nase gegen einen Drahtzaun. Ich befand mich in einem Käfig mit Zementfußboden.
Hinter dem Zaun gab es noch mehr Welpen. Sie waren aber nicht blond mit dunklen Augen wie meine Geschwister, meine Mutter und ich. Es waren kleine, aufgedrehte Kerle mit dunkler Zeichnung und einem Fell, das in alle Richtungen abstand. Sie sahen aus, als wären sie gute Spielkameraden, aber der Zaun trennte uns.
In dem Käfig auf der anderen Seite erspähte ich eine weiße Hündin mit schwarzen Flecken. Der Bauch hing ihr fast bis zum Boden, und sie bewegte sich nur langsam. Sie warf mir einen Blick zu, schien aber nicht weiter an mir interessiert zu sein.
An der Vorderseite des Käfigs gab es eine Tür. Diese Tür war mir schon früher aufgefallen. Jeden Tag tauchte ein Mann mit einem Futternapf für meine Mutter auf, er öffnete die Tür und stellte den Napf ab. Sie rappelte sich auf, schüttelte ein, zwei Welpen ab und schlang ihre Mahlzeit hastig herunter, um sofort wieder bei uns zu sein.
So hatte ich zum ersten Mal einen näheren Blick auf die Welt hinter der Tür werfen können. Gras. Ein langer Streifen aus Rasen. Der Duft von feuchter Erde und wachsenden Pflanzen kitzelte meine Nase. Die Wiese war von einem Holzzaun umrahmt.
Die Eindrücke überwältigten mich. Ich stolperte zurück zu meiner Mutter und legte mich für ein Nickerchen auf zwei meiner Schwestern.
Als der Mann am nächsten Tag wiederkam, passte ich genau auf. In der einen Hand hielt er den Futternapf, in der anderen ein Blatt Papier, das er stirnrunzelnd betrachtete.
»Yorkshire Terrier, in ’ner Woche oder so«, sagte er und blickte in den Käfig nebenan, den mit den Welpen. Dann wandte er sich unserem Käfig zu und spähte herein. »Golden Retriever, wahrscheinlich in drei Wochen so weit, und eine Dalmatinerhündin, die jeden Moment werfen müsste.«
Mir war klar, dass er diese Worte nicht an uns Hunde richtete. Er sprach nie mit uns. Rasch öffnete er die Tür zu unserem Käfig. Erpicht darauf zu erfahren, wie sich das Gras unter meinen Pfoten anfühlen würde, trabte ich auf ihn zu. Aber er schubste mich mit einem Grunzen beiseite, nicht wirklich grob, sanft aber auch nicht. Er stellte den Napf vor meiner Mutter ab.
Dann fiel die Tür zu.
Ich versuchte, eine Kostprobe aus dem Napf zu erhaschen, aber meine Mutter schob mich mit der Nase fort. Der Inhalt der Schüssel roch ohnehin nicht so gut wie ihre Milch. Der Mann war schon wieder unterwegs und kam dann mit weiteren Näpfen zurück. Er stellte sie ins Gras und ging zu dem Käfig rechts von uns. Er schob die Tür auf, und dann tat er etwas, das mich überraschte – er ließ sie offen! Die Welpen mit dem drahtigen Haar – Terrier hatte er sie genannt – purzelten auf die Wiese hinaus.
»Nein, du nicht«, sagte der Mann zu der Mutter und schubste sie von der Tür weg, wie er es zuvor mit mir getan hatte.
Eifersüchtig beobachtete ich, wie die kleinen Fellkugeln auf dem Rasen herumtollten. Ihre Mutter winselte leise hinter der verschlossenen Tür. Der Mann ging weg, er verließ den Hof durch ein Tor im Holzzaun, während sich die Welpen im Gras wälzten, hineinbissen und es anbellten. Als einer auf den Rasen pinkelte, mussten natürlich alle die Pfütze vorsichtig beschnuppern.
Dann entdeckte ein Welpe einen Futternapf, indem er kopfüber hineinplumpste. Schnaubend kam er wieder hoch, leckte sich eine klebrige, braune Pampe von der Nase und fiel wieder in die Schüssel hinein. Seine Geschwister drängten sich um ihn und taten es ihm nach.
Als das Futter aufgefressen war, kamen die Welpen an unsere Käfigtür, um uns zu beschnüffeln. Ich schleckte ihnen die Essensreste aus dem Gesicht, während einer meiner Brüder sich auf meinem Kopf abstützte. Dann zischten sie wieder ab, um auf dem Rasen hin und her zu rennen, zu bellen, zu stolpern und wieder aufzustehen. Jetzt sah ich, dass es noch weitere Käfige links und rechts von uns gab. Die Welpen liefen bald hierhin, bald dorthin und schnupperten an allen Hundenasen in Reichweite.
Ich wünschte mir, ich könnte mit ihnen dort draußen sein. In unserem kleinen Käfig mit seinem Geruch nach Mutter und Welpen, Futter und Milch hatte ich schon alles erkundet, was es zu erkunden gab. Ich war bereit für mehr.
Als der Mann zurück in den Hof kam, ließ er das Tor hinter sich offen stehen. Ich erkannte ein dünnes Band aus blauem Himmel, grüne Bäume und darunter eine dunkle Straße. Sehnsucht packte mich. Dort draußen gab es etwas für mich – da war ich mir sicher. Etwas Wichtiges. Etwas, das ich brauchte. Sollte ich je frei über die Wiese laufen, würde ich direkt durch das offene Tor rennen. Warum die Terrierwelpen das nicht taten, konnte ich nicht verstehen. Sie waren wohl zu sehr mit Balgen beschäftigt.
Der Mann hob zwei Welpen hoch und trug sie, einen in jeder Hand, durch das Tor. Zweimal musste er noch für die übrigen gehen. Dann waren sie alle fort.
Ohne ihr leises, hohes Bellen erschien der Hof plötzlich schrecklich still. Ihre Mutter lehnte sich mit den Vorderpfoten gegen die Tür und heulte. Dann sank sie wieder zu Boden und lief in ihrem Käfig auf und ab.
Der Mann ging zu ihr und schaute sie an, aber er rief sie nicht, sprach nicht mit ihr, griff nicht in den Käfig, um sie zu streicheln. Irgendwie wusste ich, dass er all das hätte tun können und dass es ihr Leid ein wenig gelindert hätte. Aber er tat es nicht. Er drehte sich einfach um und ging davon.
Die Trauer der Mutter im Käfig nebenan ergriff auch mich. Ich drängte mich wieder zwischen meine Geschwister und lehnte mich Schutz suchend an die warme Flanke meiner Mutter.
Aber der Gedanke an das Tor in die Welt dort draußen ließ mich nicht los. Als wir, einige Tage später, auf das grüne Gras hinausdurften, war es so weit. Der Mann stellte die Futternäpfe für uns auf, genau wie er es für die Terrier getan hatte, dann öffnete er die Tür zu unserem Käfig. Wir stürmten hinaus auf die Wiese. Zwei meiner Schwestern tapsten mir direkt über den Kopf, um zu den Näpfen zu kommen. Ich bahnte mir meinen Weg zwischen ihnen hindurch und fraß meinen Anteil. Es schmeckte köstlich, und feste Nahrung zu kauen, anstatt Milch zu saugen, tat gut.
Als ich satt war, zog ich den Kopf aus der Schüssel und schaute mich um.
Alles war wunderbar feucht und voller Gerüche. Das Gras war saftig. Die Erde darunter feucht und dunkel. Ich kratzte sie mit der Pfote auf und steckte meine Nase direkt hinein. Dann nieste ich und schüttelte den Kopf, um den Dreck auf meiner Schnauze loszuwerden. Ich trabte hinüber zum Käfig der Dalmatinerhündin, und ihre nagelneuen Welpen stolperten zur Tür, um mir die Schnauze zu lecken, genau wie ich es vor nicht allzu langer Zeit mit den Terriern getan hatte.
Nachdem ich die jüngeren Hunde begrüßt hatte, trat ich zurück und schnupperte mit hocherhobener Nase. Selbst die Luft roch nach unendlichen Möglichkeiten. Von irgendwoher strömte der Duft von Wasser herbei, mehr Wasser, als ich je in einer Schale gesehen oder gerochen hatte. Ich roch fremde Hunde und auch andere Tiere: ein Eichhörnchen, das auf dem Zaun schnatterte, und noch ein Tier – größer, schwerer und auffällig riechend –, das vor einigen Nächten am Hof vorbeigelaufen war.
Nun kam der Mann wieder und öffnete die Tür zu unserem Käfig, um meine Mutter herauszulassen. Meine Geschwister stürzten alle auf sie zu, aber ich hatte gerade einen toten Wurm unter meinen Pfoten bemerkt, und der war im Moment interessanter.
Wieder ging der Mann fort und warf das Tor hinter sich zu.
Das Tor …
Mein Blick blieb an der Klinke hängen.
Am Zaun neben dem Tor stand ein Holztisch mit einem Hocker davor. Ich lief hin. Der Hocker war so niedrig, dass ich hinaufklettern konnte. Von dort aus war es nur ein kleiner Hops, und ich konnte mich an der Tischkante festkrallen und mich hinaufhieven.
Vor mir lagen leere Futternäpfe und ein Beutel, der ziemlich spannend roch. Wäre mein Bauch nicht voll gewesen, hätte ich ihn wohl aufgebissen und mir den Inhalt schmecken lassen. Aber im Moment galt mein Interesse etwas anderem.
Ich erinnerte mich, wie der Mann die Hand auf die Metallklinke gelegt und sie heruntergedrückt hatte. Dann war das Tor aufgesprungen.
Konnte ich so etwas schaffen?
Die Klinke war aus einem länglichen Stück Metall. Mit meinen kleinen Zähnen fand ich kaum Halt an dem Ding, aber ich tat mein Bestes. Ich biss zu, zerrte und verdrehte den Hals. Nichts geschah, abgesehen davon, dass ich das Gleichgewicht verlor und auf den Boden purzelte.
Ich setzte mich auf und bellte das Tor missmutig an. Das nützte aber auch nichts. Meine Geschwister rasten auf mich zu und stürzten sich auf mich, aber ich gab mich nicht mit ihnen ab. Zum Spielen hatte ich jetzt keine Lust.
Ich hatte etwas Wichtiges zu erledigen.
Noch einmal kletterte ich auf den Tisch und packte den Griff mit den Zähnen. Dieses Mal legte ich auch die Vorderpfoten auf die Klinke, um nicht erneut zu stürzen, und zu meiner Überraschung bewegte sie sich unter mir. Ich rutschte ab, und im Fallen traf mein ganzer Körper auf die Klinke. Ich plumpste ins Gras und blickte verwundert auf.
Das Tor war offen!
Natürlich nicht sehr weit, aber als ich meine Nase in den Spalt schob und drückte, schwang es ein wenig weiter auf. Ich war frei!
Gespannt lief ich hinaus und stolperte über meine kurzen Beine. Vor mir lag ein Pfad, zwei schmale, parallel verlaufende Spuren im Gras. Bestimmt war das der Weg, den ich einschlagen sollte.
Aber ich drehte mich um und blickte durch das Tor zurück. Meine Mutter saß in der offenen Käfigtür und beobachtete mich.
Mir wurde klar, dass sie nicht mitkommen würde. Sie würde im Hof bleiben. Ich war auf mich gestellt.
Ich überlegte, ob ich zu ihr zurückrennen, mich an ihre warme Flanke schmiegen und mich ordentlich ablecken lassen sollte. Aber ich tat es nicht.
Irgendwie wusste ich, dass Welpen ihre Mutter verlassen mussten. Es mochte für uns beide traurig sein, aber so war es nun mal. Wenn ich jetzt nicht ging, würde der Mann kommen und mich forttragen, so wie er es mit den Terrierwelpen getan hatte.
Ohnehin wusste ich aus tiefstem Herzen, dass auf dieser Seite des Tors etwas auf mich wartete. Oder jemand. Es gab noch andere Menschen auf dieser Welt, da war ich mir sicher, und nicht alle würden so sein wie der Mann, der uns gefüttert und unseren Käfig geöffnet hatte.
Irgendwo gab es freundliche Hände und sanfte Stimmen. Ich musste sie nur aufspüren.
Also zog ich hinaus in die Welt, um genau das zu tun.
2
Die staubige Spur im Gras fühlte sich unter meinen Pfoten unglaublich gut an! Sie roch nach Gummireifen, nach all den Tieren, die sie überquert hatten, und nach dem Regen, der vor ein paar Tagen gefallen war. Ich trabte glücklich den Weg entlang und wedelte mit meinem kurzen Schwanz. Vor mir schwirrte eine Libelle umher, nach der ich schnappte. Ich stapfte durch eine Pfütze. Dann fand ich ein phantastisches Stöckchen und schleppte es mit, bis mir der Nacken weh tat. Ich ließ es fallen und flitzte vorwärts, weil mir ein neuer Duft in die Nase stieg. Ein leerer Napf! Nein, er war gar nicht leer! Ich fand noch etwas Süßes und Klebriges darin. Vorsichtig leckte ich ihn sauber. Dann ging es weiter.
Nach einer Weile endete der Weg an einer Straße, die sich so hart anfühlte, wie der Boden meines Käfigs. Ich beschnupperte sie, dann setzte ich behutsam eine Pfote darauf. Bald beschloss ich, der Straße zu folgen. Denn hier wehte mir der Wind entgegen und brachte im Sekundentakt neue Gerüche mit sich. Feuchtes, vermodertes Laub! Bäume! Wassertümpel! Eichhörnchen! Mäuse! Würmer!
Aufgeregt wollte ich mich ins Abenteuer stürzen, aber plötzlich hielt ich inne. In einem Laubhaufen vor mir bewegte sich etwas.
Argwöhnisch schlich ich darauf zu, pirschte mich näher und näher heran. Da brach es aus dem Laub hervor und surrte mir direkt ins Gesicht! Ein Käfer! So einen hatte ich noch nie gesehen. Ich machte einen Satz rückwärts und bellte ihn an, um klarzustellen, dass ich keine Beute war. Der Käfer wendete und flog die Straße entlang. Ich jagte hinterher. Dem würde ich schon zeigen, wer hier der Boss war!
Hinter mir hörte ich einen Laster, aber ich hielt nicht an, bis der Käfer in einen Baum flog. Wie unfair! Ich bellte missmutig. Dann fiel mir auf, dass der brummende Motor des Lasters verstummt war.
Eine Tür knallte. Ich wandte mich um. Der Laster hatte am Straßenrand gehalten, und ein Mann mit faltiger, sonnengebräunter Haut und schmuddeliger Kleidung war ausgestiegen. Er kniete sich hin und streckte mir die Hände entgegen.
»He, du, kleines Kerlchen!«, rief er.
Unsicher blickte ich ihn an. Was für ein Mensch mochte das sein? Was waren das für Hände? Würden sie mich beiseiteschubsen wie die des ersten Mannes? Oder würden sie geduldig und freundlich sein?
»Hast du dich verlaufen, Kleiner?«
Was die Hände anging, konnte ich noch nicht sicher sein, aber die Stimme klang nett. Und er sprach direkt mit mir. Das hatte der erste Mann nie getan. Und er hatte sich auch nie zu mir heruntergekniet, um mit mir zu reden.
Der Mann wirkte vertrauenswürdig. Ich lief auf ihn zu.
Dann nahm er mich in seine großen Hände, die mich ganz umfassten. Und die Hände waren freundlich. Obwohl er mich kurz hoch über seinen Kopf hob, war ich erleichtert. Es machte mir auch nichts aus. Er senkte die Arme auch sofort wieder und drückte mich an seine Brust. Er roch nach Rauch, Schweiß, Staub und Natur. Köstlich!
»Ein hübsches kleines Kerlchen bist du. Siehst aus wie ein reinrassiger Retriever. Wo kommst du her, Kerlchen?«
Ich leckte dem Mann über das von Bartstoppeln raue Kinn. Er lachte.
Ja, beschloss ich, ich könnte Kerlchen heißen. Bei diesem Mann konnte ich bleiben. Ich konnte sein Hund sein, tun, was er mir sagte, und ihm folgen, wohin er ging. So sollte es doch sein, oder nicht? Dass ich bei einem Menschen blieb? Da war ich mir ziemlich sicher. Es fühlte sich richtig an.
Der Mann trug mich zu seinem Laster und ließ mich auf den Beifahrersitz plumpsen. Dann kletterte er neben mir auf die Bank. Das gefiel mir! Noch besser wurde es, als er den Wagen startete. Das Fenster war einen Spalt breit offen, und tolle neue Gerüche wehten herein.
Ich stützte mich mit den Vorderpfoten gegen die Scheibe und versuchte, meine Nase möglichst weit in den kühlen Luftzug zu strecken. Das machte Spaß, auch wenn ich jedes Mal herunterpurzelte, wenn das Auto eine Bodenwelle traf oder eine Kurve nahm. Der Mann lachte und griff nach mir, um mich mit seiner warmen, großen, freundlichen Hand festzuhalten.
Dann bog er plötzlich scharf ab, und ich fiel auf den Boden des Lasters. Kein Problem. Hier unten roch es auch interessant. Mit quietschenden Bremsen hielt der Wagen, und der Mann schaute mich an.
»Wir stehen im Schatten«, erklärte er mir.
Ich legte die Vorderpfoten auf den Sitz und sah ihn an. Dann hüpfte ich auf den Sitz und warf einen Blick aus dem Fenster. Wir standen vor einem Haus mit vielen Türen. Der Mann deutete mit einem Nicken auf eine der Türen neben einem dunklen Fenster.
»Ich bin in ein paar Minuten wieder da«, versprach er und kurbelte die Fenster hoch. »Sei brav.«
Dass er ging, merkte ich erst, als er ausstieg und die Tür hinter sich zuwarf. Hey, warte mal! Was ist mit mir? War ich jetzt nicht sein Hund? Sollte ich ihm nicht folgen, wohin er auch ging?
Ich beobachtete, wie der Mann in dem Gebäude verschwand, und ließ mich dann auf den Sitz plumpsen, um zu warten. Ich fand einen Lappen und kaute eine Weile darauf herum, aber besonders gut schmeckte er nicht. Gelangweilt legte ich mich für ein Nickerchen hin. Die Sonne war gewandert und schien nun schön warm durch das Fenster auf meinen Rücken.
Als ich aufwachte, war die Sonne mehr als warm. Sie war heiß.
Die Luft im Wagen war feucht und roch abgestanden. Ich fing an zu hecheln. Dann musste ich winseln. Ich legte die Pfoten ans Fenster, um zu sehen, ob der Mann wiederkam. Keine Spur von ihm! Und das Fenster war so heiß, dass es an meinen Pfoten brannte. Ich ließ mich zurück auf den Sitz fallen und lief auf der Bank hin und her. Das Hecheln half auch nichts. Es war unerträglich stickig.
Plötzlich verschwamm alles vor meinen Augen, und die Umrisse der Sachen im Auto wurden unscharf. Ich legte mich auf den Sitz und dachte an die Wasserschüsseln, die der Mann uns immer gebracht hatte, an die Pfütze auf dem Weg, an die kühlen, frischen Gerüche im Wind.
Die Zunge hing mir bald so weit aus dem Mund, dass sie den Sitz berührte, aber jeder weitere Atemzug, der meinen Mund mit mehr heißer Luft füllte, machte alles nur noch schlimmer. Ich zitterte am ganzen Körper.
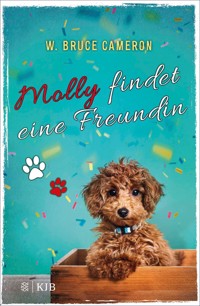
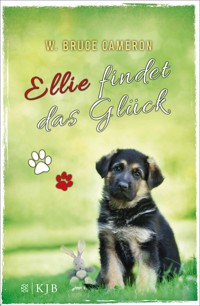













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













