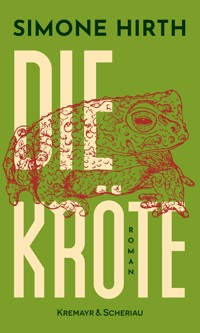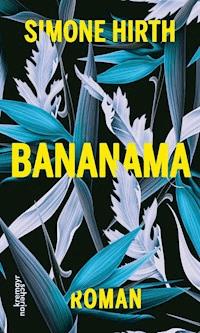
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was ist grün und klopft an die Tür? Wer schreit im dunklen Wald von Bananama? Und warum verschließen die Eltern das Haus? Fragen, die sich ein sechsjähriges Mädchen stellt. Sie lebt mit ihren Eltern, selbst ernannten Aussteigern, in einem Haus am Waldrand. Mit Befremden erzählt sie von der Veränderung ihrer Eltern, die jeden Tag merkwürdiger werden. Je wahnhafter sie an ihrer Vision von Bananama festhalten, desto weniger lässt sich die "Welt da draußen" verleugnen. Eines Morgens liegt ein toter Mann im Gemüsebeet. Die diffuse Angst des Kindes bekommt ein Gesicht. Und in Bananama bleibt nichts, wie es war. Auf beklemmende Weise geht Simone Hirth den Widersprüchen und Absurditäten unserer Gesellschaft auf den Grund. Dabei kratzt sie mit herrlich ironischem Blick an der Utopie eines sicheren Lebens, bis diese endgültig zerbricht. "Wenn wir jetzt die Tür immer zusperren müssen, sind wir dann eingesperrt in Bananama, sind wir dann nie wieder frei?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SIMONE HIRTH
BANANAMA
ROMAN
www.kremayr-scheriau.at
eISBN 978-3-218-01114-3
Copyright © 2018 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Schutzumschlaggestaltung: Christine Fischer
Unter Verwendung einer Grafik von: shutterstock.com/mystel
Lektorat: Tanja Raich
Satz und typografische Gestaltung: Ekke Wolf, www.typic.at
Handlung und Personen in diesem Romansind frei erfunden.Jede Ähnlichkeit mit tatsächlich existierenden Personenist nicht beabsichtigt und wäre daher zufällig.
Inhalt
1 DIE TOTEN WÖRTER
2 DIE TOTEN TIERE
3 NOCH MEHR TOTE TIERE
4 DIE TOTEN MENSCHEN
5 DIE GROSSMUTTER LEBT NOCH
6 BANANEN
7 RAPUNZEL
Ich bin nackt. Es ist Sommer, Nachmittag, und so heiß, dass man selbst im Schatten des Walnussbaums nicht friert. Ich erweitere meinen Friedhof.
Ich bin, wie meistens, allein. Das heißt, ohne andere Kinder. Vater sagt, wir sind Aussteiger. Aussteiger sein bedeutet, das einzige Kind zu sein, das an einer Bushaltestelle aus dem Schulbus aussteigt. Die anderen Kinder bleiben sitzen und fahren weiter in die umliegenden Dörfer, wo sie in Grüppchen aussteigen und in Grüppchen nach Hause gehen. Ich bin mein eigenes Grüppchen. Meine Bushaltestelle ist keine Haltestelle, sondern ein Holzpfahl am Rand der Landstraße, den Vater in den Boden geschlagen und auf den er ein Schild genagelt hat. Auf dem Schild steht in großen, schiefen, bunten Buchstaben: Bananama. Vater sagt, es hat eine Menge Nerven und viel Zeit auf Ämtern gekostet, dieses Schild genehmigen zu lassen und das örtliche Busunternehmen dazu zu bringen, den Schulbus dort für mich anzuhalten. Vater sagt: Die Leute verstehen keinen Humor.
Wir essen niemals Bananen. Vater mag keine Bananen und Mutter sagt: Die brauchen wir nicht. Oder fehlen sie dir?
Ich schüttle den Kopf.
Vater sagt: Du kannst jederzeit Bananen haben, wenn du Bananen willst, mein Kind. Aber du solltest wissen, woher diese Bananen kommen, unter welchen Bedingungen die Leute, die sie anbauen und ernten, leben müssen, unter welchen Bedingungen die Bananen dann zu uns gelangen und wer sich an diesen Bananen bereichert. Du solltest wissen, dass es einmal ein Land gab, in dem die Leute keine Bananen bekommen haben, weil das politische System dieses Landes Bananen nicht vorgesehen hatte. Die Leute in diesem Land haben sich aber so sehr Bananen gewünscht, dass mehr und mehr Leute das Land verließen. Und als es das Land schließlich nicht mehr gab und die Leute Bananen kaufen konnten, so viele sie wollten, da stellten sie fest, dass Bananen gar nicht so wichtig sind. Sie schmecken zwar, aber nicht so überragend gut, dass man sie unbedingt braucht, um glücklich zu sein. Verstehst du, was ich meine?
Das Wort Banane habe ich längst schon beerdigt.
Vater sagte einmal, man muss seine Angst beerdigen. Ich wusste damals noch nicht, was beerdigen heißt. Ich fragte: Was ist das? Vater sagte: Man gräbt etwas in der Erde ein und dann wachsen schöne Blumen darüber, oder Beerensträucher, oder Bäume.
Ich versuchte es also, sobald ich einen Spaten besaß und der Boden getaut war, mit dem Wort Angst, in Schönschrift geschrieben. Es wuchs nichts darüber, und die Angst kam bald wieder. Ich fand aber Gefallen am Graben, und so versuchte ich es mit anderen Wörtern: Sonne, Tod, Stille, Weißmehl, Entschleunigung, Recycling, Shoppingcenter, Autarkie. Wörter, von denen ich noch nicht wusste, wie man sie schreibt oder was sie bedeuten, mochte ich am liebsten. Ich musste das dann erst herausfinden und üben, bevor ich sie beerdigte. Bald wuchs Gras darüber. Und Gänseblümchen. Ich hielt es für einen guten Anfang.
Über dem Wort Anfang wächst eine Brennnessel. Ich mache stets einen Bogen darum, traue mich aber nicht, sie auszureißen.
Zuerst waren es Wörter. Ich schreibe sie in Schönschrift auf kleine Zettel, langsam, und so oft, bis sie schön genug ausschauen, um sie zu begraben. Aussteiger, schreibe ich heute, denn es ist so heiß und so still, dass ich glaube, jetzt noch besser zu verstehen, was es heißt, einer zu sein. Es gelingt mir gleich beim ersten Versuch, allen Buchstaben den richtigen Schwung zu geben. Ich rolle das Zettelchen ein und stecke es in ein Einmachglas, das ich aus Mutters Regal mit den leeren Gläsern hole. Ich lege eine Handvoll Gänseblümchen dazu, manchmal auch Klee oder Kieselsteine, Nussschalen, Beeren. Dann hebe ich mit meinem Spaten ein Loch unter dem Walnussbaum aus. Vater sagt, es ist wichtig, dass auch Mädchen mit einem Spaten umgehen können, genauso wichtig wie Lesen, Schreiben und Rechnen.
Ich habe meinen kleinen Spaten zum fünften Geburtstag bekommen, da konnte ich längst lesen, schreiben und rechnen, denn Vater hat mich schon unterrichtet, bevor ich in die Schule kam. Die ersten Buchstaben und Zahlen malte er mir auf, als ich allein auf einem Stuhl sitzen konnte. Mein Geburtstag ist im Februar. Der Winter, in dem ich meinen Spaten bekam, war sehr kalt, der Boden gefroren und ich konnte es kaum erwarten, im Frühling mein erstes Grab zu schaufeln.
Eines der ersten Wörter, das ich in diesem Frühling nach dem Wort Angst beerdigte, war das Wort Mitleid. Ich erinnere mich noch gut an die Beerdigung dieses Wortes, denn in den Tagen zuvor hatte Vater es oft benutzt. Er sagte zu Mutter: Dein Mitleid bringt dich nicht weiter. Oder: Für die großen Ideen muss man sich ein wenig von seinem Mitleid befreien. Mutter schwieg viel in diesen Tagen und beachtete mich kaum. Ich glaube, dass sie manchmal weinte, denn ihre Augen, mit denen sie immer in eine Richtung starrte, bei der ich mich fragte, was sie dort sah, waren oft geschwollen und rot. Während ich also ein Loch für das Mitleid grub, hörte ich Vater und Mutter im Haus plötzlich sehr laut über etwas lachen. Mutter kreischte sehr lustig und Vater rief: Der Frühling ist da, der Frühling ist da, ein Hoch auf Mutter Natur. Mutter kicherte: Du Spinner.
Ich schraubte das Einmachglas fest zu und sagte: Leb wohl.
So mache ich es noch immer, mit jedem einzelnen Wort. Ich lege jedes Glas in ein sorgfältig ausgehobenes Loch, bedecke es mit Erde, bis es darunter verschwunden ist, binde ein Kreuz aus kleinen Ästen und markiere damit jedes neue Grab.
Die toten Tiere kamen erst später dazu. Aber das ist eine andere Geschichte.
Es ist schon ein großer Friedhof unter dem Walnussbaum.
Der Walnussbaum steht schon sehr lange an dieser Stelle. Er weiß mehr als ich, mehr als Vater und Mutter, er ist so riesig, knorrig und alt, dass man ihm alles glauben würde. Schließlich war er schon vor uns da. Außerdem vor uns da waren: zwei Kirschbäume. Zwei Apfelbäume. Ein Birnbaum. Ein Zwetschgenbaum. Ein Baum mit Früchten, deren Namen ich mir nicht merken kann, die aber aussehen wie Kirschen und schmecken wie Zwetschgen.
Auch diese Bäume wissen mehr als wir. Sie haben sich alles gemerkt, was jemals hier war und passiert ist. Alles ist in ihre Äste und bis in ihre Früchte hineingewachsen. Vor allem in die, deren Namen ich immer wieder vergesse.
Vater sagt: Sie beschützen uns.
Manchmal finde ich, die Bäume machen sich ein bisschen zu wichtig, sie versperren uns die Sicht über die Grenze unseres Grundstücks hinaus, sie rascheln geschwätzig mit ihren Blättern bei jedem noch so schwachen Wind, und am Ende schweigen sie doch, wenn ich sie etwas frage. Nur der Walnussbaum spendet genügend Schatten, um sich zumindest vor der Sonne zu schützen. Ich bin sicher, er weiß am meisten. Aber auch er rückt nicht mit der Sprache heraus.
Das Haus, in dem ich geboren wurde, gibt es nicht mehr. Ich weiß aber noch, wie es aussah, denn es ist erst ein paar Monate her, dass es hier neben dem Walnussbaum stand. Es hatte zwei schiefe Schornsteine und ein grünes Dach. Das Dach war grün vom Moos. Aus der Regenrinne wuchs eine kleine Birke. An einer Seite schob sich der wilde Wein durch das Fenster, sobald man vergaß, seine Ranken zu kürzen. Die Gartenschere musste immer auf der Fensterbank liegen. Oft verbrachte ich ganze Nachmittage damit, am Fenster zu stehen und darauf zu warten, dass der Wein hereinwuchs. Meine Hand lag auf der Gartenschere, jederzeit bereit, sie zu ergreifen. Ich rührte mich stundenlang nicht. Warten kann ich wirklich sehr gut. Ich kann sogar besser warten als sprechen. Oder gehen. Oder graben. Oder rechnen. Während ich darauf wartete, dass der Wein wuchs, dachte ich an gar nichts. Manchmal schlief ich im Stehen ein. Während meine Augen geschlossen waren, passierte eine Menge in der Welt, von dem ich nichts wusste. Von dem ich besser nichts wissen sollte. Als Aussteiger muss man eine Menge wissen und eine Menge nicht wissen. Man muss gut im Stehen schlafen können, ganz ohne Träume. Man muss Geduld haben, bis das Gemüse endlich reif ist, der neue Fahrer des Schulbusses endlich weiß, dass er in Bananama anhalten muss, bis Mutter einem endlich die neue Hose fertig genäht hat, weil die alte schon viel zu kurz geworden ist, bis man endlich alles vergessen hat, was man gerne hätte, in Bananama aber nicht hat. Letzteres dauert am längsten. Man muss als Aussteiger die Zeit am besten ganz vergessen. Man muss gut mit einer Gartenschere umgehen können.
Als ich die Augen wieder öffnete, war der Wein gewachsen und ich machte schnipp schnapp.
Unser altes Haus atmete, und manchmal schwitzte es. Es fror auch manchmal. Genau wie wir.
Auf der Kellertreppe krochen Nacktschnecken und in der Küche tauchte immer irgendwo eine Ameise auf. Manchmal waren es viele Ameisen. Wenn es zu viele wurden, füllte Mutter eine Sprühflasche mit Essig, mit der ich auf die Ameisen zielen sollte. Das gefiel mir nicht, aber Mutter sagte: Die tragen sonst unser Haus davon.
Neben der Küche gab es eine finstere Kammer voller Regale. Darauf standen Gläser mit eingemachtem Obst und Gemüse.
Die sind noch von der Großmutter, sagte Mutter. Sie war sich selbst nicht sicher, wie lange die Gläser schon in der Kammer standen. Ich habe sie nie eines öffnen sehen. Ich habe die Großmutter nicht mehr kennengelernt.
Ich bin in dem alten Haus geboren, Mutter und Vater nennen es noch immer nur: das alte Haus. Mutter hat mir die Stelle im Wohnzimmer gezeigt, auf den schiefen Dielen vor dem Holzofen. Sie hatte sehr laut geschrien bei meiner Geburt und geglaubt, sie würde sterben und zugleich eine andere werden. Sie hat gesagt: Ich kannte mich selbst nicht mehr, als ich mich hier wälzte, und als ich mich ganz verloren hatte in meinem Geschrei, warst du da.
Vor diesem Ofen bist du zur Welt gekommen, hat Mutter gesagt und gelächelt. Ich wäre in kein Krankenhaus der Welt gegangen, hat sie gesagt, niemand hätte mich an diesem Tag von diesem Ofen wegbekommen, kein Arzt, keine Hebamme und auch die Aussicht auf Schmerzmittel nicht.
Vater hat gesagt: Zum Teufel mit der Pharmaindustrie, sie versucht uns sogar noch während des schönsten Ereignisses, das es im Leben gibt, zu betäuben. Die moderne Medizin heilt nicht, sie macht unser Körpergefühl kaputt. Man muss fast zum Aussteiger werden, damit man seine Kinder so bekommen darf, wie man will.
Da hat Mutter geschwiegen und ihr Gesicht hat nachdenklich ausgeschaut. Dann hat sie wieder gelächelt, als wäre ihr ein schönes Geheimnis eingefallen, das sie aber nicht verraten durfte. Sie hat genickt und gesagt: Ich habe nicht immer genau gewusst, was ich will, aber dafür wusste ich immer ganz sicher, was ich nicht will und weshalb.
Mir gefällt, dass ich zu Hause geboren bin. Obwohl ich sonst kein Kind kenne, das zu Hause zur Welt kam, und obwohl ich sonst alles, was nur auf mich zutrifft und sonst auf kein Kind aus der Schule, nicht leiden kann, über das Wort Hausgeburt freue ich mich noch immer. Ich sage es immer laut und deutlich und stolz, wenn jemand mich nach meinem Geburtsort fragt. Auch wenn mich lange niemand danach gefragt hat.
Als es unser altes Haus noch gab, setzte ich mich oft auf meine Geburtsstelle und versuchte, mich zu erinnern, wie es war, als ich genau da aus Mutter herausgerutscht bin. Ich versuchte, Spuren zu finden im Holz der Dielen oder in den Ritzen dazwischen, ein erstes Haar, das dort noch lag, ein Tröpfchen Blut, irgendetwas. Ich fand nichts, aber die Stelle war eine gute Stelle, eine der Dielen quietschte, wenn man sich bewegte. Ich stellte mir vor, dass sie auch gequietscht hatte, als ich aus Mutter herausglitt und ihr letzter lauter Schrei sofort verstummte und vergessen war, weil sie lachen musste. Man erwartet doch alle anderen Geräusche, aber ein Quietschen erwartet man nicht, wenn ein Kind zur Welt kommt. Ich legte mich oft auf die Stelle, meine Arme und Beine weit ausgestreckt. Ich starrte an die Decke und dachte: Das ist mein Platz. Wenn das Feuer im Ofen brannte, war es auch der wärmste Platz im Haus, der einzige Platz, wo man liegen wollte, der einzige Platz, wo man auf die Welt kommen wollte. Ich war mir sicher: Das Haus wurde nur gebaut, damit dieser Platz ein Dach hat, damit Mutter dort schreit und stirbt und zugleich eine andere wird, damit Mauern diesen Platz schützen und er eine Adresse bekommt, die man sich merkt.
Jetzt wohnen wir in einem neuen Haus. Es hat nur fünf Tage gedauert, bis es stand. Vater, Mutter und ich saßen daneben und machten ein Picknick, während ein Kran die Wände an ihre Stelle hob und Arbeiter sie ineinander verschraubten.
Das Haus sieht aus wie ein Schuhkarton.
Alles an unserem neuen Haus ist weiß.
Das Haus atmet nicht und schwitzt nicht, es friert auch nicht. Wir schon noch. Wir machen alles wie vorher. Nur leichteren Herzens, sagt Mutter.
Vater sagt: Wir verbrauchen jetzt viel weniger Energie.
Manchmal vermisse ich die finstere Kammer. Immer wenn ich Angst hatte, konnte ich sie dort einsperren. Ich habe sehr viel Angst. Ich weiß nur meistens nicht genau, wovor.
Ich weiß nicht, was aus dem Eingemachten der Großmutter geworden ist. Ich weiß auch nicht, was aus der Großmutter geworden ist.
Ist die Großmutter beerdigt worden, frage ich Mutter.
Und wo?
Das erkläre ich dir ein andermal.
Ich weiß nicht, wann ein andermal ist.
Ich weiß dafür, wie Trichterwinden ausschauen, und dass sie kaum loszubekommen sind, wenn sie erst einmal an einer Stelle zu wachsen beginnen. Sie wachsen dann bald überall und nehmen alles in Beschlag.
Ich weiß, dass durch das Beerdigen nichts verschwindet. Die Wörter nicht und die Tiere nicht und die Menschen wohl auch nicht. Sie bleiben, im Kopf, in der Luft, die man einatmet, ausatmet. Sie sind da, nur nicht mehr sichtbar. Man wird sie nicht los. Wenn man nur einen Moment lang nicht aufpasst, vermisst man die Menschen, auch wenn man sie nicht kennt. Und man weint um die Tiere. Und nimmt die Wörter schon wieder in den Mund.
Manchmal versuche ich, mir Mutters Schreie vorzustellen, sehr laute und durchdringende Schreie, wie sie sagt. Sie sagt: Ich konnte es selbst nicht glauben, dass solche Schreie aus mir kommen können, das waren keine menschlichen Schreie mehr, sie klangen eher nach einem wilden Tier. Aber diese Schreie waren nicht aufzuhalten, sie füllten das ganze Haus und halfen mir sehr. Ich versuche, mir vorzustellen, wie diese Schreie unser neues Haus füllen, aber es gelingt mir nicht, sie passen nicht recht hinein. Unser neues Haus ist zu geräumig, zu freundlich und zu sauber, um sich solche Schreie darin vorstellen zu können. Ein leises Ächzen oder ein Seufzen könnte gerade noch hineinpassen, aber das hätte Mutter wohl nicht geholfen, das wäre zu sanft gewesen, zu vorsichtig und zu wenig durchdringend, dafür, dass sie dabei nicht weniger als mich aus sich selbst herausschob. Meine Angst hat auch mit dem Ächzen und Seufzen zu tun. Sie ist nicht wirklich zu hören. Sie ist trotzdem da. Wieder und wieder versuche ich, sie in die Ritzen unserer Holzterrasse zu schieben. Sie sind zu eng.
Unsere Holzterrasse ist auch neu. Sie befindet sich an derselben Stelle, an der hinter unserem alten Haus einmal zwei Steinstufen waren, die in den Garten führten. Ich saß oft auf der oberen Stufe, die schief war und glatt, und wenn die Sonne darauf schien schön warm. Manchmal sah ich von Weitem schon eine Eidechse auf der Stufe sitzen, ganz reglos, und dann traute ich mich nicht, näher heranzutreten, dann ließ ich die Eidechse ungestört sitzen und suchte mir einen anderen Platz. Mit der Eidechse konnte ich ein wenig von meiner Angst dort auf der Steinstufe sitzen lassen. Sie wärmte sich in der Sonne auf und rührte sich nicht. Sie war einfach da und es war für eine Weile in Ordnung.
Nun haben wir die Terrasse aus Holz. Vater sagt: Nicht irgendein Holz, sondern heimisches Eichenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, PEFC-zertifiziert. Was das bedeutet, erkläre ich dir ein andermal.
Vaters ist stolz auf die Terrasse, denn er hat die einzelnen Holzteile im Internet bestellt und selbst zusammengesetzt. Zu dritt sind wir noch nie auf der Terrasse gesessen, denn dafür war noch keine Zeit und wir haben noch keine Terrassenmöbel. Mutter sagt: Es gibt jetzt Wichtigeres als Möbel. Die Terrasse ist da, und sie kann warten. Wenn genügend Ruhe eingekehrt ist, werden wir noch viele Stunden auf ihr sitzen und uns sonnen.
Ich sage: Aber es ist doch ruhig.
Mutter sagt: Hier schon. Aber nicht in der Welt.
Ich höre ein leises Knistern. Sehr weit weg knistert es, wird ein wenig lauter, dann wieder leiser. Es ist ein unangenehmes Knistern, es kratzt mir in den Ohren. Mir tropft eine Schweißperle vom Haar in den Nacken und kriecht kalt meinen Rücken hinunter, es schüttelt mich. Das Knistern ist wieder verstummt.
Ich will Mutter fragen, was in der Welt Lärm macht, was man dagegen tun könnte, und warum wir ihn hier nicht hören. Oder ob es das Knistern ist. Mutter aber hat sich schon abgewendet und sagt: Ich muss noch ein wenig Buchhaltung machen.
Wenn Mutter Buchhaltung macht, darf ich sie nicht stören. Die Buchhaltung ist wichtig, hat sie mir einmal erklärt, sie hält alles hier zusammen. Wenn man auf sich gestellt ist und unabhängig bleiben will, muss man das mit Köpfchen und Struktur angehen. Ohne eine ordentliche Buchhaltung und eine gute Planung würde Bananama bald auseinanderfallen.
Ich will nicht, dass Bananama auseinanderfällt. Wo sollen wir dann wohnen?
Ich sitze also allein auf dem Holzboden der Terrasse und strecke meine Beine ins Gras. Ich muss über vieles nachdenken. Über den Lärm in der Welt. Über ein andermal. Was oder wann das sein soll, und ob dieses andermal, die Eidechse, die Großmutter, PEFC-zertifiziertes Holz und der Lärm, den wir hier nicht hören, auf irgendeine Weise zusammengehören.
Ich zähle die Grashüpfer, die über meine Beine springen, streiche mir eine Zecke von der Wade, bevor sie sich festbeißen und fettsaugen kann.
PEFC, sage ich, PEFC. Ich sage es wie eine Formel auf, und: Ein andermal, andermal, andermal.
Und während ich wieder und wieder PEFC und ein andermal sage, geht langsam die Sonne unter. Es wird kühler und ich höre wieder das Knistern. Ich stecke mir einen Finger ins Ohr, um mich zu kratzen. Aber es hilft nichts. Das Knistern wird lauter. Kommt näher. Ist da. Und jetzt bemerke ich: Es sind die Trichterwinden. Sie wachsen um meine Beine, schlingen sich um meine Waden, Knie und Schenkel, wachsen schneller und schneller. Ich kann mit den Augen kaum mehr verfolgen, wie schnell sie wachsen, knisternd, immer lauter. Ich kann schon nicht mehr aufstehen, die Trichterwinden halten mich nun hier fest, bis ich die Formel verstanden habe. PEFC, ein andermal. Bis ich alles weiß, auch wenn ich es nicht wissen will oder soll. Ich bin Rapunzel. Rapunzel heißt auch ein Salat, den meine Mutter gerne aß, als sie mit mir schwanger war. Ich war verrückt danach, sagt Mutter, und daher wächst nun massenhaft Rapunzel in unserem Garten. Mutter sagt: In Bioqualität. Ich sitze in einem Eichenholzturm hinter Trichterwinden, ich bin ein Bio-Rapunzel, das seine Formeln aufsagt, bis Angst und andermal sich reimen und gemeinsam endgültig beerdigt werden können. Und ein Bananenbaum darüber wächst. Oder eine Antwort. Vorher komme ich hier nicht weg.
Ich weiß auch nicht, was aus der Eidechse geworden ist.
DAS IST DIE GESCHICHTE VON DEN TOTEN TIEREN.
Oder eigentlich: DIE GESCHICHTE, ALS VATER MIR ERKLÄRT HAT, WIE MAN SICH DIE HÄNDE WÄSCHT.
Die geht so:
Einmal fand ich einen toten Maulwurf auf dem Feldweg. Ich wusste, Vater und Mutter mögen Maulwürfe. Sie sagen oft: Die Maulwürfe sind auf unserer Seite. Die Maulwürfe sind unsere liebsten Tiere.
Also habe ich den toten Maulwurf nach Hause getragen und auf den Küchentisch gelegt. Der Küchentisch war noch ganz neu. Der Maulwurf gefiel mir, wie er dort lag. Ich betrachtete ihn lange. Als Mutter in die Küche kam, schrie sie kurz und leise auf. Es war kein freudiger Schrei, eher ein unheimlicher Schrei, sehr leise, fast nicht zu hören. Ich bekam eine Gänsehaut.
Mutter sagte: Du solltest ihn beerdigen, schnell!
Das tat ich. Mutter sah mir vom Küchenfenster aus zu. Ich begrub ihn neben dem Wort Altlast. Ich weiß genau, wo welches Wort begraben ist.
Dann holte Vater mich herein und schob mich ins Bad. Er sagte zuerst gar nichts. Mutter blieb in der Badezimmertür stehen. Dann sagte Vater: Jetzt wollen wir dir mal zeigen, wie man sich die Hände wäscht.
1.Man dreht den Wasserhahn auf.
2.Man nimmt ein Stück Seife.
3.Man macht seine Hände mitsamt dem Stück Seife gut nass.
4.Man dreht den Wasserhahn zu.
5.Man reibt mit dem Stück Seife über seine Handflächen, die Finger, die Handrücken. Man lässt keine Stelle an den Händen aus.
6.Man legt das Stück Seife zur Seite und reibt die Hände aneinander, bis es richtig schäumt.
7.Man dreht den Wasserhahn auf.
8.Man spült den Schaum mit dem Wasser gründlich von den Händen.
9.Man dreht den Wasserhahn wieder zu.
10.Man nimmt ein Handtuch und reibt sich die Hände trocken.
11.Man hat saubere Hände.
Das ist eine langweilige Geschichte. Aber ich wollte sie trotzdem erzählen, sonst wäre der Maulwurf nie beerdigt worden und ich hätte noch immer schmutzige Hände.
Unsere Seife, sagt Vater, ist zu hundert Prozent aus pflanzlichen Rohstoffen, da ist nichts Schlechtes drin.
Ich frage Vater und Mutter: Was kann in einem Stück Seife überhaupt Schlechtes drin sein?
Vater sagt: Mehr, als man denkt.
Mutter sagt: Und als man denken will.
Vater und Mutter wollten dieses neue, helle Haus mit großen Fenstern. Obwohl ihre Lieblingstiere Maulwürfe sind. Wie soll man sie bei dem vielen Licht im Haus denn je zu Gesicht bekommen, wenn nicht tot?
Ich frage Vater und Mutter: Warum haben wir ein so helles Haus, wo die Maulwürfe doch auf unserer Seite sind?
Vater sagt: Das Kind ist nicht auf den Kopf gefallen.
Mutter sagt: Manchmal wünschte ich, es wäre.
Ich langweile mich häufig, weil ich ja sehr oft allein bin. Ich sitze im Gras, auf der Terrasse, unter unseren Obstbäumen, in meinem Zimmer, und stelle mir vor, wie es wäre, wenn es andere Kinder in der Nähe gäbe. Wenn jemand vorbeikommen und nach mir fragen würde. Wenn ich mit jemandem spielen würde, anstatt nichts zu spielen oder immer nur mit mir selbst und ganz leise. Wie es wäre, wenn es nicht langweilig wäre. Was das Gegenteil von Langeweile ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und meistens langweile ich mich auch ganz gerne, denn während ich mich langweile, bin ich ein leeres Einmachglas, und ich sehe weder Gespenster noch höre ich ein Knistern oder andere Geräusche, von denen ich nicht weiß, woher sie kommen. Während ich mich langweile, ist das Gras grün und der Himmel blau. Ich bin ein Kind, das nicht weiß, was es noch spielen soll und wozu. Das sich aber auch nicht fürchten muss. Das einfach nur dasitzt.
Ich würde gerne immer so sitzen und es Abend werden lassen.
Eine Freundin zu haben wäre trotzdem schön. Das Sitzen würde nicht so lange dauern und der Abend würde mit einem Lachen beginnen anstatt mit stummen, länger werdenden Schatten.